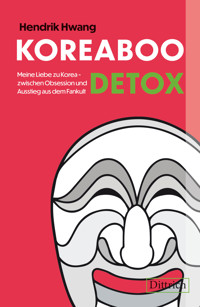
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
KOREABOO DETOX beschreibt die Ver- und Entzauberung eines persönlichen Kulturfetischismus in einem Land, das zwischen extrem positiven und extrem negativen Klischees wenig Raum für die Wahrheit lässt. Vor dem Hintergrund seiner multikulturellen Herkunft beschreibt Hendrik Hwang seine Erfahrungen mit der koreanischen (Realität Pop )Kultur aus einem ganz persönlichen Blickwinkel. Er erzählt, wie er sich nach und nach zu einem Koreaboo, einem besessenen Anhänger der koreanischen Kultur entwickelte, was zu der Entzauberung führte und welche Umstände die uneingeschränkte Begeisterung relativierten. Warum gerade so viele Europäer eine Obsession für die koreanische Kultur entwickeln, schlüsselt Hwang in seinem von persönlichen Erfahrungen in Korea geprägten Bericht auf und gewährt überraschende Einblicke in eine faszinierende Kultur. Die koreanische Gegenwart ist geprägt von einem uneingeschränkten Fortschrittsglauben in einem Land der begrenzten Ressourcen. Sie mutet geradezu wie ein Brennglas an, durch das man einen Blick in die Zukunft erlangt. Hwang beschreibt pop- und subkulturelle Entwicklungen wie die Hallyu (koreanische Kulturwelle), die Mechanismen hinter K-Pop, Fankult und Traumfabrik, soziale Verwerfungen, wiederkehrende Muster in der Arbeitswelt und die Opferbereitschaft der Bevölkerung, religiöse Umtriebe, politische Prozesse und Konflikte, gesellschaftliche Verhaltensnormen und Umbrüche, kulinarische Phänomene, sprachliche Besonderheiten – und er enthüllt Paradoxien zwischen Tradition und Fortschritt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hendrik Hwang
Koreaboo Detox
© Dittrich Verlag ist ein Imprint der Velbrück GmbH Verlage, Weilerswist-Metternich 2024
www.dittrich-verlag.de
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-26-1
eISBN 978-3-910732-32-2
Satz: Katharina Jüssen, Metternich
Coverlayout: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Zeit der Unschuld – Meine Zeit vor Korea
Zwischen Umbruch und Aufbruch – Das Rufen eines Sehnsuchtsortes
Die Vertreibung aus dem Paradies – Acht Jahre Aufenthalt
Uegug-in, Aliens und Koreaboos – Der kleine feine Unterschied
Blicke hinter die Kulissen
Lernen, Lehren und … Staunen
Hierarchien oder die Ordnung der Dinge
Korea und seine Nachbarn
K-Drama, K-Pop, Pop-Up Entertainment und K-Movies
Grand Open und Passion Pay – Startups und Ausbeutung
Manner vs. Nunji
Ajummas – Unantastbare Heilige
Ajeoshis – Die ewigen Verzweifler
Highspeed – Wo Schnelligkeit der Standard ist
Die koreanische Ungeduld … und Geduld
Politik und religiöser Fanatismus
Die Attraktivität der Größe – Das Kugelfischsyndrom
Sampo, Wanpo und Suizid
Fighting – Motivation durch Konglisch
Meog Bang – Wenn es nicht nur ums Essen geht
Ghosting – Soziale Distanzierung ohne Vorwarnung
Drive me crazy – Vorfahrt auf Koreanisch
Die Sache mit der Liebe – Sogaeting, Sex und Blitzhochzeiten
Norebang und Roomsalon
Der Detox-Prozess oder: Die Entzauberung
Epilog
Glossar
Danksagung
Prolog
Für viele Europäer ist Korea wohl nur ein Land am Rande Ostasiens. In die Berichterstattung der Nachrichten mischen sich ab und an Meldungen über Nordkorea: Es werden befremdlich wirkende Bilder gezeigt, von perfekt orchestrierten Massenaufmärschen und einem in die Menge winkenden Diktator, dem man alles zutraut.
Aus einer anderen Parallelwelt der koreanischen Halbinsel hingegen erreichen uns Bilder von gut gemachten, skurrilen Filmen wie Parasite, die bei den Filmfestspielen von Cannes und den Oscarverleihungen Preise abräumen und von einem Leben berichten, das wir als surreal bezeichnen würden.
Tatsache ist, dass nicht wenige Menschen dieser surrealen Parallelwelt Südkoreas mit Haut und Haaren verfallen sind. Die Ausläufer der Hallyu, der koreanischen Kulturwelle, sickern langsam, aber stetig in das Bewusstsein westlicher Menschen. Diese Welle brandet geradezu in die Wahrnehmung von jungen und junggebliebenen Generationen, die ekstatisch verzückt K-Pop, K-Dramas und sonst alles konsumieren, was die Medien hergeben.
Für Marktforscher gestattet Korea einen Blick in die Zukunft, in Hinblick auf das Leben in verdichteten Ballungsräumen, digitaler Entwicklung und künstlicher Intelligenz. Die Errungenschaften koreanischer Innovationskraft werden von westlichen Work-Life-Balance-Anhängern anerkannt, ohne kulturelle Hintergründe oder die systematische Selbstausbeutung zu hinterfragen. Die Schaumkrone der Welle wird kommentiert, ohne den Ozean zu kennen.
Für viele ist Südkorea so zu einem Sehnsuchtsort geworden. Das Land mit seinen über 52 Millionen Einwohnern ist nicht nur eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt, es ist auch eines der fortschrittlichsten. In der Metropolregion um Seoul mit seinen Trabantenstädten und Speckgürteln, genannt Sudogwon, lebt gut die Hälfte der südkoreanischen Gesamtbevölkerung. Jeder, der nach Seoul kommt, fühlt sich magnetisch angezogen und trägt auch selbst zur Anziehungskraft bei. Als mein Lebensweg erstmals mit der koreanischen Kultur in Berührung kam, schien meine Sinnsuche ihr Ziel gefunden zu haben. Lange hatte dies gedauert. Bis dahin trug ich immer das Gefühl in mir, nicht angekommen zu sein. Denn mein multikultureller Hintergrund half nicht dabei, meine Identität in Einklang mit meiner Lebensumgebung zu bringen. Als Sohn deutsch-italienischer Eltern im Südafrika der Apartheid geboren, wurde ich in meiner Wahrnehmung immer auf den fremden Teil in mir angesprochen. In den 1980er Jahren in Deutschland aufgewachsen, war ich hier der »Spaghetti« und in Italien der »Beckenbauer« oder »Hitler«. Manchmal nannten mich die Italiener »il Tedesco«, der Deutsche, oder sie riefen »Kaputt«, um ihre Deutschkenntnisse anzubringen. Meine Antwort war meist ein verlegenes Lächeln, manchmal stolz, manchmal traurig.
Auf der Suche nach meiner kulturellen Identität glich ich damals einer Flipperkugel – die Älteren mögen sich noch an das Spiel erinnern. An jedem Kontaktpunkt wurde ich, wie die kleine Metallkugel, wieder in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Meine Orientierungslosigkeit verschaffte den Spielern Punkte. Meine Ankunft enttäuschte sie und sie stießen mich wieder zurück ins Spiel.
Mit meiner persönlichen Entdeckung Koreas konnte ich das Spiel selbstbestimmt gestalten, denn es war meine eigene Entscheidung gewesen, als ewiger Ausländer den Lebensmittelpunkt in eines der verschlossensten Länder der Welt zu verlegen.
Meine ersten Erkundungen in das Land machte ich ab 1996. Vor gut zehn Jahren erhielt ich dann unverhofft das Angebot, an einem Weiterbildungsprogramm teilzunehmen, ausgerichtet von der Yonsei Universität und der University of London und finanziert von der Europäischen Kommission, das es einem als Manager aus der Europäischen Union ermöglichte, in Südkorea zu studieren.
Als mich dieses Angebot erreichte, blickte ich bereits auf sieben Jahre erfolgreiche Selbständigkeit zurück. Es war mir gelungen, in Deutschland ein kleines Beratungsunternehmen aufzubauen und gleichzeitig Geschäftsführer der Vertriebsniederlassung eines italienischen Unternehmens zu werden. Das alles war nicht einfach gewesen. Es erforderte viel Herzblut und Fleiß, ein ausgedehntes Netzwerk und vor allem einen schmerzhaften Lernprozess aus einer gescheiterten, früheren Gründung und so manche berufliche Enttäuschung in der ein oder anderen Firma. Insgesamt aber trug die Gesamtheit meiner auch positiven Erfahrungen dazu bei, mich in dem Berufsfeld zu etablieren, gute Kunden zu akquirieren und zu halten, viele davon für die gesamte Zeit, in der ich das Unternehmen führte. In all das platzte die Nachricht dieses sogenannten ETP-Programms. Allein der Gedanke, nach Korea zurückzukehren, welches ich fast zwanzig Jahre zuvor, nach einem dreimonatigen Sprachkurs an der Yonsei Universität, verlassen hatte, elektrisierte mich bis in die letzte Haarspitze.
Was ich als Neubürger Südkoreas dann vorfand, war ein Land im rastlosen Taumel. Korea ist ein Ort, in welchem nach dem Ankommen nicht das Durchatmen folgt, es ist ein Land in einem andauernden Ausnahmezustand. Die Menschen folgen dort einer Lebensvorstellung, die nach Exzellenz strebt und die Arbeit absolut in den Vordergrund stellt, aber auch auf uferlosem Konsum und Entertainment basiert.
In den ganzen Jahren meines Aufenthaltes ist so viel passiert, dass sich daraus Stoff für mehrere Bücher ergäbe. In diesem Buch möchte ich versuchen, meine persönlichen Erfahrungen zu skizzieren und weiterzugeben. Den Ausschlag gab mein guter koreanischer Freund Jeesoon, mit dem mich eine langjährige Freundschaft und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit verbindet. Eines Abends kam er mit der Frage auf mich zu, ob ich nicht ein Buch über meine Erlebnisse schreiben wolle – besonders unter dem Aspekt der Arbeit in Korea.
Ich war dem Gedanken, über meine Arbeitserlebnisse in Korea zu schreiben, nicht sofort zugetan, auch weil ich ein Mensch bin, der ungern viel über sich preisgibt, sondern gewohnt ist, für die Probleme anderer ein Gehör und Lösungen zu finden. Wenige Stunden nach dem Gespräch konnte ich allerdings das Kopfkino nicht mehr stoppen, unzählige Erlebnisse und Gedanken fanden ihren Weg zurück in meine Gegenwart. Jeesoon hatte mich überzeugt, einen guten Teil dessen zu berichten, was mir in meinem Sehnsuchtsland widerfahren war.
Ich behalte mir vor, nicht alles offenzulegen und nicht alle Namen zu nennen. Mir geht es darum, die Leser in das eintauchen zu lassen, was das Studium, die Arbeit und die Lebensweise in Korea betrifft. Dies geht natürlich nicht, ohne auch Hintergründe meiner selbst und Teile meines Umfeldes preiszugeben.
Nicht eine Biographie im eigentlichen Sinne sollte entstehen, sondern eine Erzählung, in der aus einer anfänglichen Inspiration erst Leidenschaft für ein Land wurde und dann eine Obsession. Auch habe ich dieses Buch nicht ausschließlich für Koreaner oder Koreainteressierte geschrieben, sondern für all diejenigen, die einen anderen Blick auf eine faszinierende, wenn auch schwer zu durchdringende ostasiatische Kultur werfen wollen, jenseits der »Political Correctness« und der Anbiederung an einzelne Gruppen. Es war mir wichtig, abseits der Klischees ein tiefergehendes Bild zu zeichnen. Über Hintergründe und Mechanismen zu berichten, einen kritischen, aber auch wohlwollenden Blick auf eine außergewöhnliche Gesellschaft zu lenken, nicht selten mit einem Augenzwinkern.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Traktat zu sein. Es ist vielmehr eine Erzählung, in der ich mir die Freiheit nehme, über persönliche Ereignisse zu berichten. Es wird Menschen geben, die sich durch dieses Buch wohl in ein ungünstiges Licht gerückt fühlen werden, obwohl es mir nicht darum geht, Noten zu verteilen, sondern einzig darum, die aus meiner persönlichen Sicht geschilderten Geschehnisse und das Loslassen von einer Besessenheit nachvollziehbar zu machen. Dabei ist alles, was ich hier erzähle, so tatsächlich geschehen und alles, was ich nicht erzähle, eventuell Stoff für eine andere Geschichte.
Mein Leben als offizieller »Ue-gug-in«1 (외국인), wie es auf Koreanisch heißt oder »Alien«, wie man dort praktischerweise Ausländer bezeichnet – also Wesen von einem anderen Planeten – hat erst mit meinem permanenten Aufenthalt in Korea stattgefunden. Und doch greift das Buch auch auf jene Zeit zurück, die davor lag, denn sie erklärt, wie es dazu kam, dass ich mich auf das Abenteuer Korea eingelassen habe. Meine acht Jahre in ›Hell Joseon‹, wie viele Koreaner ihr Land selbstironisch nennen, vergingen wie im Flug. Und während in Europa manchmal die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, hat Korea in diesen letzten Jahren einen weiterhin atemberaubenden Wandel durchlebt.
Da sich der ganze Stoff etwas komplex darstellte, habe ich beschlossen, der Erzählung eine Struktur zu geben und sie in drei Hauptteile zu gliedern. Gemäß einer Bezeugung von Ereignissen und Schilderungen, in der meine Geschichte stellvertretend steht für andere Einwanderungsgeschichten, in anderen Teilen der Welt:
Zeit der Unschuld – Meine Zeit vor Korea
Zwischen Umbruch und Aufbruch – Das Rufen eines Sehnsuchtsortes
Die Vertreibung aus dem Paradies – Acht Jahre Aufenthalt
Im dritten Teil werde ich zudem genauer auf spezielle Aspekte und Beobachtungen koreanischer Gegebenheiten eingehen und so habe ich auch diesen in weitere thematische Schwerpunkte gegliedert.
Viel Freude beim Lesen!
Zeit der Unschuld – Meine Zeit vor Korea
»Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen.«
John Lennon
Wie es sich anfühlt, Ausländer zu sein, weiß ich seit meiner Geburt. Manchmal ist es eine Art Stigma, das man mit sich trägt, man fühlt sich einer Gesellschaft nicht zugehörig. Manchmal ist es jedoch auch die Chance, unabhängig sein zu können und sich nicht von den idealisierenden Narrativen einer Nation vereinnahmen zu lassen.
Als Sohn deutsch-italienischer Eltern im Südafrika der Apartheid in den 1970ern geboren, wurde ich früh sensibilisiert hinsichtlich Rassismus und Ausgrenzung, der Überhöhung einzelner Bevölkerungsgruppen gegenüber im selben Land lebenden Mitbürgern. Zu dieser Zeit war die staatlich organisierte strikte Rassentrennung allgegenwärtig. Es gab zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln Sitze für weiße und Sitze für schwarze Menschen, bei Parkbänken war das nicht anders, und zu vielen Bereichen hatten Schwarze überhaupt keinen Zutritt. Rassistische Äußerungen gegenüber der schwarzen Bevölkerung waren an der Tagesordnung. Auch meine Nanny Ruth, eine rundliche, liebevolle Frau vom Volk der Zulu, mit deren Hilfe ich meine ersten Schritte machte, war natürlich davon betroffen. Wie alle als ›farbig‹ klassifizierten Menschen musste sie die Kernstadt nachts verlassen und sich in ihre Siedlung Soweto begeben, ein Township außerhalb von Johannesburg.
Meine Eltern waren aufgrund ihrer kulturellen Diversität sensibilisiert, sahen es aber auch als normal an, das System der Apartheid zu tolerieren. Da sie des Öfteren Opfer von Raubüberfällen geworden waren und zur Selbstverteidigung auch von der Schusswaffe Gebrauch machen mussten, entschieden sie dann früh, nach Deutschland zurückzukehren. Meiner Mutter war außerdem das Klima nicht zuträglich und so drängte sie auf Rückreise. Weder meine Eltern noch ich sollten jemals mehr in dieses Land zurückkehren. Manchmal bedauere ich das sehr, denn zu gerne hätte ich Ruth Danke gesagt und sie in den Arm genommen. Obwohl ich mich kaum an sie erinnere, kenne ich sie doch aus den lebhaften Schilderungen meiner Mutter, die mir von ihr erzählte, nachdem ich als Kind einmal von Ruth geträumt hatte. Seitdem trage ich immerhin ihr Abbild in meinem Herzen.
Die Rückkehr nach Deutschland verlief nicht reibungslos, da meine deutsche Mutter ohne die Erlaubnis ihrer Eltern einen Italiener geheiratet hatte. In den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges war dies bei einigen Deutschen nicht gerne gesehen, zumal sie die Italiener als Verräter und als leichtfüßige Charaktere betrachteten. Meine Eltern hatten daher zeitlebens einen schweren Stand bei den Großeltern mütterlicherseits. Meinem Umgang mit der eigenen Identität hat dies zu jener Zeit auch nicht geholfen. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis ich mich von diesen Bürden befreien konnte.
Meine ersten Jahre in Deutschland waren geprägt von einer langen, sehr schweren Erkrankung meiner Mutter und einem Vater, der sich mit großem Fleiß bemühte, den Erwartungen der deutschen Gesellschaft gerecht zu werden. Ursprünglich als Kunstschmied arbeitend, aber mit einer großen Liebe zum aktiven Sport, bildete er sich zum Physiotherapeuten und Sportmediziner weiter und hatte wenige Jahre später, nach Eröffnung seiner ersten Praxis, immensen Erfolg. Meiner Mutter ging es nach mühevollen Jahren der Krankheit besser und so waren wir schließlich so etwas wie eine stabile Familie geworden.
Meine Schulzeit war schön. Auch, weil ich mehr an Mädchen interessiert war als an Mathematik, weshalb nicht alle Lehrer froh waren, mich in der Klasse zu haben. In anderen Fächern wie Biologie, Kunst und Deutsch musste ich mich nicht bemühen, sie gingen mir leicht von der Hand. Das waren Fächer, in denen mein Lern- und Gestaltungseifer entbrannte, was ich allerdings auch dem inspirierenden Unterricht der Fachlehrer zurechnete.
Zu den weniger motivierenden Lehrern gehörten solche, die mich spüren ließen, dass ich einen italienischen Nachnamen hatte. Da meinte zum Beispiel einer in breitem Bayrisch, als es um die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ging: »Ja, ja, die lieben Italiener, unsere ewigen Freunde!« Er sah mich dabei durchdringend mit diabolischem Grinsen an. Natürlich bezog er sich auf das Italien, das nach dem Sturz Mussolinis 1943 die Seiten zugunsten der Alliierten gewechselt hatte.
Ich wuchs in einer stadtnahen, ländlichen Gegend auf und hatte die Natur vor meiner Haustür. Manchmal auch in meinem Zimmer, eingehegt in Aquarien und Terrarien, einem eigenen Chemielabor in einer stillgelegten, gekachelten Küche und eine Naturkundesammlung, aus der auch unser Biolehrer gerne Exponate erhielt.
Mein Lieblingsspielzeug war ein Mikroskop, unter dem ich praktisch alles, was sich mit einem Durchlichtmikroskop untersuchen lassen konnte, in Augenschein nahm. Auch verschlang ich unzählige Bücher über Abenteuer und Abenteurer, über Native Americans und die Entdecker und Helden vergangener Epochen.
Es gab zwei, drei Jahre in meinem Leben, in denen ich, Huckleberry Finn aus dem gleichnamigen Roman von Mark Twain gleich, mehr Zeit in der Natur bei offenem Lagerfeuer verbrachte. Oder mit einer aus Ästen geschnitzten Angelrute Forellen aus den Bächen der Umgebung zog. Hausaufgaben bestanden im Schnitt darin, mir das Stroh von Stoppelfeldern aus den Haaren zu bürsten oder meine neuen Naturfunde zu sortieren. Mein Schreibtisch zu Hause verstaubte. So endete die Zeit meiner Kindheit mit einem mittelmäßig erfolgreichen Schulabschluss, jedoch mit Top-Noten in Biologie, Kunst und Deutsch.
Bereits während meiner Schulzeit durchlief ich den Wandel vom leicht verwilderten Naturburschen hin zum modeaffinen Konsumenten. Der Grund dafür war ein Klassenkamerad, der mich mit seiner Begeisterung für Marken und Luxus ansteckte. Da sich auch mein Interesse für Mädchen von einer rein schwärmerischen Ausrichtung hin zu mehr körperlicher Zuneigung veränderte, gab ich dem ausgeprägten Willen zur äußerlichen Selbstoptimierung nach. Dazu gehörte der häufige Gang zum Friseur, der Kauf der neuesten Mode-Items und nicht zuletzt Körperpflegeprodukte und Kosmetik. Meine Mutter unterstützte das zum Glück und so tolerierte sie es, dass ich Großteile meines Taschengeldes in teure Duschgels und Modezeitschriften investierte.
Mein persönliches Konsumverhalten ging einher mit der wohl dynamischsten Entwicklung, die die Modebranche je erfahren hat. Das goldene Zeitalter der Stardesigner und Supermodels rauschte geradezu durch die Gesellschaft. Überall öffneten neue Boutiquen und ich sammelte alles von Giorgio Armani bis Gianni Versace, aber auch Marken, die nach einem Jahrzehnt des Booms genauso meteoritenhaft abstürzten, wie sie vorher kometenhaft am Modehimmel aufgestiegen waren.
Noch musste ich mich mit dem Angebot in unserer kleinen Stadt zufriedengeben, obwohl die Boutiquen dort durchaus gut bestückt waren. Besser sah es schon in München aus, eine Stadt, die, drei Autostunden entfernt, bereits die ganz große Modeszene bespielte. Modefürsten wie Karl Lagerfeld und Promis wie Gunther Sachs gaben sich dort in den 1970er und 80er Jahren die Klinke in die Hand. Auch wenn das in meiner Nähe stattfand und die Schallwellen der Mondänität bis zu mir durchdrangen, so war ich doch noch ein Grünschnabel und nicht wirklich in der Lage, ganz in die Welt der Mode und der Clubszene einzutauchen. Das sollte sich aber bald grundlegend ändern.
Da ich nach dem Schulabschluss nicht so recht wusste, wie es weitergehen sollte, mein Interesse für Mode aber stetig stieg, suchte ich nach Möglichkeiten, diesem Drang eine Richtung zu geben. Ich hatte dazu ein ausgeprägtes Interesse für Kunst, was sich wohl aus der Geschichte meiner Familie herleitete. Auf beiden Seiten, sowohl auf der deutschen als auch auf der italienischen, gab es Künstler und Designer. Die Brüder meiner deutschen Großmutter waren erfolgreiche Unternehmer eines vollstufigen Produktionsbetriebs für Damenwäsche gewesen. Einige erlesene Stücke, die ich bei meiner Großmutter bestaunen konnte, zeigten elegante Nahtführungen und die innovativen Verarbeitungen der 1920er bis 1940er Jahre. Hans und Alfred, so hießen die Brüder, hatten die gesamte Produktionskette unter ihrer Leitung, von der Spinnerei und Weberei über die Färberei bis hin zur Konfektion. Alfred war der kreative Kopf der beiden, er hatte in Paris bereits für die Galeries Lafayette2 entworfen, während Hans der Kaufmann und charismatische Manager gewesen war.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der fast sechs lange Jahre tobte, wurden beide Brüder krank und starben kurz darauf. Sie hinterließen zwei Firmensitze in Deutschland und Frankreich in den Händen einer Erbin, die vom Geschäft nichts verstand und die die beiden beim besten Willen nicht ersetzen konnte. Und so endete das Unternehmen leider bald ausgerechnet in einem Nachkriegseuropa, das hungrig nach Bekleidung und Konsum war.
Mein Interesse für Mode und künstlerische Gestaltung, sowie der Nachlass meiner Familiengeschichte, modellierten meine Vorstellung zunehmend in Richtung Modedesign. Allerdings erwies sich der Einstieg in Deutschland als nicht einfach. Es gab den klassischen Weg über eine Schneiderausbildung, aber mir dämmerte, dass dies nicht mein Weg war, da ich es für unmöglich hielt, es für drei Jahre in einem Schneideratelier auszuhalten. Also blieb mir nur der Weg über eine kaufmännische Ausbildung, in der ich die Grundlagen des Business lernen konnte, speziell des Vertriebs, was mich durchaus interessierte. Eine Gelegenheit dazu ergab sich wieder über die Familie: Da gab es tatsächlich einen Verwandten, der eine Modeagentur leitete und der es mir ermöglichte, in seinem Unternehmen eine Ausbildung zu machen.
Meine Ausbildung dauerte fast drei Jahre. In dieser Zeit reiste ich auch ein paar Mal nach Paris. Ich verbrachte dann die Nächte in den angesagten Pariser Clubs Le Bain Douche und Le Palace, traf auf Designer wie Thierry Mugler und Jean Paul Gaultier, rauchte mein erstes Gras und ließ mich von hübschen Französinnen anbaggern. Die Begegnungen waren durchweg unfassbar und surreal. Es war das erste Beschnuppern einer neuen Welt, aber es geschah so unmittelbar, dass ich mich dem nicht mehr entziehen konnte. Auch überwand ich Barrieren von Verhaltensnormen, die für mich zuvor völlig tabu waren, wie zum Beispiel das Verwenden von allerlei sichtbarem Make-up, bevor ich in die Nacht eintauchte. Meine Haare trug ich sehr lang. Wenn ich bis dahin noch nach einem Lebensweg suchte, so war ich jetzt fest entschlossen, in keiner anderen Welt als der Modewelt leben zu wollen.
Zu genau diesem Zeitpunkt, als ich mich aufmachte, mich permanent ins Nachtleben zu stürzen, erreichte Europa die Schockwelle der Aidsepidemie. Mit spontanen Dates war es für mich zu Ende und hinter jeder körperlichen Begegnung stand die Todesangst. Aids sollte alles verändern, die Gesellschaft in ihrer Art zu leben umkrempeln – nichts würde mehr so sein wie vorher. Vielleicht war es kein Zufall, dass sich bereits in den 1990er Jahren der Niedergang der glamourösen Modebranche abzeichnete.
Es wäre naheliegend für mich gewesen, nach Paris zu gehen, um meinem beruflichen Werdegang den richtigen Rahmen zu geben. Noch naheliegender war es allerdings, mich nach Italien zu orientieren, speziell nach Mailand.
Ich war zwar Sohn eines Italieners, aber ich war es in meiner Jugend nicht gerne. Ich hatte damit ein Problem aus den bereits genannten Gründen. Im Alter von fünf Jahren konnte ich nach einem dreimonatigen Aufenthalt bei meiner italienischen Großmutter fließend Italienisch, aber nach meiner Heimkehr kein Deutsch mehr. Es war mir damals nicht bewusst, dass es unterschiedliche Sprachen gab. Ich nahm nur wahr, dass mich meine deutschen Freunde nicht mehr verstanden und ich sie nicht mehr. Das war eine traumatische Erfahrung, die bewirkte, dass ich mich dem Italienischen und allem, was mit Italien zu tun hatte, komplett entzog. Ich vergaß die Sprache völlig, da ich nur noch Deutsch sprechen wollte. Erst, als mit neunzehn Jahren meine Pläne für ein Modestudium reiften, entschloss ich mich, Italien allein zu bereisen. Mit einem 3.000 km-Zugticket in der Tasche und einem alten Koffer voller Klamotten fuhr ich über den halben italienischen Stiefel über Rom, die Toskana, Bologna und Mailand und erlebte ein Italien, welches so anders war, als das der Klischees und Vorurteile. Ich begegnete faszinierenden, kreativen Menschen. Alle mit einem großen Herzen in ihrer Brust, in einem Italien, das sich im inspirierenden Taumel der Modeschöpfung befand.
Alle Modelabels, die ich liebte, waren dort. Armani und Gianni Versace erwähnte ich schon, dann waren da Krizia und Missoni, Moschino, Gianfranco Ferré und Romeo Gigli, Marithé + François Girbaud, Valentino und Fiorucci, Benetton, Prada, Ferragamo, Trussardi und Dolce & Gabbana. Es war klar, dass ich nichts anderes wollte, als dort zu studieren. Also meldete ich mich am Istituto Marangoni for Fashion Design an und überzeugte meine Eltern, mir zumindest in Teilen das Studium zu finanzieren. Es sollten aber noch zwei Jahre vergehen, bis ich dieses auch wirklich antreten konnte.
Zuvor absolvierte ich ein einjähriges Grundlagenstudium für Grafikdesign an einer privaten Kunstschule in Deutschland und arbeitete nebenher als Verkäufer bei einem Herrenausstatter. Daraufhin verbrachte ich ein Jahr an einer Akademie in L’Aquila in den mittelitalienischen Abruzzen, um Italienisch und besser zeichnen zu lernen.
Nach atemberaubenden neuen Erfahrungen und Begebenheiten trat ich das lang ersehnte Studium in Mailand an. Finanzieren konnte ich es mir, neben der Hilfe meiner Eltern, durch verschiedene Kreativjobs, die ich bereits ausführte, so zum Beispiel meine Arbeit bei zwei Werbeagenturen und einer Firma für Hemden, für die ich das Printdesign machte. Dennoch reichte das Geld hinten und vorne nicht, denn ich war es nicht gewohnt, mein Monatsbudget in einer so hochpreisigen Stadt sinnvoll einzuteilen. So war ich oft nach nur zehn Tagen pleite. Auch die Mietkosten für mein kleines Apartment waren nicht gering. Dazu kam, dass ich Unmengen an Material wie Farbstifte, Marker und Papier benötigte. In der vor-digitalen Zeit wurde alles noch von Hand gezeichnet und jeder Farbton, den es gab, von einem bestimmten Pantone-Marker repräsentiert. Also Hunderte. Dazu kamen doppel- und dreispitzige Marker und Buntstifte verschiedener Härten und verschiedenster Hersteller. Ich war im Kunstmaterial-Kaufrausch und meine Taschen waren leer.
An einem dieser ersten Tage nach Studienbeginn erhielt ich eine Liste von Materialien, die ich zu besorgen hatte. Das Geschäft dazu war ganz in der Nähe meiner Schule und so begab ich mich dorthin, betrat den Verkaufsraum und war sofort überwältigt von der Auswahl an Kunst- und Designbedarf. Ich war nicht der einzige Kunde in dem Geschäft. Außer mir war da eine Asiatin, die sich ganz in der Aufmerksamkeit des Verkäufers befand, welcher hinter dem Ladentisch auf sie einredete, nicht ohne nach italienischer Art zu flirten.
Ich wartete also, mit meiner Liste in der Hand, und betrachtete den Laden nochmals von oben bis unten. Hinter der Asiatin stehend, die vielleicht um die 22 Jahre alt gewesen sein dürfte, nahm ich unvermittelt einen Geruch wahr, der von ihr zu kommen schien. Dann betrachtete ich ihren Halsansatz und die Textur ihrer pechschwarzen Haare, die zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden waren. Ich mochte diesen Anblick irgendwie, auch wenn er für mich exotisch war. Ihren Geruch nahm ich jetzt stärker wahr. Es war eine Mischung aus einem Parfum von Kenzo3 und vergorenem Knoblauch. Eine starke Mischung, die mit jeder ihrer Bewegungen zu mir drang.
Nachdem die Asiatin nach einer gefühlten Ewigkeit das Geschäft verlassen hatte, wandte sich mir der Verkäufer, der mich noch gar nicht kannte, mit den Worten zu: »Hübsch sind sie ja, diese Koreanerinnen, wenn sie nur nicht so viel Knoblauch essen würden.« Seine Miene verzog sich geringschätzig. Ich hingegen spürte mein Gesicht einfrieren und ich fühlte mich durch seine Äußerung eigenartigerweise persönlich angegriffen. Es machte mir den Verkäufer unsympathisch.
Das war meine erste Berührung mit Korea – ein Ereignis, das sich tief bei mir einprägen sollte. Denn was der Verkäufer empfand, war nicht meine Empfindung. Vielmehr verband ich eine wohlige Vertrautheit mit dem Geruch dieser jungen Frau.
In der Anfangszeit meines Studiums badete ich erst einmal in meiner neuen Umgebung aus Modemetropole und Designunterricht. An der Schule waren Studenten aus unterschiedlichsten Ländern dieser Welt, geschätzte 60 Nationen, und alle brachten etwas aus ihrer Kultur mit. Das Eintauchen in andere Kulturen faszinierte mich. Viele Kommilitonen kamen aus Süd- und Lateinamerika oder aus Spanien. Besonders asiatische Studenten waren gut vertreten. Die erste Asiatin, mit der ich näher in Kontakt kam, war eine Japanerin mit dem hübschen Namen Kyoko. Sie war im selben Kurs wie ich und saß mir normalerweise schräg gegenüber. Sie fiel mir auf, weil sie bei jedem Satz, den unser Designlehrer zu ihr sagte, heftig mit dem Kopf nickte und noch heftiger mit den Augen blinzelte. Ich fand das befremdlich, aber auch süß. Eines Tages kam es zu einem Vorfall. Der Lehrer betrachtete die Zeichnungen, die wir zuhause angefertigt hatten. Er nahm sich auch Kyokos Mappe vor. Dann sagte er voller Enttäuschung und sehr trocken zu ihr: »Ich hasse dich!« Sie fing unmittelbar schrecklich zu weinen an, während er sich von ihr abwandte und aus dem Raum ging. Ich reichte ihr noch ein Taschentuch, aber auch sie verließ sodann mit gerötetem Gesicht den Ort.
Kyoko und ich wurden bald darauf ein Paar, jedoch nur mit begrenzter Haltbarkeit. Die Kommunikation war nicht immer einfach. Kulturelle Ansichten und Unterschiede, aber besonders die Tatsache, dass sie aus einer der wohlhabendsten Familien Japans stammte, bereits jemand anderem versprochen war und ihr Vater sie bespitzeln ließ, erschwerten die Beziehung.
Während die meisten Ausländer, speziell Asiaten, nur ein Jahr an der Marangoni absolvierten, weil viele schon ein Vorstudium in der Tasche hatten und nach einer Aufwertung ihres Lebenslaufes suchten, war ich für drei Jahre eingeschrieben. Ich wollte in Italien bleiben und dort auch arbeiten. So kam es, dass viele Freundschaften, die ich schloss, bereits von Anfang an mit einem Ablaufdatum versehen waren. Natürlich lassen sich Freundschaften auch über längere Distanz aufrechterhalten, allerdings nur schwerlich nachhaltig ausbauen, vor allem, wenn es um Liebesbeziehungen geht. Zumindest damals, in den 1990er Jahren ohne Internet, war dies nicht so einfach.
Eines Tages ging ich in die Universitätsbibliothek, um nach Stoffmustern zu recherchieren. Eine Studentin war bereits dort, lief zwischen den Buchregalablagen hin und her und suchte offensichtlich nach Inspiration. Eine Asiatin mit einem langen geflochtenen Zopf, ähnlich wie ihn Chinesen traditionellerweise getragen haben. Bekleidet war sie mit engen Jeans und einem schwarzen Top. Außerdem trug sie eine überdimensionierte Hornbrille, die auf mich einen unästhetischen Eindruck machte. Sie hatte etwas an sich, das sie von den meisten an der Schule unterschied: Sie wollte nicht auffallen. Wir sollten uns in dieser Bibliothek noch öfter begegnen und irgendwann fingen wir ein Gespräch an. Sie war mir sympathisch, auch wenn sie auf mich einen verhuschten und etwas schrulligen Eindruck machte, und wir freundeten uns an. Es gab immer wieder Gelegenheiten, in denen ich ihr unglaublich künstlerisches Talent sowohl im Zeichnen als auch im Handwerklichen bewundern konnte.
Vielleicht erübrigt es sich dies zu erwähnen, aber sie war Koreanerin.
Gemeinsam mit einem serbischen Freund mit dem schönen Namen Dusan besuchten wir gerne und ausgiebig die Mailänder Modeschauen. Meine neue platonische Freundin Sunhee entpuppte sich als eine sehr nette Person mit subtilem Humor. Der Besuch der Modeschauen war ein absolutes Highlight für uns, und obwohl wir oft keine Eintrittskarten hatten, gelang es uns meistens, mit allerlei Finten in die Show zu gelangen. Das Repertoire an Tricks hatten wir mit der Zeit immer weiter verfeinert. Entweder kamen wir sehr früh zur Show, wenn die Sicherheitslinien noch nicht geschlossen waren, oder wir suchten nach achtlos weggeworfenen Einladungsbriefumschlägen, die den Besitz der Karten vorgaukelten. Wir bezirzten Feuerwehrleute, die die Notausgänge sicherten, oder wir hingen uns in den Windschatten der VIPs mit ihren Trossen. Nicht selten gelangten wir nach der Show auch in den Backstagebereich, in dem es von Models und Fotografen nur so wimmelte und der Designer, umringt von Journalisten, Fragen beantwortete. Selfies gab es leider zu jener Zeit noch nicht. Das hätte sich hier angeboten und aus heutiger Sicht betrachtet bedauere ich es, ein Analog-Native zu sein.
Unser Freund Dusan war ein Meister der Organisation. Er wusste immer, wo gerade die beste Show lief und wo die reichhaltigsten Buffets kredenzt wurden, bei denen wir uns gepflegt satt essen konnten. Außerdem war er so lustig, dass wir immer unseren Spaß hatten. Vor allem, wenn er wieder einmal eine seiner berüchtigten, exzentrischen Anwandlungen hatte. Unvergessen ist der Anfall, den er bekam, als wir Schwierigkeiten hatten, in die Show von Mila Schön zukommen. Eine Designerin, die Dusan zwar aus tiefster Seele verachtete, deren Modenschau er aber trotzdem sehen wollte, natürlich nur, um danach ungehemmt abzulästern. Die hühnenhaften Sicherheitsleute hatten die Eintrittsgasse verengt und obwohl wir uns an so manche Top-Einkäufer hängten, um in ihren Windschatten durchzuschleichen, hatten uns die Kontrolleure entdeckt und wieder heraus gewunken. Dusan warf sich urplötzlich vor der versammelten Besucherschaft auf den Boden, längs ausgestreckt, mit gefalteten Händen in Gebetshaltung und schrie mit slawischem Akzent: »Cholt mirr jemand diese Mila Schooon, ich will da rrrein!!« Wir haben uns vor Lachen unter Tränen nur so gebogen, während die vornehmen Herrschaften um uns herum pikiert vorbeizogen.
In einer der Pausen zwischen den Modeschauen unterhielt ich mich mit Sunhee und fragte sie, wie man auf Koreanisch ›Ich liebe Dich‹ sagt. Sie verstand es nicht falsch und antwortete: »saranghe«. Ich wollte es für die Zeit festhalten und bat sie, mir das auf einen Zettel zu schreiben. Natürlich schrieb sie in Koreanisch, was ich selbstverständlich nicht im Geringsten lesen konnte. Ich konnte es mir dennoch merken und in den Jahren auch das ein oder andere Mal verwenden, aber darauf gehe ich hier nicht im Detail ein. Unsere Freundschaft wuchs weiter und in der Zwischenzeit lernte ich andere Koreaner kennen und kam mit ihrer Kultur immer mehr in Berührung. Sunhee nahm mich eines Tages mit zu einem Freund, der als Make-up-Artist und Hairstylist arbeitete, aber sich auch für Modedesign interessierte. Er hieß Kim Sungmin.
Er war sehr aufgedreht und wir hatten sofort eine tolle Unterhaltung über Mode und Trends, Make-up und das Leben in Italien. Plötzlich sprang er auf. Mit euphorischer Körperspannung steuerte er auf den Kühlschrank zu und ließ verlauten, dass ihm seine Mutter Kimchi aus Korea geschickt habe und wir das unbedingt probieren sollten. Ich hatte noch nie davon gehört, war aber seit jeher aufgeschlossen für alles, was neu war. Er holte eine Tupperdose aus dem Kühlschrank und stellte sie auf den Küchentisch. Das Behältnis war noch mit Frischhaltefolie umwickelt, was mir seltsam vorkam, aber er wickelte ja alles aus. Vielleicht, so dachte ich mir, war es das erste Mal, dass er die Dose nach ihrer Ankunft in Italien öffnete.
Nun, dem war nicht so. Es gab wohl einen guten Grund, die Tupperware hermetisch zu versiegeln. Im Bruchteil von Sekunden, nachdem er den Deckel angehoben hatte, wohlgemerkt immer mit diesem beseelten Gesichtsausdruck, schlug mir ein Geruchs-Tsunami in die Nase. Ich musste alle meine Sinne zusammennehmen, um weiterhin interessiert dem olfaktorischen Spektakel beizuwohnen. In der Box war kein normales Kimchi, wie ich später lernte, sondern ein besonders lang gereiftes. Kimchi, heute weitgehend bekannt, ist durch Bakterien fermentierter Kohl, meistens mit pikantem Chilipulver und einer Unmenge an Knoblauch. Der Geruch war so extrem, dass ich um Atem ringen musste. Sungmin hatte aber bereits zwei Metallstäbchen in der Hand und griff damit ein vergorenes Kohlblatt heraus, um es sich kurz darauf mit Genuss zwischen die Lippen zu schieben. Unsere Freundin Sunhee verstand ihn gut und wollte es auch probieren. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als es ihnen gleichzutun. Auch wenn ich nur ein Stückchen, nicht größer als eine Briefmarke, in den Mund nahm, waren alle meine Geschmacksnerven in höchstem Alarmzustand. Saures und Scharfes galoppierten über meinen Gaumen, schossen in meinen Rachen und kräuselten meine Schleimhäute, dass mir schwindelig wurde. Ich hätte mir in diesem Moment niemals vorstellen können, dass ich später einmal ein leidenschaftlicher Kimchi-Esser und sogar Kimchi-Macher werden würde.
Ich hatte in den verbliebenen Jahren meines Studiums viel Gelegenheit, koreanisches Essen zu probieren, ich würde fast behaupten, einen Gutteil dessen, was die koreanische Küche hergibt. In besonderer Erinnerung bleibt mir, als ein Freund mit dem Namen Gukseo mich einlud und ich zum ersten Mal Ojingeo bokkeum4 (오징어 볶음), Tintenfisch in scharfer Soße sautiert, aß. Es schmeckte fantastisch.
Hingegen war es Sunhee, bei der ich das erste Mal Kimbab5 (김밥), Ra-myeon6 (라면) und Jajang-myeon7 (짜장면) testen konnte. Sie war es, die die Saat legte und mein Interesse für das Land Korea als Erste entfachte.
Einen Moment der finalen Begeisterung erfuhr ich, als Sunhee eines Tages einverstanden war, mit mir zusammen ein großes Bild zu malen. Ich hatte eine enorme Leinwand vorbereitet und wollte wissen, wie es ist, unsere so unterschiedlichen Herangehensweisen und Empfindungen auf ein Bild zu bannen. Meine Wohnung glich einem Atelier, was sie sonst nicht tat, aber ich hatte wieder eine dieser Phasen kreativer Eruption und fieberte dem Moment entgegen, etwas Bleibendes zu schaffen. Sunhee klingelte am Haupteingang meines Kondominiums. Ich öffnete ihr und wartete, bis sie das Treppenhaus heraufkam. Ich war sehr überrascht, ja, fast erschrocken, als dort eine andere Frau erschien. Unfassbar attraktiv und gestylt. Sie musste sich in der Tür geirrt haben, so dachte ich für Sekunden, bis die Frau »Ciao« sagte und ich darin Sunhees Stimme erkannte. Ich stand in Schockverzückung im Türrahmen, während sie mit einem genüsslichen Lächeln, fast triumphal, an mir vorbei in die Wohnung schritt.
Die unscheinbare Freundin schien verschwunden und die Sunhee, die ich jetzt sah, so bezaubernd, dass es mir sehr schwerfiel, ans Malen zu denken. Dennoch gelang es uns an diesem Nachmittag, ein großes Bild zu malen. Bunt und farbenfroh. Wie eine Explosion der Gefühle. Auf manche mag diese Anekdote vielleicht nebensächlich wirken, für mich war es jedoch ein prägender Moment.
Unsere Freundschaft neigte sich dem Ende zu, als sie irgendwann Probleme mit ihrer Kirchengemeinde bekommen zu haben schien und sie für immer längere Zeiträume völlig von der Bildfläche verschwand. Nur wenig später ging sie nach Paris, wo sie, wie ich sehr viel später erfuhr, für Gaultier arbeiten wollte. Wir sollten uns erst Jahrzehnte später wiedersehen.
Was mir nach drei Jahren Modedesignstudium blieb, waren die Aussicht auf einen guten Job, erste Kenntnisse in der koreanischen Kultur, ein paar erhaltene Liebesbriefe auf Koreanisch, die ich damals nicht verstand, und ein einsames Herz, denn die meisten meiner Freunde waren weitergezogen. Entweder in ihre Heimat Südkorea zurück oder sonst wohin.
Bald nach meinem Studium bekam ich meinen ersten richtigen Modejob, beim Marzotto-Konzern, der bald Valentino Gruppe heißen sollte. Es war ein sehr guter Einstieg für mich, denn er ermöglichte mir in einer Doppelrolle, als Designer und als Produktmanagement-Assistent, zu arbeiten. Dadurch erweiterte sich mein praktisches Wissen in der Modebranche enorm, speziell im Hinblick auf Materialien. Ich durfte für hochwertige Marken wie Missoni und Gianfranco Ferré arbeiten, nicht als Chefdesigner, aber als Produktmanager in der Umsetzung der Kollektion und in der Produktbetreuung. Dafür musste ich in die Toskana umziehen, nach Arezzo, wo sich eine Niederlassung der Firma befand.
Ich war zu jener Zeit bereits tief mit dem »Korea Blues« infiziert, einer Sehnsucht nach dem Land, das ich noch nicht kannte, nach den Freunden und ja, auch von der Sehnsucht nach den Freundinnen. Alles, was mir von ihnen geblieben war, waren handschriftliche Mitteilungen auf Koreanisch und ein paar Souvenirs.
Meine Sehnsucht nach Korea versuchte ich mit Surrogaten zu lindern. So interessierte ich mich für Buddhismus und las Bücher koreanischer und japanischer Schriftsteller. Ich sammelte alles, was irgendwie ostasiatisch anmutete. Etwas, was viele Europäer tun, wenn sie das Koreanische noch nicht präzise verorten können oder wollen, weil sie nicht in diesen Kulturen geboren und aufgewachsen sind. Oftmals ist Korea nur die verdauliche Ersatzdroge des asiatischen Lebensgefühls. Bei mir sollte es sich anders entwickeln.
Als mein Arbeitsvertrag in Arezzo auslief und ich endlich in mein geliebtes Mailand zurückgekehrt war, schloss ich wieder Freundschaft mit Koreanern und einer Französin. Rita, so hieß sie, war eine fröhliche Person und hatte ihre kulturellen Wurzeln genau in der Gegend im Elsass, in der auch meine Großonkel tätig gewesen waren. Wir wurden sofort Freunde. Sie hat mir dann eine ältere koreanische Dame vorgestellt, bei der ich Koreanisch lernen konnte. Ich wollte es so sehr. Auch, weil ich immer noch die Briefe besaß und sehr neugierig hinsichtlich des Inhalts war. Ich hätte ja niemanden bitten können, die Briefe zu übersetzen, da ich nicht wusste, welche intimen Details dort geschrieben standen.
So erhielt ich bald darauf einmal pro Woche Koreanischunterricht. Ich fing ganz klassisch an, mit dem koreanischen Alphabet Hangul, das nicht schwer zu erlernen ist. Ich konnte es in wenigen Tagen und trug die Übungsblätter immer bei mir, egal, wohin ich ging. Ich erinnere mich gut, dass mein italienisches Umfeld nicht positiv auf meine Begeisterung für Korea reagierte. Nicht meine Freunde und auch nicht meine damalige Arbeitsstelle, ein Designstudio. Ich sah wohl aus wie ein frisch Verliebter, der seinen Aufgaben nicht mit derselben Leidenschaft nachkommen wollte, wie er sie mit vermeintlich profaneren Dingen verschwendete. Aber das war mir egal. Eine italienische Freundin sagte mir ins Gesicht: »Du hast gar keine Zeit mehr für mich, hängst nur noch mit diesen verdammten Koreanern rum!«
Ich nutzte die Zeit, um möglichst viel von der Sprache zu lernen. Und wo immer sich die Gelegenheit bot, mit Koreanern zusammen zu sein, tat ich dies. Dabei half es sowohl, regelmäßig die koreanisch-katholische Kirchengemeinde zu besuchen, als auch die protestantische. Mein Glaube an Korea wurde zu meiner persönlichen Ökumene. Die Konfession spielte dabei keine Rolle.
Es war im Frühjahr 1996, als ich immer tiefer in die koreanische Kultur eintauchte. Mein Tunnelblick war nun vollendet und es war mir nicht mehr egal, über welches Land wir hier sprachen. Es ging mir nur noch um Korea. Im selben Frühjahr bot meine Koreanisch-Lehrerin einen Abendkurs in einer öffentlichen Schule in Mailand an, genauer gesagt, in der zentrumsnahen Gegend um Moscova, und sie bat mich, teilzunehmen, was ich gerne tat. Es sollte sich als eine folgenschwere Entscheidung erweisen, die mein Leben für immer veränderte.
Koreanisch zu lernen scheint am Anfang einfach zu sein. So wie ich Italienisch nach einem Jahr wieder gut beherrschte und es zeitweise mit dezentem Mailänder Akzent sprach, so bildete ich mir ein, auch Koreanisch leicht erlernen zu können, denn ich liebte die Sprache und Kultur. In der Koreanisch-Klasse saßen außer mir noch Rita, die auch schon Koreaerfahrung hatte, und sechs weitere Personen. Der Kurs wiederholte im Grunde, was ich bereits gelernt hatte, dennoch ging ich sehr gerne hin. Im Unterricht saß neben mir ein Junge von ungefähr 17 Jahren, der koreanisch aussah, aber kein Wort Koreanisch sprach. Er war in Italien geboren und sprach fließend Italienisch. Er erinnerte mich an mich selbst, wie ich ebenfalls, aus eigener Entscheidung, nicht zweisprachig aufgewachsen war. Als er nach meinen Beweggründen fragte, warum ich mich für Koreanisch interessiere, sagte ich ihm, dass ich nach Korea reisen wolle. Da erwiderte er, dass er von Universitäten wisse, die für Ausländer Sprachkurse anböten. Er nannte die Yonsei Universität8 und wollte mir beim nächsten Kurs die Adresse mitbringen. Das tat er dann auch, und ich schrieb umgehend einen Brief an die Universität. Damals schien alles unendlich lange zu dauern, aber nach gut zwei Wochen erhielt ich ein Antwortschreiben vom Yonsei KLI (Korean Language Institute) mit den Unterlagen zur Anmeldung. Nach Rücksprache mit meinen Eltern und einem Kassensturz hinsichtlich meiner finanziellen Möglichkeiten war ich mir gewiss, die Kosten für Reise, Studium und Aufenthalt bestreiten zu können. Ich meldete mich an und überwies die Aufnahmegebühr. Von da an konnte ich es nicht mehr aufhalten und aushalten. Ich fieberte meiner Reise entgegen.
Eine Hürde hatte ich noch zu nehmen: Ich benötigte eine Unterkunft. Mit Privatunterkünften hatte ich bisher immer gute Erfahrung gemacht, weil man in einer Familie wohnt und den Alltag der Menschen kennenlernen kann. Airbnb gab es noch nicht, ich musste mich bei meinen koreanischen Freunden erkundigen, ob sie jemanden kannten, der Zimmer vermietete. Es ergab sich, dass eine Freundin meiner Freundin eine Mitbewohnerin namens Stella in Mailand hatte. Die wiederum hatte einen Freund, dessen Familie in Seoul ein Zimmer vermieten würde.
Innerhalb von zwei Wochen hatte ich die Zusage, bei dieser Familie in der Nähe von Sadang-Seoul ein Zimmer zu beziehen. Wie es der Zufall wollte, war Stella in jener Zeit auch gerade in Seoul und konnte für mich einiges organisieren.
Ich war sehr glücklich, denn es kam mir vor wie eine Vorsehung.
Zwischen Umbruch und Aufbruch –Das Rufen eines Sehnsuchtsortes
»Überall geht ein früheres Ahnen dem späteren Wissen voraus.«
Alexander von Humboldt
Als sich die Tür des Flugzeuges Anfang September des Jahres 1996 am Flughafen Gimpo öffnete und die schwül-heiße Luft des koreanischen Spätsommers meine Schläfen in einen Schraubstock spannte, spürte ich sofort, dass alles, was jetzt kommen würde, so anders sein würde als das, was ich schon erlebt hatte. Allein der Geruch hier war so fremd und für einen kurzen Moment stand ich wieder im Kunstbedarfsladen in Mailand, hinter der jungen koreanischen Frau.
Abgeholt wurde ich am Flughafen von Woong, einem Sohn der Gastfamilie und eben jenem Freund von Stella. Auch er hatte in Mailand studiert und sprach ein gutes Italienisch. Er wirkte froh, einen italienischen Gast begrüßen zu können, und wir unterhielten uns ausgiebig auf dem Weg zu seinem Zuhause.
Auf der Fahrt fielen mir die unzähligen Apartment-Wohnblöcke auf, die den breiten Han Fluss säumten und die vorherrschende Bauweise zu sein schienen. Auch meine Gastfamilie lebte in einem ähnlichen Wohnblock. Als Europäer war ich es nicht gewohnt, in großen Wohnanlagen zu wohnen. Jugendstilvillen waren angesagter, mit ihren hohen Decken und alten Gemäuern. Aber gut.
Ich war entspannt und ließ mich auf alles ein. Meine Grundstimmung war positiv. Als wir die Wohnung erreichten, war die Gastmutter da und begrüßte mich mit einem sehr freundlichen, etwas verlegenen Lächeln. Sie zeigte mir mein Zimmer, welches ich für mich allein hatte. Das Bad sollte ich mit Woong teilen, dessen Zimmer gegenüber lag. In meinem Zimmer stand der einzige Personal Computer des Hauses und er hatte die erste Version von Windows mit Internetzugang, was für mich eine absolute Sensation war, zumal ich die Erlaubnis hatte, ihn zu benutzen. Der anschwellende Klingelsound beim Hochfahren des Rechners ist mir heute noch so präsent, als wäre es gestern gewesen.
Mit meiner Gastfamilie hatte ich einen Glückstreffer gelandet. Die Mutter war eine außergewöhnlich freundliche Person, zu deren Leidenschaften das Kochen und das Erlernen der japanischen Sprache zählte. Der Vater war ein hoher Beamter in einem Ministerium und die beiden Söhne durchwegs nette Kerle. Woongs Bruder hieß Lim und arbeitete bei einem US-Koreanischen IT-Unternehmen im Stadtteil Yeouido9





























