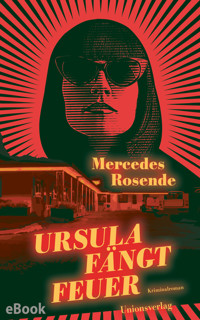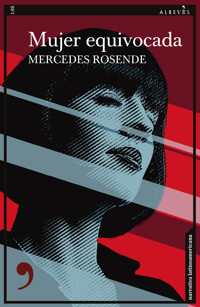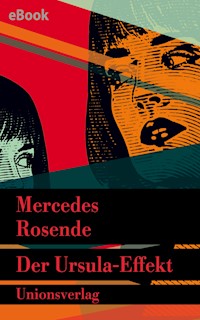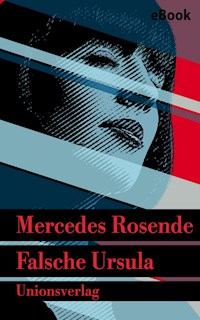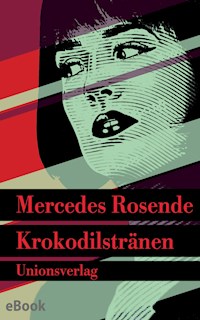
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Schauplatz: die Altstadt von Montevideo, mit düsteren Gassen und neugierigen Bewohnern. Der Coup: ein Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter. Die Besetzung: Germán, gescheiterter Entführer mit schwachen Nerven. Ursula López, resolute Hobbykriminelle mit unstillbarem Hunger. El Roto, der Kaputte, berüchtigter Verbrecherboss mit zu viel Selbstvertrauen. Doktor Antinucci, zwielichtiger Anwalt mit großen Plänen. Und schließlich Leonilda Lima, erfolglose Kommissarin mit einem letzten Rest von Glauben an die Gerechtigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Schauplatz: die Altstadt von Montevideo. Der Coup: ein Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter. Die Besetzung: Germán, gescheiterter Entführer. Ursula López, resolute Hobbykriminelle. Doktor Antinucci, zwielichtiger Anwalt. Und schließlich Leonilda Lima, erfolglose Kommissarin mit einem letzten Rest von Glauben an die Gerechtigkeit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Mercedes Rosende, geboren 1958 in Montevideo, Uruguay, studierte Recht und Integrationspolitik. Für ihre Romane und Erzählungen wurde sie mit dem LiBeraturpreis, dem Premio Municipal de Narrativa, dem uruguayischen Nationalliteraturpreis und dem Código Negro ausgezeichnet. Sie lebt in Montevideo.
Zur Webseite von Mercedes Rosende.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Mercedes Rosende
Krokodilstränen
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
Die Montevideo-Romane (2)
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2016 bei Estuario Editora, Montevideo.
Deutsche Erstausgabe
Originaltitel: El Miserere des los Cocodrilos
© by Mercedes Rosende, 2016
© by Estuario Editora, 2016
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Chris Barbalis (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30976-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 03:57h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KROKODILSTRÄNEN
Erster Teil1 – Müde sind sie. Vom frühen Aufstehen, von der …2 – Viele Jahre davor3 – Kaum irgendwo herrscht eine so dichte Atmosphäre wie …4 – Sieht ganz so aus, als hätte Ursula eine …5 – Ein starkes, buntes, leuchtendes Bild, wie aus einer …6 – Nur mit Mühe hat er in den Schlaf …7 – Kommissarin Lima öffnet den Ordner, blättert eine Weile …8 – Halb drei am Morgen9 – Und wer kommt da angerast, mit durchgedrücktem Gaspedal …10 – Ausziehen!«, befiehlt der Polizist. Er ist groß und …11 – Sie hat nur wenige Erinnerungen an ihre Mutter …12 – Im Wartesaal des Strafgerichts. Nein, kein in Pastelltönen …13 – Bericht aus der Tageszeitung »El informante«14 – Hallo, Roña, olle Krätze, wie wars im Knast …15 – Als die Frau drin ist und gerade die …16 – Eine eher triste Szenerie: ein kalter Tag …17 – Nachdem er im Zentrum aus dem Bus gestiegen …18 – Guten Tag, ich bin Kommissarin Leonilda Lima …19 – Sie will nicht aufwachen. Will das gemütliche Bett …20 – Dass das Fernseh-Horoskop am Morgen dem Steinbock eine …21 – Kurz nach Mittag, in der Altstadt22 – Die Frau zieht sich langsam den Mantel aus …23 – Ein Zimmer, ein Bett, und darauf eine Frau …24 – Dinge, die Ursula nie macht: beim Treppen-Hinunterlaufen zwei …25 – Montevideo bei Tagesanbruch. Nichts regt sich, kein Mensch …26 – Montevideo bei Tagesanbruch. Die Helligkeit dringt durch die …Zweiter Teil09.23 Uhr09.28 Uhr09.29 Uhr09.31 Uhr09.35 Uhr09.40 Uhr09.42 Uhr09.43 Uhr10.15 Uhr10.25 Uhr10.35 Uhr10.40 Uhr10.44 Uhr10.44 UhrDritter TeilPapaBericht aus der Tageszeitung El informante.UrsulaLeonildaMehr über dieses Buch
Mercedes Rosende: »Jeder meiner Romane enthält gleichzeitig all die Romane, die ich nicht geschrieben habe.«
Über Mercedes Rosende
Mercedes Rosende: »Wir dürfen den Sinn für das Komische nicht verlieren.«
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Mercedes Rosende
Zum Thema Uruguay
Zum Thema Frau
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Lateinamerika
Abrakadabra Opfersegen
Düstere Rose, die du deinen Moschusduft verströmst,
libysche Seherin, von Epilepsien geschüttelt,
Gonk-Gonk hast du schlachtfrische Eingeweide geopfert
und Herzen nubischer Panther dazu.
Hast laszive Tragödien zur Beschwörung der Geister
des Regens postum in Szene gesetzt,
umringt von Gebeinen, lauwarmen Resten
und blonden Schöpfen gefangener Frauen.
Ein Donner ertönt. Und im letzten Abglanz
von Feuer und Blut ward der Götzen
verwirrtes Gemüt zu mystischem Schweigen besänftigt …
In knisternden Fäden fiel der Regen hernieder,
und in der Ferne lange noch seufzend vergoss,
um Vergebung flehend, das Krokodil seine Tränen.
Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875–1910)
Erster Teil
1
Müde sind sie. Vom frühen Aufstehen, von der Fahrt, vom Warten. Sie versuchen, die erniedrigende Einlasskontrolle zu verdrängen, beim Reinkommen sehen sie sich um, dann sehen sie sich an, messen sich mit dem Blick, aber wozu? Überall sehen die Frauen das Gleiche, das schlecht verdaute Frühstück im Magen, die Ratlosigkeit, die Armut, den Hass. Im Inneren des Besucherpavillons stehen Tische und Stühle aus Plastik, sie sind in losen Gruppen angeordnet, die neu arrangiert, umgestellt, aufgelöst werden, aufgehoben und mit lautem Getöse zu Boden gestellt. Der Raum ist ziemlich groß, etwa fünfzig mal zwanzig Meter, das Wellblechdach nicht richtig dicht. Bei jedem kleineren Schauer tropft es durch, der Boden nackter Beton, die Wände mit Namen, Fürbitten und Liedtexten beschmiert, dazu Herzen, Kreuze, Geschlechtsteile. Durch das einzige Fenster sieht man auf den ebenfalls betonierten Hof hinaus, der in den schmutzig grauen Himmel ohne Horizont übergeht. An der Nordseite sind die Toiletten, die Tür bei den Männern ist ausgehängt, lehnt seitlich am Rahmen und verdeckt den Zugang nur notdürftig. Hier riecht es besonders streng.
Am Eingang steht ein Polizist, der mit einem Stöckchen zwischen seinen Zähnen herumstochert, ab und zu spuckt er Holzstückchen oder Speisereste aus.
Germán hat sich in einer düsteren Ecke niedergelassen, so weit wie möglich von den anderen Häftlingen entfernt. Er wartet auf seinen Anwalt. Sein blauer Overall sieht ziemlich abgetragen aus, er hat graue Bartstoppeln, die Fäuste geballt und einen Kloß im Hals.
Die Frauen öffnen alte Eisdosen, in denen sich jetzt Nudelsuppe, faserige Schnitzel oder Polenta mit Tomatensauce befinden, sie holen Bananen, Mate- und Tabakpäckchen, Mandarinen, Zitronen und kleine Tüten Brausepulver aus ihren Taschen. Untermalt wird das Ganze vom dumpfen Geräusch eines Fußballs, der draußen immer wieder auf dem harten Boden aufprallt, und vom anschwellenden Stimmpegel der Unterhaltungen. »Hier drin ist die Welt noch ein bisschen beschissener«, sagt sich Germán.
Und wer kommt da angestiefelt, mit gegeltem Haar, bordeauxroter Krawatte und Ray-Ban-Brille? Doktor Antinucci. Die kleine Narbe über der rechten Braue hat er bestimmt von einem Faustschlag, die Sache muss aber lange her sein, die Haut ringsherum ist glänzend und glatt, offenbar schon seit Jahren verheilt. Der Doktor ist weder alt noch hässlich, kommt einem aber trotzdem so vor. Am auffälligsten sind seine übermäßig großen und übermäßig vortretenden, verwaschen grauen Augen unter den fleischigen Lidern. Manchmal ziehen sie sich zu kalten, schmalen Schlitzen zusammen. Das ist jetzt, hinter den dunklen Gläsern der Sonnenbrille, und erst recht im Halbdunkel des Besucherpavillons, aber nicht zu sehen. Sein Köfferchen braucht er an der Einlasskontrolle nicht zu öffnen. Nie.
»Bitte schön, Herr Doktor.«
»Danke, Jungs.«
Germán hört seine festen entschlossenen Schritte, sie kommen immer näher – es ist, als folgte Antinucci den Klängen eines Marsches, der im Inneren seines Kopfs ertönt –, Germán sieht auf, und da steht er auch schon vor ihm. Nach einem knappen soldatischen Kopfnicken schnellt zur Begrüßung seine Rechte hervor. Germán muss bei dem Anblick an ein aufklappendes Springmesser denken. Der Händedruck des Anwalts ist dagegen überraschend schlaff, eine flüchtige kalte Berührung, und sogleich zieht die Qualle sich wieder zurück. Antinucci rückt sorgfältig den Stuhl ihm gegenüber zurecht, lässt sich darauf nieder, klappt das Lederköfferchen auf, holt eine ebenfalls in Leder gebundene Mappe heraus, legt sie vor sich, richtet sie rechtwinklig zur Tischkante aus, schlägt sie auf und entnimmt ihr mehrere Blätter. »Das Mäppchen«, sagt sich Germán beim Anblick des abgewetzt fleckigen Einbands, den er bei einem früheren Besuch schon einmal gesehen hat. »Mein Ordner«, nennt ihn Antinucci. Offensichtlich hütet er ihn wie seinen Augapfel. Germán verspürt einen leisen Schauder, warum auch immer. Die getönte Ray-Ban bildet eine undurchdringliche Mauer zwischen ihnen. Germán weiß nicht, ob die Augen des Anwalts ihn ansehen oder nur damit beschäftigt sind, die Gegenstände millimetergenau anzuordnen, die er auf dem Tisch ausbreitet. Außer dem Ordner und den Blättern sind das noch ein Bleistift, ein blauer und ein roter Kugelschreiber, ein Mobiltelefon, ein Radiergummi und die Armbanduhr, die Antinucci abstreift und so am oberen Ende des Ganzen platziert, dass das Zifferblatt aufgerichtet und ihm zugekehrt ist. Germán ist der Gedanke lieber, dass der Anwalt ihn nicht ansieht. Seinerseits bemüht er sich, den Blick nicht auf dessen Brillengläser zu richten, als könnte er sich auf diese Weise den Worten entziehen, die er sich, wie er weiß, zuletzt dennoch wird anhören müssen.
Antinucci klappt das Lederköfferchen zu und stellt es genau parallel zu seinem Stuhl auf den Boden, schlägt die Beine übereinander, zieht eine Tüte Bonbons aus seiner Jackentasche, nimmt eins heraus und wickelt es bedächtig aus, steckt es sich in den Mund und faltet das Papier zweimal. »Sie sind ein Loser«, sagt er und lässt sich dabei jede Silbe auf der Zunge zergehen.
Ohne das Gesicht abzuwenden, steckt er das zusammengefaltete Bonbonpapier in die Tüte und die Tüte wieder in die Jackentasche, holt anschließend ein Päckchen Zigaretten und ein Markenfeuerzeug hervor, zündet sich eine Zigarette an, zieht mehrmals daran und bläst den Rauch in Richtung seines Gegenübers. Das Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen scheint bis heute an drei Orten dieser Welt nicht zu gelten – in Guantánamo, türkischen Gefängnissen und uruguayischen Haftanstalten. Germán würde gerne etwas erwidern, bringt aber außer einem Geräusch, das wie das Stottern eines alten Motors klingt, nichts heraus. Er sieht zu dem Polizisten am Eingang hinüber, der immer noch zwischen seinen Zähnen herumstochert und ab und zu ein Holzsplitterchen oder Speisereste oder beides gleichzeitig ausspuckt.
»Und dieser Sergio, mit dem Sie Santiago Losada entführt haben, lässt es sich währenddessen gut gehen, wo auch immer, auf jeden Fall mit dem Geld, das Sie dem Typen abgeknöpft haben.« Antinucci lässt die Zigarettenasche auf den Boden fallen, aber natürlich nicht auf sein Köfferchen. »Ich hab Ihnen ja gesagt, hier kommen Sie schnell wieder raus. Und ich hab mich nicht getäuscht – ich täusche mich nie. In ein paar Tagen werden Sie freigelassen.«
Germán hat den Eindruck, er müsse sich freuen, strahlend vom Stuhl aufspringen, dem anderen auf den Rücken klopfen, ihm die Hand schütteln, ihn sogar umarmen, ja, vielleicht laut loslachen, begeistert klatschen. Aber nichts davon geschieht, er verspürt nicht die geringste Freude, keinerlei Begeisterung, bloß eine leise Erleichterung, die sich langsam in ihm breitmacht. Denn hat sich die schwarze Gefängnisnacht erst einmal in einem eingenistet, kann die Sonne noch so hell scheinen, das schüttelt man nicht einfach so ab wie Staub. Selbst die bestmöglichen Nachrichten sorgen da gerade einmal für leichte Entspannung, alles andere braucht seine Zeit.
»Was Ihnen am meisten genützt hat, war die Aussage des Entführten, so seltsam es klingt. Ja, die von Losada. Er hat zum Richter gesagt, dass Sie ein Loser sind. Und dass der andere Entführer, dieser Sergio, der für Losadas Firma gearbeitet hat, sich das Ganze ausgedacht hat. Und am Ende hat er Sie reingelegt und ist einfach mit der Kohle abgehauen. Und Sie saßen währenddessen bei Losada und haben gewartet, dass er Sie abholt, stimmts?«
Während Germán überlegt, was die beste Antwort auf eine Frage sein könnte, die er nicht versteht, betrachtet er seine Hände.
Antinucci spricht weiter: »Wissen Sie was? Losada hat sogar behauptet, Sie seien eigentlich kein schlechter Kerl, und Sie hätten ihn gut behandelt, und irgendwelche körperliche Schäden hätte er auch nicht davongetragen. Und nachdem seine Frau, diese Ursula López, dann auch noch gesagt hat, dass keinerlei Lösegeldforderungen gestellt wurden, standen Sie natürlich ziemlich gut da.«
Germán spreizt die Finger, starrt weiter seine Hände an und glaubt zu spüren, dass Antinucci ihn mit dem Blick durchbohrt und seine Gedanken zu lesen versucht.
»Komisch, wirklich … Sie haben mir doch gesagt, Sergios Plan hätte vorgesehen, dass Sie Santiago Losada entführen, um dann von seiner Frau Geld zu verlangen. Als Sie gemerkt haben, dass Ihr Partner mit dem Geld aus Losadas Auto durchgebrannt ist, warum haben Sie da nicht trotzdem Lösegeld verlangt, bloß eben allein? Die Frau war schließlich noch da, warum hätte sie nicht spuren sollen? Beziehungsweise, warum haben Sie ihren Mann drei Tage lang festgehalten, wenn nicht für Lösegeld?«
Antinucci wirft den Zigarettenstummel auf der anderen Seite seines Stuhls – dort, wo nicht sein Köfferchen steht – auf den Boden und tritt ihn aus, zermalmt ihn unter dem Absatz seines auf Hochglanz polierten Halbschuhs.
»Jetzt mal ehrlich, haben Sie Losadas Frau erpresst oder nicht? Diese Ursula, so heißt sie doch, den Namen vergisst man nicht so leicht. Vielleicht wollte sie ja einfach nur keine Probleme mit den Behörden und hat darum nichts gesagt. Sagen Sies mir – kennen Sie sie, ja oder nein?«
Während der Anwalt auf ihn einredet, hält er eine unsichtbare Melone in den Händen. Germán möchte etwas erwidern, zögert, hält sich zurück. Hat er Angst, ist er unsicher? Es sieht so aus, als könnte er aus irgendeinem Grund nichts sagen, oder, falls doch, weiß er offenbar nicht, welche Version er seinem Anwalt erzählen soll.
Mit theatralischer Gebärde nimmt Antinucci langsam die Brille ab, legt sie vorsichtig auf die Mappe beziehungsweise den Ordner, fokussiert mit stumpfem Blick einen Punkt in Germáns Gesicht, der auf einmal einen Druck oberhalb der Nasenwurzel zu spüren meint und feststellt, dass die Augen des Anwalts sich zu zwei schmalen Schlitzen zusammengezogen haben.
»Was ich außerdem nicht verstehe, ist, dass die Polizei in dem Versteck, wo Sie Santiago Losada festgehalten haben, keine Waffe gefunden hat. Soll das heißen, Sie und Sergio hatten nicht mal eine Pistole? Also hören Sie, ich bin doch nicht von gestern …«
Antinucci schnalzt mit der Zunge und verzieht den Mund, behält Germán dabei aber fest im Blick, sosehr der versucht, ihm auszuweichen. Für einen kurzen Augenblick zieht sich die Welt um Germán herum zurück, und mit ihr der Besucherpavillon. Ihm wird schwindlig.
»Sie sagen immer noch nichts? Wie Sie wollen, das ist Ihre Sache. Von Ihrer Haft hier wird jedenfalls nichts in den Unterlagen stehen, nur dass ein Verfahren gegen Sie eröffnet wurde. Und in ein paar Jahren gibts dann irgendwann ein Urteil, vielleicht ist die Sache bis dahin auch verjährt, würde mich zumindest nicht wundern, bei dem Zustand der Justiz hierzulande … Also stellen Sie sich schon mal darauf ein: So Gott will, kommen Sie in ein paar Tagen raus. Vorher werden Sie allerdings noch mal aufs Gericht gebracht, für eine Gegenüberstellung, Routinesache …«
»Eine Gegenüberstellung? Mit wem denn?«
»Aha, Sie können ja doch sprechen. Die Gegenüberstellung ist mit der Frau von Losada. Mit Ursula, Ursula López. Schöner Name, finden Sie nicht? Mir gefällt er, ich weiß auch nicht, warum. Aber wie gesagt, für Sie ist das kein Problem, sie hat ja erklärt, dass Sie nie Lösegeld von ihr verlangt haben. Ich hab da so meine Zweifel, aber wenn Sie das vor dem Richter bestätigen … Und jetzt unterschreiben Sie das Formular hier. Und das da auch.«
Was soll er dem Anwalt sagen? Dass sie natürlich eine Waffe hatten und dass er selbst nicht weiß, wie der Revolver aus der Hütte verschwunden ist, in der sie Santiago versteckt hatten? Und dass er natürlich Ursula getroffen und Lösegeld verlangt hat, dass sie dann aber eine seltsame Zweckgemeinschaft gebildet haben? Dass sie ihm Geld angeboten hat, allerdings nicht, damit er ihren Mann frei-, sondern damit er ihn verschwinden lässt? So etwas würde ihr natürlich niemand zutrauen – doch nicht der Ehefrau eines Unternehmers wie Santiago Losada. Germán würde es auch niemals verraten, schließlich hat Ursula sich ihm gegenüber sehr fair verhalten, und wenn er rauskommt, will er bei ihr vorbeigehen und sich bedanken.
Er versucht, an nichts zu denken und den Druck oberhalb der Nasenwurzel zu ignorieren, er sieht auf, weicht aber dem sezierenden Blick seines Gegenübers aus, betrachtet stattdessen die Decke des Pavillons, die Wände, die Leute um sie herum.
Immer noch mehr durchfrorene Häftlingsfrauen kommen herein, sie machen einen ratlosen, schicksalsergebenen, gedemütigten Eindruck. Inzwischen riecht es im ganzen Raum nach Schmalzgebäck, feuchter Kleidung und Wohnungen ohne Dusche. Die Frauen holen Stühle heran, lassen sich nieder und fangen an, sich lautstark zu unterhalten. Dazu trinken sie Mate.
Der Aufseher an der Tür spricht in sein Mobiltelefon, lacht manchmal, stochert bei alldem weiter zwischen seinen Zähnen herum und spuckt ab und zu aus.
Germán fragt leise: »In ein paar Tagen, haben Sie gesagt?«
»Genau. Über meine Arbeit können Sie sich wirklich nicht beschweren.«
»Sobald ich kann, zahle ich Ihnen das Honorar.«
»Das wird nicht lang dauern, Germán, Sie hören von mir, schon ganz bald, heute noch, oder sonst morgen.«
Germán spürt ein Stechen im Genick, und sein Magen zieht sich zusammen. Aber jetzt geht es erst einmal darum, rauszukommen. Einen ganzen Monat ist er jetzt schon hier, sagt er sich und sieht auf den Hof hinaus, wo das vom Wind aufgehäufte Herbstlaub liegt. Die Frau von Santiago Losada hat gelogen, als sie gesagt hat, er habe kein Lösegeld verlangt, das hat sie getan, weil sie anständig ist. Trotzdem stimmt da irgendwas nicht, er ist verwirrt und hat den Eindruck, die Schuldigen und die Unschuldigen in dieser Geschichte sind nicht unbedingt die wirklichen Schuldigen und Unschuldigen.
2
Viele Jahre davor.
Sie ist nur ein verschüchtertes hungriges Mädchen. Ein Mädchen, das an der dunkelsten Stelle des Flurs reglos mit geschlossenen Augen an der Wand lehnt. Schweißtropfen stehen ihr auf der Stirn, am Hals, am Haaransatz, sie keucht, als würde sie laufen oder im Schulhof seilspringen, und ihre Hände zittern leicht. Sie ist nur ein Mädchen, und der Entschluss fällt ihr nicht leicht, aber sie hat Hunger, ständig hat sie Hunger. Schließlich beugt sie sich hinab, zieht sich geräuschlos die Lackschuhe mit den Silberschnallen aus, stellt sie vorsichtig auf den Boden und setzt sich lautlos in Bewegung. Ihre weißen Strümpfe gleiten über das frisch gewachste Parkett, ein paar Meter noch, dann bleibt sie zögernd an der Tür stehen, lauscht, drückt vorsichtig die Schwingtür auf und streckt den Kopf vor.
Von der Schwelle aus betrachtet sie den großen einladenden Raum, die Sonne scheint zwischen den Vorhängen hindurch und lässt den Eichentisch erstrahlen, sie sieht die Regale, die Gläser mit Gewürzen. Den Kühlschrank. Bei seinem Anblick läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Doch trotzdem bleibt sie wachsam, sie weiß, im Nebenzimmer schläft die Köchin, aufmerksam verfolgt sie ihre immer lauter werdenden Schnarchgeräusche.
Sie ist ein hungriges Mädchen, aber die Angst ist mächtig, und so traut sie sich noch immer nicht, die wohldurchdachte Ordnung, die in der Küche herrscht, zu entweihen, das verbotene Terrain, die ihr verschlossene Welt voller Verheißungen zu betreten, über die die Köchin mit der weißen Schürze wacht, die in diesem Augenblick ihren Mittagsschlaf hält.
Bei Tag und bei Nacht denkt sie ans Essen, wenn sie aufwacht und wenn sie ins Bett geht, bevor sie sich zu Tisch setzt und während sie isst, was die Köchin oder Papa ihr aufgeben. Hat sie die kleinen Portionen verzehrt und steht auf, ist ihr Hunger noch längst nicht gestillt, und sie denkt weiterhin bloß ans Essen. Auch in der Schule und beim Fernsehen und Puppenspielen mit ihrer Schwester Luz ist das so. Luz ist schlank und darf essen, soviel sie will, meistens probiert sie aber nur wenige Bissen. Luz ist schlank, und ihr Papa sagt, sie ist schön, so schön, wie Mama war, und wenn er das sagt, sieht er immer sie an, die dann jedes Mal das Gefühl hat, dass ihr Körper viel zu viel Raum einnimmt.
Sie drückt die Tür noch ein Stückchen auf und tritt ein. Sie hat Angst, aber der Hunger ist stärker. Sie lauscht auf die tiefen regelmäßigen Atemzüge, weiter!, befiehlt ihr Magen dem Hirn, und auf Zehenspitzen durchquert sie die Küche, setzt vorsichtig einen Fuß nach dem anderen auf, zwei Schritte noch, dann steht sie vor dem Kühlschrank, ihre Hand bewegt sich wie von selbst, streckt sich aus, nähert sich dem Griff, betastet ihn unsicher, während ihre Besitzerin sich wachsam umsieht, die Finger gleiten über die verchromte Oberfläche, der Hunger wird stärker und stärker, die kleine Hand umfasst jetzt das kühle Metall, packt zu, ein Ruck. Was für ein Hunger!
Der Kühlschrank geht auf.
Sie greift nach einem Stück Huhn und führt es an den Mund, schlägt die Zähne hinein, die das Fleisch zerreißen, sie schluckt und beißt erneut zu, einmal, zweimal, nach einem Blick auf das Schälchen mit Marmelade nimmt sie ein Stück Käse, umwickelt es mit einer Scheibe Schinken und schiebt sich das Ganze in den Mund, kaut einen Augenblick darauf herum und schlingt es hinunter, ein kurzer Blick zur Tür, dann schraubt sie das Glas mit der Mayonnaise auf, steckt den Finger hinein und schleckt ihn ab, das Gleiche sofort noch einmal, dann tunkt sie ein Stück Kartoffel in die Mayonnaise und stopft es sich in den Mund, wieder ein hastiger Blick über die Schulter zur Tür, dann mit zwei Fingern in die Karamellcreme, sie schnalzt mit der Zunge und leckt und leckt, danach eine Frikadelle mit Sauce und Reis, noch eine, diesmal mit Sauce und Mayonnaise, sie leckt sich über die Lippen, dann versenkt sie den Finger in der Marmelade, lutscht genüsslich daran, wieder ein Blick zurück, gleich darauf das zweite Stück Huhn, fast unzerkaut wandert es in ihren Magen, noch mehr Karamellcreme, aber irgendetwas stört jetzt, schnell noch mal alle Finger in die Sauce getaucht, sie leckt und schleckt, lutscht und saugt – und erstarrt mit offenem Mund. Das störende Element sind Schritte, die sich nähern, sie kennt das Geräusch genau, noch sind sie im Flur.
Sie lauscht. Zittert. Wendet den Kopf.
Leise geht die Tür auf. Ein Mann steht auf der Schwelle und betrachtet das Mädchen.
»Ursula.«
»Nein, Papa.«
Ursula streift die kleinen Finger an ihrem Kleid ab, fährt sich mit dem Ärmel über den verschmierten Mund, drückt mit dem Hintern die Kühlschranktür zu und presst sich dann mit dem Rücken an das kühle weiße Gehäuse, in dem sie sich in diesem Augenblick am liebsten auflösen würde. »Papa, nicht … Ich tu es nie wieder.«
Der große schlanke Mann trägt einen dunklen Anzug und Krawatte, seine polierten schwarzen Schuhe verbreiten einen geradezu aggressiven Glanz. In der Rechten hält er ein goldenes Feuerzeug. Er sieht das Mädchen mit stahlhartem Blick an. »Komm her, Ursula.«
»Ich versprechs dir, Papa.«
Sie sieht ihren Vater an, blinzelt, schließt die Augen, versucht, die Tränen zurückzuhalten, die ihr jetzt über das fettige, verklebte Gesicht laufen. Ihr ist klar, welche Strafe ihr bevorsteht, Panik steigt in ihr auf. Sie macht einen Schritt auf ihren Vater zu, weicht seinem Blick aber aus und beißt sich auf die Unterlippe, bis sie ganz weiß wird. »Nicht, Papa, bitte«, flüstert sie.
Sie fängt an zu schwitzen, ist vor Angst wie gelähmt. Sie weiß, was jetzt kommt – gleich wird sie das bekannte Geräusch hören, das leise Schaben der Sohlen auf dem glatten Boden, sie wird den schwarzen Glanz des Leders vor sich sehen, der Vater wird sie an der Schulter packen und ein Stück vor sich herschieben, dann werden sie stehen bleiben, und er wird, heftig atmend, anfangen, seine Tochter zu umkreisen. Irgendwann wird er sie am Kinn nehmen und sie zwingen, aufzusehen, er wird sich räuspern, mehrmals, sie weiß es genau. Dann wird er mit dem Feuerzeug spielen, es auf- und zuklappen lassen, die Flamme wird aufleuchten und erlöschen, immer schneller. Bei der Vorstellung fängt sie an, mit den Zähnen zu klappern.
Bis er schließlich sagen wird: »Ich tus nur für dich.«
»Ich tus nur für dich, Ursula. Ich muss dir helfen, deine Schwächen in den Griff zu bekommen.«
Die Tränen laufen ihr über die verschmierten Wangen, fallen auf das Kleid mit den Marmeladen- und Saucenflecken. Der Vater lässt das Feuerzeug Feuerzeug sein, nimmt sie behutsam am Arm, zieht sie zu sich her, hebt ihr Kinn an, zwingt sie sanft, ihm in die Augen zu sehen. Bis über seine Brust hinaus schafft sie es jedoch nicht, zitternd senkt sie den Blick wieder zu Boden, wo er auf zwei schwarze Spiegel trifft, seine Schuhe.
»Glaub bloß nicht, deine Krokodilstränen machen mir Eindruck, Ursula.«
»Papa, bitte …«
Sie fleht ihn an, obwohl sie weiß, dass es zwecklos ist, ihr Vater ist durch nichts zu erweichen, er hört ihr nicht einmal zu. Dafür drängt er sie jetzt mit sanfter Gewalt zur Küchentür, führt sie danach durch den Gang zu ihrem Zimmer, an ihr Bett mit der rosa Chenilledecke, dem Teddybären und den Puppen, schiebt all das behutsam zur Seite. Ursula verfolgt, wie die Dunkelheit sich im Raum breitmacht, während ihr Vater die Fensterläden schließt, das Rollo herunterlässt und die Vorhänge mit den Feen zuzieht, sodass nicht ein Lichtstrahl von außen hereindringen kann. Alles, was ihr jetzt noch bleibt – und nur für einen kurzen Augenblick, auch das weiß sie –, ist der schmale Streifen Helligkeit, der durch den Türspalt ins Zimmer fällt.
»Leg dich hin.«
Ursula tut, was er sagt, und rollt sich zitternd unter der Decke zusammen. Sie versucht, sich die Gebete ins Gedächtnis zu rufen, die sie immer mit ihrer Mutter gesprochen hat, das klappt nur, wenn sie Angst hat, schreckliche Angst, so wie jetzt. Angst vor dem, was ihr bevorsteht. »Bitte, Papa, ich tus nie wieder!«
Schluchzend sieht sie das ernste Gesicht ihres Vaters über sich, beleuchtet von der Flamme des Feuerzeugs, das auf- und zuspringt, die gerunzelte Stirn, die dünnen angespannten Lippen, die ganze hochgewachsene schlanke Gestalt mit den blank polierten Schuhen, deren Schwarz jetzt stumpf und glanzlos ist. Doch in ihre salzigen Tränen mischt sich ein bitterer Geschmack, der die wütende Auflehnung vorwegnimmt und sie noch heftiger zittern lässt.
Auf einmal sind andere Schritte zu hören, sie kommen aus der Küche, und dann zeichnet sich die Silhouette der Köchin im erleuchteten Türspalt ab. Ihr Gesicht kann Ursula nicht sehen, aber sie hört ihren keuchenden Atem und presst die Augen zu. Bestimmt lächelt sie. Doch als Ursula die Augen wieder aufmacht, ist da bloß noch ein Schatten, der sich umdreht und davongeht. Ursula bebt vor Angst und Wut. Ihr Vater, der an diesem sonnigen Nachmittag noch am Leben ist, zieht den Schlüssel aus dem Schloss und hält dann einen Augenblick inne, als würde er überlegen – vielleicht vergibt er ihr ja doch, sagt sich Ursula mit verzweifelter Hoffnung, vielleicht macht er das Fenster wieder auf, sodass das Licht hereinkann, und sie darf wieder aufstehen. Ja, sie spürt, dass er zögert, Papa ist gut, und sie hasst ihn nicht mehr, sie hat bloß noch ein bisschen Angst vor ihm, weil er so groß und schlank ist, der größte und schlankeste Mann auf der Welt.
»Deine Strafe dauert einen Tag, Ursula, einen Tag ohne Essen und Licht. Die Dunkelheit macht dich stark, und das Fasten reinigt deinen Körper.«
Leise schaben die Sohlen über den Boden, und im Licht des Feuerzeugs leuchten die stahlharten Augen auf.
»Alicia bringt dir heute Abend etwas zu trinken und geht mit dir ins Bad. Wir beiden sehen uns morgen früh um acht wieder. Morgen um acht ist deine Strafzeit zu Ende.«
Der Vater schließt die Tür, und das letzte bisschen Sonne dieses Tages ist verschwunden. Ursula hört, wie sich der Schlüssel zweimal im Schloss dreht. Sie rollt sich noch enger im Bett zusammen, macht sich ganz klein, presst das tränennasse Gesicht ins Kissen und versucht, die Dunkelheit um sie herum auszublenden, während eine Stimme ihr zuflüstert, dass irgendwann irgendwer für ihr Weinen wird bezahlen müssen.
3
Kaum irgendwo herrscht eine so dichte Atmosphäre wie im Gefängnis, kaum irgendwo befällt einen eine vergleichbare Mischung aus Herzrasen und Klaustrophobie, kein Wunder, dass dieser Ort im Häftlingsjargon auch als Grab bezeichnet wird. Schmutzige, von den unterschiedlichsten Gerüchen erfüllte Gänge und düster gähnende Gemeinschaftsräume, deren einziges Mobiliar in ein paar schiefen Stühlen, wackligen Tischen und Bildern von nackten Frauen besteht, die mit Reißzwecken an den bröckelnden Wänden befestigt sind, alles getaucht in durchdringende, klebrige Feuchtigkeit.
Und dann erst die Insassen. Manche kommen daher wie menschliche Tschernobyls, die mit jedem Atemzug, jedem Wort, jeder Handlung ein unsichtbares, tödliches Gift verströmen. Beim Anblick dieses bis ins Mark verdorbenen Ricardo etwa möchte Germán jedes Mal am liebsten schlagartig die Flucht ergreifen. Gerade schlurft er wieder durch den leeren Gang auf ihn zu, Germán sieht sich verzweifelt um, aber er weiß, es gibt keinen Ausweg. Er spürt, wie die Übelkeit in ihm aufsteigt, Schwindel befällt ihn, manchmal wird er bei solchen Gelegenheiten ohnmächtig, das Letzte, was ihm in der Gegenwart dieses Typen passieren darf.
Ricardo – Spitzname »el Roto«, »der Kaputte« – lächelt ihn an und lässt den Kaugummi, auf dem er herumbeißt, zwischen den Zähnen hervorsehen. Bei Germán angekommen, umkreist er ihn einmal mit wiegendem Oberkörper, fast wie ein Boxer, der seinen Gegner umtänzelt, um dann die Hemdsärmel hochzukrempeln und seine Tätowierungen zu präsentieren, diverse Namen, Totenschädel mit glänzenden Augen, Blutstropfen, die scheinbar an ihm hinunterlaufen.
Roto hat die unangenehme Gewohnheit, seinem Gegenüber beim Sprechen den Mund fast aufs Ohr zu pressen.
»Du hast ganz schön Dusel, Cosita«, flüstert er kauend, und der Sabber läuft ihm aus dem Mund, »bis jetzt hast du hier echt Dusel gehabt.«
Germán bewegt den Kopf ein winziges Stück zur Seite, gerade so viel, dass er den Würgreiz unterdrücken kann. El Roto riecht nach fauligem Wasser, Schweiß und ungewaschenem Geschlechtsteil. Mit angehaltenem Atem erwidert Germán: »Ja, Roto. Und das hab ich dir zu verdanken.«
Roto spuckt den Kaugummi auf seine ausgebreitete Handfläche und betrachtet ihn, auch als er weiterspricht – er spricht zu dem Kaugummi: »Ich hab dir ja erklärt, wie das mit dem Zellenboss läuft, er ist für alles zuständig, was mit Geld zu tun hat, er sammelt von jedem die Miete ein, kauft den Stoff und verteilt ihn auch.«
»Ich hab ihm alles gegeben, was sie mir gelassen haben, die ganze Kohle ist an ihn gegangen.«
Roto ergreift den Kaugummi jetzt mit zwei seiner blutwurstdicken Finger und drückt ihn ans Fenster, presst so lange mit dem Daumen dagegen, bis er sich in eine hauchdünne, annähernd kreisrunde Scheibe verwandelt hat. »So gehört sichs auch, Cosita.«
»Ja, Roto, na klar.«
»Eins musst du außerdem wissen, schließlich bist du noch neu hier: Du kannst von Glück sagen, dass dein Boss den Caramelero fickt. Aber Vorsicht, ewig geht der Spaß mit dem Caramelero nicht, und du bist eben der Neue.« Roto sieht zur Decke, kräuselt die Lippen, saugt Luft ein, tut, als steckte ihm etwas zwischen den Zähnen, fährt mit der Zunge im Mund herum.
Germán gibt sich geschlagen, wie immer. »Also wenn du mir da helfen kannst, wär ich echt dankbar …«
»Mit einem Dankeschön erreichst du hier nichts, Cosita. Ich habs dir ja gesagt, so viel Dusel gibts nicht für umsonst, da musst du schon was springen lassen.« Kopfschüttelnd greift Roto sich in die Hosentasche, zieht eine Zigarette hervor, steckt sie sich zwischen die Lippen, zündet sie an und schüttelt die ganze Zeit weiter den Kopf. »Da muss schon was für mich rausspringen, Cosita.«
»Ich hab aber kein Geld, das hab ich alles ihm gegeben …«
»Verarsch mich nicht. Hier drin gibts nichts für umsonst, das weißt du genau.«
Germán verzieht erschrocken das Gesicht. »Ich sag ja nicht …«
»Willst du dich aufspielen, Milchbart? Meinst du, dein Arsch interessiert mich?« Er schreit fast, spuckt ihm ins Ohr. »Wichser, wenn ich will, bums ich dich jetzt sofort hier auf’m Klo.«
Germán versucht, ihn zu beruhigen. »Ich mein doch bloß …«
»Du regst mich echt auf, Schwachkopf!«
»Was soll ich denn tun? Sags mir, bitte.«
El Roto sieht ihn mit blutunterlaufenen Augen und mahlenden Kiefern an, als wäre er ein Pitbull, bereit, sich im nächsten Augenblick auf Germán zu stürzen.
Dann verzieht sich sein Gesicht plötzlich zu einem Lächeln, und er fasst Germán sanft am Arm. Dem verschwimmt vor Angst die Sicht.
»Und, war der Anwalt gut, den ich dir besorgt hab?«
Mühsam holt Germán Luft. »Ja, ja.«
»Erzähl doch mal.«
»Ich hab mich schon zweimal mit ihm unterhalten, und …«