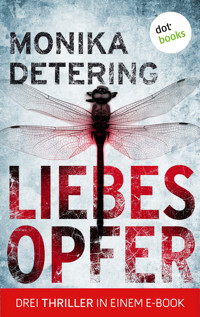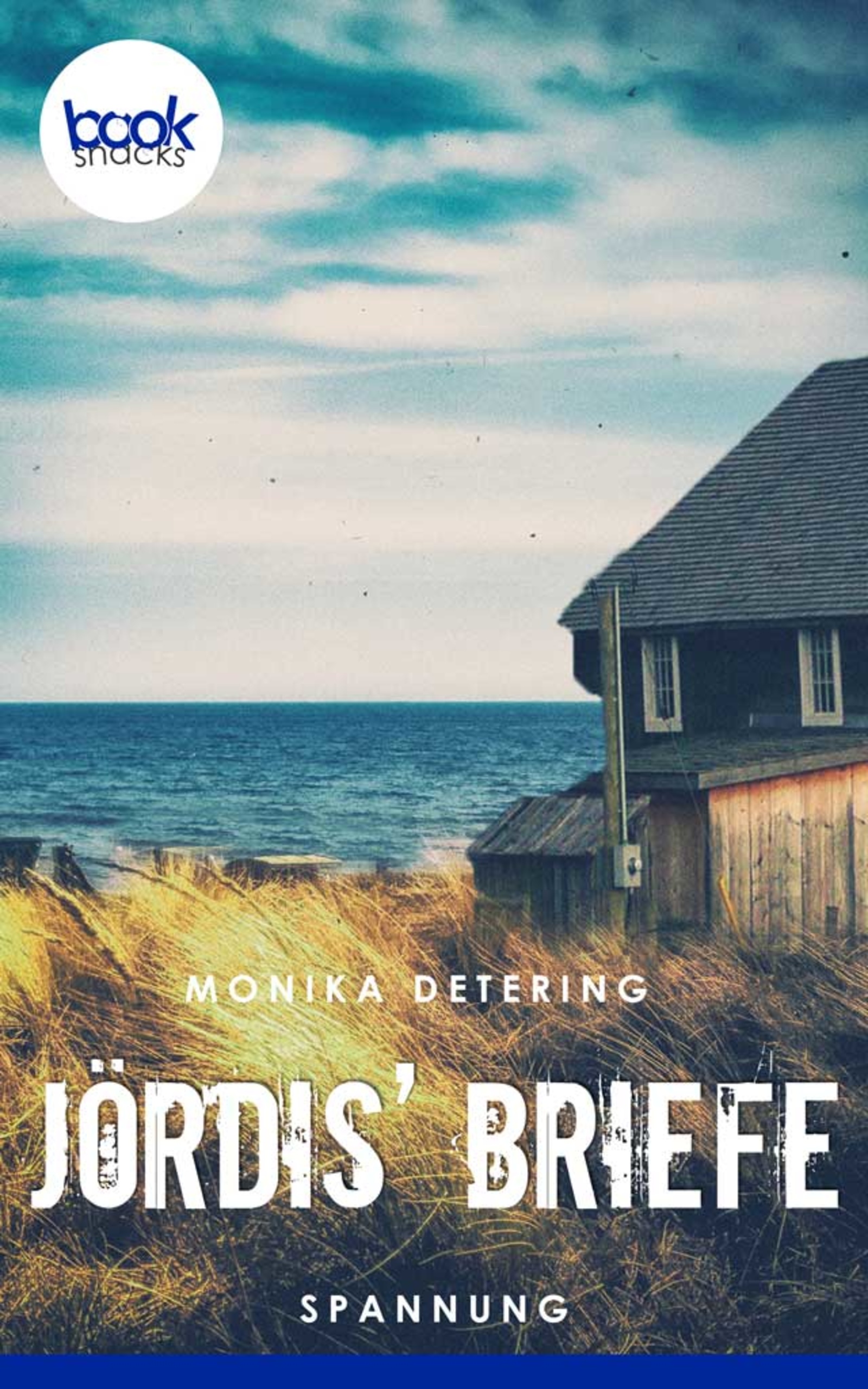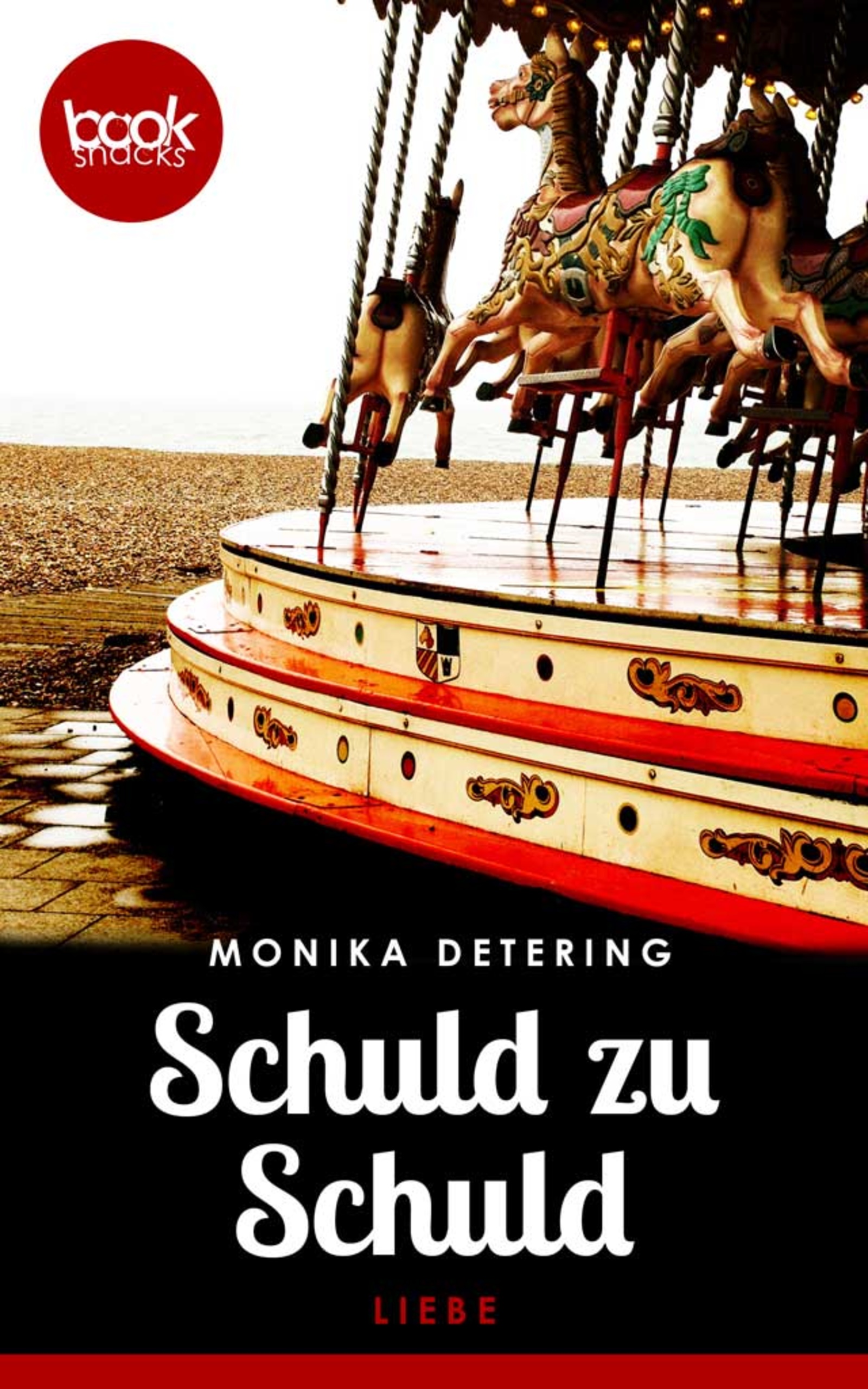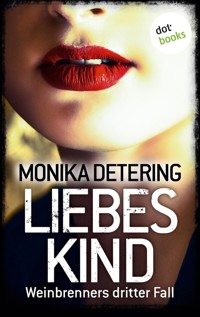Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Und für die Nachtclubsängerin habe ich mir die Dietrich geholt", sagt Billy Wilder. "Wen? Marlene Dietrich?", staunte Alfred. "Die spielt mit?" Ganz sicher. Und da staunt nicht nur Alfred Poggel. Es ist die Zeit aufkeimender Träume und gewiefter Verbrecher. In 17 Kriminalerzählungen beschreiben die Autoren Monika Detering und Horst-Dieter Radke, wie wie es gewesen sein könnte im Ruhrpott der 1950er Jahre, aber auch an der Nordseeküste, im zerbombten Berlin und im Rheinland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kuhlen, Kohlen und Geklimper
Puff & Poggel ermitteln
Kurzkrimis
von
Monika Detering
und
Horst-Dieter Radke
Anna, Ruinen und der Junge im Matrosenanzug
1947
Sie bückte sich. Das musste sie, trotz ihrer knappen einsachtundfünfzig. Der Eingang zur Ruinenbehausung in der Mülheimer Altstadt war besonders niedrig. Denn über der Tür hatten die Wehners sich eine Art »Zwischenstock« gebaut und jeden Tag dachte Anna, Gottogott, hoffentlich kommt das ganze Gedöns nicht runter, wie kann das bloß halten.
Aber es hielt. Die Wehnerschen Hölzer machten eben nur um einen Kopf kürzer. Sozusagen. Genau wie viele andere hatten auch sie Linden abgeholzt, der eisige Winter hatte zu Dingen gezwungen, an die Anna an diesem Sonntag in April 1947 nicht denken mochte, die sie am liebsten vergessen hätte. Aber man vergaß nicht so leicht.
Dieser Raum, den sie im letzten Herbst gefunden hatte, besaß sogar ein Fenster mit Glas. Auch wenn das Licht sich einen Weg suchen musste, um in diese ehemalige Souterrain-Wohnung zu gelangen. Aber das Zimmer war inzwischen nach dem grausamen Winter eisfrei – ebenso wie die Wände. Wenn sie auch noch sehr kalt waren, aber der Frost zog heraus. Muss man ja froh sein, dachte sie und ging die vier bröckelnden Stufen hoch ins Freie. In den Hof. Luft! Licht! Denn ihre »Wohnung« war dämmrig und still.
Wenn nur der Hunger nicht wäre. Heute früh gab es mit Sägemehl gestrecktes Graubrot und Brennnesseltee. Das musste sich ändern. Besaß sie doch kostbare Schätze. Jene aus Hamburg. Zwei Ringe, eine Kette, eine Uhr und das Bild mit dem Jungen im Matrosenanzug. Und andere Kleinigkeiten. Hamburg. Ach ja, seufzte sie … Hamburg …
***
Anna blickte über den Hinterhof. Löwenzahn hatte sich durch Schutt und Steine gequält und leuchtete. Niemand war zu sehen. Waren alle unterwegs, wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt.
Muss ich auch, unbedingt. Mit den Lebensmittelkarten reicht es nie. Und die Arbeit als Kontoristin bringt auch nicht viel Lohn. 47 Reichsmark die Woche. Aber ein Pfund Zucker kostete, wenn die Lebensmittelkarte für den Monat aufgebraucht war, 80 Reichsmark. Und meine ist aufgebraucht, das meiste gab’s ja überhaupt nicht. Was nützt einem dann so eine graue Karte? Vielleicht treffe ich da den Langen, diesen Heinz. Der hat mir letztens was zugesteckt. Ein bisschen Kaffee, gestreckt natürlich, aber immerhin, einfach so. Angeplinkert hat er mich. Wer macht denn so was in diesen Zeiten. Ob er eine Wolldecke hat? Im Tausch gegen das Brillengestell aus Horn? Ich hab noch eins aus Hamburg.
Die Sonne schien an diesem Vormittag, wärmte den Kopf und den Rücken, während Annas Füße elendig kalt waren, noch steckte der Frost im Boden.
Ob’s in Hamburg jetzt besser ist? Anna Puff dachte wieder an die Stadt an der Elbe und an jene irrwitzige Zeit.
***
'43 wurde sie in Mülheim ausgebombt, damals wohnten sie am Kirchenhügel. Und anstatt dass Hugo, ihr Mann, während des Angriffs ins nächste Haus mit dem größeren und stabileren Keller gerannt war, was Anna instinktiv getan hatte – war er geblieben. Urlaub hatte er gehabt. Urlaub. Und dann traf diese Bombe das Haus während jenes verheerenden Angriffs in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1943. 530 Menschen verloren in Mülheim ihr Leben. Einer von ihnen war Hugo Puff.
Wenige Tage nach dem Angriff packte sie ihre Habseligkeiten in einen großen Stoffrucksack, den sie im Schutt gefunden hatte. Welch ein Glück! Wer wusste nach solch einer Nacht schon, wem was gehörte? Ihre Wohnung gab es nicht mehr. Das Haus war nur noch eine geschwärzte Wand, Rohre zitterten anklagend im Wind, Tapeten erzählten von der Vergangenheit und ein Kronleuchter baumelte an einem Stück Decke. Starr und versteinert ging sie in Richtung Bahnhof und stieg in einen der Züge. Sogar einen Sitzplatz ergatterte sie. Aber nur, weil der Zug erst Stunden später abfuhr. Müdigkeit war wie eine ansteckende Krankheit in ihre Knochen gekrochen, und saß in jeder Zelle. Sie schlief sofort ein und wurde irgendwann durch einen unangenehmen Geruch wach. Vor und neben ihr drängten sich Menschen, dünsteten Schmutz, Schweiß und Angst aus. Dann hieß es, alle aussteigen. Auf freier Strecke mussten sie warten. Anna war es so egal gewesen, wo sie landen würde, es war ja alles verloren, Hunger und Angst hatte sie, außerdem die paar Sachen in dem Rucksack, sogar feste Schuhe und ihren Wintermantel, in dem es an jenem Junitag viel zu warm wurde, aber es war ein gutes Vorkriegsstück und sah nicht ärmlich aus.
Nach endlosem Halten und wieder Anfahren, dem Ruf des Lokführers: »Kohle ist alle, warte auf Nachschub«, der dann irgendwie herangeschafft wurde, hielt der Zug endgültig in Hamburg. Aussteigen galt für alle. Und hier sah es sehr viel düsterer, trostloser und dunkler als in Mülheim aus. Kein Wunder, hier fielen doch mindestens so viele Bomben wie im Ruhrgebiet.
Anna war schlank, fast mager, wie so viele in diesen Jahren. In ihrem Kopf drehte es sich. Der Magen krampfte sich zusammen und signalisierte Übelkeit. Sie schwitzte und der Rucksack wurde schwer. Sie fragte vorm Hauptbahnhof, wo sie Arbeit, ein Zimmer und was zu essen bekommen könnte. Antwort bekam sie keine. Die Leute hasteten vorbei. Als sie weitergehen wollte, kippte sie um, noch ehe sie überhaupt etwas von der Stadt gesehen hatte. Sie wusste noch genau, wie die helle, zwitschernde Stimme sich angehört hatte.
»Konstantin, heb sie mit auf, wir bringen sie in den Wagen. Kann nicht so liegen bleiben«, und die Stimme setzte ein leichtes Lachen hinterher.
So kam sie nach Blankenese, in die Villa der Sängerin Friederike Meerwald. Ein Haus, dessen einstiger Glanz verloren gegangen war, in dem seit 1943 unendlich viele Leute wohnten. Die Bauchtänzerin, der Drucker, ein Maler samt Gefährtin und viele mehr. Friederike, die Elegante, bot Anna Arbeit als Kindermädchen für den siebenjährigen Albert und die sechsjährige Ingrid an. Anna bekam ein Zimmer, ein kleines, aber für sich allein. Es waren das Chaos des Krieges, das Chaos der Verlorenheit und der gierige Hunger nach Leben, die sie alle zusammenhielten. Friederike war oft unterwegs, sang vor den Truppen und brachte, wenn sie wieder zurück war, unglaubliche Schätze wie Kaffee, Butter, Zigaretten und Süßes für die Kinder mit. Deutsche Offiziere gingen bei ihr ein und aus. Es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert, getrunken, gelacht, während Anna die Kinder immer wieder in den Schlaf sang.
Aber dann kam der Tag, an dem die Kinder nach Süddeutschland mussten. Man nannte das »Kinderlandverschickung«. Friederike Meerwald war erleichtert darüber, denn in Hamburg war niemand mehr sicher. Wenn auch die Viertel wie Blankenese weitgehend verschont blieben. Aber das konnte niemand vorher wissen.
Als Friederike die Nachricht erhielt, dass ihr Mann gefallen war, verschwand sie. Aber - Annas Lohn stand seit zwei Jahren aus. Deshalb, nur deshalb bediente sie sich. Rechnete nach, was das eine oder andere Stück wert war. Besonders auf dem Schwarzmarkt. Alle im Haus bedienten sich. Möbel, Teppiche, Bücher und anderes verschwanden, gingen unter im Nirgendwo. Weil Anna die Kinder vermisste, nahm sie auch das Portrait des kleinen Jungen mit, Albert in der dunkelblauen Matrosenuniform. Zur Erinnerung. Zum Aufbewahren. Vielleicht kann ich es ihm einmal wiedergeben, hieß ihre Entschuldigung. Wenn die Zeiten besser geworden sind. Wenn Friederike die Kinder zurückholt. Wenn.
Anna ging. Schlug sich durch nach Mülheim. Die Stadt hatte sie immer als ihre Heimat angesehen, obwohl sie dort nicht geboren war und auch ihre Kindheit in einer anderen Gegend verbracht hatte.
Anfang ’46 hatte sie Glück, traf auf eine ehemalige Kollegin, die ihr vorübergehend einen Schlafplatz in ihrer winzigen Wohnung anbot. So lange, bis deren Mann zurückkam. Danach wurde es schwierig. In Mülheim gab es keine freien Wohnungen. Deshalb schätzte sie sich fast glücklich, als sie diesen Raum in dieser Ruine fand und besetzen konnte. Niemand war da, der darauf Anspruch erhob. Das war vor dem Wintereinbruch gewesen. Dass dieser so entsetzlich, so grausam werden würde …
Glück hieß auch, dass sie auf der Hütte - im Büro - Arbeit bekam. Abends suchte sie in den Trümmern nach Brauchbarem. Ein Bettgestell, Holz … manches fand sich. Kleidung und Schuhe tauschte sie gegen Friederikes Ring.
Und jetzt saß sie im Hinterhof »ihrer« Ruine und genoss die Wärme der Sonne.
Hunger, giftete es in ihr. Also schob sich Anna zurück in ihre winzige Behausung, steckte einiges zum Tauschen ein, dachte für einen Moment an das Bild mit dem kleinen Jungen, das verpackt, in einem gefundenen Koffer unter ihrem Bett lag. Das bleibt, entschied sie einmal wieder, ich werd’s dem Albert zurückgeben.
***
Sie machte sich auf den Weg ins Schwarzmarktgebiet. Flüstern, Tuscheln, schnelles Auf- und Zuschlagen von Mänteln oder Jacken, Anna murmelte »Butter, Kaffee und Wurst«, zeigte kurz eine Kette hinterher. »Echt Gold, mit Brilli.«
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. Kontrolle? Alles hinwerfen? Nie im Leben. Da musste sie sich anders draus retten. Empört drehte sie sich um. Wollte lauthals schimpfen, so etwas wirkte manchmal.
»Frau Puff, kommen Se mal mit mir, lassen Se den Mantel zu, gehn Se mal vor bis zum Ende der Straße …«
Ach. Dieser Heinz, der Lennewegs. Dürrer Schlacks. Immer nett. Immer hilfsbereit. Muss er mich so erschrecken?
Hinten, an der Ecke, blieb sie stehen. »Was ist?«, fragte sie kess.
»Schöne Augen haben Sie, so etwas sehe ich zu selten …«
»Quatschen Sie mich nicht zu«, sagte sie. »Das haben schon andere gesagt.«
»Nun behalten Sie mal für heute Ihre Brillis und was Sie da sonst noch haben. Können wir uns später drüber unterhalten.«
»Warum dat denn?« Anna Finger umkrampften in der Manteltasche die Kostbarkeiten.
»Ich möchte Sie nach Hause bringen.«
Anna schüttelte den Kopf. »Ich hab Hunger!«
»Ich auch. Deswegen ja.« Er lachte. Es war so ein leichtes, übermütiges und durchtriebenes Schieberlachen.
»Wie – Sie wollen bei mir essen? Hab doch nix. Deshalb bin ich ja hier. Verstehnse dat nicht?«
»Haben Se Kohle zu Hause?«, fragte Heinz.
Anna nickte.
»Gut, sehr gut. Ich geh mit, Sie machen Ihren Ofen an und ich komme – dauert so ein Stündchen – mit was Gutem und wir essen gemeinsam?« Zur Bekräftigung seiner Absicht zog er aus dem Rucksack ein Schwarzbrot und gab es ihr. »Schon mal vorab!«
Während sie sich der Ruine näherten, biss Anna in das Brot, kaute und dachte: Der kommt nie wieder, was soll’s. Hab ich wenigstens für umsonst was zu essen.
***
Er kam wieder. Wenn auch erst nach drei Stunden. Heinz Lennewegs kam mit Kartoffeln und fettem Speck, mit zwei Zwiebeln, mit Brot, Schokolade und Nivea-Creme.
Natürlich aßen sie zusammen und teilten. Diese Bratkartoffeln waren so köstlich, dass es Anna danach übel wurde. Das war sie nicht mehr gewöhnt, so reichhaltig zu essen. Und als Heinz noch sagte, nachdem sie mit Brennnesseltee ausgiebig Brüderschaft getrunken hatten, »Du musst hier raus, ist ja nur ein Loch und das Stinkehäuschen da hinten – nix für eine Frau wie dich. Ich besorg dir was«, dachte sie an eine schöne warme Märchenstunde. Wann hatte zuletzt jemand so fürsorglich mit ihr geredet?
Heinz blieb. Ihn störten in dieser Nacht die Enge des Zimmers und die Enge des Bettes nicht. Und Anna war endlich einmal wieder warm geworden, sie fror nicht wie in den vielen Nächten zuvor. Früh standen sie auf, ohne jegliche Verlegenheiten. Es war ihnen gut gegangen und ihre Gesichter wirkten entspannt. Heinz begleitete Anna zur Arbeit. Wieder sah der Himmel so aus, als würde den ganzen Tag die Sonne scheinen. Drosseln zwitscherten spöttisch aus ihrem Nest, oben in der süß duftenden blühenden Linde. Der Weg führte über zersprungene Fliesen, Geröll, über Steine, die noch gut zu gebrauchen waren.
Wie jeden Morgen ging Anna in den Toilettenraum der Hütte und wusch sich. Hier lag stets Kernseife und ihr Chef drückte beide Augen zu, denn außer ihr wusch sich auch Henriette, ihre Kollegin, vor der Arbeit.
Anna cremte sich ihr Gesicht ein, die rauen Hände. Duftende Nivea-Creme – danke Heinz! Sie steckte ihr Haar auf, rieb sich die Wangen rot und ging erfrischt an ihren kleinen Schreibtisch, vor die alte, viel genutzte Mercedes-Schreibmaschine.
***
Eine Woche später holte Heinz sie ab. Er lachte haltlosen Übermut heraus und steckte Anna damit an. Und dann flüsterte er ihr ins Ohr: »Ich habe eine Wohnung für dich. Wirklich. Kannste gleich einziehen. Kannste auch bezahlen. Ich regle das. Vertrau mir.«
Vor einem unversehrten Haus in der Schloßstraße blieb Heinz stehen. »Hier!«, sagte er. »Lass mich reden, sag erst mal nix.« Er klingelte bei »Schreiber« und es dauerte, bis die Haustür geöffnet wurde. Eine ältere Frau guckte die beiden misstrauisch an, suchte in ihrer Schürzentasche, zog eine Brille hervor, setzte sie auf und strahlte. »Ach. Hätt Sie fast nicht erkannt. Herr Lennewegs, wegen der Wohnung? Und das ist Ihre Frau?«
»Meine Verlobte, die Anna Puff.« Dabei stieß er Anna warnend in die Seite.
»Wollen Se ne Familie gründen, wird ja bald alles besser, näch? Und so still, so zurückhaltend die Dame, haben Sie Arbeit? Ach, kennen wir uns nicht? Is ja man auch egal.«
Anna nickte. Sie war viel zu verblüfft, um noch irgendetwas zu sagen.
»Ich geh mal vor!« Frau Schreiber schloss mit dem Schlüssel auf, der in der Tür steckte. »Hamse Möbel? Platz ist genügend da - auch für viele Kinderchen. Ja, wissen Se, der Herr Lennewegs hat mir so viel besorgt, hat mir sehr geholfen. Und die Wohnung ist frei, muss renoviert werden, die Leute sind halt fort, zurück nach Hamburg.«
Bei »Hamburg« zuckte Anna zusammen.
Die Wohnung war riesig. Anna wagte nicht zu fragen, wie hoch die Miete sein würde. Sie sah das große Bad. Mit Boiler. Die große Küche, Vorratskammer und so viele Zimmer. Das ist meine Wohnung! Sie wollte sie, musste sie haben, egal, wie.
»Und wenn’s nun so schnell keine Kinder gibt, Frau Schreiber, da könnten wir doch untervermieten. Ich meine, bis dahin?« Anna wurde sogar rot, was ihr gut stand. Jedenfalls fand dies Heinz Lennewegs.
»Das geht schon. Machen wir einen Vertrag. Herr Lennewegs hat schon angezahlt, mit Kaffee, mit Kakao, mit Reichsmark. Ich werde weggehen, ich ziehe zu meiner Tochter ins Lippsche. Aufs Land.«
***
Eine Woche nach diesem Treffen zog Anna ein. Zu später Stunde. Weil sie sich schämte, nur so wenig Sachen zu haben. Heinz aber hatte ein großes Bett organisiert, mit Matratze, mit Bettzeug, er kam mit Handtüchern und Bettwäsche und verbot Anna zu fragen, woher.
Aber das Bild mit dem kleinen Matrosen-Albert versteckte sie gut. Und erzählte nichts darüber. Das war etwas Persönliches, das quälte sie und oft fragte sie sich, was wohl aus den Geschwistern geworden war. Ob sie noch lebten? Und Friederike? Bestimmt waren alle irgendwo verstreut – und doch, wieder einmal schwor sich Anna, dieses Bild nicht zu verhökern, sondern es einmal dem Albert zurückzugeben.
Dass sie sich Tränen aus den Augen wischte, sah Heinz. Aber er dachte, vor Glück und vor Freude. Deshalb nahm er sie in die Arme und küsste sie. Ganz vorsichtig. Sehr liebevoll.
So windig er und seine Geschäfte auch waren, er schwor sich, bei Anna zu bleiben.
Offiziell hatte Heinz Lennewegs eine winzige Wohnung in der Thusneldastraße, die er behalten wollte. Und da er nicht jeden Tag und nicht jede Nacht bei Anna war, vertrugen sie sich bestens.
Frau Schreiber zog aus, übergab vorher Anna das Amt der Hausmeisterin. War so großzügig, von vornherein die Miete herunterzusetzen. »Dann gibt’s kein Gejackere mit dem Bezahlen. Ich denke, so isses gut und Sie können den Herrn Lennewegs heiraten. Wenn wat Kleines unterwegs ist, schreiben se mir.«
Sie heirateten nicht. Und ein Kind war auch nicht unterwegs. Dafür besorgte Heinz Anna eine Menge – Möbel für die Zimmer – und aus der Kontoristin und Ruinenbewohnerin Anna Puff wurde eine erfolgreiche Zimmervermieterin. Bis Ende ’49 arbeitete sie auf der Hütte. Dann sagte Heinz, sie müsse ihm helfen, beim Verpacken seiner Waren und überhaupt …
Ja. Es hätte alles so gut gehen können, wenn nicht Heinz nur ein Jahr später zu übermütig geworden wäre …
Monika Detering
Black Market
Juli 1947
Er kannte das von Mülheim. Zerbombte Häuser und völlig zerstörte Straßenzüge. Aber so hatte er das noch nie erlebt. Ganze Viertel waren nur noch Ruinen. Wie lange ging er schon durch den Ostsektor? Es kam ihm wie Stunden vor. Bald müsste doch das Brandenburger Tor zu sehen sein? Ein Schatten huschte über die Straße, flackerte an den Häuserwänden entlang. Er sah hoch und erkannte ein Flugzeug, war versucht, sich in einen Hauseingang zu flüchten. Dann riss er sich zusammen. Der Krieg ist vorbei! versicherte er sich. Keine Bomben mehr, schon länger als zwei Jahre. Aber die verfluchte Angst saß noch tief drinnen. Mit zitternden Händen holte er die Zigarettenschachtel aus der Jackentasche, ließ sie aber gleich wieder darin verschwinden. Er rauchte nicht – schon lange nicht mehr. Aber es war beruhigend, eine Schachtel dabeizuhaben. Für alle Fälle. Man wusste ja nie.
Verfluchter Auftrag. Das musste ein Ende haben. Er hätte sich nicht darauf einlassen sollen. Vermutlich sind die längst über alle Berge – oder tot. Andernfalls hätten sie sich doch sicher gemeldet? Die hätten sonst längst auf der Matte gestanden, zumindest Klothilde. Wie früher. Ihr Helmut kam nicht immer mit, der war ein hohes Tier bei der Wehrmacht und deshalb oft genug unabkömmlich. In der ganzen Familie war Tante Klothilde nicht gut angesehen, aber sie war immerhin Mutters Halbschwester und deshalb hieß es: Alfred, du fährst jetzt nach Berlin und siehst nach ihr.
Das ließ sich leichter sagen als durchführen. Die Adresse verlief ins Nichts. Ging unter in einem dieser Straßenzüge, die wie Schweizer Käse aussahen, in denen allenfalls noch Ratten hausten, hier und dort jemand aus einer Mauerlücke schaute, mit dem man besser nicht auf kurze Distanz Bekanntschaft schließen wollte. Die waren so was von ausgebombt, dass man nicht mal mehr eine Porzellanscherbe von ihrem edlen Service finden konnte. Bestimmt waren sie über alle Berge. Mussten sie ja. Helmut hätte den Nazi nicht verleugnen können. Alfred spuckte aus. Konnte er Tante Klothilde schon nicht leiden, dann ihren Helmut erst recht nicht. Gehasst hatte er ihn. Wie der immer aufgetreten war, von jüdischer Weltverschwörung geiferte und dass der Adolf denen jetzt zeige, was eine Harke sei. Bereichert hatten die beiden sich, denunziert, wo es nur ging. Wenn Helmut sich nicht abgesetzt hat, dann haben sie den am Wickel, und seine Klothilde auch. Recht wär’s ja, dachte Alfred. Aber vermutlich sind die über ihre Seilschaften längst im Ausland untergetaucht.
»Mir auch lieber«, sagte er halblaut vor sich hin. »Dann muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich die anzeige oder nicht.«
»Hasse ma ’ne Zichte für mir?«
Alfred sah den Mann, der da plötzlich neben ihm ging, überrascht an. Wie aus dem Zille-Buch geschnitten, ging ihm durch den Kopf. Er griff wieder in die Jackentasche, holte die Schachtel vor und klopfte zwei Zigaretten heraus. Hielt sie ihm hin. Der Mann griff erfreut zu.
»Danke, Kumpel. Gleich zwee? Ham wa ooch nich alle Tage.«
»Sag mal«, fragte Alfred, »geht’s hier in Richtung Brandenburger Tor?«
»Nee, da sind Se janz falsch geloofen, wa? Komm’ Se mit, icke zeig Ihnen, wo Se lang marschieren müssen.«
Zwanzig Minuten später sah Alfred das Tor zwischen den Trümmern auftauchen. Der Mann griff an seine Schiebermütze, grüßte kurz und verschwand in einer Seitengasse. Beim Näherkommen entdeckte Alfred eine Menschenansammlung vor dem Tor. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Schwarzmarkt? Er wollte vorbei, aber es ging nicht. Wie von einem Magnet gezogen, spurte er auf den Schwarzmarkt zu. Er sah schnell: Es gab das Übliche, so wie sie es auch in Mülheim hatten. Der eine schob den rechten Ärmel hoch und zeigte mehrere Armbanduhren, ein anderer klappte den Mantel auf und hatte diverse Würste in den Taschen stecken, wieder einer bot über den Arm gelegt Nylonstrümpfe an. Wem soll ich die auch mitbringen?, dachte er sehnsüchtig. Eine Freundin hatte er leider nicht. Vor dem Krieg war das noch anders gewesen – aber jetzt? Es fiel ihm auf, dass auf dem Schwarzmarkt viele Amerikaner aktiv waren. Plötzlich klappte einer eine Pappkiste auf. Alfred bekam große Augen. Er konnte nicht mehr an sich halten.
»Das ist ja eine Schokoladentorte!«, rief er und beugte sich über die Kiste. Der Mann, dem diese Köstlichkeit gehörte, ließ sie den beiden Leuten, die Hausrat im Angebot hatten, zog ihnen die Matratze unter allem weg und machte sich davon. Der Kasten wurde zugeklappt. Alfred überlegte, ob er für ein Stück von der Torte etwas bieten sollte.
»Okay. Die Szene ist im Kasten. Wir machen für heute Schluss.«
Plötzlich gingen alle auseinander. Nach kaum einer halben Minute stand Alfred alleine da und sah sich erstaunt um. Einige Menschen, die ein paar Meter entfernt standen, lachten. Plötzlich wurde sich Alfred der Szenerie bewusst und errötete. Direkt vor ihm stand sie auf einem hölzernen, dreibeinigen Stativ: die Kamera. Die haben hier einen Film gedreht? Und ich Schussel habe denen alles vermasselt. Jetzt gibt’s Ärger.
Es kam nämlich jemand auf ihn zu. Ein Typ etwa in seinem Alter, aber in amerikanischer Armeeuniform.
»Es tut mir … äh … leid …«, stotterte Alfred. »Ich habe Ihnen wohl die Szene versaut?«
»Nein, guter Mann, ganz und gar nicht.« Der Wiener Akzent war unüberhörbar. »Das war zwar nicht geplant, aber es passt ganz wunderbar. Als hätte ich es selbst ins Drehbuch geschrieben. Die Szene bleibt, wie sie ist, und Sie können sich später im Kino sehen.«
»Ich kann … was?«
»Aber Honorar gibt’s nicht. Das hätten Sie vorher mit mir aushandeln müssen.«
»Aber nein … aber nein … ich werde doch nicht …« Alfred war das Stottern immer noch nicht los.
»Überhaupt ist auch noch nicht sicher, ob man den Film, den wir hier drehen, in den nächsten Jahren in Deutschland überhaupt sehen will.«
»Wer spielt denn mit?«, fragte Alfred, dessen Neugierde inzwischen das Stottern überwunden hatte. Ins Kino war er immer schon gern gegangen.
»Ich habe die Jean Arthur wieder aus der Reserve geholt«, sagte der Mann und schmunzelte. »Der John Lund wird mir den Captain Pringels machen. Das war übrigens der, der eben mit der Matratze weggegangen ist.«
Alfred sah sich um, entdeckte den Mann aber nicht.
»Und für die Nachtclubsängerin habe ich mir die Dietrich geholt.«
»Wen? Marlene Dietrich?«, staunte Alfred. »»Die spielt mit?«
Der Mann nickte und zeigte ein breites Lächeln. »Genau. Die spielt und singt mit. Als Nachtclubsängerin. Als Nazischlampe. Das muss man sich mal vorstellen, wo sie doch die ganze Zeit über nichts mit diesem Gesocks zu tun hatte. Die Frau hat Größe.«
Alfred sah sich wieder um. »Ist sie hier?«
»Nein. Sie ist in Paris und kommt erst in Hollywood bei den Studioaufnahmen dazu.«
»Wär ja auch zu schön gewesen«, seufzte Alfred. Dann hielt er dem Mann die Hand hin, die dieser ergriff. »Ich heiße Poggel, Alfred Poggel.«
»Wilder«, sagte der Mann und sprach es amerikanisch aus. »Billy Wilder.«
Wieder bekam Alfred große Augen. »Wilder? Billy? Doch nicht der …?«
»Vermutlich doch!«, sagte der andere.
»… der damals den Emil mit den Detektiven gemacht hat?«
»Allerdings« lachte der Mann. »Habe ich. Zusammen mit dem Kästner habe ich das Drehbuch geschrieben. War ’ne feine Sache.«
»Einer meiner Lieblingsfilme«, gestand Alfred. »Ich weiß nicht, wie viele Male ich den schon gesehen habe.«
»Ich denke auch noch oft daran«, sagte Billy Wilder. »Durfte damals ja noch nicht Regie führen. Das hat der Lamprecht gemacht. Aber die Zusammenarbeit mit Kästner am Drehbuch war schon gut.«
»Den würde ich auch noch mal gerne kennenlernen, den Erich Kästner«, seufzte Alfred.
»Grüßen Sie ihn dann von mir. Es geht jetzt weiter. Wir müssen noch ein paar Außenaufnahmen drehen. Vor allem drüben im Ostsektor. Hat mich gefreut, Herr Poggel, und vielen Dank für den spontanen Einsatz in der Schwarzmarktszene.«
Er hob die Hand noch einmal zum Gruß, drehte sich um und verschwand. Alfred blickte ihm nach und rief: »Wie heißt er denn?«
Billy Wilder schaute zurück. »Wen meinen Sie?«
»Na, den Film. Wie heißt der Film, den ihr hier gerade dreht?«
»A Foreign Affair«, rief der Regisseur, drehte sich wieder um und ging weiter.
Kopfschüttelnd ging Alfred davon. Einmal hat sie doch etwas Gutes bewirkt, die Tante Klothilde. Jetzt bin ich nicht mehr böse, wenn ich sie noch finden sollte. Was aber vermutlich nicht passieren wird, denn ich fahre nachher mit dem Zug zurück.
Er war noch nicht weit vom Brandenburger Tor entfernt, hatte gerade die Dorotheenstraße überquert und auf der Luisenstraße die Spree noch nicht erreicht, da gab es vor ihm plötzlich einen Aufruhr. Er sah, wie eine Frau weglaufen wollte, aber von anderen festgehalten und zu Boden geworfen wurde. Man schlug auf sie ein, trat sie. Alle – nicht nur die am Boden liegende Frau – kreischten und schrien. Alfred eilte hin, griff in seine Jackentasche und fühlte ein Stück Metall – die alte Dienstmarke, die er in seinem Schreibtisch gefunden hatte. Von seinem Vorgänger oder irgendwem, nicht gültig eigentlich. Aber er holte sie hervor, rief, nein schrie: »Polizei! Auseinander!« Er fuchtelte mit der Blechmarke herum und schubste die Leute von der Frau weg, half ihr mit der anderen Hand hoch.
»Hören Sie sofort auf!«, gebot er der Menge Einhalt. »Was ist hier überhaupt los?«
»Die da«, sagte ein Mann und zeigte auf die Frau, »hat einer alten Frau die Nährmittelkarten gestohlen.«
»Umgestoßen hat sie sie«, schrie eine andere »und ihr dann die Karten weggenommen.«
»Die kenne ich. Das war früher eine Denunziantin, eine von denen, die andere angezeigt haben, um selbst gut dazustehen«, rief ein Weiterer.
»Aber damit ist jetzt Schluss«, sagte ein großer Mann und trat drohend näher. »Die Zeiten sind vorbei, jetzt ist das braune Gesocks dran, Dreck zu fressen.«
Alle rückten näher und schlossen einen Kreis um Alfred und die Frau.
»Halt!«, rief Alfred. »Zurück! Keiner rührt sie an. Wenn sie sich des Diebstahls schuldig gemacht hat, dann nehme ich sie mit. Um so etwas kümmert sich die Polizei.«
»Sie soll aber erst die Marken rausrücken«, rief jemand.
Alfred sah sich die Frau näher an, die da verschmutzt und verdreckt neben ihm stand, schwer atmend, mit Prellungen im Gesicht und einer aufgeschürften Wange. Tränen hatten Spuren im Dreck hinterlassen und Rotz lief ihr aus der Nase. Trotzdem erkannte er sie sofort. Die rechte Hand hielt verkrampft etwas fest. Alfred beugte sich ein wenig zu ihr hin und flüsterte: »Du gibst mir jetzt die Karten, Klothilde, sonst kann ich für nichts garantieren.«
Den Blick konnte sich Alfred nicht erklären. Er sah Angst darin, aber auch Hass und Wut. Sie zögerte, streckte ihm dann aber die Hand entgegen und öffnete sie. Alfred nahm ihr die zerknüllten Marken ab und glättete sie ein wenig. Fleisch, Gruppe I, dachte er, kriegen doch sonst nur Schwerarbeiter.
»Wo ist die Frau, der die Karten weggenommen wurden?«
Ein altes Mütterchen, das etwas abseits von der Gruppe gestanden hatte, humpelte heran.
»Ist sie das?«, fragte Alfred die Umstehenden.
Einige nickten, einer sagte: »Ja, das ist sie.«
Alfred hielt ihr die Marken hin. Sie nahm sie ihm aus der Hand und sah ihn dankbar an.
»Mein Sohn arbeitet schwer. Das kann er nicht mehr, wenn er nichts zu essen bekommt«, sagte sie. Dann schaute sie zu der Frau, die wie abwesend neben Alfred stand. Der Blick der Alten verhärtete sich. Sie spukte aus, drehte sich um und ging davon.
»Die nehme ich mit«, sagte Alfred und griff wieder Klothildes Arm. Sie wollte sich herauswinden, doch er hielt sie fest. »Und ihr macht, dass ihr nach Hause oder an die Arbeit kommt.«
»Brauchen Se keene Zeugen, Wachtmeester?«, fragte einer keck.
»Name?«, fragte Alfred.
»Freddie Malunke.«
»Kommen Sie morgen zur Wache und geben Sie alles zu Protokoll.«
»Zu welche Wache soll icke mir begeben?«, fragte der Mann.
»Egal, die, die für Sie am günstigsten zu erreichen ist. Sagen Sie, worum es geht, dann können Sie das Protokoll auf jeder Dienststelle aufnehmen lassen. Hinterlassen Sie dann auch Ihre Adresse, damit wir Sie als Zeugen vorladen können. Dann gibt’s vielleicht auch Zeugengeld.«
Der Mann tippte an seine Mütze und machte sich davon. Alfred ging mit Klothilde ein paar Schritte auf der Luisenstraße weiter. Dann ließ er sie los.
»Ich suche schon seit Tagen nach dir und wollte heute unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Dass ich dich unter solchen Umständen doch noch treffe, hätte ich mir ja nicht träumen lassen.«
Klothilde sagte nichts.
»Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Mutter war schon unruhig und hat sich mächtig Sorgen gemacht.«
Klothilde lachte, aber es klang eher wie eine abfällige Bemerkung. »Damit sie uns erwischen und einsperren?«
»Wenn ihr nichts ausgefressen habt, sperrt man euch auch nicht ein. Aber wenn du solche Machenschaften wie eben treibst, dann kannst du ganz schnell in Schwierigkeiten geraten.«
»Hast du mich jetzt verhaftet?«
Alfred antwortete nicht darauf, sondern fragte stattdessen: »Also, wo wohnt ihr?«
»Nirgends« sagte Klothilde und sah weg.
»Und Helmut?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ist weg, bevor die Russen kamen. Ich habe seither nichts mehr von ihm gehört.«
»Seit fünfundvierzig? Kein Lebenszeichen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Alfred traute ihm alles zu. Wird sich wohl nach Südamerika abgesetzt haben oder sonst wohin, wo sich die Altnazis versammeln. Ohne Familie kommt man natürlich besser durch.
»Und du bist allein hiergeblieben? Mit Hedwig?« Hedwig war ihre Tochter.
»Ich habe Hedwig Ende vierundvierzig nach Flensburg geschickt; Helmuts Bruder hat dort einen Hof. Da ist sie jetzt noch. Hoffe ich.«
»Du weißt es aber nicht?«
»Ich habe ihr geschrieben. Aber antworten kann sie mir nicht. Eine feste Adresse gibt es nicht. Dass Hedwig nicht hier war, als die Russen kamen, ist mein einziger Trost. Du ahnst ja nicht, was man als Frau aushalten muss.« Wieder sah sie weg.
Doch, Alfred ahnte, was ihr durch die Russen widerfahren war. Gut, dass Hedwig das nicht erleben musste. Oder? Er blickte seine Tante zweifelnd an.
»Ich nehme dich mit nach Hamm«, entschied Alfred. »Wir werden uns um dich kümmern. Von Hamm aus kannst du auch zu Hedwig Kontakt aufnehmen und sie kann dir dorthin schreiben.«
»Nach Hamm?« Für einen Augenblick leuchteten ihre Augen auf, dann wurden sie wieder ausdruckslos. »Was soll ich in Hamm? Dann werde ich doch noch eingesperrt. Nie im Leben!«
»Wer sollte dich denn einsperren?«
»Sie sperren doch alle ein, die treu zum deutschen Volk gestanden haben. Und dann geht’s nach Nürnberg und an den Galgen.«
»Klothilde …«
»Nein, ich komme nicht mit. Danke für die Hilfe, Alfred, aber das mache ich nicht.«
»Hör mal …«
»Und du bist ja auch bei der Polizei, nein, nein, ich komme nicht. Lass mich gehen, bitte. Oder willst du mich auf der Wache abliefern?«
Alfred schüttelte den Kopf. Das hatte er nie vorgehabt. Er hatte es nur gesagt, um die aufgebrachte Menge zu zerstreuen. Hier würde ihn keiner wiedererkennen, denn morgen war er bereits nicht mehr in Berlin. Alfred überlegte, ob er sie zwingen sollte, mit ihm nach Hamm zu fahren, doch er kam schnell davon ab. Er griff in die Tasche und holte ein paar zerknitterte Scheine hervor – Reichsmark und Reichskreditkassenscheine. Sie waren nicht mehr viel wert – aber immerhin. Er zog die Zigarettenschachtel aus der anderen Tasche und reichte beides Klothilde.
»Ist leider nicht viel.«
Klothilde zögerte, dann griff sie zu, nahm die Zigaretten und das Geld. »Und du?«
»Ich habe die Rückfahrkarte bereits gekauft, und bis ich in Hamm bin, brauche ich kein Geld mehr.«
»Bist du nicht mehr in Mülheim?«