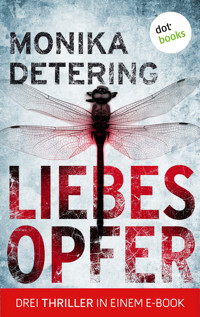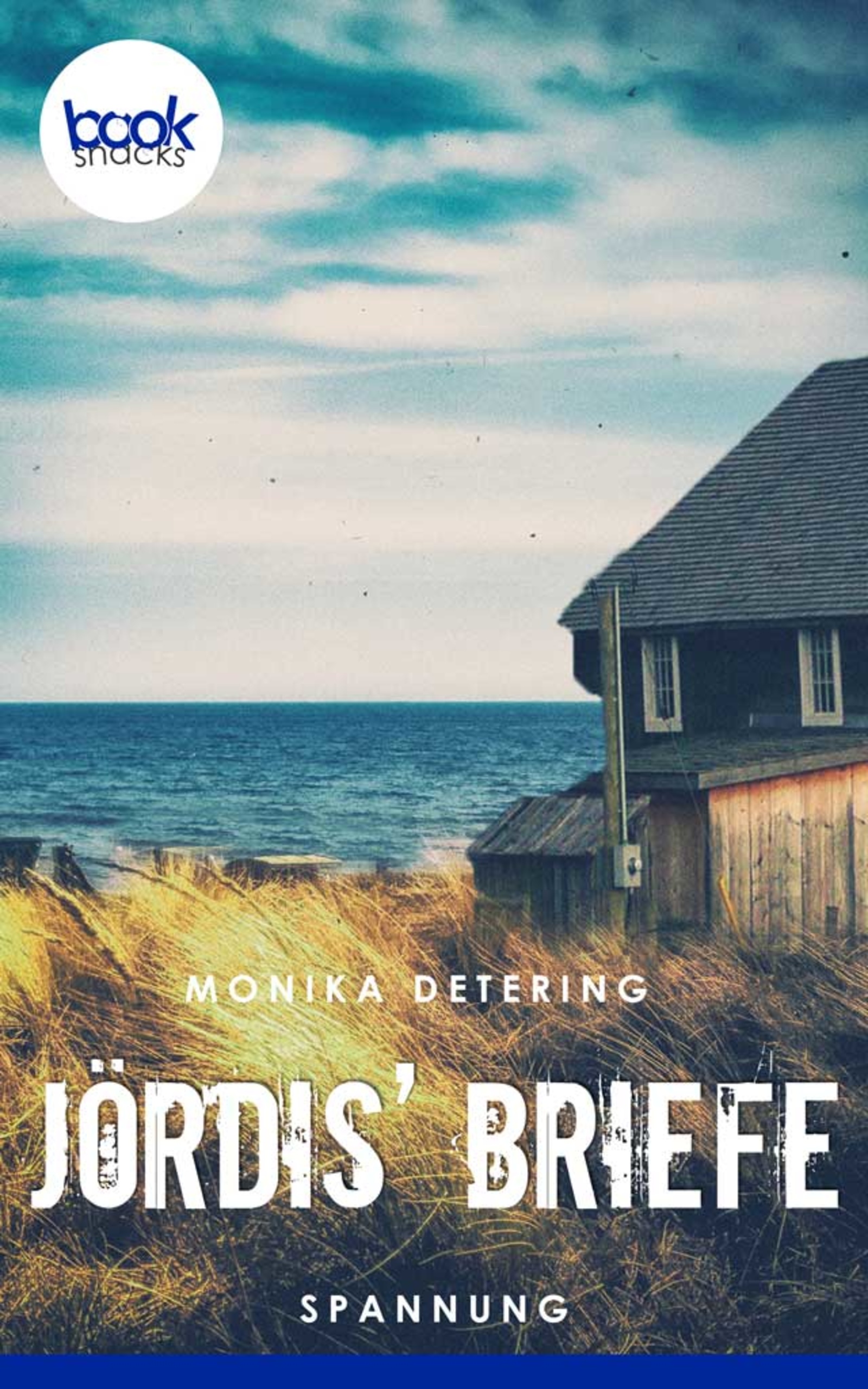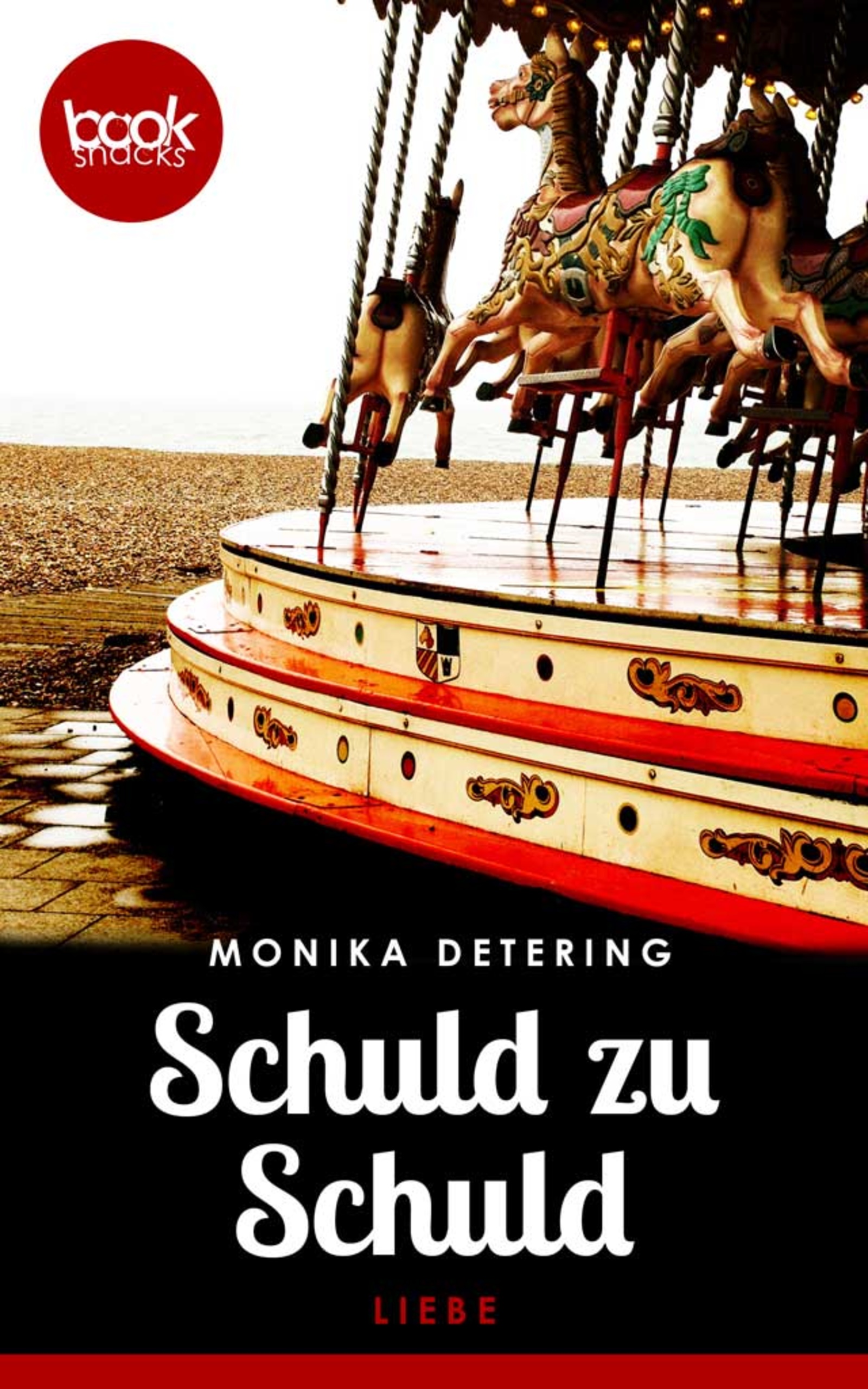Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zusammen ist man weniger allein: ein Ostsee- und Familienroman, der lange nachhalt. Was bleibt von der Liebe, wenn man alle Erinnerungen verliert? Diese Frage stellt sich Viktoria jeden Tag, während ihr Mann häufig nicht mehr weiß, was gestern und was heute ist. Richard, der doch immer ihr Fels in der Brandung war, findet sich im hektischen Hamburg immer weniger zurecht. Als sie unverhofft ein kleines Haus am Ostseebad Nienhagen erben, packt Viktoria darum kurzentschlossen ihre Koffer – und hat hier, am Meer unter weitem blauem Himmel, zum ersten Mal seit langem das Gefühl, wieder frei atmen zu können. Dabei hilft auch die etwas schräge Senioren-WG im Haus nebenan: vier liebenswerte Herren, die von Schriftstellerei bis Traumtänzerei alles betreiben – und die rüstige Frau Goldmann aus dem Ruhrpott, die immer im rechten Moment anzupacken weiß. Können sie gemeinsam das für Richard zurückholen, was längst verloren zu sein scheint? Blauer Himmel, weite See, eine kleine Gemeinschaft und die geheime Kraft der Bäume – ein Roman, so nachdenklich und herzerwärmend wie Petra Pellinis Bestseller »Der Bademeister ohne Himmel« und Amy Neffs »Warte auf mich am Meer«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Was bleibt von der Liebe, wenn man alle Erinnerungen verliert? Diese Frage stellt sich Viktoria jeden Tag, während ihr Mann häufig nicht mehr weiß, was gestern und was heute ist. Richard, der doch immer ihr Fels in der Brandung war, findet sich im hektischen Hamburg immer weniger zurecht. Als sie unverhofft ein kleines Haus am Ostseebad Nienhagen erben, packt Viktoria darum kurzentschlossen ihre Koffer – und hat hier, am Meer unter weitem blauem Himmel, zum ersten Mal seit langem das Gefühl, wieder frei atmen zu können. Dabei hilft auch die etwas schräge Senioren-WG im Haus nebenan: vier liebenswerte Herren, die von Schriftstellerei bis Traumtänzerei alles betreiben – und die rüstige Frau Goldmann aus dem Ruhrpott, die immer im rechten Moment anzupacken weiß. Können sie gemeinsam das für Richard zurückholen, was längst verloren zu sein scheint?
Blauer Himmel, weite See und die geheime Kraft der Bäume – ein Roman, so atmosphärisch wie Patricia Koelles »Sehnsuchtswald-Reihe« und so aufwühlend wie das Film-Highlight »Honig im Kopf«.
Der Roman ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich, www.sagaegmont.com/germany.
Über die Autorin:
Monika Detering wollte Schiffsjunge, Malerin oder Schriftstellerin werden. Als Puppenkünstlerin arbeitete sie u. a. in New York, Washington und Philadelphia, aber auch auf Langeoog, Juist und Spiekeroog. Jahre als freie Journalistin folgten. 1997 erschien ihr erster Roman, viele weitere folgten. Neben Romanen veröffentlichte sie Krimis, Kurzprosa und Sachbücher. Sie gewann zahlreiche Preise, u. a. mit der Kurzgeschichte »Herrin verbrannter Steine« den 1. Preis des großen Wettbewerbs für Frauen aus deutschsprachigen Ländern. Monika Detering ist Mitglied bei den 42erAutoren.
Die Autorin im Internet: www.monikadetering-de.info/
Monika Detering veröffentlichte bei dotbooks auch die drei Krimifälle von Kommissar Weinbrenner: »Herzfrauen«, »Puppenmann« und »Liebeskind«, die auch im Sammelband »Liebesopfer« erhältlich sind.Außerdem erscheinen bei dotbooks ihre Romane »Bernd, der Sarg und ich« und »Das Geheimnis der Inselfreundinnen«. Zusammen mit Horst-Dieter Radke veröffentlichte sie die Romane »Ein Sommer auf Hiddensee« und »Ein Sommer auf der Sanddorninsel«.
***
Originalausgabe November 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Renate Kunstwadl
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-872-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Heimweh nach dem Leben«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Monika Detering
Heimweh nach dem Leben
Roman
dotbooks.
»Gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW-Corona-Hilfen«
Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinwegund lehrt sie, mit dem eigenen Leid zu spielen.
Anselm Feuerbach
Die Erinnerung ist eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens.
Gerhard Roth
Dies ist die Geschichte eines alten Mannes, dessen Gedächtnis sich für immer ins Nichts zurückzieht. Es ist auch die Geschichte seiner Frau und eigenwilliger Nachbarn, die am Rande des Waldes abgeschieden leben. Eine Geschichte von Einsamkeit und Verzweiflung, vom Helfen und Lachen, von Freude, Vergebung und von Demenz.
Erster Teil
Kapitel 1
Dass ich seine Frau Viktoria bin, weiß Richard heute nicht immer. Wieder einmal sichte ich alte Fotos von ihm, lese in meinen Aufzeichnungen, so, wie ich die Erzählungen von Richard niedergeschrieben habe. Ob alles genau so stimmt, kann ich nicht nachprüfen. Es sind Richards Rückblicke in die Zeiten, in denen er gesund war.
Es war ein strahlender Tag, als Richard am 10. Mai 1936 in dem prächtigen Haus an der Wartenau in Hamburg geboren wurde.
Auf jeder der vielen Aufnahmen, die es von der Villa gibt, glänzt sie in hellem Licht mit wenigen Schatten, als wäre Hamburg ein Sonnenparadies.
Richard war ein Sonntagskind. Eine Hausgeburt. Sein Vater, Dr. Heinrich Georg Hintzpeter, genehmigte sich in seiner Bibliothek einen großzügigen Schluck eines erlesenen Hennessy Paradis Extra Rare Cognac, den er für besondere Anlässe bereithielt. Zuletzt hatte er davon getrunken, als er drei Jahre nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler in die NSDAP eintrat. Er war davon überzeugt, dass er dies als Unternehmer tun sollte.
Richards Mutter Greta hatte mit ihren siebenundzwanzig Jahren viel erreicht, ihr Aufstieg verlief so, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Sie stammte aus dem Karolinenviertel, aus der Marktstraße, und war in einem engen Hinterhofgebäude groß geworden. Aus dieser Umgebung wollte sie so schnell wie möglich raus. Sie hatte in der Rumbaumschen Schule acht Volksschuljahre absolviert. Und wollte die Handelsschule besuchen. Da1923 Arbeitslosigkeit, Hunger und Wohnungsnot das tägliche Leben bestimmten, wurde sie von den Eltern gedrängt, sich eine Arbeit zu beschaffen. Der Vater war 1918 verletzt aus dem Krieg zurückgekehrt und fand nicht mehr in sein Leben zurück. Die Mutter kränkelte. Greta rannte von Firma zu Firma, stellte sich in den Geschäften anderer Viertel vor. In einer Künstler- und Konzertagentur in Altona durfte sie stundenweise Mädchen für alles sein. Gleichzeitig übte sie sich in einem Versicherungsbüro als Sekretärin. Nur, weil sie äußerst hübsch war und sehr arbeitswillig, lernte sie der Juniorchef an. So lange, bis sie wieder auf der Straße stand.
Knapp drei Jahre lang war sie arbeitslos und auf Stellensuche gewesen, als sie sich auf ihre charmante, auch ein wenig dreiste Art bei Dr. Heinrich Georg Hintzpeter als äußerst tüchtige Stenotypistin vorstellte und blieb. Zunächst hatte sie sich auf dem weitläufigen Firmengelände verirrt, ehe sie den Eingang zu den Büros, insbesondere des Chefbüros fand.
Greta war jung, sie war hübsch und sie war ehrgeizig. Sie hatte auch das in ihren Augen, was andere männerverschlingend nannten.
Sie schloss mit sich selbst eine Wette ab, eine Wette, die sie viele Jahre später ihrem erwachsenen Sohn lachend und stolz erzählte. »Und ich hatte wieder einmal gewonnen«, so ähnlich berichtete es Richard mir.
Greta wollte den Mann, sein Vermögen, sie wollte sehr gut leben – und sie besaß einen eisernen Willen. Jedenfalls zu jener Zeit. Schnell eroberte sie den nüchternen, strengen und schnell aufbrausenden Mann mit den schmalen Lippen, der die Altonaer Kalksandstein-Werke von seinem Vater übernommen hatte. Zwei Jahre später war sie Heinrichs Frau und sichtbar schwanger.
Die Eltern waren sehr stolz auf ihren ersten Sohn. Das ist deutlich auf den wenigen Fotos, die alle drei in großer Innigkeit zeigen, zu sehen. Er sollte ihr einziges Kind bleiben.
Richard wurde ein feiner, blonder und strammer Knabe, der hoffentlich später auch in die Partei eintreten würde. Das wünschte sich der Vater, der noch von der Ideologie der Nazis überzeugt war.
Greta hielt sich vom Politischen fern. Nach der Hochzeit brauchte sie nicht mehr im Büro zu arbeiten und erfüllte sich ihren nächsten Wunsch: Sie machte eine Ausbildung zur Sängerin. Sie wollte bewundert werden, und wo konnte dies besser gehen als auf der Bühne? In langer, eleganter Abendgarderobe, lasziver Haltung, in einer Hand einen Schal aus Pelz, der lässig über den Bühnenboden schleifte. Auf den Bildern waren auch ihre schlanken Fesseln zu sehen, und die Füße steckten in eleganten, teuer aussehenden Riemchenpumps. Das üppige braune Haar hatte sie in breite Wellen legen lassen.
Das alles war ganz in Heinrichs Sinne, denn so war sie beschäftigt, während er sich mit Firma und Partei befasste. Außerdem war Greta auf Festen und Empfängen hübsches und charmantes Beiwerk, ein Schmetterling, der vergnügt hierhin und dahin flirrte. Operetten und Schlager wie: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, oder: Ich bin heute ja so verliebt – ja, die lagen ihr.
Für Richards Betreuung wurde Tereza eingestellt. Sie stammte aus einem Dorf nahe Prag.
Ich besaß auch von den beiden mehrere Fotos. 6x6-Format, trotzdem waren die beiden mit einer Lupe gut zu erkennen. Tereza, sehr dichtes, dunkles Haar, mit Kämmen zur Seite gesteckt, an der Hand einen fast zu hübschen Jungen mit fragendem, nein, eher skeptischem Blick. In seinen Augen liegt ein scheues Lächeln.
Tereza kümmerte sich gut um Richard, spielte mit ihm und zog ihn fein an, wenn sie an der Alster spazieren gingen. Das machte ihr Spaß, und es war Mutter Greta wichtig, immer schön bei kühlem Wind das dunkelblaue »Hamburger Mäntelchen« anzuziehen und die dunkelblaue Baskenmütze auf den Kopf zu setzen. Sobald sie die Wartenau verlassen hatten und zum Kuhmühlenteich gingen, riss Richard die Baskenmütze runter und gab sie der Kinderfrau. »Kratzt!« Tereza lachte gutmütig und verstrubbelte sein blondes, gelocktes Haar. Vom Kuhmühlenteich aus war der Weg nicht weit bis zur Außenalster. War noch genügend Zeit, spazierten sie weiter zur Innenalster. Hier, am Ballindamm, wohnten die Großeltern, die ihren Enkel mit Vergnügen verwöhnten. Nachdem der Großvater sich aus dem Betrieb zurückgezogen hatte und nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem Sohn Heinrich aus dem Haus an der Wartenau ausgezogen war, freute er sich ungemein, wenn Richard mit Tereza auftauchte. Großvater Dr. Albert Hintzpeter hatte sich mit seiner Frau Friederike von der Familie seines Sohnes zurückgezogen. Als Freimaurer verachtete er die politischen Ambitionen seines Sohnes.
Aber trotz aller Zuwendung von Großeltern und Kinderfrau vermisste Richard seine Mutter. Saß sie am Klavier, durfte er nicht stören. Abends brachte ihn meistens Tereza ins Bett, weil im Salon ein Musikabend stattfand, mit SS-Offizieren und deren Begleiterinnen. Richard wollte sich in den feinen Kleidern seiner Mutter vergraben, ihre Wärme spüren und ihren Duft einatmen. Manchmal wurde er aus dem Schlaf geholt und den Gästen vorgeführt, dann trug Greta ihn mit dekorativer mütterlicher Miene herum, und die Gäste sagten: »Ach, was für ein hübscher Junge.«
Und dann kam, was Vater Heinrich und seine Parteifreunde erwartet hatten: Der Krieg brach aus. Heinrich wurde als Offizier eingezogen, und Greta konnte ihre Gesangskünste zur Aufheiterung und Stabilisierung der Soldaten bei der Truppenbetreuung darbieten. Zwischendurch kam sie nach Hause, lachend, voller Unruhe – nein, sie konnte sich nicht um den Haushalt kümmern. Das war nicht ihr Metier. Sie brauchte Musik, das Tanzen und Feiern und Trinken. Sie brauchte Verehrer, und die gab es reichlich. Greta glaubte nicht, dass Bomben »ihr« Blankenese zerstören könnten.Aber es fielen erste Bomben auf Hamburg. Zu Anfang waren sie eher eine Sensation als eine Bedrohung.
Greta bekam neue Auftritte. 1941 entließ sie das Personal, bis auf die Köchin und den Gärtner. Heinrich konnte nur im Urlaub nach Hause kommen, und er begann, den Krieg und Hitler zu verfluchen. Für den kleinen Richard wurde er schnell ein fremder Mann.
Heinrich und wenige enge Freunde ahnten, dass die Spreng- und Brandbomben aus den Bombenschächten britischer Lancaster-Maschinen auch die Zivilbevölkerung als Ziel nutzen würden. Er sorgte sich um seine Familie, er zeigte Greta den nächsten Luftschutzbunker, falls es nötig würde, ihn aufzusuchen. Und was sie an Papieren immer bei sich tragen musste.
In den besonders schlimmen Zeiten sang Greta auch, sie bekam Engagements, sie sang vor heimwehkranken Soldaten.
So blieb dem Kind nur Tereza, die sich immer um ihn kümmerte. Richard weinte sich oft genug in den Schlaf, wenn die Mutter einmal wieder fort war und singen musste. Seine Sehnsucht nach ihr war groß. Wie oft saß er draußen auf der Freitreppe und wartete auf Greta. Er begann sich zurückzuziehen, er lernte: Sehnsucht nützte ihm gar nichts.
Der Krieg zerbombte das Kalksandsteinwerk, er tötete den Vater 1944 in der Tschechei, die Mutter, erst süchtig nach Arien, nach Aufmerksamkeit, fuhr regelmäßig in das Timmendorfer Spielcasino, und am Ende des Krieges war jegliches Vermögen dahin. Sie behalf sich mit Spielautomaten in Hamburg, nur ging von ihnen weder hoffnungsvoller Glanz aus, noch gab es in solchen Läden wohlhabend wirkende Kavaliere, die reiche und schöne Spielerinnen abzocken konnten. Hier galt nur die rasende Gier auf ein paar Groschen.
Das Kind Richard fühlte sich immer verlorener, er wollte weg von zu Hause und wurde nach Würzburg zu einem soliden kinderlosen Ehepaar geschickt, das sich auf den Jungen freute. Sie waren überglücklich, nun ein Kind zu haben.
Vielleicht hat Richard die permanente Unrast seiner Mutter geerbt. Vielleicht. Denn dieses Getriebensein hat sich lange durch sein Leben gezogen. Jedenfalls wollte er nach einigen Jahren nach Hamburg zurück, und Onkel Korbinian brachte ihn schweren Herzens zur Bahn. Tante Gertrud war in Tränen aufgelöst zu Hause geblieben. Ich habe diese netten Pflegeeltern noch kennengelernt, sie haben mir von diesem Abschied erzählt. Richard wollte seine Mutter sehen, die ihm nie geschrieben oder ihn angerufen hatte. Die ihm nie zu seinen Geburtstagen gratulierte, solange er in Würzburg war.
Als Zwölfjähriger brachte er Bilder und Bettzeug ins Pfandhaus, damit er für sich und seine Mutter wenigstens Brot ergattern konnte. Nichts war mehr vom einstigen Wohlstand übriggeblieben. Greta war tagelang verschwunden, Richard hauste in einem Zimmer in der einst schönen Villa. Nun war jedes Zimmer von fremden Menschen besetzt, legal, illegal. Greta tauchte mit einem englischen Offizier auf. Sie hatte Glück, er beschaffte Brot, Eier, Speck und Fleischwurstringe.
Die Zeit rollte auch über diese Menschen hinweg. Als Greta verstand, dass sie alles verspielt hatte, verfiel sie in eine tiefe Depression. Und Richard war wieder allein.
Ich habe alles aufgeschrieben, was Richard mir im Laufe unserer gemeinsamen Jahre erzählt hat. Diese Aufzeichnungen habe ich auch für unsere Kinder angefertigt, damit sie einmal mehr über ihren Vater und ihre Großeltern wissen. Mit 84 Jahren, diversen Krankheiten und dem verfluchten Alzheimer wird er nicht mehr viel Zeit haben. Ich wünsche mir, dass sich Richard noch einmal erinnert und aus seinem Leben erzählt. Was er nicht mehr weiß – da kann ich einspringen.
Selbst wenn ich ihn nach Dingen von gestern frage – es ist weg, wie nie gewesen. In seiner Welt ist er der Gefangene und die Demenz sein Wärter. Wenn er manchmal herauskommt, lacht und spricht wie früher, ich seine sarkastischen Scherze höre, ist das immer ein besonderer Augenblick, so täuschend echt, der mich denken lässt, er wird wieder gesund.
Das wird er nicht.
Nie mehr.
So hüte ich seine Erinnerungen. Zu seinem 85. Geburtstag will ich für ihn einen Film mit den alten Bildern vorführen, denn in uns steckt ein tiefes Heimweh nach der Vergangenheit.
Kapitel 2
Richards Erkrankung wurde für seine Umwelt erkennbar in seinem letzten Jahr im Sandtorhafen. 2014, mit 78 Jahren, war er immer noch stundenweise als Ehrenamtlicher dort tätig. Es war ein langsamer Prozess. Er konnte das gut verdecken, noch immer war er der Mann mit den vielen Ideen und sah sich noch lange nicht reif für ein Rentnerdasein. Aber er musste gehen, man legte es ihm nahe, obwohl – oder gerade weil – er vor Einfällen fast platzte, von denen er allerdings keinen in die Wirklichkeit umsetzte. Er begann etwas, wandte sich dem nächsten zu und verhedderte sich.
Er hat die besten Zeiten hinter sich, so waren meine Gedanken.
Das erste Jahr zu Hause setzte Zeichen. Er wurde ungeduldig und reizbar. Besonders der Marathonlauf ist mir in Erinnerung geblieben.
Richard hatte sich angemeldet und intensiv trainiert. Dennoch musste er vorsichtig sein, er litt unter einer chronischen Bronchitis, die nicht besser wurde. Untersuchungen lehnte er ab. Er wollte nur eins: der erste in seiner Jahrgangsklasse sein. »Dann wird alles besser.«
Ich stand am Jungfernstieg und unser Sohn Michael in der Zielgeraden in Rotherbaum. Ich sah Richard, wie er seine Mitläufer überholte. Er lief viel zu schnell. Würde er am Ende genügend Kraftreserven haben?
Michael erwartete ihn am Ziel, er wartete vergebens. Wir trafen uns wieder in unserer Wohnung, die sich in der Altstadt von Altona befand. Richard tauchte erst kurz vor Mitternacht auf. Er war verschmutzt, als wäre er hingefallen, wirkte desorientiert und fegte mit einer ärgerlichen Handbewegung unsere besorgten Fragen weg. Bevor er ins Bett gehen wollte, hielt ich ihn trotzdem fest. »Wo warst du so lange?«
Ich war nahe dran, ihn anzuschreien. Er guckte seltsam. Sein Gesicht strahlte große Trauer aus. Als wäre seine Welt verlorengegangen.
»Es war zu weit, viel zu weit!«
»Du hättest den Lauf doch abbrechen können.«
»Pah, der Marathon … Ich wollte zu meinem Dorf an der Ostsee, aber alles war viel zu weit. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich muss dahin, meine Zeit geht zu Ende.«
Ich nahm ihn in den Arm und hielt ihn lange fest. »Das ist zu Fuß nun wirklich zu weit. Aber wir fahren doch bald dahin, schon vergessen?«
»Vergessen. Warum? Nichts ist vergessen.« Nach einer langen Pause behauptete er mit Siegerstimme: »Aber ich habe gewonnen. Ich war der Einzige am Harvestehuder Weg, da unter den Bäumen. Die werden mir wohl morgen gratulieren, es war ja schon spät.«
Ich kannte die Streckenführung, und sie verlief nicht über den Harvestehuder Weg.
In den Folgetagen mied ich das Thema, und seltsamerweise kam Richard nicht mehr darauf zurück. Er lief seine Runden durch unser Viertel und kam immer zur passenden Zeit zurück. Danach war er ziemlich erschöpft. Ich hatte keine Lust zum Joggen. Überhaupt nicht. Aber immer mehr wurde Richards Sehnsuchtsort das Thema, von dem er nicht ablassen konnte.
Dieses Ostseebad am Gespensterwald war lange nicht zur Sprache gekommen, jedenfalls, seitdem wir von Stralsund zurück nach Hamburg gezogen waren. In Nienhagen besaß seine Kusine ein Haus, und bei ihr ist er oft gewesen, soweit dies in DDR-Zeiten möglich war. In seiner Zeit als Hafenmeister in Stralsund bin ich auch mitgefahren. Eine reizvolle Gegend, mir gefällt sie.
»Lass uns da hinziehen.«
»Aber Richard, wir haben noch nicht einmal unsere Eigentumswohnung abbezahlt. Hamburg ist doch unsere Stadt.«
»Ja, aber …«
»Was ist mit einem Mal anders?«, fragte ich.
»So laut. Alles ist laut und unruhig.«
Er hatte nicht unrecht. Das Haus, in dem wir wohnten, befand sich in einer stark befahrenen Straße. Anfangs war sie das nicht, oder ich habe es nicht so wahrgenommen. Da fuhr ich noch täglich in die Polsterwerkstatt, ich der ich damals arbeitete. Ich war Innenausstatterin und hatte von Grund auf das Polstern gelernt. Es machte mir Spaß. Heute nahm ich privat Aufträge an und blieb so im Kontakt mit meinen Kunden. In Mariekes ehemaligem Zimmer lagerten Stoffe, Holz und Handwerkszeug.
Marieke, unsere Tochter, lebte in Amsterdam. Sie war Schauspielerin, machte Straßentheater mit einer festen Truppe. Verdienen konnte sie nicht viel damit. Wir waren froh, dass sie trotzdem ihr Staatsexamen als Juristin gemacht hatte. Sie konnte darauf zurückgreifen, wenn das Theater nicht mehr ihre Leidenschaft war.
Michael, seitdem wir uns ein zweites Mal in Hamburg niedergelassen hatten, war gleich in eine WG mit zwei Freunden gezogen.
»Wir können doch nicht wieder umziehen, Richard«, griff ich den Faden auf.
»Können wir. Ich bleibe nicht in Hamburg.« Er klang trotzig wie ein Kind.
»Ich habe hier meine Arbeit«, wandte ich ein.
»Hör damit auf. Ich ziehe an die Ostsee. Du kannst den Leuten hier weiterhin die Stühle für ihre fetten Hintern aufpolstern.«
Wochenlang war ein Umzug unser Thema. Dann wurde es weniger.
Aber Richard telefonierte oft mit seiner Ostseekusine. Dieses Gesprächsbedürfnis blieb. Aber sonst – vergaß er zu viel. Ich gewöhnte mich fast daran, erinnerte und schluckte, wenn er unwissend oder ärgerlich reagierte. Woran ich mich nicht gewöhnen konnte, war, dass er in manchen Wochen nur auf mein Drängen hin frische Kleidung anzog. Und vorher war er immer so pingelig mit seinen Sachen gewesen.
Und dann kam der Tag, als Richard während eines Abendessens nach langem Schweigen sagte: »Ich habe so eine Scheißangst vor Demenz. Oder Alzheimer. Oder was es da sonst noch gibt. Etwas ist anders bei mir, nur was?«
»Aber Richard …« Meine schon lange währende Sorge drängte höhnisch grinsend an die Oberfläche. »Bitte, das kann doch nicht sein, du musst keine Angst haben.« Was ging in ihm vor? Er hatte sich verändert, das war mir schon sehr bewusst. »Du hast dich von deinen Freunden zurückgezogen. Warum eigentlich? Du vergisst einiges – aber sonst? Solange du es selbst noch bemerkst, kann es nicht so schlimm sein.«
Ich traute mich nicht, noch mehr zu sagen.
»Unterbrich mich nicht«, reagierte er schroff. »Lass mich ausreden. Es ist nur so, immer öfter bin ich durcheinander. – Vielleicht, weil du dazwischenredest und alles besser wissen willst?« Er guckte mich grimmig an. »Namen fallen mir nicht ein. Aber vielleicht sind sie einfach nicht wichtig, was meinst du? Dummerweise habe ich auch vergessen, mit wem ich befreundet bin. Und wenn ich das alles nicht weiß, ist mein Gehirn wie eine blanke Fläche. Ein Gefühl, als würde ich am Rande einer hohen Klippe stehen – und unter mir ist Leere. Das Nichts. Es macht mir schreckliche Angst. Bald weiß ich nicht mehr, wer ich bin, und staune, wenn mich einer mit ›Richard‹ anspricht. Ich brauche Zeit, bis ich begreife, dass ich ›Richard‹ bin. Und an anderen Tagen ist alles normal. Dann schreibe ich Gedanken und Vorhaben auf Zettel, über die du so schimpfst. Überall gelbe Zettel, überall Gekrakel, selbst auf dem Tisch und an den Wänden. Ja, ja, ja. Das sagst du dauernd. Ist das bei dir auch so komisch da oben?« Er tippte sich an die Stirn.
Ich schüttelte beklommen den Kopf.
»Ich durchwühle meine Erinnerungen nach Namen und nach dem, was ich tun soll, so hilf mir doch. Ich kann das nicht allein. Das da im Kopf«, er schlug mit den Fäusten gegen seine Schläfen, »das da – was macht es mit mir? Ich will das nicht. Bitte! Wie soll ich denn weiterleben?«
»Ach, Richard, das geht bestimmt vorüber.« Und ahnte, dass es nicht vorübergehen konnte. Alle bisher verdrängten Befürchtungen fielen wie Geier über mich her. Am liebsten hätte ich geheult. Aber es war Richard, der traurig und bedrückt neben sich stand. Ich streichelte seine Hände, diese schönen, kräftigen Hände. Ich ging zu ihm, umarmte meinen Mann, schluckte Tränen hinunter und flüsterte: »Das schaffen wir zusammen! Es gibt bestimmt Medikamente, die dir helfen können.«
Sein Blick wurde beängstigend leer. Als wäre er in diesem Augenblick nicht da.
Ich sah zwar, dass Richard seinen Pullover auf links trug. Nur – so etwas konnte jedem mal passieren.
An jenem Abend ergriff mich die große Furcht, die mich nie wieder loslassen sollte. Ich beobachtete Richard von nun an sehr viel aufmerksamer, und es kam mir gleichzeitig unangemessen vor. Als wäre ich eine Spionin. Gehörtes und Gesehenes spielte ich herunter. Das konnte doch alles nicht sein. Ist Demenz Ver-rückt-sein? Noch war es eine Vermutung, über die ich aber nicht sprach. Natürlich hatte ich sofort gesagt, »du musst zum Arzt«, was er vehement ablehnte.
Tage nach diesem Vorfall hatte ihn erneut die Angst im Würgegriff. Ich sah es an seinem Blick. Er schlug die Hände vor das Gesicht.
»Erklär es mir genauer, damit ich dir helfen kann. Wovor fürchtest du dich so?«
»Immer musst du quatschen. Nur dummes Zeug.« Er blickte mich nicht an, er schaute neben mir geradeaus zu einem Bild an der Wand. »Verstehst du nicht? Als würde sich an meinem Gehirn zäher Nebel festkrallen. Herrgott, mach das weg!«, schrie er panisch. »Dieses Verschwommene. Meine Gedanken! Ich will denken.«
Er schüttelte sich, stand auf und ging.
Nach einer Stunde war er noch nicht wieder zurück.
Ich fand ihn am Sandtorhafen, dort hatte Richard zuletzt gearbeitet. Den Traditionsschiffhafen liebte er, hier lagen historische Schiffe, waren alte Hafenanlagen und Arbeitsgeräte zu sehen – Zeugen maritimer Geschichte der Stadt. Er stand am Anfang des Sandtorkai und ging ein Stückchen rauf, blieb stehen, sah sich um, so, als würde er etwas suchen. Dieser Kai hatte die älteste Kaimauer, sie war vor etlichen Jahren restauriert worden.Richard war von diesem Hafen fasziniert und hatte uns oft darüber erzählt, dass es mal der modernste Hafen seiner Zeit gewesen war.
Im August 1866 wurde die Anlage, ganz in der Nähe der Speicherstadt, feierlich eröffnet. Am Sandtorkai konnten Schiffe erstmals längsseitig be- und entladen werden.
Richard ging weiter und bog in den Kehrwiedersteg ein. Wie gut, dass ich mich hier auskannte – sonst hätte ich mich gnadenlos verirrt. »Richard!«, rief ich ihm hinterher.
Doch er hörte mich nicht – oder wollte mich zumindest nicht hören – und ging unbeirrt weiter.
»Richard!«, rief ich nach einer Weile noch mal.
Endlich blieb er stehen.
Ich ging zu ihm. »Kommst du mit nach Hause? Michael kommt auch gleich. Wir wollen doch zusammen essen.«
»Ich kann nicht.«
»Warum nicht?«
Er zeigte auf drei Stufen, die er runtergehen musste. »Weiß nicht, wie.«
Ich wartete. »Nun komm.« Es konnte nicht sein. Die paar Stufen! Er ist sie doch hinaufgegangen.
Er machte einen Schritt nach vorn, guckte runter, ging wieder zurück.
Ich nahm seine Hand. »Komm, wir müssen nach Hause.«
Endlich! Langsam und sehr vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Dann hatte er es geschafft. »Nach Hause. Will kochen.«
Inzwischen sprach er häufig abgekürzt oder brachte Worte, die niemand außer ihm kannte – und das vielleicht auch nicht einmal –, in einen ansonsten logischen Satzaufbau.
Es dauerte, bis wir zu Hause waren. Aber das machte nichts. »Was möchtest du denn kochen?«, fragte ich.
»Pe… Pe… Penissuppe.«
Wie bitte? Ich lachte. »Was soll das denn werden?«
Endlich. Richard machte Witze. Das hatte er immer gut gekonnt.
»Dann koch mal.« Ich bohrte nicht nach, was er wirklich meinte, damit er nicht ärgerlich oder unsicher wurde. Er ging an den Kühlschrank, guckte lange und zog aus der Gemüseschublade den Spargel hervor, der dort in ein feuchtes Handtuch eingeschlagen lagerte. Er wickelte die Stangen aus, hielt eine triumphierend hoch und grinste.
Na ja, so ungefähr wusste ich jetzt, was er gemeint hat. Auf die Idee musste man auch erst kommen.
»Also eine Spargelsuppe. Kannst du das?«
»Geh raus. Ich mach das schon.«
»Denk dran, Michael will nachher auch mitessen.«
Vorsichtig guckte ich einige Minuten später nach. Er bemerkte mich nicht. In unseren großen Familientopf hatte er viel Wasser gefüllt. Die ungeschälten Stangen brach er ein paarmal durch und warf sie hinein. Aus einem anderen Topf mit Resten von gestern löffelte er Fleischstückchen und Soße heraus und tat dies zu seiner Suppe.
Entgeistert verzog ich mich und schickte Michael eine WhatsApp-Nachricht. »Papa kocht, nur das wird nix. Bring doch für uns drei was vom Chinesen mit.«
»Der blöde Herd geht nicht an.«
Schubladen knallten.
Nach einer knappen Stunde rief er: »Madame, essen kommen!«
Alle vier Herdplatten waren aus.
»Setz dich.«
Ich hoffte auf Michael. Sah, wie Richard weißen Pfeffer mit der Gewürzmühle in den Suppentopf mahlte.
Mit der kleinen Kelle schöpfte er Suppe auf meinen Teller. Dünn, wässerig, eine kalte Flüssigkeit mit rohem Spargel, obenauf schwammen Fleischstücke.
»Guten Appetit!«
»Wirklich, Richard, das kann ich nicht. Das ist keine Spargelsuppe. Außerdem ist sie kalt. – Hast du den Spargel weder geschält noch gekocht?«
»Bist nie zufrieden. Immer am Meckern.« Er stand auf, nahm den Topf und knallte ihn in die Spüle.
Es klingelte, und Richard öffnete – Michael stand mit köstlich duftenden Päckchen vor ihm.
Er erfasste schnell die Situation. »Du hast gekocht, Papa? Was ist das – ein Penissüppchen, sagst du? Esse ich nachher. Ich habe Pekingenten mitgebracht. Die dürfen nicht kalt werden.«
»Woher weißt du, dass ich die so gerne esse?«, fragte Richard.
»Als Sohn weiß man das!«
Es schmeckte uns dreien köstlich, und zwischendurch entsorgte ich heimlich den Topf mit der komischen Suppe.
Ohne es zu wollen, stritten wir uns nun häufig. Heute weiß ich, dass es Richards Verunsicherung, seine Ängste und eine große Wut waren – er merkte, dass etwas nicht mehr stimmte. Ich war so weit, dass ich gehen wollte. Ich sah mir Wohnungen an, eine Wohnung für mich allein. Wollte zu neuen Ufern aufbrechen, weit weg von allem sein. Die Kinder sind groß, sie brauchen mich nicht mehr, überlegte ich. Auch meine Koffer waren gepackt. Zunächst wollte ich einfach mit dem Zug reisen, dachte, eine Wohnung bekomme ich allemal. Denn ich wusste nicht, wo ich bleiben sollte. Vielleicht eine Zeitlang in einem Pariser Hotel leben? Ich malte mir vieles aus, und es war so real, dass ich an manchen Morgen, wenn ich aufwachte, verwundert um mich sah und staunte, dass ich immer noch neben Richard lag.
Als er mich zum ersten Mal um Hilfe beim Anziehen bat, steckte ich meinen Fluchtwunsch weg. Ich musste es und bin geblieben.
Und schließlich sprach Richard über seine Verunsicherung.
Ich beschloss, ihn nicht allein zu lassen, solange die Liebe reichte. Und würde sie verloren gehen, konnte ich immer noch sagen: »Richard, ich mag dich sehr, ich passe auf, dass dir kein Leid geschieht.«
Kapitel 3
Zwei Monate später kam Richard wieder auf das Thema Umzug zu sprechen. Da begann ich, mich ernsthafter damit zu beschäftigen. Aber ich suchte noch nicht nach einer Wohnung. Viele waren sowieso nicht frei, die meisten Leute in den Ostseeorten vermieteten nur Ferienquartiere.
»Ich bin im Exil«, sagte er an einem Abend, nachdem er mir eine seiner Beleidigungen an den Kopf geworfen und worauf ich mich gekränkt in mein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte.
Ich begriff, dass er nicht aufhören würde, die Ostsee und den kleinen Ort mitsamt seinem Gespensterwald zu vermissen. Also schluckte ich meinen Ärger hinunter und ging zurück ins Wohnzimmer, wo er inzwischen im Sessel eingeschlafen war. Ich betrachtete ihn. Im Schlaf sah er wie ein Fremder aus. Und eigentlich ist man sich immer fremd. Der Kern eines jeden ist tief verschlossen mit Wünschen, mit Geheimnissen, die niemanden etwas angehen.
»Viktoria?«, kam es flüsternd.
»Ja, was ist?«
»Ich möchte nur wissen, ob du da bist.«
»Ich bin da, Richard.«
Ich blieb bei ihm stehen und ging etwas später zum Sofa und setzte mich. »Wir sprechen mit deiner Kusine, ob die nicht Bekannte hat, die vermieten wollen.«
Er hatte Streit mit seinem besten Freund Owe, durch den ich von der Auseinandersetzung überhaupt erst erfuhr.
Darauf angesprochen reagierte Richard verwundert. »Was hat der denn? Ist alles bestens. Nix ist gekracht. Kommt von krachen, wer hat Lärm gemacht?«
»Lärm? Ihr habt doch gestritten. Worüber eigentlich?«
»Männersache.«
Ich fragte nicht weiter nach, und Richard mähte anschließend von sich aus den Rasen. Es ist nur jeweils ein kleines Stückchen hinter und vor dem Haus. Aber es war nötig, und ich hoffte, dass er auch das Unkraut, das zur Straßenseite in den Steinlücken sprießte, ausriss.
Endlich hatte ich wieder das Gefühl von Normalität, bis er abends sagte: »Da habe ich einen Zellenfresser im Gehirn. Ich spür das. Ob ich womöglich einen Humor habe?«
»Wie meinst du das?«
»Kapierst du nicht? Humor. Hast doch wohl sicher was darüber gehört.«
Ich überlegte. »Meinst du einen Tumor?«
»Tumor, ja sicher, habe ich doch gesagt. Das meine ich.« Dann wechselte er abrupt das Thema und forderte: »Gib mein Gefäß wieder.«
Gefäß? Ich kapierte. Er meinte seine Tasse, diese hässliche grüne, aus der er am liebsten trank.
»Du musst dich untersuchen lassen, ich komme auch mit. Du sorgst dich, und vielleicht ist es bloß ein verzogener Halswirbel, der dir Kummer macht.«
Er nickte ein wenig. »Ich bin müde.«
»Dann geh schlafen.«
Wir hatten erst 20 Uhr 30.
Mehr und mehr solcher Situationen häuften sich. Dann war wieder alles normal, bis Richard das Einkaufen in Altona entdeckte.
Wir wohnten in der Altstadt, da gab es genügend Einkaufsmöglichkeiten. Aber nein, er musste in die Rindermarkthalle auf St. Pauli, einen Riesensupermarkt. Sein neuer Einkaufsfimmel strapazierte meine Geduld sehr. Er wollte allein fahren. Ich ließ ihn. Und dann kam er abgehetzt und verzweifelt zu Fuß zurück.
»Was ist los? Hattest du einen Unfall?«
»Nein. Das Auto ist auf dem Parkplatz. Hab’s aber nicht wiedergefunden. Meine EC-Karte ist auch weg, und der Einkauf steht hinter irgendeiner Kasse. Hast du mir die Karte weggenommen?«
Hatte ich nicht.
Wir suchten. Ich stülpte Richards Jackentaschen um.
»Wir fahren mit den Rädern hin, komm!«
Richard eilte von Kasse zu Kasse, sagte sein Sprüchlein auf: »Ich muss meinen Einkauf mitnehmen!«
Ich merkte, dass es so nicht ging. Am Informationsschalter erklärte ich die Situation.
»Aber sicher, der Einkauf ist dort in der Nische geparkt!«
Ich sah Richard kommen. Er drängte sich in unser Gespräch: