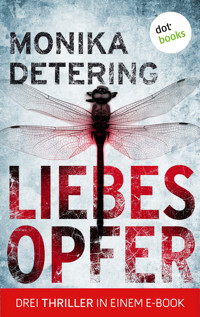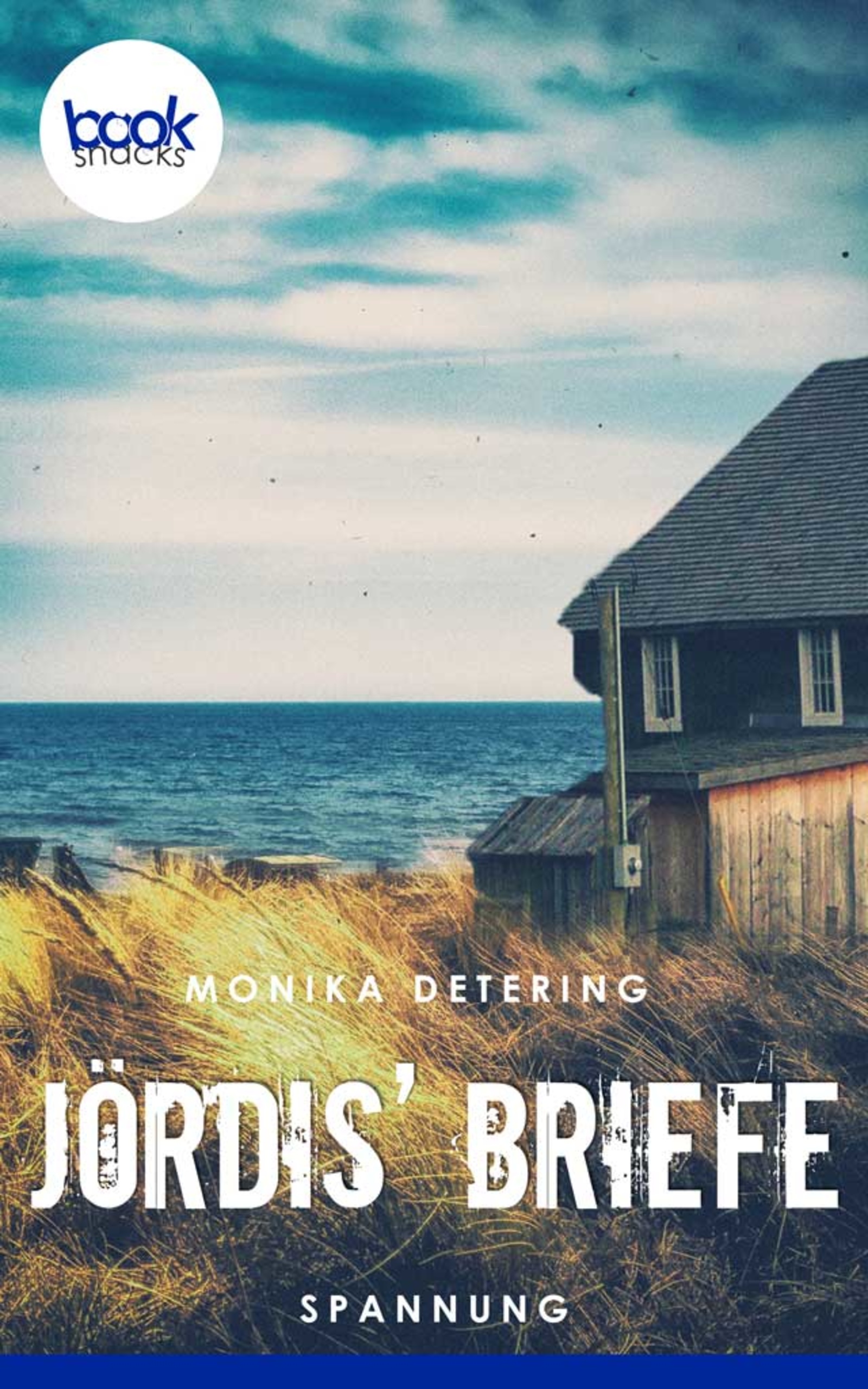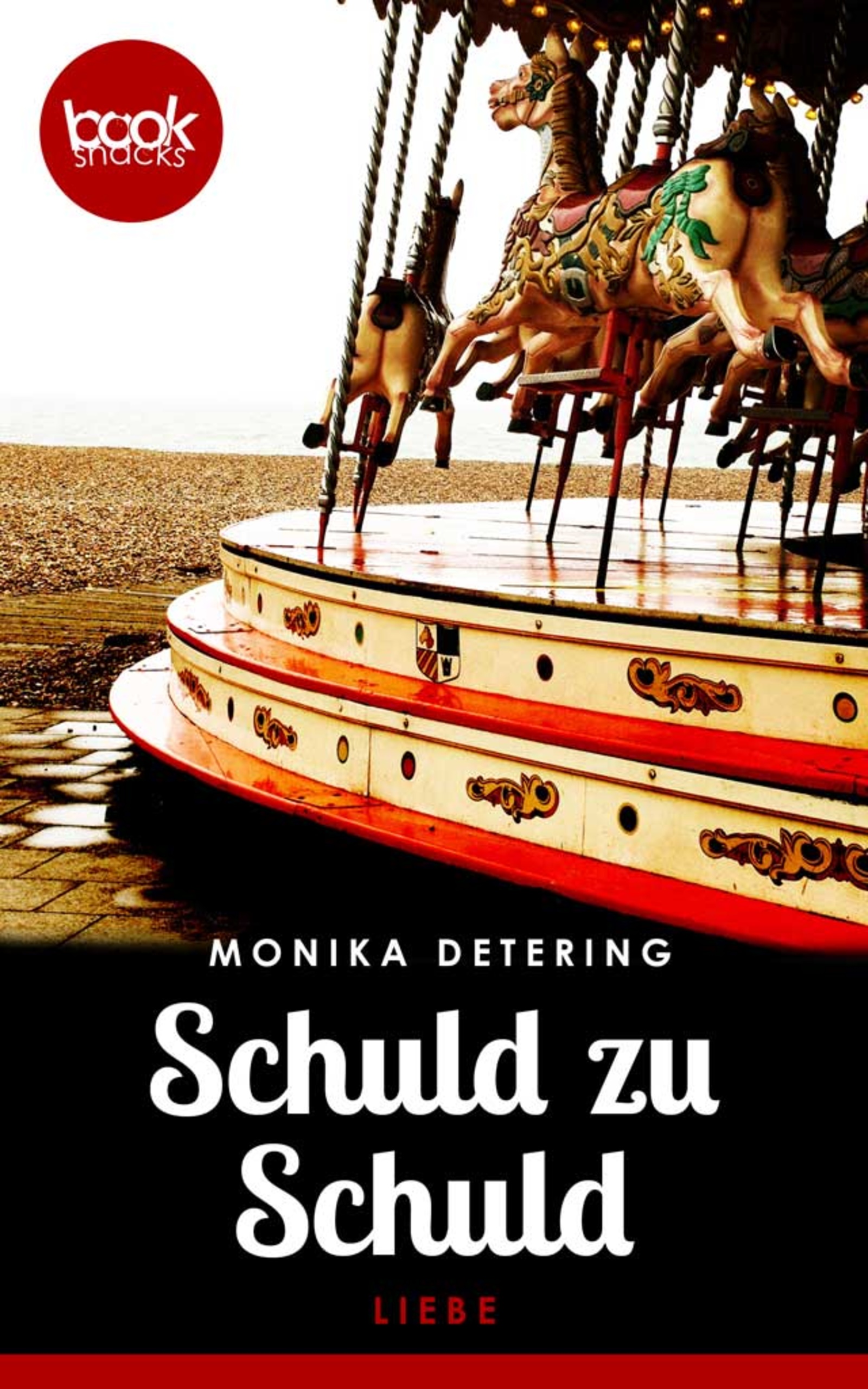Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emotional, aufwühlend, hoffnungsvoll Wenn alte Geheimnisse zu neuen Anfängen führen … Seit dem Unfalltod ihres Freundes, fühlt sich das gemeinsame Haus im Havelland für Siri nur noch einsam an – und als Schuldgefühle an Felix' Tod aufkommen, will sie ein Versprechen, dass sie ihm vor langer Zeit gegeben hat, endlich einlösen. Sie soll für ihn die alte, berühmte Holzmarionette eines Raben finden. Eine Spur führt nach Hiddensee, wo Siri das Gefühl hat, bei frischer Inselluft und langen Strandspaziergängen endlich wieder frei atmen zu können. Sie mietet sich in einer kleinen Pension ein – doch warum kommt ihr der charmante Pensionsgast Magnus so seltsam bekannt vor? Mehr und mehr hat sie den Verdacht, dass Felix ihr einiges aus seinem Leben verschwiegen hat. Ein Hinweis auf den Raben führt Siri weiter nach Prag zum alten Besitzer eines Marionettenladens, doch dort begreift sie, dass sie erst die Geheimnisse der Vergangenheit lösen muss, wenn eine neue Zukunft möglich sein soll … »Die Autorin wollte mit dem Buch den Raben eine eigene Geschichte widmen. Gleichzeitig hat sie damit Josef Skupa, dem Schöpfer von Spejbl und Hurvineck, ein literarisches Denkmal gesetzt.« (Manuela Benesch/Lesejury.de) Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »Der Sommer des Raben« erschienen und wird Fans von Patricia Koelle und Anne Barns begeistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn alte Geheimnisse zu neuen Anfängen führen … Seit dem Unfalltod ihres Freundes, fühlt sich das gemeinsame Haus im Havelland für Siri nur noch einsam an – und als Schuldgefühle an Felix' Tod aufkommen, will sie ein Versprechen, dass sie ihm vor langer Zeit gegeben hat, endlich einlösen. Sie soll für ihn die alte, berühmte Holzmarionette eines Raben finden. Eine Spur führt nach Hiddensee, wo Siri das Gefühl hat, bei frischer Inselluft und langen Strandspaziergängen endlich wieder frei atmen zu können. Sie mietet sich in einer kleinen Pension ein – doch warum kommt ihr der charmante Pensionsgast Magnus so seltsam bekannt vor? Mehr und mehr hat sie den Verdacht, dass Felix ihr einiges aus seinem Leben verschwiegen hat. Ein Hinweis auf den Raben führt Siri weiter nach Prag zum alten Besitzer eines Marionettenladens, doch dort begreift sie, dass sie erst die Geheimnisse der Vergangenheit lösen muss, wenn eine neue Zukunft möglich sein soll …
Über die Autorin:
Monika Detering wollte Schiffsjunge, Malerin oder Schriftstellerin werden. Als Puppenkünstlerin arbeitete sie u. a. in New York, Washington und Philadelphia, aber auch auf Langeoog, Juist und Spiekeroog. Jahre als freie Journalistin folgten. 1997 erschien ihr erster Roman, viele weitere folgten. Neben Romanen veröffentlichte sie Krimis, Kurzprosa und Sachbücher. Sie gewann zahlreiche Preise, u. a. mit der Kurzgeschichte »Herrin verbrannter Steine« den 1. Preis des großen Wettbewerbs für Frauen aus deutschsprachigen Ländern. Monika Detering ist Mitglied bei den 42erAutoren.
Monika Detering veröffentlichte bei dotbooks die drei Fälle von Kommissar Weinbrenner – »Herzfrauen«, »Puppenmann« und »Liebeskind« –, die auch im Sammelband »Liebesopfer« erhältlich sind, sowie ihren Spannungsroman »Bernd, der Sarg und ich«.
Bei dotbooks erscheint außerdem ihr Roman »Heimweh nach dem Leben«, der auch als Hörbuch bei Saga Egmont erhältlich ist.
Gemeinsam mit Horst-Dieter Radke veröffentlichte sie die Romane »Ein Sommer auf Hiddensee« und »Ein Sommer auf der Sanddorninsel« bei dotbooks.
Und zusammen mit Silke Porath veröffentlichte sie bei dotbooks den Roman »Das Geheimnis der Inselfreundinnen«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Dieses Buch erschien bereits 2017 unter dem Titel »Der Sommer des Raben« bei edition oberkassel Verlag Detlef Knut, Düsseldorf
Copyright © der Originalausgabe © edition oberkassel, 2017
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / Marvin sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-211-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Monika Detering
Das Versprechen eines Lebens
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
In diesem Sommer starb Felix, an einem Tag, als die Hitze glühte und das Gras verbrannte. In einem Sommer sind wir uns das erste Mal begegnet, damals waren wir uns sicher, dass nichts uns trennen könnte.
Und ich hatte Schuld an seinem Tod.
***
Ich buk Brötchen auf und mahlte Kaffee. Erst sein Duft brachte mich zur Besinnung. Verwirrt stellte ich alles Geschirr zurück, hastete hin und her, wollte vor dem Schmerz wegrennen und glaubte, solange ich in Bewegung bliebe, könnte meine Unrast Felix’ Tod auf Abstand halten.
Noch.
Bis zu jenem Moment, in dem die Geräte abgeschaltet wurden, bis zu dem Augenblick davor, an dem sein Herz immer langsamere Schläge tat, hatte ich mich an der Hoffnung festgeklammert. Ich war nicht vorbereitet auf die Leere, die mich jetzt umgab.
Ich rannte in den Garten, blieb stehen, sah . oben und entdeckte auf einem Schornstein zwei Störche in ihrem Nest. Fast wollte ich Felix anstoßen und ihm die Vögel zeigen. Ich ging zum Birnbaum, wo ein alter Küchentisch stand; da hat er oft gesessen. Egal bei welchem Wetter. Auf der staubigen Tischplatte lag die dunkle Feder eines Vogels. Ich nahm sie hoch, pustete sie in die Luft und fing an zu weinen.
Die letzten Wochen haben meine Erinnerungen zerschnitten. Nichts passte mehr zusammen. So war es auch gewesen, als ich noch hoffte, Felix würde wieder gesund. Im tiefsten Innern wusste ich aber, er würde es nicht.
Jeden Tag fuhr ich zum Krankenhaus, jedes Mal mit der Hoffnung, heute würde es ihm bessergehen.
Nichts wurde besser. Die Nachbarn erkundigten sich, auch Mara, meine Freundin, kam oft. Die Tage vergingen, ich nahm sie kaum wahr, es gab nur diesen einen Kreis, den ich um Felix gezogen hatte. Den Kreis seiner Zeit.
Ich vernachlässigte meine Arbeit. Stornierte Aufträge schob ich zur Seite, auch Nachrichten, in denen Kunden ihr Unverständnis mir gegenüber ausdrückten - kannten sie mich doch als sehr zuverlässig. Ich drängte alle Gedanken an den kommenden Ärger weg. Wie ein riesiger Mülleimer fühlte ich mich, der schluckte und schluckte, bis heute.
Ich starrte auf die Schmetterlingswiese, das Gras, auf den Tisch, hörte mich sprechen; meine Stimme war kratzig, vielleicht schrie ich, wahrscheinlich wie gestern auch. Denn Felix war tot.
Gestern war ich ein letztes Mal im Krankenhaus gewesen, um Felix’ Sachen einzupacken. Der Bestatter hatte den Leichnam schon abgeholt. Ein Abschied von meinen Hoffnungen, meiner Anspannung, und diesem wortlosen Kittel-und-Haube-Anziehen. Vor der Intensivstation hatte ich mich ein letztes Mal auf die Bank gesetzt. Daneben stand der Aschenbecher. Und wenn man aufstand, ins Weite guckte, sah man das Reichstagsgebäude.
Wieder sah ich die Szenen der letzten Tage vor mir. Hörte auch hier im Garten das Zischen des Sauerstoffs. Sah die Infusionsständer mit den durchsichtigen Beuteln. Wusste um immer neue Medikamente, die nicht mehr halfen. Dachte an den Atemschlauch. Er schien Felix gequält zu haben, seine Hände tasteten oft zum Hals, und die Augenlider flatterten blaugrau, wie jene seltenen Bläulinge, die es kaum noch gibt. Gehirnblutung. Dazu eine Lungenentzündung. Die Ärzte versetzten ihn ins künstliche Koma. Als sie ihn daraus zurückholen wollten ... sahen die Ärzte und ich nur die grauenhafte Panik in seinem Blick, als er wieder allein atmen sollte und es nicht konnte. Meist standen seine Augen offen und die nadelfeinen Pupillen wirkten wie Sterne entfernter Galaxien.
Ich sah mich am Waschbecken einen Frotteelappen anfeuchten, mit dem ich über Felix’ Gesicht wischte, es mit einem Handtuch abtupfen und die Haut eincremen. Seine Wangenknochen traten hervor, die Nase wurde spitz und die Falte zwischen Nase und den Mundwinkeln hatte sich vertieft. Ich erzählte ihm Komisches, hatte gelacht, wir haben immer viel zusammen gelacht. Ich erzählte aus jenen Tagen, in denen wir uns kennengelernt hatten. Und jeden Tag zog ich in diesen Frühsommertagen die Kunststofflamellen hoch, die das Zimmer verdunkelten. Er sollte die Sonne spüren.
Sein Herzschlag wurde schnell, viel zu schnell, wenn ich flüsterte: »Ich muss jetzt gehen.«
Sagte ich: »Ich schlafe diese Nacht in deinem Zimmer«, wurde er ruhiger. Nur, immer ging das nicht, ich musste zu Hause einiges tun. Meist aber tat ich zu Hause wenig, ich saß im Garten und fühlte mich wie gelähmt. Manches Mal schlief ich draußen, in der Hängematte, die Felix einmal von Birnbaum zu Birnbaum gespannt hatte. Es gab auch Abende, an denen ich die Sehnsucht nach Felix nicht auszuhalten glaubte und von intensiver, verrückter und atemloser Liebe mit ihm träumte.
An einem seiner letzten Tage erzählte ich, dass ich möglicherweise schwanger wäre, obwohl ich schon wusste, dass die Reaktion meines Körpers stressbedingt war. Außerdem fand ich mich mit neununddreißig Jahren zu alt für ein Kind. Ich hatte meinen Job - war als Agentin für außergewöhnliche und seltene Puppen neben der Arbeit am Computer viel zu viel auf Reisen. Und doch: In sehr ruhigen Momenten hatte ich ein gemeinsames Kind vor Augen.
Ich setzte mich ins Gras und zupfte an Gänseblümchen. Das erinnerte mich an den Moment, als ich auf das leere Bett mit dem Plastiküberzug geschaut hatte, dort stand und stand, als würde ich darauf warten, dass eine Krankenschwester käme und mir sagte, er komme gleich wieder.
Aber ich verließ das Krankenhaus mit Felix’ Sachen, fuhr durch die Stadt, landete in der Nähe des Ku’damms, parkte in der Bregenzer Straße und schaute an dem Haus Nummer fünf hoch, das mit der gut erhaltenen Vorkriegsfassade. Ich war davon überzeugt, einen Schatten vorauseilen zu sehen - Felix? Glaubte mich um Jahre zurückversetzt und dachte, wir seien eingeladen bei Fräulein Zuckschwert, die mit dem fetten Pekinesen.
Ich guckte auf die Namensschilder, und Fräulein Zuckschwert stand nicht mehr auf dünnem Papier in den goldglänzenden Blechfassungen. Aber in diesem Haus hatte ich vor Jahren gewohnt. Da war die Frau schon achtzig gewesen, wollte ›Fräulein‹ genannt werden, und den Köter mussten wir mit ›Herr Liebe‹ anreden.
Ich erinnerte mich an jenen Abend, an dem sie uns einlud ... Schon gab mein Gehirn einen geheimen Ort mit abgelegten Gerüchen frei, schon witterte ich Dill und eingelegte Gurken, den schweren Geruch des Herrn Lieber, der mit einem Handtuch auf einem Stuhl saß. Felix und ich hatten Hunger, aber wir waren nicht fähig, etwas aus dem dampfenden gusseisernen Topf zu nehmen. Nach diesem Abend begannen wir, in Brandenburg nach einem gemeinsamen Zuhause zu suchen.
Ich wollte mich nicht in der Vergangenheit verheddern, musste den Gerüchen entkommen, und fast meinte ich, ›Nun komm schon, Herr Liebe‹ zu hören.
Da raste ein neuer Gedanke durch meinen Kopf: Soll ich das Auto stehen lassen, ins Graffiti gehen, da an der Kreuzung Adenauerplatz und Ku’damm? Graffiti. Hier hatte Felix mir eine dreißig Seiten umfassende Liebeserklärung überreicht. In unserem ersten Jahr.
Nein. Das Graffiti konnte ich nicht aushalten. Und der Schatten, den ich noch eben als Felix gewähnt hatte, der war fort.
Ich fuhr aus der Stadt, fuhr, bis ich die Eingangsschilder von Wützow las, fühlte mich gerettet, hatte wieder nicht unser Haus betreten wollen, an diesem Sommertag, als die Birnen noch nicht reif waren und die Johannisbeeren einem, wenn man sich passend bückte, in den Mund fielen. Der Sommer an der Havel war hell und weit; alle Sommer würden nun tieflilablau aussehen.
Vor sechs Jahren waren Felix und ich hierhergezogen. Wützow.
Aalsteig 3. Als wir den rauchig bitteren Geruch der Räucheröfen in der Nase hatten, den Sisalgeruch der Havel, den Geruch der Birnen, der Äpfel, rannten wir wie ausgelassene Kinder durch die Straßen, blieben plötzlich stehen, blickten auf dieses Haus und auf das Schild »Zu verkaufen«. Wir sagten nichts, nickten und wussten: Das ist es, was wir haben wollten.
Sechs Jahre, vorgestern, gestern ... Seit zwei Tagen war Felix tot.
Ich schüttelte energisch den Kopf, kam wieder in der Gegenwart an, und mein Garten schien dichter geworden zu sein, als wollte er mich beschützen. Ich stand auf. Während ich meine Jeans abklopfte, von Erde und zerdrückten Gänseblümchen, hörte ich einen festen Schritt näherkommen. Meine Nachbarin. Jetzt nicht. Ich hätte ihr das sagen können, aber ich war zu müde, zu erschöpft, zu leer, um mit jemandem reden zu können. Durch die Hintertür ging ich ins Haus, es roch ungelüftet; ich holte mein Tagebuch und ging damit in Felix’ Büro. Früher war dieser Raum eine Räucherkammer gewesen. Die Wände strömten immer noch den Geruch nach Rauch und Feuer aus.
Ich schlug das Tagebuch auf. Fand sofort die Notizen, die an Felix gerichtet waren. »Wir hatten ein Paradies gefunden, einen Ort für Liebende, und du weißt, dass der Unfall auch deiner Eifersucht zuzuschreiben ist.«
Nein. Davon wollte ich nichts wissen.
Jetzt musste ich handeln, durfte weder träumen noch Erinnerungen nachhängen.
Ich musste Papiere zusammensuchen. In drei Tagen war die Verbrennung im Krematorium. Ich würde allein vor dem Sarg stehen. »Ich will verbrannt werden, wenn es so weit ist«, hatte er gesagt. Felix, der Glückliche. In zehn Tagen sollte die Trauerfeier in der Dorfkirche sein. Ich rief die Bestatterin an. Sie wollte mir die Trauerkarten bringen. »Die Endgültigkeit macht mir große Angst«, sagte ich.
»Möchten Sie mit einem Geistlichen sprechen?«
»Nein, auf keinen Fall.« Ich sprach sie auf den Grabstein an, sie sagte, den macht der Steinmetz, das hat noch Zeit, der Betrieb ist zwei Straßen vom Friedhof entfernt. Die Frau verströmte mit ihrer unaufgeregten Stimme Vertrauen. Endlich konnte ich auflegen.
Kurz danach konnte ich die Karten entgegennehmen; ich gab der Bestatterin die notwendigen Unterlagen. Bis nach Mitternacht ging ich durch unsere Zimmer und fand, sie begannen sich schon zu verändern. Ein vorübergehendes Alleinsein war etwas anderes als das für immer. Ich wusste auch, dass ich nicht schon wieder im Garten übernachten konnte, legte mich endlich in mein Bett, schlief einige Stunden und hatte einen jener Träume, von denen man nicht wusste: Sind sie real oder nicht? Ich war davon überzeugt, Felix neben mir gespürt zu haben. Mit einem beschwingten Gefühl erwachte ich. Und dann fiel mir alles wieder ein.
Duschen, anziehen. Sich bloß nicht gehen lassen. Ich redete auf mich ein, als sei ich eine Fremde, und hörte so lange ›Disziplin‹, bis ich daran glaubte. Nach einem starken Kaffee holte ich mir den Text für den Grabstein aus meiner Handtasche. Gestern hatte ich ihn notiert.
In der Mitte seines Sommers ging er, in der Mitte seinerzeit.
Ich fand ihn passend, wollte ihn aber auch mit Felix’ Eltern besprechen und rief in Hannover an. Endlich konnte ich mich überwinden. Ich musste den Eltern Bescheid sagen, ich zwang mich zu einer ruhigen Stimme, ich wollte nicht in den Hörer heulen. Ich kannte die beiden nicht persönlich. Nach einer langen Pause, in der Felix’ Eltern das Geschehene hörten, aufnahmen, nach einer langen Pause sagte Herr Hochhäuser: »Wir kommen morgen.« Ich sagte: »Sie können gern bei mir übernachten.« Felix’ Vater erwiderte: »Uns ist ein Hotel lieber.« Später, wir werden sehen.
Georg Hochhäuser kam allein. Mit seinem Menjoubärtchen sah er wie ein Darsteller in einem alten Film aus. Er brachte neben seinem Kummer, der deutlich zu sehen war, auch eine Liste mit den Anschriften der Verwandtschaft mit und Grüße von Mechthild, seiner Frau. »Sie kommt zur Einäscherung. Unser zweiter Sohn ist bei ihr, damit sie nicht allein ist.«
Ich hatte von der Existenz eines Bruders nichts gewusst. Fand das eigenartig, hatte keine Zeit zum Grübeln, guckte auf die Adressenliste, blickte den Vater an, in dessen Augen ich Ähnlichkeiten mit Felix fand.
»Ich möchte ihn nicht auf der Trauerfeier dabei haben«, sagte er.
Das klang wie eine Ohrfeige, und ich zuckte zurück. »Warum nicht?«
»Familiengeschichten.«
Ich schaute ratlos.
»Ich spreche vom Sohn meiner Frau. Er stammt aus ihrer ersten Ehe. Aber lassen wir das. Jetzt müssen wir zwei uns kennenlernen. Sie wären ja beinahe unsere Schwiegertochter geworden. Leider ist Felix in den letzten sechs Jahren kaum noch nach Hannover gekommen; warum hat er Sie nie mitgebracht? Erzählen Sie von Felix, aus der Zeit vor dieser Krankheit, aber es war ja ein Unfall? Und warum haben Sie uns nicht eher benachrichtigt?« Letzteres blieb zwischen uns stehen und ich fühlte mich unbehaglich, sagte: »Später«, legte meine Bitte in das Wort, damit er verstand, dass ich es jetzt nicht konnte.
Georg Hochhäuser blickte streng, prüfend und sehr traurig.
»Sie möchten alle einladen?«, fragte ich. »Ob Felix das so gewollt hätte? Und ich kenne niemanden. Worüber soll ich mit fremden Tanten und Onkeln, Nichten und Neffen sprechen?«
»Über meinen Sohn. Das ist doch ganz einfach. Es ist selbstverständlich, dass unsere Familie bei der Trauerfeier dabei ist. Wir müssen uns noch ein Lokal für danach aussuchen.«
Ich führte den alten Mann herum. Er mochte nicht in unser Haus kommen. »Später, gerne, zusammen mit Mechthild. Ich muss Sie erst kennenlernen. Der Text für den Grabstein wird Mechthild gefallen, mir ist er zu bombastisch, aber machen Sie nur – und ja, geben Sie eine Anzeige in der Zeitung auf.« Er gab weitere Anweisungen, in einem Ton, als sei ich eine Bedienstete. Trotzdem mussten wir gemeinsam vorbereiten. Dass ich manches anders getan hätte, das behielt ich für mich. Georg telefonierte mit seiner Frau, es wurde ein langes Gespräch mit vielen Pausen. Danach war er sehr in sich gekehrt und sagte mir etwas später: »Ich muss nachher zurückfahren. Mechthild ...« Ich sah Tränen in seinen Augen.
Abends rief ich Hochhäusers an. Nach stockenden Sätzen übernahm Mechthild das Gespräch, brachte einen familiären Ton ein, in dem mitschwang: »Du weißt doch ...« Am Ende des Gesprächs bat sie mich, das Adressenschreiben zu übernehmen. »Vergessen Sie dabei bitte nicht die Annsophie – Name und Adresse stehen auch auf dem Papier, das Sie von Georg bekommen haben. Bitte schreiben Sie ihn zusammen, sie ist eigen mit ihrem Vornamen. Ja, die Annsophie«, seufzte Mechthild. Ich wollte gerade fragen: »Was ist an der so wichtig?«, da ergänzte Mechthild: »Sie war einmal Felix’ Freundin, auch sie wäre fast unsere Schwiegertochter geworden. Die beiden waren damals sehr glücklich.«
Den Hinweis hätte sie sich sparen können. Gab es Regeln, im Todesfall Exgeliebte benachrichtigen zu müssen? Annsophie zusammengeschrieben, klang nach einer ätherisch blassen Erscheinung. Von Verflossenen wollte ich nichts wissen, und bestimmt nicht, ob Felix mit der Frau ›glücklich gewesen war‹.
Keiner muss alles aus dem Leben des anderen wissen.
›Sonst wären wir ganz ohne Geheimnisse. Unsere Zukunft ist jetzt, darin liegt alle Vergangenheit‹.
Schöne Worte von Felix, mit denen ich jetzt nichts anfangen konnte. Eins aber wusste ich: Die Zusammengeschriebene wollte ich nicht auf der Trauerfeier sehen.
Die Anzeige in der Märkischen Allgemeinen hatte ich aufgegeben. Ich hatte kuvertiert und beschriftet, brachte manche Briefe auch persönlich vorbei, warf bei Lisabeth und der dicken Doris ein, bei Jutta Clössens, die bestimmt in der Räucherei war. Diese Frauen standen mir nah.
Und Annsophie? Die kann mich mal
Kapitel 2
Hochhäusers kamen nicht. Georg hatte mich früh angerufen und gesagt, dass Mechthild vor Kummer derart erschöpft sei, dass sie nur noch weinte und der Arzt zu ihnen unterwegs war.
Deshalb war ich noch einmal mit Felix allein.
Ein letztes Mal blickte ich in den Sarg, sah den Toten, und das schief gezogene Lächeln war fremd. Ich redete mir auch nicht ein, dass er aussah, als würde er schlafen. Ich legte meine Hand gegen seine Wange, zuckte zurück ob der Kälte, einer Kälte wie Stein und schwer auszuhalten. Gedanken sprangen wie Gummibälle, dabei wollte ich mich doch auf diesen Abschied konzentrieren und konnte es nicht. Ich legte dem Toten jenen dreißigseitigen Liebesbrief auf die Brust, er sollte ihn mitnehmen; ich musste mich davon lösen, sonst würde ich immer wieder in der damaligen Zeit stecken bleiben.
Ich nickte dem Mann vom Bestattungsinstitut zu. Er schloss den Sarg. Bald würde von der Leiche nicht mehr viel übrig sein. Die Einbringung des Sarges in den Verbrennungsofen war trotz allem Wissen darum schlimm. Ich hatte den Impuls, hinterherzurennen – und dann schlossen sich die Türen des Ofens.
Ich ließ mehrere Lieder spielen, dachte: »Er kann sie doch nicht hören, nie mehr.« Sie waren mein ureigener Trost.
Später fuhr ich zum Steg, saß unter Reusen und Fischernetzen, der Holunder zeigte grüne Früchte. Wimpel flatterten, der Fluss glitzerte, ich merkte, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, holte Butterfisch und Brot, dazu starken, bitteren, knallheißen Kaffee, heulte, trank, heulte, ging mit dem Teller und der Tasse vorsichtig balancierend zurück zum Steg. Setzte mich, stellte alles neben mich und aß. Langsam wurde es mir besser, das Schwindelgefühl verschwand. Ich achtete nicht auf Leute, die redeten, kamen und gingen, ich blickte auf das Wasser, und das Holz unter mir knarrte.
Es gab noch so viel zu tun. Aber ich wollte jetzt nicht Stunde um Stunde mit Aktivitäten füllen. Telefonieren und mit den anderen sprechen, mit denen, die Felix hier in Wützow gekannt hatten.
»Mein Beileid«, sagte eine Stimme neben mir. Ich blickte hoch. Es war der Betreiber des Imbissstandes. Ich stand auf und gab ihm die Hand. Ich sagte irgendetwas, an das ich mich schon fünf Minuten später nicht mehr erinnerte.
»Hier haben Sie beide oft gesessen«, sagte der Mann noch. »Sie waren ein schönes Paar. Ich geh denn mal wieder, muss was tun ...«
Eine Krähe zankte sich mit einer Möwe um Brotreste. Wütendes Kreischen und ärgerliches Schimpfen. Während ich zuschaute, geriet ich wieder in die Vergangenheit.
Ich erinnerte mich an Momente, in denen Felix in sich gekehrt gewirkt hatte. Wie meist war sein Schreibtisch mit Papieren überfüllt gewesen. Aber das alles war nicht wichtig – Felix hatte mich einige Male irritiert; er telefonierte und legte, als er mich in sein Büro kommen sah, hastig den Hörer auf. An eine andere Frau hatte ich nicht dabei gedacht. Eher an seine komische Angewohnheit, nur allein telefonieren zu können. Ich hatte auch jedes Mal daran gedacht, dass er vielleicht mit der Suche nach jener geheimnisvollen Rabenmarionette weitergekommen wäre und mich überraschen wollte ...
Schon sah ich vor meinem inneren Auge die Brücken und Häuser von Prag, ich dachte an Pavel Smutný, an seinen kleinen Laden in der Lumirova. Felix hatte bei einem Straßenhändler Maronen gekauft, und während ich wartete, entdeckte ich diese Werkstatt. Ich zeigte auf das kleine Fenster, auf die Figuren, wir hatten den gleichen Gedanken – wie oft. Mit den Tüten, die bis obenhin mit heißen Maronen gefüllt waren, rannten wir über die Straße und tauchten ein in die faszinierende Welt der Marionetten; wir waren so schnell, als hätten wir Angst, etwas zu verlieren.
Seltsam war das schon gewesen.
Wir waren vom ersten Augenblick angefangen, sahen Köpfe, die dicht an dicht zum Trocknen aufgehängt waren; unter der Zimmerdecke drehten sich Fantasiegeschöpfe mit tiefgründigen Blicken, unheimlich und schön.
Wir wurden von einem kleinen schmalen Mann angesprochen, der einigermaßen gut deutsch sprach. Er stellte sich vor: »Pavel Smutný.«
Wir hatten ja keinen besonderen Wunsch, wir wollten einfach nur gucken, staunen, bewundern. Der Besitzer des Ladens, der auch eine Werkstatt hatte, wie er uns stolz sagte, zeigte uns ein altes Marionettentheater aus Böhmen. Auf der Außenseite des Vorhangs war ein Panoramablick mit der Karlsbrücke und dem Hradschin gemalt, im Vordergrund war der Böhmische Löwe zu sehen. Auf der anderen Seite stieg Apoll aus dem Sonnenwagen herunter zum Parnass, wo ihn die Musen erwarteten.
Pavel Smutný erklärte stolz, dass die dazugehörenden Marionetten aus Holz geschnitzt waren und er über 700 verschiedene Garderoben zum Ausstatten der Puppen in einem Nebenraum lagerte. Ich war schon weitergegangen, fand einen Drachen mit Leuchtaugen, wollte ihn Felix zeigen, aber er winkte ab und ich sah, wie er ganz hinten, in einer fensterlosen Nische, stehen geblieben war.
Hier hingen große Fotografien. Auf allen war dieselbe Marionette abgebildet: ein blauschwarzer Rabe mit schwarzem Schnabel, mit Augen, die um die Ecke zu schauen schienen, mit hintergründigem Blick, selbstbewusst und hoheitsvoll. Auch ich betrachtete den Vogel aufmerksam, sah die feinen Gelenke, den klugen Gesichtsausdruck. Felix stellte sich dazu. »Den muss ich haben.« Aufgeregt winkte er Pavel Smutný herbei. »Wo haben Sie den Vogel im Original? Ich will den sehen, ich will ihn kaufen. Unbedingt!«
Der Mann schien vor Verlegenheit fast zu schrumpfen und sagte dann voller Eifer: »Gerade diese Marionette wurde mir gestohlen, es tut mir wirklich leid, mein Herr. Aber kommen Sie mit in meine Werkstatt, ich habe viele interessante Stücke.«
Stur hatte Felix auf dem Raben beharrt. »Ich muss ihn haben. Der soll in unserem Haus wachen.«
»Der Raben Bad und der Huren Beichte sind unnütz«, antwortete Pavel.
»Der Rabe lässt das Stehlen nicht«, zitierte Felix. »Ich glaube nicht, dass er Ihnen gestohlen wurde.«
»Was den Raben gehört, ertrinkt nicht«, konterte Pavel. »Aber Sie müssen mir schon glauben, mein Herr. Er wurde gestohlen. Aber – ich kann Ihnen einen ganz nach Ihren Wünschen arbeiten. Wenn Sie das nächste Mal in Prag sind, können Sie ihn abholen.«
»Ich will diesen Raben und keinen Ersatz. Bitte! Ich zahle gut.«
Ich hatte mich über die plötzliche Faszination gewundert. Davon hatte ich nichts gewusst. Und die Zitate. Die kannte ich auch nicht. Ach Felix. Wie gut habe ich dich wirklich gekannt?
Ich hatte den Vogel auch interessant gefunden, aber mehr aus der Sicht meines Jobs. Ich wusste viel über alte und neue Sammlerstücke. Und für Tiermarionetten hatte ich eben auch meine Kunden.
Ich erhielt die Aufträge zum Suchen und Finden. Wie zum Beispiel die Suche nach ›Ame-uri‹, den ›Süßigkeitenverkäufer‹, einer fein modellierten Jünglingsfigur, die an einem Schulterriemen einen Holzkasten mit Süßigkeiten trug. Ein Japaner, der seit Jahrzehnten in Flensburg wohnte, hatte sich so diese Figur gewünscht – und ich fand sie in einer Berliner Galerie. Die Figur war eine Erinnerung an seinen Vater gewesen. Wie oft hatte ich erlebt, dass gerade Figuren, Puppen und Marionetten in manchen Menschen Geschichten aufbrachen, die ansonsten tief versteckt in ihnen waren.
Damals hatte ich gedacht: »Was versteckst du, Felix? Warum musst du gerade diesen Raben und keinen anderen haben?«
Ach. Der Rabe, der einfach nur ›Havran‹ hieß ...
Das Wasser unter dem Steg gluckste. Ich war hier, in Wützow, sah die Vögel über mir, hörte ihr Lärmen und dachte mit Wehmut an Prag. Ich wollte sitzen bleiben. Ich stand auf und fühlte mich seltsam schwer.
***
Felix’ Eltern wollten das Prozedere der Anzeige regeln. Wir telefonierten, ich sprach mit Georg. Fragte, ob er die Familie und mich oder auch die weitere Verwandtschaft aufführen wollte.
»Als was sollen wir Sie denn angeben?«, fragte Georg.
»Als seine Lebensgefährtin. Als was sonst?«
»Wir sind da eher konservativ. Wenn Sie wenigstens ein Kind miteinander hätten. Wissen Sie, wie sehr wir uns nach einem Enkelkind gesehnt haben? Aber die Frauen von heute kümmern sich kaum noch ums Kinderkriegen. Ich denke, Sie machen Ihre Anzeige, und wir unsere. Wir lassen auch eine in der ›Hannoverschen‹ erscheinen. Liebe Siri, nehmen Sie es mir nicht übel. Wäre ich jünger, würde ich vielleicht moderner denken. Aber – ich bin einundachtzig. Im Alter wird man so. Wir hätten es gern gesehen, wenn unser Sohn« – da fing er an zu schluchzen, »geheiratet hätte. Sie sind ja viel unterwegs mit Ihren Puppen, hatte uns Felix erzählt. Und er saß mit seinen Vaterschafts- und Gerichtsgutachten zu Hause. Mein Sohn hätte sehr viel mehr aus seinem Leben machen können. Er war so klug.« Georg seufzte. »Wenn wir kommen, dann möchten wir sein Haus gerne sehen – damit wir wissen, wie er gewohnt hat.«
Nach einer Pause, sagte er einen Hauch versöhnlicher: »Nehmen Sie die Worte eines alten Mannes nicht übel.« Wieso sein Haus? Es gehörte uns beiden. Es gehört jetzt mir.
Um dieses Gespräch abzuschütteln, gab ich meine Anzeige auf. Danach telefonierte ich mit einigen Kunden, erklärte meine Situation und bat um Verständnis. Ich versprach, ohne zu wissen, ob ich Zusagen einhalten konnte, mich so schnell wie möglich um die Aufträge zu kümmern.
Alle Briefe waren aufgegeben, auch der an die Zusammengeschriebene, an Annsophie. Gegen Abend betrat ich Felix’ Büro.
»Hast du noch was mit ihr gehabt, seitdem wir zusammen sind?« Ich stand vor seinem Schreibtisch und glaubte, dass sich sein apfelgrüner Drehstuhl empört herumschwang, soweit ein Drehstuhl Empörung zeigen konnte. Erschrocken blieb ich stehen. »Felix?«, flüsterte ich. »Felix?«
So etwas schien es ja wohl zu geben, eine Art atmosphärische Verdichtung; vielleicht konnten die Seelen der Toten sich manchmal nicht aus ihrer angestammten Umgebung lösen ...
»Siri Nilsdotter«, sprach ich mich selbst laut und streng an, »du fängst an, durchzudrehen!«
Der Stuhl schwang ganz leicht hin und her. Der Geruch des Zimmers wurde intensiver als sonst. Rauch und Feuer.
Das hatte es auch im Krematorium gegeben.
Ich hörte das Klappen eines Fensterflügels.
***
Auch in dieser Nacht schützten mich Träume. Felix hielt mich an der Hand, wir standen auf einer Brücke über der Moldau, dabei wusste ich, dass es die Havel war; wir hatten gesprochen und mit einem Mal breitete Felix die Arme wie Flügel aus und schwebte, ohne sich nach mir umzudrehen, davon, über den Fluss, flog, bis ihn Wolken umschlossen, ich aufwachte und seinen Namen schrie.