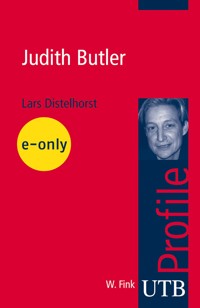Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Keine Frage – in Kunst und Kultur und der Entwicklung der Menschheit überhaupt hat es immer Übernahmen und Aneignungen von Techniken, Fertigkeiten, Motiven usw. gegeben. Man lernt ja voneinander. Doch darum geht es hier nicht. Kultureller Austausch ist etwas anderes als kulturelle Aneignung. Lars Distelhorst schreibt aus der selbstreflektierten Perspektive eines Weißen über einen aktuell so populären wie unzureichend theoretisierten Begriff, der ein bemerkenswertes Affektpotenzial hat: Ob es um Faschingskostüme oder um Dreadlocks geht, um Soulmusik oder Yoga – die Diskussion kocht sehr schnell hoch. Distelhorst veranschaulicht zunächst anhand der Reaktionen auf die Empfehlung einer Hamburger Kita im Jahr 2019, die Kinder zum Fasching nicht als "Indianer" zu verkleiden, und eines kurzen Abrisses der deutschen Kolonialgeschichte den Zusammenhang zwischen Mikro- und Makroebene von kultureller Aneignung. Er setzt sich mit verschiedenen Definitionen des Begriffs auseinander, vor allem mit dem oft unterstellten Zusammenhang mit essenzialistischen Kulturkonzeptionen, und analysiert drei Dimensionen der Aneignung: kolonialen Kulturraub, ungefragte Repräsentation anderer Kulturen und Konsum von Kultur als Ware. Schließlich verknüpft Distelhorst kulturelle Aneignung mit einer kapitalismus- und rassismuskritischen Perspektive, um das Konzept für die Kritik von Dominanzverhältnissen fruchtbar zu machen, und lotet aus, was Antirassismus für weiße Menschen bedeuten kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARS DISTELHORST, geboren 1972 in Georgsmarienhütte, hat an der Universität Bremen Politikwissenschaft studiert und promovierte an der Freien Universität Berlin über Geschlechterpolitik. Er ist Professor für Sozialwissenschaft an der Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam und lebt in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm Kritik des Postfaktischen. Der Kapitalismus und seine Spätfolgen (Fink 2019) und Leistung. Das Endstadium der Ideologie (transcript 2014).
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus GmbH 2021
Deutsche Erstausgabe September 2021
Umschlaggestaltung: Maja Bechert
www.majabechert.de
Satz: Corinna Theis-Hammad
www.cth-buchdesign.de
Porträt des Autors auf Seite 2:
© Die Hoffotografen GmbH
2. Auflage September 2022
ePub ISBN 978-3-96054-269-8
Inhalt
Einleitung
Kita und Kolonialismus
Deutsche Alltagsszenen
Erinnerung an den Kolonialismus
Zwischen den Extremen
Definitionen kultureller Aneignung
Vom Essentialismusproblem …
… zum Transkulturalitätsproblem
Dimensionen der Aneignung
Koloniale Beutekunst
Geraubte Repräsentationen
Supermarkt der Kulturen
Identität und Hegemonie
Identität und Identitätspolitik
Der Kampf um Hegemonie
Noch einmal zur Definition
Kulturelle Aneignung und Kapitalismus
Kommodifizierung der Kultur
Sinn- und Bedeutungsverlust
Ausgehöhlte Identitäten
Rassistische Begehrlichkeiten
Race und Rassismus
Die Macht der Strukturen
»Das machen doch alle«
Weißer Antirassismus
Zwischen Allyship und Privileg
Selbstachtung und Verzicht
Was bleibt?
Anmerkungen
Literatur
Danksagung
Am Ende steht immer nur ein Name drauf, aber Bücher werden nur selten von einem Menschen allein geschrieben. Ich danke meiner Familie, meinen Freund*innen, Kolleg*innen und Studierenden, mit denen ich immer wieder über dieses Buch und die darin erörterten Themen diskutiert habe. Mein Dank gilt vor allem auch meinen Lektorinnen Katharina Picandet und Katharina Bünger, ohne deren engagierte Arbeit das Buch nicht das geworden wäre, was es nunmehr ist.
Einleitung
Wenn meine Studierenden mich fragen, ob sie ihre Hausarbeiten in der Ichform schreiben können, rate ich ihnen in den meisten Fällen ab. Das Ziel des Schreibens über gesellschaftliche und politische Fragen sollte darin bestehen, Aussagen und Argumente mit überindividueller Gültigkeit zu formulieren, schließlich verhandeln wir in solchen Auseinandersetzungen Fragen, die eine Vielzahl von Menschen betreffen und nicht nur uns selbst. Geben wir diesen Anspruch auf, funktionieren unsere Gespräche irgendwann nur noch so, als würden wir uns darüber unterhalten, ob wir Hunde oder Katzen lieber mögen.
Mit Blick auf dieses Buch wäre es allerdings vermessen, sich auf eine universelle Position zurückzuziehen und zu behaupten, es käme immer nur auf die Qualität der Argumente an, nicht aber darauf, wer sie von welchem Ort aus formuliert. Das Thema kulturelle Aneignung ist ebenso tief in die Dynamik des Kapitalismus wie in die des (Post-)Kolonialismus und Rassismus eingebettet und verweist damit auf einen Graben, diesseits und jenseits dessen sich das Leben für Menschen sehr unterschiedlich gestaltet, insofern die einen Privilegien erfahren, wo die anderen diskriminiert werden. Oder einfach ausgedrückt: Als nicht-weißer Mensch, also als BIPoC (Black, Indigenous, People of Color), über ein solches Thema zu schreiben, ist etwas anderes, als es als weiße Person zu tun. Deswegen möchte ich am Anfang ein wenig über mich selbst sagen und wie ich auf die Idee zu diesem Buch gekommen bin.
Ich bin ein weißer Mann Ende vierzig. Politisch halte ich an der Möglichkeit einer Welt jenseits von Kapitalismus und Rassismus fest, in der Menschen frei von Ausbeutung, Entfremdung und Diskriminierung zusammen ihr Leben gestalten und dabei lebendige soziale Beziehungen führen können. Marx hat dies in der zum Bonmot gewordenen Formulierung aus Diedeutsche Ideologie eine Welt genannt, in der es möglich sei, morgens dies und abends das zu machen, zu jagen, zu fischen und Viehzucht zu treiben oder nach dem Essen zu kritisieren, ohne dabei jemals Jäger*in, Fischer*in, Hirt*in oder Kritiker*in zu werden.
Und hier fangen die Probleme an. Auf Marx bin ich früh gestoßen, habe in jungen Jahren Lektürekurse besucht und mich zusammen mit anderen durch Das Kapital gebissen. Kapitalismuskritik hat meine intellektuelle Biografie stets begleitet. Aber wie war das mit Rassismuskritik? Rassismus habe ich stets als Unrecht kritisiert, zumindest im Rahmen meiner damaligen Möglichkeiten, die sich in Umfang und Reflexionsniveau gegenüber meiner Kapitalismuskritik mehr als bescheiden ausnahmen. Dass ich als Linker kein Rassist sein konnte, war für mich lange Zeit eine ausgemachte Sache, über die ich mir entsprechend wenig Gedanken gemacht habe. Bis ich dann irgendwann anfing, diese Selbstverständlichkeit infrage zu stellen und mich näher mit Rassismus auseinanderzusetzen.
Das war und ist nicht unbedingt eine schmeichelhafte Angelegenheit. Ich kann mich noch sehr genau an meine erste Lektüre des Buches Deutschland Schwarz Weiß1 der afrodeutschen Autorin Noah Sow erinnern. Wer das Buch nicht kennt, aber es zu lesen plant, sollte diesen Absatz vielleicht am besten überspringen. Die Autorin veranstaltet zu Anfang ihres Buches ein kleines Ratespiel zur Frage, wo sie als Schwarzer Mensch denn eigentlich »wirklich herkommt«. Dazu schreibt Sow, es gebe in ihrem Land schon seit einiger Zeit eine Episode stabiler Demokratie, auch Telefonanschlüsse seien mittlerweile fast überall zu finden und von den vielen Dialekten sei einer zur Amtssprache ausgewählt worden. Das Land ist – Deutschland. Bin ich auf die Antwort gekommen? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil kramte ich in meinem Kopf nach Namen afrikanischer Länder, auch wenn ich kaum welche kannte. Bei einem Rassismusworkshop ein paar Jahre und Bücher später wurden wir gebeten, aus einer langen Liste von Adjektiven diejenigen auszuwählen, die für unser Leben besonders wichtig seien. Habe ich das in der Liste enthaltene Wörtchen »weiß« angekreuzt? Natürlich nicht. Schließlich war das für mich normal.
Was ich mit Beispielen wie diesen sagen will, ist nicht, wie sehr ich mich schäme, denn Scham bringt einen hier nicht wirklich weiter, auch wenn sie in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus nicht vermieden werden kann. Sondern: Kann man in einer massiv von Rassismus geprägten Gesellschaft aufwachsen, die sich durch eine kaum aufgearbeitete Kolonialgeschichte auszeichnet und die Erinnerung an den nationalsozialistischen Holocaust im Namen einer Schlussstrichmentalität langsam zur Seite legt, kann man in einer solchen Gesellschaft aufwachsen, ohne von rassistischen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsmustern geprägt zu sein? Angesichts dieser Frage gibt es kein Taktieren. Die Antwort lautet schlicht und einfach: Nein. Diesen Mist wieder aus dem Kopf zu bekommen, setzt als allererstes voraus, zu erkennen, wie tief man als weißer Mensch des globalen Nordens in ihn verstrickt ist, gerade wenn man Rassismus ablehnt und sich als Linke*r bezeichnet.
Das betrifft auch kulturelle Aneignung. In meinen Zwanzigern trug ich Dreadlocks, die mir bis über den Hintern reichten, und ließ mir als Belohnung für die Beendigung meines Studiums ein großes Tribal auf den Oberarm stechen. Noch vor zehn Jahren hätte ich in keinem von beidem ein Problem gesehen. Ich wanderte voll Bewunderung durch das Pergamon- und das Ägyptische Museum in Berlin, ohne mich zu fragen, wo die Exponate eigentlich herkommen (angesichts der Anwesenheit eines ganzen Stadttores eine reife Leistung) und ergriff durchaus auch mal beherzt das Wort, um im Namen unterdrückter Minderheiten zu sprechen (oder im Namen von Menschen, die ich dafür hielt), weil ich mich in sie hineinversetzen zu können glaubte. Die Dreads habe ich mir mit Ende zwanzig abgeschnitten. Tattoos sind leider etwas hartnäckiger. Ins Museum gehe ich noch immer, habe heute aber eher das Gefühl, durch eine Beutekammer zu wandeln, und bevor ich mich im Namen anderer zu Wort melde, denke ich mittlerweile (hoffentlich) länger nach als früher oder halte auch einfach mal den Mund.
Bewusst mit dem Thema »kulturelle Aneignung« konfrontiert wurde ich das erste Mal 2016, als ich im Internet über den Artikel Fusion Revisited: Karneval der Kulturlosen von Hengameh Yaghoobifarah stolperte,2 der die Diskussion in Deutschland wesentlich mit angestoßen hat. Da dieser noch ausführlich besprochen werden wird, an dieser Stelle nur ein paar kurze Worte: Yaghoobifarah, iranisch-deutsch, gewinnt ein Ticket für die Fusion (ein großes Festival für elektronische Musik), stößt dort an jeder Ecke auf kulturelle Aneignung in all ihren Spielarten und kritisiert das mit überaus deutlichen Worten. Mein Urteil stand damals schnell fest – und es war so unberechtigt wie von ungetrübter Weißheit: Der Artikel war in meinen Augen von einem im Kern rassistischen Kulturverständnis getragen, und deswegen Teil des Problems und nicht der Lösung. Ich fühlte mich sehr im Recht, klopfte mir für meinen Antirassismus auf die Schulter und befand mich zudem in Gesellschaft vieler anderer weißer Menschen mit der gleichen Auffassung. Doch irgendwie konnte ich den Artikel nie wirklich ad acta legen. Er ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Meine feste Überzeugung, ein Antirassist zu sein, hielt mich davon ab, den Artikel sauber zu durchdenken, weil ich ihn dazu auch auf mich beziehen musste, was mir lange Zeit wirklich schwerfiel und noch in der ersten Niederschrift dieses Buches Probleme machte.
Bin ich also in alles verstrickt, worüber ich hier schreibe? Sicherlich. Gerade deswegen schreibe ich dieses Buch. Vielen weißen Menschen dürfte es ebenso gehen wie mir: In der festen Überzeugung, Antirassismus verstünde sich von selbst, verdrängen wir für uns unangenehme Fragestellungen und machen uns zu Kompliz*innen des täglichen Rassismus. Gerade in vermeintlichen »Kleinigkeiten« wie Prozessen kultureller Aneignung klebt der Rassismus an uns wie altes Kaugummi und wir weisen alle Vorwürfe von uns. Kulturelle Aneignung? So ein Quatsch. Als ob irgendein Schwarzer Mensch in den USA weniger von der Polizei verprügelt wird, wenn ich mir hier die Dreadlocks abschneide. Noch vor wenigen Jahren hätte dieses Argument durchaus von mir sein können. Sollte ich als weiße Person also ein Buch über kulturelle Aneignung und damit auch über den Zusammenhang zwischen Rassismus und Kapitalismus schreiben? Schließlich bin ich von kultureller Aneignung ebenso wenig betroffen wie von Rassismus. Sollten weiße Menschen nicht besser einfach den Mund halten und zuhören? Doch das kann auch zu einer bequemen Haltung verkommen, in der sich hinter scheinbar achtsamem Zuhören die Gleichgültigkeit versteckt und langsam wieder auf Normalbetrieb umschaltet. Nein, weiße Menschen können sich nicht darauf beschränken, sich von Schwarzen Menschen und People of Color ihren Rassismus erklären zu lassen, sondern müssen selbst eine Haltung zu dieser Problematik entwickeln und verstehen, was Rassismus auch mit ihnen macht. Schließlich ist Rassismus eine weiße Erfindung und wird maßgeblich von weißen Menschen aufrechterhalten.
Doch es ist nicht nur die eigene Rolle, die es als weißer Mensch zu beachten gilt. Nicht von Rassismus betroffen zu sein, bedeutet, erkenntnistheoretisch betrachtet, vor einem Graben zu stehen, der nicht zu überwinden ist und große Bedeutung für die Frage hat, was man als weiße Person eigentlich wissen, sagen und schreiben kann. Ich werde aufgrund meiner Race niemals verstehen können, wie sich Rassismus anfühlt und kann mir das auch nicht ausreichend aus anderen Diskriminierungserfahrungen wie beispielsweise Klassismus herleiten, weil diese aller scheinbaren Parallelen zum Trotz letztlich eben anders funktionieren (man kann die Klasse z. B. durch sozialen Aufstieg wechseln). Aber auch jedem weißen Menschen ist die Erkenntnis zugänglich, dass Rassismus Menschen massiv beschädigt und im Zweifelsfall tötet. Es gilt also im Sprechen und Schreiben über Rassismus aus weißer Sicht eine sehr heikle Grenze zu beachten: Als weißer Mensch kann man wissen, welche objektiven Konsequenzen Rassismus hat, nicht aber wie diese sich auf subjektiver Ebene anfühlen. Ich habe mich beim Schreiben dieses Buches sehr bemüht, diese Grenze zu wahren.
Doch was ist denn nun eigentlich kulturelle Aneignung? Im weiteren Verlauf des Buches werden einige Definitionen des Begriffs eingehend analysiert, und es wird auch eine eigene Definition entwickelt, weswegen an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden soll. Eine einleitungstaugliche Arbeitsdefinition könnte aber lauten: Als kulturelle Aneignung wird gemeinhin ein Vorgang verstanden, bei dem Menschen aus einer dominanten Kultur sich, ohne die Haltung der Betroffenen dazu zu beachten, Kulturelemente aus einer diskriminierten oder unterdrückten Kultur aneignen, wodurch deren Bedeutung verschoben oder verflacht wird. Falls sich während der Lektüre des Vorhergehenden jemand gewundert hat, warum kulturelle Aneignung über den Rassismus hinaus auch mit dem Kapitalismus verknüpft wurde, wird dies durch die gegebene Definition vielleicht ein wenig deutlicher. Was das Machtgefälle zwischen der »Dominanzkultur«3 und der unterdrückten Kultur begründet, ist die Geschichte des Kolonialismus und Kapitalismus, deren wesentliche Säule stets der Rassismus war, sei es als Legitimation von Herrschaft oder zur Erklärung von Ungleichheit (der Zusammenhang dieser Begriffe wird im Laufe des Buches deutlich herausgearbeitet werden).
Dementsprechend hat die Debatte um kulturelle Aneignung ihre Ursprünge in der postkolonialen Theorie. In Aufsätzen über kulturelle Aneignung wird öfter der 1976 auf einer Konferenz der »Association Internationale des Critiques d’Art« als Vortrag gehaltene Aufsatz Some General Observations on the Problem of Cultural Colonialism des britischen Kunstkritikers und -professors Kenneth Coutts-Smith als eine der ersten dezidierten Auseinandersetzungen mit der Problematik genannt.4 Der Aufsatz spannt einen großen geschichtlichen Bogen und endet mit dem Plädoyer für die Etablierung eines neuen Forschungsprogramms. Ein genauer Blick ist sehr lohnenswert, da in den Ausführungen des Autors so ziemlich alles vorweggenommen wird, was auch heute noch für die Debatte um den Begriff kulturelle Aneignung zentral ist. Coutts-Smith schreibt vor dem Hintergrund der Dekolonisierung des afrikanischen Kontinents und beginnt mit der Feststellung, Kunst existiere nicht in einer universellen Blase fernab von Geschichte und Geografie, sondern sei von der Bourgeoisie in diesen Rang gehoben worden, weil sie ihr bei der Legitimation der abstrakten und naturfernen Gesellschaft des entwickelten Kapitalismus helfen würde (marxistisches Vokabular genoss damals noch eine andere Selbstverständlichkeit).5
Interessant an dem Aufsatz und prägend für die Debatte um kulturelle Aneignung ist vor allem die Rekonstruktion, wie es zur Verschiebung der Kunst auf ein angeblich universelles Terrain jenseits von Geschichte und Kultur gekommen ist. In der Renaissance hätten die Herrschenden sich die Geschichte Roms angeeignet und sich zu deren Nachfolgern erklärt, um ihre eigenen Interessen mitsamt ihrer Kultur zu einer universellen Zivilisation zu verklären und zu rechtfertigen. Mit dem Aufstieg der Geschichtswissenschaft Ende des 18. Jahrhunderts aber sei dies immer schwieriger geworden, da nun auch einfache Menschen die Möglichkeit hatten, sich Wissen über die Geschichte anzueignen und diese nicht mehr nach Belieben verklärt und umgeschrieben werden konnte. Während Napoleons Ägyptenfeldzug seien dann das erste Mal kulturelle Güter nicht nur als ein Akt der Unterwerfung entwendet worden, sondern mit dem Ziel der Aneignung ihres künstlerischen Stils.6 Aus diesem Ereignis habe sich das spezifisch europäische Streben entwickelt, sich die Kulturen der Welt zu eigen zu machen, um so als die höchste Verkörperung der Kultur überhaupt zu erscheinen, in die alle sonstigen Zweige und Varianten einmünden, um in ihr zur Vollendung zu gelangen.7 Deswegen brauche die europäische Kultur immer wieder neues Futter und dringe dazu stets aufs Neue bis in die letzten Winkel der Welt vor, um neue Objekte und Wissensbestände aufzuspüren, wie Coutts-Smith anschaulich anhand der Geschichte der Malerei von Delacroix bis Gauguin nachzeichnet. Würden wir diese Linien eingehend studieren, so der Autor, kämen wir schließlich zu dem Schluss, die europäische Kunstgeschichte sei weniger eine Schöpfungs- als eine Aneignungsgeschichte.8
In den achtziger Jahren wurde die Debatte über kulturelle Aneignung in den USA mit Blick auf die Situation der Native Americans und Schwarzer Menschen weitergeführt. Der gemeinsame Bezugspunkt war dabei die Aneignung von Kulturbeständen nicht mehr nur in der Kunst, sondern durch die Medien- und Modeindustrie, um sie als Waren auf den kapitalistischen Markt zu werfen, wo sie von der weißen Mehrheitsbevölkerung konsumiert werden. Als problematisch galten (und gelten bis heute) hier vor allem zwei Punkte. Zum einen könnten weiße Menschen sich risikofrei zu eigen machen, was für andere Menschen zu Diskriminierung und Ausschließung führen könne, wie sich etwa an der Geschichte Schwarzer Frisuren in den USA zeige.9 Zum anderen komme von den erwirtschafteten Profiten in der Regel nichts bei den Communitys an, deren Geschichte und Kultur als Inspirationsquelle für Filme, Musik oder Mode herhalten müsse. Filme wie Pocahontas bringen einem Konzern wie Disney viel Geld ein, während die indigenen Gemeinschaften in den USA gleichzeitig massiv benachteiligt und in ein werbetaugliches Klischee verwandelt werden, mit dem sich diverses Merchandise ebenso gut verkaufen lässt wie Essen und Softdrinks von Burger King.10 Bekannt geworden ist auf diesem Gebiet der Sammelband Everything but the Burden des afroamerikanischen Schriftstellers und Musikers Greg Tate von 2003. In der Einleitung rekurriert der Herausgeber auf den marxschen Begriff der Ware, deren idealtypische Verkörperung für ihn die Figur des aus Afrika in die USA verschleppten Sklaven darstellt, die die amerikanischen Phantasien über Race heimsuchen würde und in den Augen von Weißen bis heute entweder besessen oder ausgelöscht werden müsse. Aus dieser Ambivalenz heraus sei die amerikanische Musikindustrie stets auf der Suche nach weißen Künstler*innen, die eine glaubwürdige Schwarze Performance abliefern könnten, angefangen vom »King of Swing« Paul Whiteman in den zwanziger Jahren bis zu modernen Interpret*innen wie Eminem.11 Das Geld bleibe bei den Weißen, die sich der Ideen von Schwarzen Menschen bedienen, um damit zu Berühmtheit und Reichtum zu gelangen, während die Musik von Minderheiten langsam in ihren Besitz übergehe.12
Von hier hat sich die Debatte um kulturelle Aneignung wieder auf den Bereich der Kunst ausgedehnt, wobei die Kapitalismuskritik von Kenneth Coutts-Smith zugunsten eines ausschließlich kulturphilosophischen Ansatzes entsorgt wurde. Auf diesem Gebiet hat der (weiße) US-amerikanische Philosoph James O. Young mehrere Bücher und zahlreiche Aufsätze veröffentlicht, in denen die Rolle kultureller Aneignung im Rahmen des künstlerischen Schaffensprozesses hinterfragt wird.13 Zwar ist er sich über die potentielle Problematik kultureller Aneignung im Klaren, versteht die meisten Fälle aber als kulturgeschichtlich »normales« Phänomen und vertritt aus diesem Grund keine sonderlich kritische Perspektive.14 Abgesehen von diesen Höhepunkten der Diskussion setzt sich der wissenschaftliche Diskurs über kulturelle Aneignung überwiegend aus zerstreuten Artikeln zusammen, die über den Zeitraum der letzten dreißig bis fünfunddreißig Jahre in Zeitschriften erschienen sind. Das Thema ist also eher ein Nebenschauplatz der weiteren Diskussionen über Kapitalismus, Kultur, (Post-)Kolonialismus und Rassismus. Für einige Autor*innen geht kulturelle Aneignung denn auch in ihrer Meinung nach größeren Themen auf und bedürfe deswegen keiner eigenständigen Analyse. So erklärt der ghanaisch-britische Philosoph Kwame Anthony Appiah beispielsweise in seinem Buch Identitäten, die mit kultureller Aneignung verbundenen Formen der Ungerechtigkeit ließen sich sehr viel besser als Missachtung oder Ausbeutung verstehen, und verwirft auf diese Weise gleich den ganzen Begriff.15 Kenneth Coutts-Smiths leidenschaftlicher Appell zu weiteren Forschungsanstrengungen blieb auf akademischem Gebiet also leider bis heute weitgehend wirkungslos.
Ganz anders sieht es mit der Präsenz des Begriffs in Zeitungen, Blogs und sozialen Medien aus. Hier gibt es eine schier unüberschaubare Zahl an Beiträgen, die kulturelle Aneignung kritisieren und den richtigen Umgang mit ihr diskutieren. Doch als journalistische Artikel lassen sie – bei all ihrer Wichtigkeit für die Öffentlichkeit des Problems – naturgemäß eine detaillierte Analyse vermissen und setzen ihren Gegenstand in vielen Fällen eher voraus, als ihn systematisch zu entwickeln. Unter dem Strich entsteht so eine recht ambivalente Situation: Der Begriff ist zugleich omnipräsent und in aller Munde, gleichzeitig aber unzureichend theoretisch entwickelt und in vielen Aspekten tendenziell unklar. Zur Schließung dieser Lücke soll das vorliegende Buch etwas beitragen.
Das erste Kapitel veranschaulicht anhand der Vorfälle in einer Hamburger Kita und eines kurzen Abrisses der deutschen Kolonialgeschichte den im Begriff der kulturellen Aneignung liegenden Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Mikro- und Makroebene (eine seiner wesentlichen Stärken). Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionsmöglichkeiten des Begriffs, analysiert deren Stärken und Schwächen, fragt nach dem oft unterstellten Zusammenhang mit essentialistischen Kulturkonzeptionen und geht der Frage nach, warum der Begriff auch angesichts des heute so einflussreichen Konzepts der Transkulturalität nicht aufgegeben werden sollte. Daran anschließend versucht das dritte Kapitel, ein näheres Verständnis kultureller Aneignung zu entwickeln, indem es mit kolonialem Kulturraub, ungefragter Repräsentation anderer (bzw. dazu stilisierter) Kulturen und dem täglichen Konsum von Kultur als Ware drei Dimensionen kultureller Aneignung analysiert und nach ihren Gemeinsamkeiten fragt. Das vierte Kapitel nimmt diesen Faden auf und geht dem Thema Identität nach. Identität und Identitätspolitik werden hier als Bestandteil von Kämpfen um Hegemonie verstanden und anschließend wird dafür plädiert, den Begriff der kulturellen Aneignung gegenüber seinen bisherigen Definitionen stärker ins Politische zu verschieben. Im Anschluss fragen das fünfte und sechste Kapitel nach dem Zusammenhang von kultureller Aneignung und Kapitalismus und Rassismus. Dabei wird nachzuzeichnen versucht, wie Kapitalismus und Rassismus sich wechselseitig stützen, weshalb der eine nicht ohne Einbezug des anderen sinnvoll verstanden und bekämpft werden kann, auch wenn beide natürlich nicht ineinander aufgehen und die Kritik des einen nicht die des anderen ersetzen kann. Das letzte Kapitel schließlich versucht auszuloten, was Antirassismus für weiße Menschen über ein moralisches Engagement für Andere hinaus bedeuten kann.
Nun noch ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten in diesem Buch. Im Laufe der Argumentation tauchen immer wieder Begriffe auf, die erst später ausführlicher analysiert werden. Das liegt in der Logik des Schreibens und auch in der des Lesens, da man sich bei beidem von vorne nach hinten durch einen Text bewegt, obwohl der Beginn einer Argumentation sich in vielen Fällen erst von ihrem Ende her erhellt. Die wohl wichtigsten dieser Begriffe sind Rassismus und Identität, die gegenwärtig intensiv diskutiert und im Laufe des Buches einer ausführlichen Analyse unterzogen werden. Mit Blick auf ersteren stütze ich mich auf die in meinen Augen hervorragende Definition des tunesisch-französischen Schriftstellers und Soziologen Albert Memmi aus seinem Buch Rassismus, die im siebten Kapitel dieses Buches ausführlich diskutiert werden wird:
»Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.«16
Identität verstehe ich mit dem deutschen Soziologen Lothar Krappmann als Voraussetzung, die das Individuum erfüllen muss, um an »Kommunikations- und Interaktionsprozessen« teilnehmen zu können.17 Wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Verständnis von Identität vor allem die Frage der Anerkennung durch andere. Ohne sie bleibt Identität ein nicht einlösbarer Anspruch des Individuums, der gesellschaftlich zurückgewiesen werden kann, was für die Betroffenen zu Diskriminierung und sozialem Ausschluss führt.
Lange nachgedacht habe ich über die Verwendung der Begriffe »Hautfarbe«, »Rasse« und Race. Vor dem Hintergrund der über Eltern und Großeltern gegebenen Verstrickung meiner Generation in die Geschichte des nationalsozialistischen Holocaust und der ihn tragenden Nürnberger Rassengesetze geht mir der Begriff »Rasse« auch in seiner auf den Konstruktionsaspekt verweisenden kursiven Schreibweise nicht über die Lippen. »Hautfarbe« ist allerdings auch keine Alternative, schließlich sind Menschen nicht aufgrund ihrer »Hautfarbe« von Rassismus betroffen, sondern weil ihnen auf die eine oder andere Weise eine Race zugesprochen und zum Indiz bestimmter Eigenschaften stilisiert wird – sie werden als einer Race zugehörig »gelesen«. Deswegen verwende ich den englischen Begriff Race, um kritisch auf dessen Konstruktionscharakter sowie seine Verflechtung mit Macht und Rassismus hinzuweisen. Mit Blick auf nicht-weiße Menschen gebrauche ich in diesem Buch die Abkürzung BIPoC, also Black, Indigenous, People of Color (groß geschrieben aufgrund des politischen Charakters als widerständige Identitätskategorien), die sowohl die Differenz der durch sie bezeichneten Gemeinschaften als auch deren gemeinsame politische Identität markiert.
Oft gebrauche ich in diesem Buch auch den Begriff Hegemonie. Er wird im Kapitel über Identität ausführlich analysiert, allerdings auch vorher schon vereinzelt verwendet. Zusammengefasst bezeichnet Hegemonie eine Vorstellung von politischer Herrschaft, die einerseits zwar auf dem Machtmonopol des Staates fußt, sich andererseits aber (und dies ist hier wichtiger) auf die Zustimmung seitens der Bevölkerung stützt. Aus dieser Sicht ist jede politische Ordnung darauf angewiesen, den öffentlichen Diskurs zu dominieren und eine ihrer Herrschaft dienliche Interpretation der sozialen Wirklichkeit durchzusetzen.
Der*die eine oder andere könnte vielleicht auch über den von mir benutzten Begriff »Verletzlichkeit« stolpern. Verletzlichkeit wird im normalen Sprachgebrauch oft auf Individuen und ihre Befindlichkeiten bezogen: Jemand ist verletzt, hat allemal ein Recht dazu, soll sich nicht so haben und so weiter. Das ist hier nicht gemeint. Ich verstehe Verletzlichkeit ausgehend von der feministischen Theoretikerin Judith Butler als Konsequenz der wechselseitigen Verbundenheit von Menschen, die als körperliche Wesen einander ausgesetzt sind und die anderen brauchen, um Anerkennung für ihre Identität zu finden und ein sicheres Leben führen zu können. Menschen sind zwar alle verletzliche Wesen, von Verletzungen allerdings in sehr unterschiedlicher Weise betroffen, abhängig von Race, Geschlecht, Status, Religion, Herkunft, Kultur und anderen Faktoren. Genau das meine ich, wenn ich von Menschen spreche, die verletzt wurden oder von Verletzung bedroht sind. Verletzung ist aus dieser Sicht keine subjektive Befindlichkeit, sondern ein aus Rassismus und anderen Diskriminierungsformen resultierender objektiver Tatbestand.
Kita und Kolonialismus
Bei näherem Hinsehen verklammert der Begriff kulturelle Aneignung die zahllosen kleinen Gedanken, Äußerungen und Handlungen, bei denen wir nichts Böses im Sinn haben, von denen unser Alltagsleben getragen ist, mit dem wesentlich größeren Horizont von Kapitalismus, Rassismus und der Geschichte des Kolonialismus. Deswegen reicht es nicht, über individuelle Fälle zu sprechen, anschließend die moralische Aufladung der Politik zu bedauern und das Thema dann ad acta zu legen. Stattdessen muss kulturelle Aneignung vor ihrem jeweils konkreten Hintergrund betrachtet und dadurch in eine Perspektive gerückt werden, die den Blick auf die im Begriff liegende innige Verflechtung von Mikro- und Makroebene freigibt. Beginnen wir also in einer Hamburger Kita und begeben uns von da zum deutschen Kolonialismus und seinen bis heute währenden Folgen.
Deutsche Alltagsszenen
Die Kita Eulenstraße in Hamburg legte den Eltern 2019 in einem Elternbrief nahe, mit Blick auf die Verkleidungswahl ihrer Kinder kurz innezuhalten, ein wenig nachzudenken und von Kostümen Abstand zu nehmen, die geeignet sein könnten, andere Menschen zu beleidigen oder Kinder auf diskriminierende Stereotype zu eichen. Als Beispiel wurden »Indianer« und »Scheich« genannt.18 Im Grunde eine so unaufgeregte wie naheliegende Bitte, denn wer möchte schon andere Menschen verletzen oder seinen Kindern unterkomplexes Denken mit auf den Weg geben? Zudem handelte es sich um nicht mehr als eine Empfehlung.
Der mediale Aufschrei erfolgte sogleich in Form eines brüskierten Artikels in der Hamburger Morgenpost. Es sei kein Witz, sondern wirklich wahr, brach sich die Empörung des Autors Mike Schlink gleich in den ersten Zeilen Bahn, der Fasching in der Kita Eulenstraße in Ottensen habe am Montag doch allen Ernstes ohne »Kostüm-Klassiker« stattgefunden. Keine »Indianer«, keine Scheichs, kein Nichts. Stattdessen nur der Verweis auf den Versuch, sich im Kitaalltag um eine »kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung« zu bemühen.19 Dass eine vom deutschen Presserat wegen Verstoßes gegen die journalistische Sorgfaltspflicht gerügte Boulevardzeitung wie die Hamburger Morgenpost das Vorgehen der Kita Eulenstraße einer marktschreierischen Meldung für wert befindet, erstaunt kaum. Durchaus erstaunen können aber die zahlreichen Reaktionen in Zeitungen von der Bild bis zum Spiegel, die sich an die Meldung in der Morgenpost anschlossen und Wellen bis hin nach Österreich schlugen.20 So sprach auch die Leipziger Volkszeitung von den »Kostüm-Klassikern«, die in diesem Jahr im Schrank hätten bleiben müssen, und widmet sich dann einer Darstellung der pädagogischen Beweggründe und der Stellungnahme der Kita. Das klingt gut, doch bereits in den einleitenden Zeilen wird dem Spaß der Kinder am Verkleiden das angebliche Verbot der Kita gegenübergestellt: »Fasching bereitet vor allem Kindern großen Spaß. Gerne verkleiden sie sich als Prinzessinnen, Piraten, Clowns – oder aber auch als Indianer. Doch genau dieses Kostüm ist in einer Hamburger Kita gar nicht mehr gern gesehen.«21
In ein ähnliches Horn bläst auch die Berliner Zeitung. In Hamburg habe »tatsächlich« eine Kita den Eltern nahegelegt, ihre Kinder keine »Indianerkostüme« tragen zu lassen, und so zum Karneval für ein »Indianerverbot« (beides im Artikel ohne Anführungszeichen) gesorgt. Hier schließen sich ironische Verweise auf die Beweggründe der Kita an und als letzter Beweis dafür, wie unbegründet die Sorgen seien, Menschen könnten sich durch Kostüme verletzt fühlen, dient der Hinweis, schließlich sei auch der Autor Jens Blankennagel selbst vor vierzig Jahren immer als »Indianer« gegangen.22
Der Spitzenkandidat der AfD für die Hamburger Bürgerschaftswahl 2020, Dirk Nockemann, ließ auf der Fraktionsseite im Internet sogleich wissen, der Fasching dauere dieses Jahr offensichtlich länger als sonst und finde seine Fortsetzung in neuen Diskussionen um »politische Korrektheit« (ein Lieblingskampfbegriff der Rechten). Jetzt müssten auch die »Kinder bei den beliebten Faschingskostümen dran glauben«, was für ein »Narrentum«, was für ein »Wahnsinn«.23 »Die Freie Welt«, ein durch Sven von Storch (den Ehemann Beatrix von Storchs) betriebener Blog, nimmt sich des Themas ebenfalls an. Wie die Argumente der Kita zu lesen sind, wird hier durch den Begriff der »Moralkeule« bereits zu Beginn klargestellt. Dieser bis zum Ende durchgehaltene Tonfall mündet schließlich in den Ausruf: »Was für Sünder waren doch einst die Eltern, die Karl-May-Filme sahen und anschließend draußen Cowboy und Indianer spielten …!«24 Alexander Wallasch ergeht sich im Blog »Tichys Einblick« zunächst in Anspielungen auf Verschwörungstheorien über Stiftungen und Verbände, die sich, querfinanziert durch das Familienministerium, zusammengeschlossen hätten, um die Kindergärten der Republik mit ihrem »verqueren Gedankengut« zu »penetrieren«. Es ist ein aufschlussreicher performativer Widerspruch, welche Metaphern die um »Frühsexualisierung« von Kindern so besorgten Neuen Rechten hier verwenden. Doch weit davon entfernt, diesen auch nur zu bemerken, wird im weiteren Verlauf von einer »Vergewaltigung der kindlichen Fantasie« gesprochen, schließlich sollten Kostüme für Kinder keine politischen Botschaften transportieren, denn es ginge beim Verkleiden vor allem um den Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen.25
Im linksliberalen Spektrum wurde durchaus anders argumentiert. In der Serie »Elterncouch« des Spiegel bekennt Theodor Ziemßen angesichts der Diskussionen über »Indianerkostüme« (hier auch im Text in Anführungszeichen) seine Verunsicherung. Schließlich finde er den Vorstoß der Kita eigentlich gut, ebenso wie die Absicht, seit Langem unhinterfragte Selbstverständlichkeiten aufzubrechen. Dass sein Sohn als »Indianer« zum Fasching geht, ist aber dennoch bereits beschlossene Sache. Allerdings nicht als irgendeiner, sondern als »Osh-Tisch«, der einer der »größten Krieger der Crow« gewesen und zwar als Mann geboren worden sei, aber als Frau gelebt und auch eine Frau geheiratet habe (was Rechte bekanntlich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt).26 Hier wird die Verkleidung vor allem als Gelegenheit betrachtet, sich mit Kindern über Kultur zu verständigen und im gleichen Zug wertvolle Bildungsarbeit zu leisten. Einen ähnlichen Ansatz vertritt auch Jens Blankennagel im bereits erwähnten Artikel in der Berliner Zeitung. Falls seine Kinder zum nächsten Fasching als »Indianer« gehen wollten, würde er ihnen beibringen zu sagen: »Ich bin doch gar kein Indianer. Ich bin Tecumseh, der Häuptling der Shawnee. Ich bin der Häuptling, der alle Stämme Nordamerikas vereinigen wollte im Kampf gegen den Weißen Mann (»weißen« groß im Original). Ich bin ein Freiheitskämpfer, ein Kämpfer für Gleichberechtigung.«27
Der rechte und der liberale Standpunkt weisen trotz aller Verschiedenheit ihrer Argumentationsmuster und der diesen zugrunde liegenden unterschiedlichen Wertvorstellungen Gemeinsamkeiten auf. Zunächst lässt sich eine erstaunliche Gleichgültigkeit gegenüber den Fakten konstatieren, denn, wie der Blog »Volksverpetzer« als einziger klarstellte, hatte es zu keiner Zeit ein Verbot gegeben.28 Vielmehr handelte es sich um einen Elternbrief, der die Eltern zu einem »kultursensiblen« Umgang mit der Frage ermuntern sollte, mit welcher Verkleidung sie ihre Kinder an Fasching in die Kita schicken würden. In diesem Brief wurden »Indianer« und »Scheich« als Beispiele für Verkleidungen genannt, die potentiell geeignet seien, andere Menschen zu verletzen, indem sie sich über ihre Kultur lustig machten und Kindern Stereotype vermitteln würden. Das war alles. Dabei könnte man es im Grunde bewenden lassen. Die ganze Diskussion wäre dann lediglich ein weiterer Auswuchs des immer stärker um sich greifenden Trends zu postfaktischen Diskursen, in deren Zuge die Unterscheidung von richtig und falsch der Durchsetzung eines von der sozialen Wirklichkeit entkoppelten Machtkalküls weicht.
Doch hinter den Reaktionen auf die angebliche Verbotspolitik der Hamburger Kita verbirgt sich ein Affekt, der einen Blick in die kulturellen Selbstverständlichkeiten des deutschen Alltagslebens gewährt. Hier treffen sich Rechte, Konservative und Liberale in einem gemeinsamen Ziel: Dem Beharren auf dem Vorrecht, selbst zu entscheiden, wo kulturelle Aneignung und Rassismus anfangen und wo sie aufhören. Bei den Liberalen liegt der Schlüssel vor allem in der Bildung. Natürlich sei an der Kritik der Kita Eulenstraße an »Indianerkostümen« etwas dran. Auf jeden Fall berechtige das an den amerikanischen Indigenen verübte »Unrecht« (den Begriff »Völkermord« nimmt niemand in den Mund) diese auch zu militantem Widerstand und habe große Freiheitshelden hervorgebracht. Und selbstverständlich sollte man angesichts dessen nicht einfach ein Kostüm von der Stange kaufen und die Kinder damit kommentarlos in die Kita schicken. Ganz im Gegenteil gilt es, sich hier mit Geschichte und Kultur auseinanderzusetzen, damit die Kinder um die Bedeutung ihrer Kostüme wissen. Zumal das den Kindern gleich noch eine Portion interkulturelle Kompetenz mit auf den Weg gibt, eine der in Zukunft wichtigsten Qualifikationen überhaupt.
Ein weiterer Schlüsselbegriff ist die Tradition. Was schon immer so gemacht worden sei, könne auch heute nicht schlecht sein, schließlich habe sich früher auch niemand beschwert. Die heute Vierzig- bis Fünfzigjährigen seien wie ihre Eltern mit Winnetou und dessen Blutsbruder Old Shatterhand aufgewachsen und hätten sich trotz allem zu vernünftigen Menschen entwickelt, die für Rechtsradikalismus nichts übrig hätten und Rassismus von ganzem Herzen ablehnen würden. Aus dieser Perspektive erscheint die Tradition als ein apolitischer Ort in der Geschichte, über den folglich auch nicht sinnvoll in politischen Begriffen gesprochen werden kann. Dirk Nockemann von der AfD fasst das in den Worten zusammen: »Kinder haben Freude am Verkleiden. Ende.«29
Teilweise überschneiden sich die beiden Muster aber auch. So stellt der Blog »Die Freie Welt« in bester bildungsbürgerlicher Manier die Frage, ob die Kinder angesichts des diskriminierenden Gehalts des Begriffs »Indianer« nicht stattdessen als »Sioux, Apache, Comanche, Dakota, Irokese oder Mohikaner« kommen könnten, und die Berliner Zeitung verweist darauf, wie schön es gewesen sei, vor vierzig Jahren als »Indianer« Fasching zu feiern. Allzu trennscharf ist die Unterscheidung zwischen Tradition als rechtem und Bildung als liberalem Diskussionseinsatz also nicht.
Ob nun rechts oder liberal: Offensichtlich kommt es trotz der in manchen Artikeln sogar zitierten Begründung für die pädagogische Empfehlung keiner und keinem der Autor*innen in den Sinn, Kinder fürderhin nicht mehr als »Indianer«, »Osh-Tisch« oder »Tecumseh« zu verkleiden. In diesem Punkt herrscht unabhängig von der politischen Couleur das sture Beharren auf dem vermeintlichen Recht vor, sich in der Wahl eines Kostüms keinerlei politischen oder kulturellen Beschränkungen fügen zu müssen. Ein guter Teil des Affektpotentials dieser so harmlosen Diskussion um den Fasching in einer bis dahin nur in der Nachbarschaft bekannten Kita dürfte aus der Infragestellung eben dieses Privilegs resultieren. Sich selbst oder (schlimmer noch) die eigenen Kinder nicht nach Belieben kleiden zu dürfen, scheint als bedrohliche Einschränkung des Handlungsspielraums empfunden zu werden, durch den sich der*die heutige Durchschnittsbürger*in als handlungsfähiges Subjekt definiert. Für die Beteiligten stellt diese Freiheit offensichtlich wahlweise ein über Bildung hart erarbeitetes oder über die Würde der Tradition ererbtes Vorrecht dar, das auf keinen Fall infrage gestellt werden darf.
Gleichzeitig herrscht interessanterweise ebenfalls Einigkeit darüber, dass bestimmte Verkleidungen im Hinblick auf das Kindeswohl durchaus ungeeignet für Fasching seien. Spätestens beim Thema Gender hört für Rechte der Spaß bekanntlich auf. Die Kita Eulenstraße hatte den Eltern nicht nur zu einem kultursensiblen Umgang hinsichtlich der Kostümwahl geraten, sondern sie auch dazu aufgefordert, ihren Kindern Mut zuzusprechen, wenn deren Verkleidungswahl wie im Falle der »Piratin« oder des »Meerjungmanns« mit den herrschenden Gendernormen in Konflikt geraten sollte. Die Piratin kommt in dem Blogartikel für »Tichys Einblick« gerade noch davon, der Meerjungmann allerdings, so weiß Alexander Wallasch mit aller Bestimmtheit, zähle mit Sicherheit nicht zu den Rollen, in die Kinder schlüpfen wollten, sondern sei Teil der bereits erwähnten »Vergewaltigung der kindlichen Fantasie«.30 Auch in anderen Artikeln werden die »Meerjungmänner« mit genüsslicher Schadenfreude erwähnt, als würde schon allein die Idee, ein Junge könnte als Arielles Vater zum Fasching gehen wollen, genügen, um den Diskussionsstand gendersensibler Pädagogik ohne jedes Argument der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Liste als unpassend geltender Kostüme ließe sich erweitern, denn auch für Liberale gibt es selbstverständlich Grenzen, wenn auch vielleicht andere. Dass eine Ku-Klux-Klan-Kluft als Verkleidung nicht geeignet ist, dürfte wohl kaum auf Widerspruch stoßen.
Es geht in der Diskussion um die Hamburger Kita demnach nicht um das Recht, sich ohne Einschränkung aus der Menge aller denkbar möglichen Verkleidungen eine auszusuchen, denn diese Menge ist offensichtlich durch diverse Erwägungen ohnehin deutlich limitiert. Solche Einschränkungen sind offenbar aber nur dann in Ordnung, wenn sie durch die Beteiligten selbst vorgenommen werden. Umgekehrt erscheinen sie dort als unerträglicher Eingriff in die Handlungsfreiheit, wo sie wie im Fall der Kita Eulenstraße von außen erfolgen. Der zentrale Einsatz der Diskussion ist aus dieser Sicht die Aufrechterhaltung einer einseitigen Definitionsmacht darüber, was politisch und kulturell als Norm zu gelten hat und infolgedessen nicht zur Disposition steht. Oder, in aller Kürze: Wo politisch und kulturell verletzendes Verhalten beginnt, definieren wir als Angehörige der Dominanzkultur und nicht die Anderen!
Was als Norm gilt und was nicht, ist immer ein Prozess politischer Auseinandersetzung und der daraus resultierenden Verteilung von Macht. Das wusste auch die Kita Eulenstraße, gab sich deswegen Mühe, ihre pädagogische Intervention nachvollziehbar zu begründen und stützte sich dabei auf den Ansatz der vorurteilsbewussten Erziehung der Fachstelle Kinderwelten, einer pädagogischen Initiative, die Projekte im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit konzipiert und durchführt. Diese hatte sich 2016 in der Veröffentlichung Fasching vorurteilsbewusst feiern! mit dem Thema Kostümwahl und Fasching beschäftigt. Dort wird ausführlich auf den Völkermord an den nordamerikanischen indigenen Gemeinschaften, die unter einem Label wie »Indianer« nicht ohne rassistische Stereotype abzubildende Diversität der Indigenen Kultur und auch auf die lange Geschichte der Kolonisierung hingewiesen, auf die der Begriff so direkt wie affirmativ verweist, indem er Kolumbus’ Herrschaftsgeste der willkürlichen Benennung ganzer Menschengruppen fortschreibt.31 Die Leiterin von Elbkinder (dem größten Hamburger Kitaträger und auch Träger der Kita Eulenstraße) äußerte in einem Interview mit dem NDR sogar Verständnis dafür, wenn viele Menschen angesichts der Entzauberung ihrer Kindheitshelden empört reagierten, erklärte dann aber in aller Geduld, Figuren wie Winnetou würden Stereotype befördern, die bis heute westliche Vorstellungen über Indigene Kulturen beeinflussen.32 Nicht nur die Kita versuchte, Verständnis für ihr Handeln zu schaffen. Es erhoben sich auch Indigene Stimmen. So schrieb der in Deutschland lebende Tyrone White, ein O’ohe Nuŋpa Lakota vom Stamm der Cheyenne River Sioux, unter dem deutlichen Titel »Ich bin ›echter‹ Indigener und finde eure Indianer-Kostüme nicht witzig« über seine Erfahrungen mit Rassismus gegen Indigene Menschen in den USA und wie die Verramschung zentraler Elemente indigener Kultur ihn verletzen würde. Er schließt mit dem Satz: »Solange der Karneval ›Indianer‹-Kostüme akzeptiert, weiß ich, dass er mich nicht akzeptiert.«33 Damit sollte zumindest die Behauptung vom Tisch sein, es sei überkandidelter politischer Moralismus, Kindern von Verkleidungen abzuraten, durch die sich ohnehin niemand gekränkt fühle. Denn offensichtlich gibt es auch in Deutschland durchaus Menschen, die solche Verkleidungen als Diskriminierung empfinden. Doch leider ist die Behauptung damit natürlich nicht vom Tisch. In ihrer primitivsten Form äußerte sich dies in einem Kommentar zum Artikel von Mike Schlink in der Morgenpost, in dem es hieß, in Deutschland gäbe es keine »Indianer«, weswegen sie sich von hiesigen Karnevalsgebräuchen auch nicht beleidigt fühlen könnten.34 Ein solches Maß an Ignoranz ist bemerkenswert.
Dass die Artikel in ihrer Ablehnung gegenüber dem Vorgehen der Kita weitgehend übereinstimmen, erstaunt umso mehr, als nicht ein Bericht etwas gegen die in der Begründung dargelegten historischen Fakten einwendet. Der Völkermord an den nordamerikanischen Indigenen Gemeinschaften wird keineswegs bestritten (wenn auch nicht so genannt), ebenso wenig wie die weit bis ins 20. Jahrhundert anhaltende Leidensgeschichte dieser Bevölkerungsgruppen oder ihre gegenwärtige Diskriminierung. Auch bestreitet niemand, dass es sich beim Begriff »Indianer« um eine kolonialistische Fremdbezeichnung handelt, die Stereotype vermittelt und der komplexen Kultur dieser Gruppen unangemessen ist.
Die Abwehr nimmt hier also nicht die Form der Leugnung an. Stattdessen herrscht einheitlich die unausgesprochene Haltung vor, Kolonialismus sowie das Leiden der betroffenen Bevölkerungen seien zwar eine Tatsache, allerdings keineswegs ein Grund, sich mit diesem Kapitel der Geschichte näher auseinanderzusetzen und mit Blick auf persönliche Einstellungs- und Handlungsmuster daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Eine solche Verhaltensoption steht allerdings nur den Angehörigen einer dominanten Gruppe gegenüber Menschen aus weniger mächtigen Gruppen offen. Das bereits festgestellte Bemühen um die Aufrechterhaltung einer einseitigen Definitionsmacht über soziale Wirklichkeit ist aus diesem Blickwinkel in eine Form der »Dominanzkultur«35 eingelassen, die sowohl ihre Grundlage als auch Gegenstand ihrer eifersüchtigen Sorge ist.