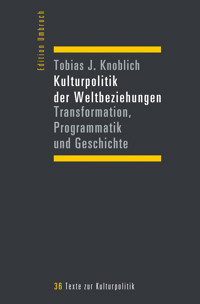
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Umbruch - Texte zur Kulturpolitik
- Sprache: Deutsch
Kulturpolitik bedeutet Beziehungsarbeit: Wie finden Kultureinrichtungen, Kulturprojekte sowie Formen der kreativen Zusammenarbeit zu gesellschaftlicher Wirksamkeit? Welche Programmatik verbindet uns, macht Kultur zum Gegenstand von Politik oder Engagement und sichert zugleich kulturelle Autonomie? Tobias J. Knoblich skizziert Möglichkeiten, wie eine hochtransformative Gesellschaft Kulturpolitik neu ausrichten kann, welche Erzählungen diese braucht und welchen Strömungen sie ausgesetzt ist. Er setzt den Fokus dabei auf Weltbeziehungen – eine Einbettung des Menschen, die von den planetaren Grenzen der Kultur bis zur notwendigen Stärkung von Gemeinschaft die sozialen Beziehungen in der individualisierten Digitalmoderne stärken will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft
und die Open Library Community Politik 2024 – einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr-Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek Zürich Sponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Tobias J. Knoblich
Kulturpolitik der Weltbeziehungen
Transformation, Programmatik und Geschichte
Die Druckkosten des vorliegenden Bands werden gefördert durch Zuwendungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien an die Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 im transcript Verlag, Bielefeld
© Tobias J. Knoblich
Umschlagkonzept: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Lektorat: Dr. Hartmut Pietsch, Duisburg
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen
https://doi.org/10.14361/9783839471692
Print-ISBN: 978-3-8376-7169-8
PDF-ISBN: 978-3-8394-7169-2
EPUB-ISBN: 978-3-7328-7169-8
Buchreihen-ISSN: 2702-9085
Buchreihen-eISSN: 2702-9093
Inhalt
Einleitung
1.Kulturpolitik und gesellschaftlicher Wandel
1.1Kulturpolitik der Weltbeziehungen
1.2Kulturpolitik in der Krise des Allgemeinen
1.3Transformatorische Kulturpolitik und adaptives Kulturmanagement
1.4Das Soziale in der Kulturpolitik. Zur Transformation des Sozialstaats
1.5Weltkultur: Kulturgüter, Monumente, Bräuche
1.6Kulturpublizistik und Resonanz
2.Zur Programmatik und Geschichte von Kulturpolitik
2.1Kunst der Freiheit
2.2Narrative und neue Erzählungen
2.3Kulturpolitik und Kulturökologie. Für ein neues Narrativ der kulturellen Einbettung
2.4Elemente einer Theorie der Kulturpolitik. Zur Bedeutung der Kulturpolitikgeschichte
2.5Kulturpolitik als Kunst und Wissenschaft
3.Kulturpolitische Resonanzen und Dissonanzen
3.1Warum Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz gehört
3.2Verfassungskultur und Deutsche Einheit
3.3Kulturpolitik nach der »Wende«. Verständnis und Missverständnisse
3.4Zum Verhältnis zwischen Kultur und Politik
3.5Die »Alternative für Deutschland« und rechte Kulturpolitik
3.6Die Stadt und ich. Über Städtebau und Identität – eine Resonanzstudie
3.7Städtebau der Migration. Zur kulturellen Transformation des Siedelns
3.8Kultur und Stadtentwicklung. Krise der Innenstädte oder Funktionswandel?
Literaturverzeichnis
In dem hochkomplizierten Gebilde einer demokratisch gegliederten Gesellschaft und ihrer partikularen Egoismen kann weder die Kultur noch die Wissenschaft gedeihen ohne das heißt die garantierte Autonomie dieser kulturfördernden Organisationen schützt und stärkt.
PETER WAPNEWSKI: MITDEMANDEREN AUGE. ERINNERUNGEN 1959-2000, BERLIN 2006, S. 104
Am Ende beginnt die Große Transformation mit dem Engagement von Einzelnen – aber nicht nur am Einkaufsregal, sondern in der Rolle als Pionierinnen und Pioniere des Wandels, die Wissen, Haltung und Fähigkeiten miteinander kombinieren und kontinuierlich im eigenen Handeln kultivieren.
UWE SCHNEIDEWIND: DIE GROßE TRANSFORMATION. EINE EINFÜHRUNGIN DIE KUNSTGESELLSCHAFTLICHEN WANDELS, FRANKFURTA.M. 2018, S. 475
Einleitung
Die hier vorgelegten Texte, die neben der Praxis mehr oder minder anlassbezogen entstanden sind und nachträglich erst zu einer relativen Ordnung fanden, ergeben kein Handbuch der praktischen Politikberatung oder der Projektarbeit. Über gutes Kulturmanagement und Fallbeispiele erfolgreichen Kulturschaffens gibt es genügend Literatur, auch über aktuelle Probleme der Kulturpolitik und zeitgemäße Governance. Als angewandte Kulturpolitik verstehen sich die Texte gleichwohl trotzdem: Das Anliegen dieser Textsammlung besteht darin, den Reflexionshorizont von Kulturpolitik auszuleuchten, gesellschaftliche Veränderungsprozesse auf dieses Feld zu beziehen und Grundlagen kulturpolitischen Handelns zu diskutieren. Notwendigerweise kommt es aufgrund der Textgenese hier und da zu Redundanzen, die aber – nicht zuletzt zugunsten auch selektiver Lesbarkeit1 – belassen wurden. Außerdem sollte die Eigenständigkeit der einzelnen Texte erkennbar bleiben. Eine Monographie wäre anderen Grundsätzen gefolgt, hier aber liegt das Konvolut eines reflektierenden Praktikers vor, der zwischen Kommunalpolitik und Gesamtbetrachtung des Systems von Kulturpolitik in Deutschland, teilweise unter Berücksichtigung internationaler Verflechtungen, oszilliert, wie es sein Tätigkeitsspektrum erfordert.
Die Programmatik dieses Buches, die den soziologischen Erkundungen Hartmut Rosas entlehnt und von der Überzeugung getragen ist, dass auch Kulturpolitik vitale Resonanzen benötigt, um in Zeiten rasanter Transformationsprozesse wirken, Beiträge für eine gelingende Zukunft sozialen und planetaren (Über-)Lebens erbringen zu können, diese Programmatik ist eine unfertige, im Denkprozess befindliche, zu deren Diskussion und Weiterführung aufgefordert sein soll. Die Beiträge selbst verstehen sich größtenteils als Arbeitstexte, essayartige, teils verdichtete Annäherungen an jenen Themenkreis, den ich für relevant und diskussionswürdig erachte. Sie sind von einer kritischen, offenen Zugangsweise geprägt und folgen keiner affirmativen, Kultur stets preisenden Rhetorik, wie sie Politikerinnen und Politiker oft verwenden, wenn sie auf Praxis treffen oder in Veranstaltungen über die Bedeutung des Feldes reflektieren (sollen). Mir geht es um die realen Herausforderungen des Wandels, Einblicke in Entwicklungen und ihre historischen Bezüge sowie ein Plädoyer für die abstrakten Aspekte, die oft oberflächlich diskutiert werden, etwa die Rolle des Verfassungsrechts für die Kultur, das für mich mehr als Symbolpolitik oder – in Gestalt des Grundgesetzes – ein vor Überfrachtung zu schützendes Heiligtum darstellt. Alles in allem geht es um die Kraft von Veränderungen, auch in der Art und Weise, wie wir über das Feld reden und es in sich dramatisch verschiebende Bedingungskoordinaten einzupassen versuchen. Die Geschichten, die wir dabei zu erzählen wissen, sind von entscheidender Bedeutung für die Antizipation künftiger Politiken, sie gehen der tatsächlichen Veränderung voraus. Hier möchten die folgenden Überlegungen Denkanstöße geben, Impulse setzen und zur Vertiefung des Wissens über die aufgeworfenen Komplexe ermutigen.
Kulturpolitik bedeutet aktive Verantwortung, auch gestaltendes Risiko; das erkannten bereits diejenigen Aktivisten, die den programmatischen Wechsel von der »Kulturpflege« zur Kulturpolitik in der jungen Bundesrepublik erzwangen, die Kultur der Sphäre des Kurativen entzogen, um sie dem Fluss gesellschaftlicher Bedürfnisse auszusetzen. Schließlich ist die Kultur keine Patientin, die es durch die Zeiten zu hieven gilt – bei allem Wertvollen und Bewahrenswerten, das es zweifelsohne gibt. Den gewonnenen, später von der UNESCO bestätigten »weiten Kulturbegriff« versetzten sie in eine konjunkturelle Spannung. Waren es damals Fragen der Kommunikation, der Kapitalismus- und Stadtkritik sowie der sozialen Verantwortung für Künstlerinnen und Künstler oder der Unterstützung neuer Ausdrucksformen und Institutionen – vor allem solcher der Zivilgesellschaft –, so kehren diese nun in einer ungleich unübersichtlicheren, hoch transformativen Gesellschaft wieder, ergänzt um Individualisierungsfolgen und revolutionäre Prozesse: eine von technologischen Veränderungen intonierte Kultur der Digitalität und eine Kultur der Nachhaltigkeit, die sich aus unseren Erkenntnissen um Ökologie und Klimawandel konturieren. Das Neue indes begegnet uns in Gestalt eines ästhetisierten Kapitalismus neuer Verwertungsqualitäten (der freilich auch die Kultur- und Kreativwirtschaft prosperieren lässt) sowie als Dispositiv einer kreativen Gesellschaft, die das Ästhetische der Sphäre eines gesonderten Wirkungsbereichs deutlich entgrenzt hat. Hierin findet Kulturpolitik ein anspruchsvolles Beziehungsgefüge, das sie zukunftsorientiert zur Sprache und Praxis bringen muss, erneut in eine konjunkturelle Spannung zu setzen vermag.
Auch die Sorge um die Demokratie kehrt wieder: War es einst im Angesicht des Aufbaus der jungen Bundesrepublik das Diktum »Mehr Demokratie wagen!« (1969), das kulturpolitisch durch den Impuls der Abschlusserklärung des Europaratssymposiums von Arc et Senans (1972) zum Programmbegriff einer Kulturellen Demokratie verdichtet worden war, also die Forderung nach einer dezentralen und pluralistischen Kultur aufmachte2, sind es heute erstarkte autokratische Systeme und Tendenzen, bis hin zu einem Kulturkampf von rechts, die die Sicherung einer auch kulturell gefestigten liberalen Demokratie notwendig machen. Narration und Programmatik sind also gefordert, Kulturpolitik für Demokratie immer wieder neu zu untersetzen.
Anschließen möchte ich mit dieser Art der schreibenden Denkarbeit an die Tradition jener Praktikerinnen und Praktiker mit teils wissenschaftlicher Neigung, die die Neue Kulturpolitik seit den 1970er Jahren programmatisch untersetzt und mit gesellschaftspolitischen Themen aufgeladen, also zu der Kulturpolitik gemacht haben, die wir heute methodisch anwenden. Um einige Namen zu nennen: Hermann Glaser, Hilmar Hoffmann, Olaf Schwencke, Alfons Spielhoff, Karla Fohrbeck oder Siegfried Hummel; später dann etwa Dieter Rossmeissl und Oliver Scheytt. Sie und andere haben auf aktuelle Debatten, künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen interdisziplinär reagiert, diese eingeordnet, ausgedeutet und damit Impulse für die gesellschaftliche Programmierung von Kulturpolitik gegeben. Schließlich entsteht und entwickelt sich Kulturpolitik nicht durch normative Setzungen und ihre Verrechtlichung, sondern durch eine Debattenkultur, Überzeugungen und die Organisation spezifischer Freiheitsräume – für die auch Spezialgesetze entwickelt werden können. Sie setzt Wissen um Prozesse voraus, Lust am Nachdenken über die Bedingungen gelingender Gesellschaft und die Neugier, Zusammenhänge zu entdecken und das Feld wirksamer kultureller Gestaltung abzustecken.
Die Texte spannen einen weiten Bogen, bilden aber gleichwohl das Spektrum kulturpolitischer Ideenbildung und Handlungsfelder nicht vollständig ab. Im ersten Teil wird die Idee der Denkfigur einer »Kulturpolitik der Weltbeziehungen« im Horizont wichtiger gesellschaftlicher Transformationen entwickelt; hier finden sich auch einige kultursoziologische Einordnungen sowie globale Einflüsse dargestellt, fokussiert auf den postkolonialen Diskurs und wichtige völkerrechtliche Kulturabkommen. Schließlich wird die Rolle von Kritik in der Kulturpolitik beleuchtet und selbst an verschiedener Stelle Kritik geübt. Der zweite Teil wendet sich der Programmatik und Geschichte von Kulturpolitik zu, in seinem Zentrum steht die Entwicklung des Herzstücks einer »Kulturpolitik der Weltbeziehungen«, nämlich das Postulat einer kulturökologischen Fokussierung und eines adaptiven Kulturverständnisses, das Grenzen der Entwicklung anerkennt und zu einem neuen systemischen Verständnis des Lebens, Produzierens und Sinnstiftens findet. Dabei werden auch philosophische und formative Aspekte wie die Bedeutung von Freiheit, Kunst und Wissenschaft für die Kulturpolitik fruchtbar gemacht. Im dritten Teil geht es um Resonanzfelder (oder auch Dissonanzen): die kulturpolitische Aufladung des Verfassungsrechts, das Verhältnis zwischen Politik und Kultur oder die Verbindungen zwischen Stadtentwicklung und Kultur. Auch die Echokammern einer neurechten Kulturpolitik werden als Gegenpol der programmatischen Standortbestimmung ausgeschritten.
Manches ist gewiss überzeichnet, provokant, verkürzt – aber kritisch immer, getragen vom ehrlichen Erkenntniswunsch, die Rolle von Kulturpolitik heute zu erfassen und sie zu stabilisieren, wo möglich zu Formeln zu verdichten. Es ist bei allen Herausforderungen schwerer geworden, auf diese Weise zu diskutieren und die verändernde Kraft der Kulturpolitik zu behaupten, da zweierlei untrüglich an Einfluss gewonnen hat: ein Pragmatismus des Machens und ein Populismus der Verkürzungen, der reduzierten Handlungsketten, der Menschen einfache Antworten auf voraussetzungs- und beziehungsreiche Fragen geben und sie im Bild einer Welt stetiger Verbesserung, stetigen Fortschritts (ein altes Versprechen der Industriemoderne) wiegen möchte. Den Fortschritt in technologischer Hinsicht gibt es unzweifelhaft, sogar exponentiell, aber er ist nicht mehr an die Verfügbarmachung der Welt zu binden, sondern in Entwicklungen zu überführen, die uns binden, begrenzen, in der Welt neu positionieren. Das ist mit großen Ungleichzeitigkeiten verbunden, die im Widerspruch zu unseren linearen Modellen der Wohlstandserfahrung und Ausdehnung stehen, die uns auch eine additive Kulturpolitik verursachten.
Ein gänzlich optimistisches Bild hat Kulturpolitik noch nie ergeben, da sie bei allem Reichtum an Kultur und menschlicher Kreativität immer ein Orchideenfach geblieben ist und problemzentriert argumentiert, also stets aufs Neue um Geltung, Konzepte, Einfluss ringt, den Finger in unterschiedliche Wunden legt. Und weil sie der Sphäre der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zugewiesen ist, kein hartes, normiertes, stabiles Feld behaupten kann, immer gegen ihre Marginalisierung kämpft, insbesondere auf kommunaler Ebene, wo ohnehin häufig der Einzelfall und weniger ein Handlungssystem regiert.
Umso wichtiger, breiten Einfluss zu reklamieren, die Bedeutung von Kulturpolitik in der Dynamik transformatorischer Prozesse zu behaupten und zu untersetzen. Dazu will das Buch einen Beitrag leisten. Es verdankt sich den Einsichten zahlreicher Diskussionen und Ratschläge, für die ich an dieser Stelle herzlich danken möchte, insbesondere den Mitgliedern und dem Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., die auch das Buch in ihre Reihe »Edition Umbruch« aufgenommen hat. Vor allem danke ich Dr. Henning Mohr, der den Vorschlag eingebracht und mich ermutigt hatte. Anreger und Diskussionspartner waren zahlreich, nennen möchte ich – für unterschiedliche Kontexte, Anlässe, Gespräche über Bücher und politische Lagesondierungen – Dr. Norbert Sievers, Prof. Dr. Oliver Scheytt, Prof. Dr. Birgit Mandel, Prof. Dr. Dieter Haselbach, Dr. Dieter Rossmeissl und die Kolleginnen und Kollegen des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag, der traditionell eine großartige Plattform für Debatten bietet, unter dem gegenwärtigen Vorsitz von Dr. Skadi Jennicke.
Erfurt, im Mai 2024
Tobias J. Knoblich
1Zur Lesbarkeit gehört auch die Entscheidung, im Text in der Regel das generische Maskulinum zu verwenden und damit geschlechtsabstrahierend zu argumentieren.
2Vgl. Stichwort »Kulturelle Demokratie«, in: Schwencke, Bühler, Wagner 2009, S. 94.
1. Kulturpolitik und gesellschaftlicher Wandel
1.1 Kulturpolitik der Weltbeziehungen
»Eine Ahnung oderEin Bewusstsein über die Richtung zu habenHeißt, in einer Erzählung zu leben […]«1
Kulturpolitik kommuniziert sich und überzeugt nur dann, wenn sie – wie andere Politikfelder auch – treffende Bilder, Geschichten und programmatische Zuspitzungen ausprägt. »Kulturpolitik der Weltbeziehungen« ist, Bezug nehmend auf Hartmut Rosas Topos der Weltbeziehung, solch eine Zuspitzung, die das Feld öffnen soll für Resonanz2, nachhaltiges soziales und umweltbezogenes Handeln. Welt als gesamtheitlicher Begriff ist dabei gerichtet auf das Planetare wie auch das Soziale, da nur durch bewusste Einbettungsstrategien eine Haltung erzeugt werden kann, die Wachstum, Verbrauch, Geltungsdrang und Repräsentation, also all jenes, was unser westliches Kulturmodell prägt und auch eine additive Kulturpolitik lange Zeit prägte, überwinden kann, die integrativ, inklusiv und auch ethisch in einem umfassenden Sinne wirksam wird. Diese Kulturpolitik ließe sich aus den gegenwärtigen ungerichtet verlaufenden Transformationsprozessen entlehnen, als Narrativ entwickeln, das eine neue Handlungsrationalität erzeugen hilft, programmatisch verdichtet und konzeptionell operationalisiert werden kann. Es geht also um einen »kulturellen Paradigmenwechsel«, der auch ein kulturpolitischer Paradigmenwechsel sein muss: »Nicht die Reichweite, sondern die Qualität der Weltbeziehung soll zum Maßstab politischen wie individuellen Handelns werden. Als Maßstab für Qualität wiederum kann und soll dann nicht mehr die Steigerung, sondern die Fähigkeit und Möglichkeit zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Resonanzachsen dienen, während Entfremdung (auf der Seite der Subjekte) und Verdinglichung (auf der Seite der Objekte) als Seismographen der Kritik fungieren können.« Es ginge also um eine auch kulturpolitisch untersetzte Postwachstumsgesellschaft, die Wiedereinbettung der wettbewerblichen, marktorientierten Handlungen in das »soziokulturelle Leben der Gesellschaft«3 sowie seine Sinnressourcen, kreativen Räume und Erinnerungsformen.
Megatrends und Transformationen
Im Fokus steht heute die Frage nach der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Transformationsprozesse, über die in aller Breite diskutiert wird. Führende Agenturen für Zukunftsforschung identifizieren vor allem die folgenden Megatrends, die als Transformationstreiber wirken: (1) Ressourcenknappheit, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit (Klimawandel, Leben mit der Welt/Begrenzung), (2) Technologischer Fortschritt (Digitalität, Künstliche Intelligenz), (3) Globalisierung und soziale Veränderungen (Wertewandel, Migration), (4) Demographische Veränderungen (Alterung, Segregation) und (5) Urbanisierung (weltweite Verstädterung, Mobilität). Sie begegnen uns in Kulturpraxis wie Kulturpolitik bereits auf unterschiedliche Weise, zunehmend in großer Dringlichkeit.4
Diese Trends lassen sich einordnen in das Bild einer Zeitenwende, einer weitreichenden, von Wechselwirkungen und Überlagerungen gekennzeichneten Wandlungskonstellation, die inzwischen als »Great Transformation« beschrieben wird.5 Verbunden ist sie mit einer Krise der Demokratie beziehungsweise des westlichen Kulturmodells, denn fortschreitende Individualisierungsprozesse unterminieren die Kräfte und geltenden Vereinbarungen kollektiver Gestaltung, es kommt zu einer veränderten Form der Vergemeinschaftung, die Andreas Reckwitz mit dem Bild einer spätmodernen »Gesellschaft der Singularitäten« charakterisiert hat. Vorherrschende Wachstums- und Wohlstandspfade blockieren zukunftsfähige Entwicklungen. Sie folgen zudem nicht mehr der Idee eines allgemeinen Fortschritts, sondern konzentrieren sich auf die Gegenwart, eine »Affektivität des Jetzt« und die Herstellung individueller Einzigartigkeit.6 Bisher gesellschaftlich Marginalisiertes kann so zwar mehr Aufmerksamkeit erlangen, die Zone eines Allgemeinen und die Kraft gesamtgesellschaftlicher Steuerung aber schwinden dahin.
Unser Verhältnis zur Umwelt wird beschrieben als neue erdgeschichtliche Epoche, als Anthropozän. Das vom Menschen Gemachte, von ihm global Beeinflusste, fällt inzwischen so gravierend aus, dass es zur ökologisch treibenden Kraft geworden ist. Die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur gerät ins Wanken, der Mensch gibt sich als Naturgewalt.7 Zugleich verlagert sich die kulturelle Evolution stärker in die Sphären von Wissen und Technologie. Sie wird inzwischen als eine epistemische beschrieben, indem sich die »Wissensökonomie von einer zufälligen in eine notwendige Bedingung für die Bewahrung, das Teilen und die Weiterentwicklung der Errungenschaften der kulturellen Evolution im globalen Maßstab verwandelt hat.«8 Welche Rolle die digitale Transformation im Verbund mit technologischen Folgeentwicklungen und Künstlicher Intelligenz dabei wirklich spielen wird, bleibt abzuwarten, aber die regulatorische Notwendigkeit im Anthropozän ist klar: Der Mensch muss sich begrenzen, sein Verhältnis zur Welt verändern. Selbst von »protektiver Technokratie« wird inzwischen gesprochen, die den Menschen vor den Folgen seiner eigenen Unzulänglichkeiten bewahren könnte, indem er die Entscheidung über zentrale Weichstellungen einer Künstlichen Intelligenz überlässt.9
Vom Wachstum zur Anpassung
In Anbetracht dieser Transformationsprozesse und Perspektivierungen deutet sich auch eine Transformation der gesellschaftlichen Erzählung an: Die Wende vom Fokus einer ökonomischen Entwicklung (die kontinuierliches Wachstum bedeutet) zur Nachhaltigkeit, die als kulturelle Revolution aufgefasst wird, Entwicklung und Umwelt aufeinander bezieht.10 Sie überwölbt gleichsam alle Veränderungsprozesse und beschreibt den Kern nicht nur der neuen Formation des Diskurses, sondern auch der Dynamik künftiger Politiken. An die Stelle von Wachstum tritt zunehmend Anpassung. Und wo es Wachstum gibt, geht es einher mit der Synchronisierung von Entwicklung und Kontext, versteht sich also als »adaptives Wachstum«11, ferner als resilientes Wachstum, da auch Krisen auf Dauer gestellt sein werden und Widerstandskraft, Lern- und Veränderungsbereitschaft sowie Agilität zum Arsenal künftiger Handlungsfähigkeit gehören müssen.
Der Wachstumsbegriff erfährt damit eine Akzentverschiebung. Weiterentwicklung bedeutet nicht mehr unbedingt Ausdehnung, Reichweitenvergrößerung und selbstreferenzielles Mehren, sondern reflexive Einbettung, Arbeit an den Grenzen von Verfügbarkeit12 und Herstellung neuer Sinnbezüge. Corine Pelluchon beschreibt dies als Einbettung des Menschen in eine Welttotalität, die seine Milieuabhängigkeit anerkennt: »Existieren heißt nicht nur, aus sich heraus- und auf die Welt zuzugehen, ob es sich nun um eine Welt von Werkzeugen handelt, um die soziale Welt oder um die als Sprungbrett für seine [des Menschen] Freiheit verstandene Umwelt.«13 Wir sind mit der Welt und durch die Welt. Unser Verständnis von Kultur muss sich zwischen zwei Dimensionen neu einpegeln: Kultur als liminalem Raum permanenter Veränderung, Aushandlung und Innovation (Kulturpolitik der Transformation) sowie Kultur als resonantem Raum in Hinblick auf Grenzen, Respekt und Einpassung (Kulturpolitik der Adaption). Das Liminale drängt nach Entwicklung, das Resonante bezieht diese aber auf kollektive Bindungen und unser planetares Gebundensein. Resonanz spricht Umwelt im doppelten Sinne an: als soziale Welt und Summe der natürlichen Ressourcen. Erst eine Kulturpolitik, die Transformation und Adaption verbindet, scheint mir wegweisend.
Auf dem Weg zu einem solch zukunftsfähigen Weltverständnis spielt der völkerrechtliche Beschluss der UNO-»Agenda 2030« (2015) mit 17 nachhaltigen Entwicklungszielen oder »SDGs« (Sustainable Development Goals) eine maßgebliche Rolle. Das »Tutzinger Manifest« von 2001 hatte bereits die kulturell-ästhetische Dimension von Nachhaltigkeit als wesentlich herausgearbeitet. Es gilt, sie endlich umfassend zu verfolgen. Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Agenda 2030, fällt auf, dass die von der UNESCO als Lebensweise aufgefasste Kultur gar kein eigenständiges Entwicklungsziel (SDG) beansprucht, wenngleich es doch um eine ökonomische, technologische, politisch-institutionelle und zuvörderst wohl kulturelle Wende geht. Zwar kann man Kultur und Kulturpolitik als Querschnittsaufgaben begreifen, doch muss man ihnen unbestritten auch eine spezifische Rolle im Prozess grundlegender Wandlungen zuweisen. Die Stadt Augsburg hat in ihren Zukunftsleitlinien Kultur explizit zu einer Dimension der Nachhaltigkeit erhoben und knüpft damit an die jahrhundertelange Erfahrung mit ihrem Wassermanagementsystem an, das seit 2019 zum UNESCO-Welterbe zählt; zudem erhielt die Stadt im Jahr 2021 den Kulturpolitischen Zukunftspreis KULTURGESTALTEN der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. Er würdigt die Stellung der Kultur als vierte Dimension innerhalb der Augsburger Zukunftsleitlinien, die den Rahmen des Nachhaltigkeitsverständnisses setzt, aus dem heraus in den drei anderen grundlegenden Dimensionen (Ökologie, Soziales, Wirtschaft) gehandelt wird.14
Neue Narration für die Kulturpolitik
Kulturpolitik kann dazu beitragen, Mentalitäten, Denkweisen und Repräsentationen zu verändern. Sie verhält sich auch nicht affirmativ zu den Transformationsprozessen, da diese selbst mit negativen Wirkungen behaftet sind, sondern sie fragt im Sinne Hartmut Rosas, wie »zwischen individueller Selbstwirksamkeit und Selbstwahrnehmung sowie gesellschaftlicher Verankerung nachvollziehbare Zusammenhänge« herzustellen sind.15 Es geht folglich nicht nur um das Überwinden von Routinen und Pfadbindungen, sondern auch die Einübung eines kritischen Umgangs mit neuen Verhaltensweisen, Technologien oder sozialen Verwerfungen durch Veränderung. So hat die Digitalität massive, aber nicht nur positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Demokratie: Sie weitet Teilhabemöglichkeiten sehr stark aus, zersetzt aber auch durch ihre Medien und Formen der Kommunikation den Diskurs, führt im schlimmsten Fall zur Herrschaft der Information ohne Orientierung und Konsens.16 Daraus ergibt sich nicht zuletzt eine Krise der Narration selbst17, der mit der Suche nach einer adäquaten kulturpolitischen Erzählung unserer Zeit entgegengewirkt werden soll.
Der Fortschrittsbegriff kommt, wie von Reckwitz beschrieben, nicht mehr dafür in Frage, Zukunft zu projektieren; Philipp Staab spricht aufgrund der starken Subjektivierung unseres Fortschrittsverständnisses vom »halbierten Fortschrittsbegriff der Spätmoderne«.18 Er plädiert alternativ für eine auf den ersten Blick paradoxe »adaptive Rebellion« und beschreibt die Klimaschutzbewegung als ein Beispiel für Fortschrittsverzicht, das individuelle und kollektive Praxis verbinde und Selbsterhaltungskonflikte herausstelle. Es käme darauf an, ein positives Verständnis von Anpassung zu erzeugen, bei dem die kulturelle Orientierung von Selbstentfaltung auf Selbsterhaltung umgestellt und auch die gesellschaftliche Räson darauf ausgerichtet würde.19 Angesprochen ist damit die Wohlstands- und Konsumwende. Der eingangs zitierte John von Düffel hat ein poetisches Plädoyer für das Wesentliche artikuliert, Adrienne Goehler legt eine ästhetische Methode vor, Nachhaltigkeit einzuüben und den Kulturbereich für Wandlungsprozesse aufzuschließen, auch zu nutzen.20 Wege, das Denken, Fühlen und Handeln umzuorientieren, zu purifizieren.
Vieles spricht für eine ganzheitliche Perspektivierung von Kultur aus einer ökologischen Sicht. Wir bewerten dann Kultur nach Kriterien eines zukunftsfähigen, also im Gleichgewicht21 befindlichen Ökosystems und verstehen kulturelle Systeme nicht als Überlegenheit gegenüber der restlichen Biosphäre. Wichtige abgeleitete Bewertungsgrößen von »guter« Kultur wären folglich »ihr kreatives Potenzial, ihr Grenzregime, ihre Fehlerfreundlichkeit, ihre Nachhaltigkeit und ihre Vielfalt. Diese Eigenschaften stehen in Wechselbeziehungen zueinander […].«22 Wir erkennen allein in dieser ersten »Entlehnung« ökologischer Prinzipien wichtige Bezüge zu laufenden kulturpolitischen Debatten und Schlagworten. Es gilt jedoch, sie vor allem als System zu denken, Entgrenzungen gegenzusteuern, auch und insbesondere im Umgang mit den eingangs genannten Megatrends. Konkrete Untersetzungen sind freilich erforderlich. Kulturpolitische Programmatik und Planung auf allen Ebenen des föderativen Systems kann dies leisten.
Als maßgebliche Agentur wurde unlängst die Anlaufstelle Green Culture etabliert, die Informationen über Aktivitäten zur ökologischen und klimagerechten Transformation anbietet, berät, vernetzt und auch hilft, das Ziel der Klimaneutralität spätestens bis 2045 zu erreichen. Die Schwerpunkte für das Jahr 2024 beispielsweise liegen bei den Themen Energieeffizienz in der Kultur, Klimafolgenanpassung der Kultur sowie Kreislaufwirtschaft in der Kultur. Dabei geht es nicht nur um die Transformation eines gesellschaftlichen Bereichs, sondern auch um die Vorbildfunktion, die das Feld innehat, und die narrative Kraft kreativer Einrichtungen.23
Gute Praxis vor Ort, die exemplarisch ist und zum konkreten Nachahmen anregt, scheint mir für einen gelingenden Bewusstseinswandel von außerordentlicher Wichtigkeit. Ein gehaltvolles, zudem hervorragend dokumentiertes Beispiel dafür ist das Klimafestival des Netzwerks Bayerischer Städte e.V., das sich seit 2020 schwerpunktmäßig mit einer »Kultur im Klimawandel« befasst.24
Heute scheint die Zeit gekommen, die umfassendere Ökologie zur Leitdisziplin zu erheben und die Ökonomie unterzuordnen – die als ästhetischer Kapitalismus gegenwärtig alles kommodifiziert. Damit müssten wir auch manageriale Leitbilder in der Kulturpolitik kritischer bewerten (ohne freilich das Kulturmanagement aufzugeben). Ironischerweise intonierte den ersten radikal reduktiven und adaptiven Appell an die kulturpolitische Steuerung ein Autorenteam, das man vor allem im Kulturmanagement verorten kann, allerdings nicht vor dem Hintergrund der Großen Transformation oder gar einer dezidiert (kultur-)ökologischen Warnung vor den Grenzen des Wachstums, sondern funktional und marktbezogen: als Kritik am »Social Engineering« des Kulturstaates und am Misstrauen gegenüber der Regulationskraft eines mündigen Publikums.25
Kulturpolitische Slogans und praktische Folgen
Eine ganzheitliche, achtsame und in der Praxis vielfältig einzuübende adaptive Haltung zur Kultur ließe sich als »Kulturpolitik der Weltbeziehungen« fassen.26 Damit ist die Qualität gemeint, wie wir Welt erfahren und wie wir sie uns aneignen. Dass diese Kulturpolitik auch eine nachhaltige ist, versteht sich von selbst.27 Allerdings scheint mir ein programmatischer Begriff besser geeignet, der die soziale Dimension betont. Schließlich geht es primär darum, das menschliche Beziehungsgeflecht neu zu kalibrieren. Damit ist auch das Ende einer additiven Kulturpolitik eingeläutet, die jedes alternative Bedürfnis mit Zusatz, nicht mit Neuausrichtung der Verflechtungen beantwortet.
Für die Kulturpolitik bedeutet die Grundierung durch ein Narrativ der beziehungsorientierten Adaption nicht nur institutionelle Revision, Begrenzung und Umbau, sondern überhaupt erst einmal eine präzise Umgebungsbilanz aller Maßnahmen, Förderpolitiken und Praktiken. Ich stelle mir die Ist-Analyse der kulturellen Infrastrukturen, Angebote und Maßnahmen bei Neu- oder Fortschreibung einer Kulturentwicklungsplanung daher anders als die bisherigen Bestandsaufnahmen vor: als Beziehungs- und Resonanzanalyse im Gemeinwesen, aber auch innerhalb der Kulturlandschaft im engeren Sinne, die voller Bezüge und Kooperationen sein sollte. Indikatoren dafür ließen sich aufstellen, Zielvorgaben anpassen. Grundlage eines Soll-Bildes wäre eine kulturpolitische Rahmenerzählung, die sich in die Gesamtstrategie einer nachhaltigen Kommune einordnet und an den SDGs orientiert, oder gleich in ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept mündet, in das alle Fachplanungen auf Basis einer übergeordneten Methodik einfließen. Dies könnte dazu beitragen, mehr Stringenz in das ansonsten schwer objektivierbare Kulturfeld zu bringen, denn sonst gilt weiterhin, was jüngst Opitz pointiert feststellte: »Vorsichtshalber lieber möglichst alles fördern […].«28
Eine neue Narration vermag also auch den Fokus praktischer Kulturpolitik zu verschieben, wenn sie untersetzt und ausgestaltet wird. Es ist an der Zeit, Haltungen einer Kulturpolitik der Transformation zu entwickeln, die beziehungsreich sind und neue Formen der Wiedereinbettung in Umgebungen in Gang setzen.
1.2 Kulturpolitik in der Krise des Allgemeinen
»Die Gemeinschaften der Herausgeputzten brauchen ein Spektakel, das an schlummernde Bedürfnisse rührt, um ansonsten vollkommen disparate Individuen für eine kurze Zeit zusammenzuführen … Das Spektakel, das diese Gemeinschaften zum kurzen Leben erweckt, verschmilzt die Interessen der Teilnehmer in keiner Weise zu einem ›Gruppeninteresse‹; durch Addition gewinnen die einzelnen Anliegen keineswegs eine neue Qualität, und die Illusion, etwas mit anderen zu teilen, hält nicht länger vor als die Erregung, die durch die Darstellung auf der Bühne vermittelt wird.«29 Besser – und noch dazu mit Hilfe einer künstlerischen Metapher – kann man wohl die Krise des Allgemeinen nicht beschreiben. Sie kündigt sich schon länger an. Das Besondere ist heute zu einer so starken sozialen Norm geworden, dass Soziologen einen Strukturwandel der Moderne darin erkennen. Der derzeit viel rezipierte Andreas Reckwitz hat sein Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten« diesem Wandel gewidmet. Zwar konzediert er, dass das Allgemeine stets strittig und umkämpft gewesen sei, dass insofern Krisen durchaus zur Geschichte der Moderne gehören, doch läuft derzeit vieles auf die Frage hinaus, »ob die Gesellschaft der Singularitäten nach ganz anderen und neuen normativen Maßstäben verlangt«30.
Aber was verschwindet da eigentlich? Und wie hat das Allgemeine in unserem Falle die Kulturpolitik geprägt? Muss es künftig eine kulturpolitische Programmatik der Singularitäten geben, ja wäre diese überhaupt möglich? Nicht »Kultur für alle«, sondern nur noch »Kultur für mich und durch mich«? Nicht erst seit Reckwitz’ »Gesellschaft der Singularitäten« beobachten wir Zentrifugalkräfte. Der gesamte Postmoderne-Diskurs lebt von der Dekonstruktion der Gewissheiten und einer »Kultur ohne Zentrum« (Richard Rorty). Wir sind eigentlich schon daran gewöhnt, jenseits alter Ganzheiten oder großer Erzählungen zu denken und einem starken Bild von Vielfalt zu folgen. Wobei die Postmoderne mehr Krisensymptom als neue Antwort war; der Begriff brachte ein Unbehagen am Universalismus der Moderne zum Ausdruck, ohne selbst zu methodischer Kohärenz zu finden. Aber genau das machte ihn so interessant und streitbar. Irgendwie stand er für eine Übergangszeit, die zu beschreiben schwerfiel, und so verwundert es nicht, dass uns Komposita mit »Post-« heute nach wie vor begegnen und hochaktuell sind, beispielsweise zur Beschreibung der Erosion von Demokratie und Politik: Postdemokratie und Postpolitik. Auch hier geht es nicht darum, etwa die Demokratie überwunden zu haben, sondern »am anderen Ende der Parabel der Demokratie« angelangt zu sein – mit »Langeweile, Frustration und Desillusionierung«31. Hartmut Rosa begreift demokratische Politik als eine »vitale Resonanzsphäre der Moderne«32, sieht jedoch heute den »Resonanzdraht zwischen Bürgern und Politik« gerissen.33 Postdemokratie als lädierte Demokratie. Aber immer noch als Demokratie. Für Postpolitik ließe sich ein ähnlicher Befund beschreiben.
Der Übergang – wohin auch immer – scheint gestaltbar zu sein, zumindest spürt man in den einschlägigen Texten zu diesem Thema die Sehnsucht danach. Postdemokratie kann jedenfalls als ein Symptom einer Krise des Allgemeinen gedeutet werden. Die »Kunst der Demokratie« (Carsten Brosda) beginnt zunächst mit der eigenen und unmittelbaren Verwicklung, der starken Identifikation mit dem Gemeinwesen, seiner Gestalt und Gestaltbarkeit. Richard Sennett schrieb dazu: »Die athenische Demokratie legte großen Wert darauf, dass ihre Bürger anderen ihre Gedanken in derselben Weise offenlegten wie die Männer ihre Körper entblößten. Diese gegenseitigen Akte des Offenlegens sollten den Zusammenhalt zwischen den Bürgern festigen.«34 Ist dies aus heutiger Sicht auch eine sehr patriarchale und maskuline Geste, spiegelt sie doch die bis ins Körperliche reichende Betroffenheit vom Gesellschaftlichen wider. Die Agora tritt als räumliche Entsprechung an die Seite des entkleideten Körpers, sie ist der politische Ort, an dem unter aller Augen Entscheidungen oder Wahlen stattfinden. Transparenz und unmittelbare Involviertheit sind seit der Antike also wichtige Bausteine demokratischen Denkens.
Demokratie scheint vor diesem historischen Hintergrund weniger Gabe denn aktive Tat. Jeder und jede von uns erzeugt und trägt sie in Ursprünglichkeit. Demokratie bedeutet Aushandeln; aufgrund ihres prozessualen Charakters ist sie grundsätzlich instabil, formbar. Schließlich geht es stets um Macht auf Zeit und die gemeinsame Gestaltung von Übergängen. Demokratie fußt auf Grundsätzen und Überzeugungen, etwa jenen der Selbstbestimmung und der gesellschaftlich eingehegten Freiheit des Einzelnen, muss aber immer auch als transformatorisches Projekt sui generis begriffen werden, d.h., es gilt, gesellschaftlichen Konsens permanent neu auszutarieren. Das macht sie anstrengend, mitunter mühsam und Missverständnisse provozierend. Nirgends erlebt man das wohl unmittelbarer als in der Kommunalpolitik.
Bei aller Dynamik kann Demokratie außerdem nur in staatlicher Verfasstheit wirksam werden, es gibt keine »Demokratie der Menschheit«, wie dies der Politikwissenschaftler Philip Manow beschreibt.35 Demokratie als Staatsform zwingt uns, immer auch ein Außen zu denken und universalistische Prinzipien auf beides zu beziehen, auf uns und andere. Wir benötigen kritisches Bewusstsein für unsere Begrenztheit und mehr Gefühl für Differenz in der Welt. Mit dem Selbstbewusstsein, auf dem Königsweg zu sein, ist es nicht getan. Leider müssen wir feststellen, dass weltweit Autokratien zunehmen bzw. schleichende Autokratisierungen geschehen. Wir können Entwicklungsimpulse aber nur setzen, wenn wir selbst eine reflektierte und robuste Demokratie tatsächlich leben. – Aber gelingt uns das? Es mehren sich die Beobachtungen, dass etwas nicht stimmt mit unserer demokratischen Verfasstheit. Von müder Demokratie, simulativer Demokratie, unpolitischer Demokratie, Entdemokratisierung der Demokratie, demokratischer Regression oder Postdemokratie ist die Rede, um nur einige wichtige Buchtitel der jüngeren Zeit zu nennen.36
Aber auch das Prozedurale der Demokratie befindet sich mutmaßlich in der Krise. Einerseits scheinen die Bürger hinter die Verfahren zurückgetreten, ist von einer Expertokratie die Rede (von der Dominanz der Gremien, Beiräte und Ähnlichem), die die Wirksamkeit des Einzelnen verschwinden lasse. Andererseits nimmt Bürgerbeteiligung zuweilen Formen an, die begründete Abwägungs- und Entscheidungsprozesse konterkarieren oder erheblich verzögern. Etwa in Gestalt jener kleinteiligen Bürgerinitiativen, die zu jedem Zeitpunkt eines Verfahrens oder auch noch lange danach wie Partisanen jenes erbittert und ohne Einsicht verteidigen, das ihnen selbst – und nur ihnen selbst – am nächsten ist. Man kann eine zunehmende Tendenz der Vergesellschaftung von Individual- oder Kleingruppeninteressen beobachten, die den eigentlichen Demos zum Erfüllungsgehilfen degradiert. Meine Demokratie ist dann das, was uns eigentlich aufeinander beziehen soll, Ausgleich schaffen.
Die empathische Sorge ums Ganze tritt zurück, wird zu etwas Abstraktem, das das hyperindividualisierte, singularistische Individuum scheinbar nicht betrifft. Hinzu kommt, dass politischen Parteien tendenziell die Mitglieder ausgehen und sich ihre Willensbildung von den Menschen zu entkoppeln droht. Daraus ergibt sich nicht nur ein Rekrutierungsproblem bei Mandatsträgern, sondern auch ein Mangel an Identifikationskraft: Wenn ich mir selbst der Nächste bin, wozu brauchte ich dann einen Kämpfer, eine Kämpferin fürs Allgemeine? Wie schnell bilden dann Politikerinnen und Politiker eine erbarmungswürdige, um sich selbst kreisende Kaste, die man missachten, beschimpfen und lächerlich machen kann. Wir beklagen also auch eine Krise der Repräsentation.
Die Postmoderne zeigt – wie heute auch die Postdemokratie – eher eine Erschöpfung, nicht das Ende von Entwicklung an. Erschöpfung kann man begegnen, sich auf ihre Erfordernisse einstellen. Ihab Hassan hatte dazu eine Merkmalreihe aufgestellt, die eine Diskussion postmoderner gesellschaftlicher Eigenschaften erlauben sollte. Als konstitutiv beschreibt er etwa Unbestimmtheiten (Ambiguitäten, Brüche, Verschiebungen innerhalb unseres Wissens und unserer Gesellschaft), Fragmentarisierung, Auflösung des Kanons, Verlust von »Ich« und von »Tiefe« (aber auch Selbstvervielfältigung, Selbstbespiegelung des Ich), Hybridisierung, Karnevalisierung oder Konstruktcharakter, um einige zu nennen.37 Auf eine Definition lief dies nicht hinaus. Es war eher eine Suchbewegung aus der Moderne, der wir noch immer nicht entwachsen sind. Deutlich wurde indes, dass Bindekräfte schwinden und Unsicherheiten an die Stelle tradierter Rationalitäten und Institutionalisierungen treten. Die »Generalisierungsmaschine« Moderne38 kommt zum Stillstand, das Einzigartige, Inkommensurable bricht sich Bahn. Bis hinein in das Verkürzte der »Infokratie« der Digitalmoderne, in der die Zeit für rationales Handeln schlichtweg fehlt, uns die »Affektkommunikation« prägt.39
Nach Reckwitz kommt es seit dem letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts zu einer »Neukonfiguration der Formen der Vergesellschaftung«, eben zu einer singularistischen: Der Einzelne in seiner Sonderung ist alles, die Märkte – als »Attraktivitätsmärkte« – sind auf ihn ausgerichtet. Und nicht nur Subjekte arbeiten an ihrem unverwechselbaren Profil, auch Objekte oder Institutionen unterliegen diesem Prozess. Alles Verbindende, alles Systemische, das die Moderne hervorbrachte, steht damit tendenziell in Frage. Für Reckwitz bedeutet die heutige Krise des Allgemeinen, das einst als Kern der klassischen Moderne galt, eine Erschütterung von Grundstrukturen und Gewissheiten, die er der Phase der Spätmoderne zuschreibt. Spät scheint dabei sowohl Reife als auch Dekadenz bedeuten zu können. In jedem Fall aber gerate ein konstitutives Element der klassischen Moderne ins Wanken, »nämlich das normative Ideal eines gesellschaftlichen Fortschritts«40, also einer gerichteten allgemeinen Bewegung. Die große Erzählung des politischen Fortschritts werde von den »kleinen Erzählungen« des privaten Erfolgs und des guten Lebens abgelöst, die Zeitstruktur sei an der Gegenwart orientiert, das »radikale Regime des Neuen«, das Reckwitz schon in der »Erfindung der Kreativität« beschrieben hatte41, sei nicht an langfristiger Innovation ausgerichtet, sondern an der »Affektivität des Jetzt«42. Für alle diese Diagnosen ließen sich Beispiele aus unserem täglichen Leben finden, auch im Übrigen aus dem Kulturbetrieb. Daraus ergeben sich nach Reckwitz nun drei Krisen: eine Krise der Anerkennung, eine Krise der Selbstverwirklichung sowie eine Krise des Politischen. Anerkennung heischen jene, die »unmittelbar an der Gestaltung von komplexen Einzigartigkeitsgütern beteiligt sind oder aber deren Arbeit als eine kostbare singuläre Leistung erscheint«43. Vorbei ist damit die Illusion des sozialen Aufstiegs für alle. Zu Recht verweist Reckwitz auf die neue Unterklasse und die Entwertung ihres Lebensstils. Im selben Zusammenhang der inzwischen obsoleten Verknüpfung von Demokratie und Wachstum bzw. Fortschritt spricht Oliver Nachtwey sogar von einer »regressiven Moderne«, die zu neuen Abstiegserfahrungen führe.44
Die Krise der Selbstverwirklichung wird gespeist vom Druck des »Steigerungsimperativ(s) der Selbsttransformation«45, der anhaltenden Erwartung an Perfektibilität und Performanz. Wenn Selbstverwirklichung eine permanente Erwartung ist, wird der Grad der Individualisierung beständig gesteigert. Dieser Druck auf die Verwirklichung des Selbst trifft aber auch die Kreativen im engeren Sinne in ganz neuer Qualität: »Um Erfolg zu haben bzw. nicht unterzugehen, muss der Kreative sich einen Namen machen …, das heißt, er muss seine monetären Gewinnansprüche rechtfertigen, indem er den Wert seines eigenen Namens zur Geltung bringt, der wie eine Marke eingesetzt wird und auch als solche rechtlich eingetragen werden kann.«46 Die absolute Selbstvermarktung ist die Konsequenz der Singularitäten. Schließlich besteht die Krise des Politischen darin, dass die gesamtgesellschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten verloren gegangen seien; Primat beanspruchten an deren Stelle »die Eigendynamiken der Ökonomie, der (Medien-)Technologie und der Kultur der Lebensstile«47. Damit würden auch Kulturessenzialismen und religiöse Partikularismen erstarken. Wir leben in einer Gesellschaft also, die sich radikal am Besonderen orientiere und das Allgemeine aus der Politik tilge.
Das betrifft auch die Ausrichtung und Wirkungsmöglichkeiten von Kulturpolitik und führt – wie zu zeigen sein wird – zur Instrumentalisierung des Kulturellen. Das ist ein starker Befund, der bei aller Postmoderne-Erfahrenheit nachdenklich stimmt, aber auch erklärt, warum uns Verständigung zunehmend schwerfällt, das Einkreisen von Schnittmengen und Kompromissen zu endlosen Debatten führt. Oder warum Debatten schnell vergiftet werden können, wenn hinter einer Politik des Allgemeinen – etwa einer europäischen Leitkultur im Sinne Bassam Tibis – der exklusive Mechanismus einer deutschen Leitkultur vermutet oder konstruiert wird.48Können wir keine Richtungsimpulse mehr setzen, die eine Klammerfunktion beanspruchen?
Deutsche Kultur als Dissonanzerfahrung
Die Krise des Allgemeinen hat uns inzwischen voll erfasst und führt zu kulturellen Verwerfungen. So hat die Debatte darüber, wer oder was die deutsche Gesellschaft sei, erheblich an Fahrt gewonnen. Von radikaler Vielfalt ist die Rede, von einer postmigrantischen Perspektive, die ein neues Miteinander einfordert, sich von national-ethnischen Bildern der Zusammengehörigkeit abhebt und mit der Fokussierung auf Pluralität die Differenzen trotz der Gleichheit aller Menschen stärken soll.49 Bisherige Begriffe und Zuschreibungen werden folglich dekonstruiert, etikettiert oder skandalisiert, ja die Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen, welche Haltung wir zu erkennen geben, gerät zum Maßstab des Diskurses, seiner Berechtigung oder gar Unmöglichkeit – bis hin zu Ansätzen einer Cancel Culture50. Da die Sprache mehr denn je zuvor als Produzentin von Wirklichkeit verstanden wird, erhöht sich die Komplexität aus Gesagtem, Gemeintem, Gewohnheit und generationeller Prägung, auch in Hinblick auf jene, die sich – etwa als Migrantinnen und Migranten oder Vertreter einer Minderheit – sprachlich neu erfinden müssen und Sprache selbstbewusst mit ihren Ansprüchen konfrontieren: »Freies Sprechen bedeutet die Emanzipation von einer Sprache, die uns nicht vorsieht – indem wir sie verändern, anstatt uns zu erklären, indem wir sie anders nutzen, um in ihr zu sein.«51 Hinzu kommt die Tendenz, die postulierte Vielfalt aus einer Privilegierungs-, Diskriminierungs- und Vulnerabilitätsperspektive zu argumentieren, die das Narrativ vom gesellschaftlichen Ganzen auf die Füße seiner vermeintlich konstitutiven Vielgliedrigkeit und Uneindeutigkeit stellt. Damit erscheint die (bürgerliche) »Mitte« der Gesellschaft als Dominanzkultur, Wolfgang Thierses Rede von Normalität als normative »Cancel Culture des alten weißen Mannes«52, werden Vergewisserungs- und Erinnerungsrituale schnell zum Arsenal der Vergiftung einer multiplen Gegenwart, ob völkisch, rassistisch, klassistisch oder gleich nazistisch. Denn jene Mitte wird als homogen, weiß und ausgrenzend imaginiert und verworfen, sie ist das Gegenteil konstitutiver Verschiedenheit, von der aus Gesellschaft nun gedacht, die Machtfrage neu gestellt werden soll. Autorität ist die Autorität der Andersdenkenden, ein Gravitationsfeld von Gesellschaft wird zunehmend in Frage gestellt.
Die Vielfalt der Kulturen im Sinne dieses Leitbildes begegnet uns als die Vielfalt der Vielen – die Vielen aber sind die Verschiedenen, miteinander einzig lose verknüpft als Verbündete kraft der Erfahrung zunehmender Selbstperspektivierung, starker Identität. Jenseits jeglichen Assimilations- und Integrationsdrucks scheint sich auch hierzulande eine Politik der Anerkennung herauszubilden, die nicht mehr die Gleichheit der Menschen zuerst betont, sondern eher ihre gruppenspezifischen Besonderheiten herausarbeitet.53 Ob Herkunft, Geschlecht oder Behinderung – ausgehend vom sensiblen Umgang mit Differenz entsteht offenbar eine wehrhafte oder distinkte Diversity, obwohl dieses Konzept eigentlich auf Gemeinsamkeit, Chancengleichheit und Abbau von Hierarchien zielt. Doch das neue gesellschaftliche Ganze, so eine berechtigte Befürchtung, darf nicht mehr sein als die Summe seiner Teile – als bewusste Verweigerung einer Großerzählung oder zumindest auf der Hut vor deren vereinnahmender Ganzheitsbehauptung, etwa einer Nation oder gar einer wertebezogenen (Leit-)Kultur. Nur so kommen offenbar »unterrepräsentierte Minderheiten« zu Gewicht und Geltung, wird erlebte oder als tradiert empfundene Unterdrückung sprachfähig. Kann man so aber Gesellschaft »neu erfinden«? Ist diese Radikalität der »Befreiung« als Geste und Praxis politisch gestaltbar, auch und gerade in demokratischer Hinsicht, oder ist sie Teil einer Überindividualisierung, eben einer »Krise des Allgemeinen«? Wird dabei Kulturpolitik zur Arena der Ideologien, sowohl rechter als auch linker Identitätspolitik? Kulturpolitik (wieder) ein Instrument der Kulturrevolution, zur Klärung der »kulturellen Macht«, der Bilder, Erzählungen, Tabus?
Der Populismus und die Wiederaufladung der Kultur
Es ist weitgehend Konsens, dass wir uns von ererbten, noch immer zirkulierenden Ganzheitsphantasien verabschieden müssen, deren Rückseite Mechanismen der Ausschließung oder Kolonisierung sind. Gegenwärtig aber scheint sich der Diskurs auf eine binäre, ideologisch geprägte Opposition zuzuspitzen, auf deren einer Seite die Neue Rechte bzw. ein Rechtspopulismus mit dem parteipolitischen Filtrat der AfD steht, auf deren anderer eine Linke, deren Gravitationszentrum immer stärker um Fragen der Identität kreist und damit auch die nazistische Totalperspektivierung verstärkt. Es werden dadurch Eindeutigkeiten und Zuschreibungen produziert, die die Debatte nicht eben positiv befördern, sondern vielmehr Frontstellungen verursachen, die eine Neujustierung der Gesellschaft erschweren. Dies läuft der eigentlich geforderten radikalen Vielfalt entgegen und beschädigt auch das errungene Maß an Diversität. Eine oft schon aggressive Viktimisierung von Minderheiten trägt dazu bei, jegliche Positionierung einer bekenntnishaften Klarheit zu verpflichten, die sich möglichst noch von allem distanziert, was durch Prägungen der Mehrheitsgesellschaft entstanden ist. Bis in die (An-)Sprache hinein. Diese verschärfte Ideologisierung spaltet sogar die Partei DIE LINKE, wie man an der Debatte über Sahra Wagenknechts Buch »Die Selbstgerechten« und ihre Parteigründung »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) trefflich nachvollziehen kann.
Nicht nur die Diskussionskultur, die von neuen Geboten und Verboten geprägt ist, belastet also den Diskurs, auch die rigiden Zuschreibungen von links und rechts machen es schwer, zwischen Gesinnung und Imago zu unterscheiden. So gibt es »echte« Rechte (Nazis) und eine Vielzahl von Akteuren, die aus unterschiedlichsten Erfahrungen oder Zuweisungen so bezeichnet werden. Es gibt Linke und ein linksliberales Milieu bzw. »Lifestyle-Linke«54. Durch Identitätspolitik, also die Betonung gruppenspezifischer Eigenschaften und den Umgang mit ihnen, werden pauschale Zuschreibungen von links und rechts verfestigt; Containerdenken der Gesinnungen, als gebe es auch sonst nur Fortschritt oder Rückschritt. Die Krise des Allgemeinen wird zur Bühne der Populismen, auf der sich alte Schemata und Konjunkturen des Identitären begegnen.
Dabei war einmal die Rede von einem linken Ansatz, der das populistische Moment geschickt für einen gesellschaftlichen Aufbruch nutzt und produktive Spannung erhält: Chantal Mouffe forderte im Sinne ihres agonistischen Denkens einen solchen Populismus ein, um dem Aufstieg rechter Parteien Einhalt zu gebieten und eine Gegenbewegung zu initiieren, die darauf abzielt, »die demokratischen Forderungen in einem kollektiven Willen zu bündeln, um ein ›Wir‹ zu konstruieren, ein ›Volk‹, das seinem gemeinsamen Gegner die Stirn bietet: der Oligarchie.«55 Diese neue Hegemonie unterscheidet sich von der national(istisch)en Souveränität der Rechtspopulisten und bindet all jene ein, die diese ausschließt. Zur radikalen Vielfalt kommt also noch die radikale Demokratie, die ein Volk konstruiert und das populistische Moment nutzt, einen neuen Common Sense zu erzeugen. Die neoliberale Oligarchie als Gegenbild wird jedoch allein nicht ausreichen, die Menschen alternativ zu verbinden, zumal der Kapitalismus im Verbund mit der Digitalisierung eine verstärkte korrumpierende Wirkung auf den Einzelnen entfaltet. Und vielleicht ist es gerade jene immer häufiger postulierte Radikalität, die es zu verderben droht. Folgt man Wagenknecht, bedeuten die Lifestyle-Linken ohnehin das Ende echter linker Politik, da sie ein bestimmtes Milieu der Akademiker und Besserverdiener repräsentierten, eher Haltungsnoten verteilten als echte Sozialpolitik zu betreiben und stärker an Selbstverwirklichung interessiert seien als an realer Veränderung. Daher unterstellt ihnen Wagenknecht auch eine Allianz mit dem Wirtschaftsliberalismus,56 sodass der angestrebte Common Sense schon im neuen linksliberalen Milieu unklar sein dürfte. Wagenknecht führt aus, wie dort eine Politik greift, die Identität nicht mehr über die soziale Stellung der Menschen definiert, wie es die traditionelle Linke tat, sondern über individuelle Eigenschaften wie Ethnie, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung.57 Dabei gäbe es in sozialer Hinsicht viel aufzubegehren in der »Abstiegsgesellschaft« der regressiven Modernisierung, in der wir »hinter das in der sozialen Moderne erreichte Niveau an Integration zurückfallen«, Demokratie und Wachstum nicht mehr untrennbar zusammengehören.58 Dies im Blick, findet Wagenknecht starke Beschreibungen wie »elitäres Stammesdenken« oder »mimosenhaftes Beleidigtsein«, um die Spaltungskraft eines identitätspolitischen Linksliberalismus zu brandmarken. Dies alles zerstöre »das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesellschaft insgesamt und damit die wichtigste Voraussetzung für gesellschaftliche Solidarität und Sozialstaatlichkeit.«59 Das sei auch der Punkt, an dem die linksliberale Erzählung der neoliberalen ähnele.
Wagenknecht berührt mit dem Begriff der Solidarität den entscheidenden Nexus, denn die reine Dekonstruktion von Gesellschaft führt zu Ent-Gesellschaftung, also zum Schwinden einer Verbindung zwischen Individuen und Gruppe. Heinz Bude beschreibt Solidarität als »die Basis für den Überbau der Interessengegensätze, der Geschmacksvielfalt und der Glaubenskämpfe. Trotz scheinbar unvereinbarer politischer, kultureller oder sozialer Gegensätze verhindert sie die Auflösung des sozialen Bandes, das alle miteinander verbindet und einander bindet.«60 Er führt den Sozialstaat als institutionalisierte Form der Solidarität ins Feld61, zeigt aber auch die internationale Dimension vor dem Hintergrund sich verschärfender Ungleichheiten auf, die unsere bisherigen Formen von Solidarität herausfordert: »Im globalen Norden müssen wir uns jetzt fragen, ob wir uns im Sinne eines Rassismus der Differenzen zu einem Kampf um Anerkennung zwischen unserem Wir und dem Wir der Anderen verleiten lassen … oder wir uns mit unserem Begehren nach Anerkennung und Solidarität einer Auseinandersetzung um die Definition eines größeren Wir jenseits eines Wir des Nordens und eines Wir des Südens stellen wollen.«62 Diese Suchbewegung verweist nicht nur auf das (globale) Konzept einer Transkulturalität im Sinne des Aufgebens kultureller Abschließung und der Betonung von Mischung im Miteinander, auf das ich zurückkommen werde, sondern eben auch auf die Suche nach Verbindendem innerhalb eines von Migration und Pluralität der Lebensstile geprägten Landes wie Deutschland. Folgerichtig widmet sich Sahra Wagenknecht den großen Erzählungen, die Bilder von Gemeinschaft prägen und rechtfertigen, die Orientierung geben. Hier setzt auch ihre Programmatik an, die an dieser Stelle nicht vertieft werden soll und von der Analyse ins Parteipolitische führt.63
Der linke Populismus müsste also zuerst das Allgemeine stärken, Verbindungen aktivieren. Wie kann er das praktisch erreichen? Immerhin hebt Mouffe auf die affektiven Energien ab und weist »künstlerischen und kulturellen Praktiken«64 eine wichtige Rolle zu. Worin deren Konvergenzversprechen in Hinblick auf das neue Volk besteht, erläutert sie indes nicht. Wir kennen aus der sozialistischen Kulturpolitik jedoch die Hoffnungen, die sich nicht erfüllten: der marxistische Kulturpolitiker Anatoli Lunatscharski (1875-1933) forderte schon seinerzeit, die Theater, Konzerte und Ausstellungen zu nutzen, um neuen Geist zu schaffen, und er bejahte eine proletarische, klassenmäßige Ästhetik.65 Sie erst forme die Identität, das Selbstbewusstsein einer Avantgarde, die sich alte Kulturschätze aneignet und zugleich neue Helden generiert. Heute, antiklassistisch gestimmt, bleibt gar kein revolutionäres Subjekt mehr übrig, das Avantgarde sein und eine Richtung vorgeben könnte.
Die Neue Rechte lernte zwischenzeitlich von der linken Kulturauffassung Gramscis und fokussiert ebenfalls das Vorpolitische: Wer die kulturelle Macht hat, kann die Gesellschaft lenken und einen Wandel herbeiführen.66 Ein neu aufgelegter Text von Alain de Benoist aus den 1980er Jahren begegnet dem rechten Theorievakuum und versucht, Lehren aus der marxistischen Dialektik zu ziehen, die die gesellschaftliche Wirklichkeit zu mechanisch von der ökonomischen Basis abgeleitet hätte. Die einfache Basis-Überbau-Lehre sieht de Benoist bei Gramsci so weitergedacht, dass sie der Komplexität der bürgerlichen Gesellschaft entspricht und die Kraft der Mentalitäten richtig gewichtet. Es ist auch die Weltanschauung, die konstitutiv wirkt; mit Pierre Bourdieu würde man heute vom Habitus sprechen, dem viel mehr eingeschrieben ist als das ökonomische Kapital. Der entscheidende Punkt der Machtfrage ist kein unmittelbarer, sondern eher einer der mentalen Emergenz, die es in Gang zu setzen gilt, denn »in den Gesellschaften, in denen eine spezifische kulturelle Atmosphäre herrscht, ist keine Übernahme der politischen Macht möglich ohne eine vorhergehende Übernahme der kulturellen Macht.«67 Die Neue Rechte versucht demgemäß, kulturelle Leitbilder zu aktivieren, die im Sinne der »Verwurzelung« der Menschen68Heimat konservativ und exklusiv neu denken, kulturelle Bande an der Stelle verdichten, an der die »Vielfalt der Vielen« die Mehrheitsgesellschaft brüskiert – so vielleicht etwas zugespitzt die Stoßrichtung. Der Multitude, also dem neuen internationalen Netzwerk der Vielen69, begegnet sie mit der vordergründig harmlosen Rede vom Ethnopluralismus, der der Konvergenz der Lebensstile im Zuge der Globalisierung scheinbar gegenläufig ist. Das klingt sogar nach mehr Pluralität. Tatsächlich aber errichtet der Terminus tödliche Mauern, denn am Ende geht es schlicht darum, unter sich zu bleiben. Diese Bilder der Abschließung funktionieren in veränderungsresistenten Milieus, weil sie mit Tradition und Brauchtum kurzzuschließen sind und vor allem Verunsicherungen aufgreifen. Die AfD hat dies mehr oder minder geschickt kanalisiert und betreibt eine Kulturpolitik der Verwurzelung – die Wähler und ein Teil der Mandatsträger werden damit leicht und pauschal zu Nazis, doch eigentlich sind sie nur die mehrheitlich unbewusste Schwungmasse einer versuchten Kulturrevolution von rechts.
Postpolitik und Postdemokratie
Ein demokratisches Grundproblem scheint, dass die rechte Energie, die Eroberung der Lebenswelt mit Hilfe einer regressiv-nostalgischen Kulturvorstellung, die das Lokale auf das ethnisch Reine, letztlich das Völkische reduziert, auch durch das Erodieren der Parteiendemokratie genährt wird. Das zeigt sich unter anderem am Mitgliederschwund der Parteien (der in Ostdeutschland gar nicht einsetzen musste, da es noch nie eine breite parteipolitische Beteiligung gegeben hat). So haben seit 1990 die mitgliederstärksten Parteien CDU und SPD etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, die FDP über 60 Prozent. Noch deutlicher trifft es die LINKE, geht man von deren Mitgliederzahlen in der Wendezeit aus, aber auch unabhängig davon ist sie nach der Vereinigung mit der WASG geschrumpft. Nur die GRÜNEN verzeichnen deutliche Mitgliederzuwächse um 134 Prozent im genannten Zeitraum (allerdings nicht im Osten, da spielen sie quantitativ nur eine marginale Rolle); die AfD existiert erst seit 2013, ihr kann jedoch ein Wachstumskurs bescheinigt werden.70 Demokratie lebt davon, dass der Einzelne eine Stimme hat, sich einbringen kann und Resonanz findet. Die Parteien und ihre Organisationen bilden das wesentlich ab und entwickeln ihre Programmatik gemeinsam mit den Bürgern, denn diese sind nicht nur Wähler (früher sprach man ähnlich wie beim Kirchenvolk auch vom Parteivolk71), sondern erleben Parteipolitik eigentlich auch als soziales Ereignis, als aktives Miteinander. Das setzt Mitglieder, deren Aktivitäten und gesellschaftliche Resonanz voraus, also auch die Sicht- und Erlebbarkeit parteipolitischen Engagements. Aber nun bleiben diese Mitglieder weg, die breite Verflechtung der Parteien mit den örtlichen Gemeinschaften fehlt – und der Tanker der »Volksparteien« fährt mit leerem Deck weiter, die Strukturen und Mandatsträger übernehmen die Macht. Dies meint die Rede von Postpolitik – während Postdemokratie nach Colin Crouch die damit verbundene demokratische Simulation72 beschreibt und einen Mangel an echter Beteiligung beklagt. Beteiligung ist für die Allermeisten einzig der beziehungslose Urnengang, immer häufiger als Briefwahl. In beiden Fällen läuft etwas alternativlos weiter, der »Resonanzdraht« zwischen Politik und Bürger ist gerissen, wie Hartmut Rosa dies nennt.73 Dies führt in eine »große Regression« – von Intellektuellen vielerorts beschrieben –, die die Demokratie gefährdet und die politische Kultur erodieren lässt: Die große Stunde der Vereinfacher und Demagogen ist damit gekommen und gerät zu einem internationalen Fanal.74 Reckwitz spricht von einer »populistischen Revolte





























