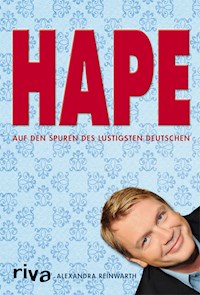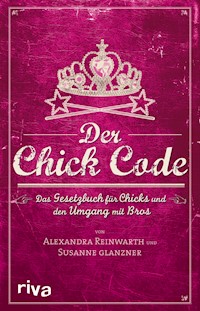12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yes Publishing
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
-Nachts wach gelegen, weil das Hirn mal wieder nicht die Klappe gehalten hat? ("Die Bemerkung der Kollegin, also das war nicht okay, die Schuhe sind bis zum Schlussverkauf bestimmt weg, habe ich die Tür abgeschlossen? Was mache ich morgen zum Essen, warum denke ich an Essen, das Wichtigste ist ein gutes Frühstück – ab morgen esse ich ein gesundes Frühstück, vielleicht mache ich sogar dieses Low-Carb-Ding, das scheint bei vielen zu funktionieren, wie hieß noch mal meine Klassenlehrerin in der Grundschule …… Oh, ist das spät, ich sollte schlafen! Warum zur Hölle bin ich noch wach? Keine Ahnung – mal drüber nachdenken… Und wenn das Auto kaputtgeht?!") -Wieder stundenlang gegrübelt, ob eine Entscheidung die richtige war, und zu keinem Ergebnis gekommen? ("Und wenn ich das Angebot für die Stelle doch angenommen hätte? Mit Marc zusammengeblieben wäre?") -Erneut analysiert, wie schlimm genau alles noch werden könnte? ("Und wenn ich den Job verliere? Wenn dem Kind was passiert? Was, wenn der Mann schon längst mit einer anderen flirtet? … gleich mal sehen, was er auf Instagram likt … verdammt, warum bin ich nur so unsicher?") Die Mehrheit unserer täglichen Gedanken ist negativ: Worst-Case-Szenarien, die nie eintreffen werden, Vergangenes, das wir nicht ändern können, und Ereignisse, auf die wir keinen Einfluss haben. Infolgedessen fühlen wir uns machtlos, erschöpft, gestresst – und wenn dann auch noch der Drucker kaputtgeht … dann ist alles zu viel. All dieses Grübeln, Nachdenken und Sorgenmachen scheint normal, ist aber vollkommen überflüssig, findet Bestsellerautorin Alexandra Reinwarth und beschließt, dass es so nicht weitergehen kann. Ein humorvolles Buch darüber, wie man Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet, endlosem Nachdenken ein Ende setzt und dadurch Leichtigkeit wiedergewinnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
ALEXANDRA REINWARTH
Wie sich dein Leben verbessert, wenn du aufhörst, dir unnötige Sorgen zu machen
Impressum
Originalausgabe1. Auflage 2024© 2024 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbRTürkenstraße 89, 80799 Mü[email protected] Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Isabelle BühlerIllustrationen: Tobias PrießnerRedaktion: Stephanie Kaiser-DauerLayout und Satz: inpunkt[w]o, Wilnsdorf (www.inpunktwo.de)eBook by ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-96905-320-1ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96905-321-8ISBN E-Book (PDF) 978-3-96905-322-5
Inhalt
Vorwort
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht ...
Die schlechte: Die Mehrheit unserer täglichen Gedanken ist negativ, und das bringt uns auf die Dauer wirklich mies drauf. Ich werde irgendwann aus der Wohnung fliegen und außerdem in Armut sterben, hätte ich damals nur den Mut gehabt, den JobinHamburganzunehmen,wardasjetztalles,was,wennich durchKIersetztwerde,unserSexlebenwarauchschonmalbesser, das mit der Cellulite wird auch immer schlimmer und überhaupt – warum bin ich oft so schlecht gelaunt?
Infolgedessen fühlen wir uns machtlos, erschöpft, gestresst – und wenn dann auch noch der Drucker kaputtgeht … dann ist alles zu viel.
Die gute Nachricht ist: Das scheint normal – ist aber vollkommen überflüssig! Die meisten miesen Gedanken drehen sich um Dinge, die nie eintreten werden, schon vorbei sind oder auf die wir eh keinen Einfluss haben.
Es ist falsch, dass wir uns nur genügend Gedanken um etwas machen müssen, um ein Problem zu lösen. Es ist auch falsch, dass wir nur alle 3000 Optionen zu Ende denken müssen, um diese eine, perfekte Entscheidung zu treffen. Und es ist komplett daneben, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob man in dem Gespräch gestern ausreichend freundlich rüberkam und ob einen Sandra jetzt leiden kann oder nicht. All das tun wir trotzdem. Unser Gehirn ist meisterhaft darin, uns permanent mit Ideen zu versorgen, worüber wir uns jetzt unbedingt den Kopf zerbrechen sollten, und immer gaukelt es uns vor, dass ETWAS TOTAL SCHLIMMES PASSIERT, wenn wir es ignorieren.
Lassen wir das sein. Es ist unnötig, es bringt uns nichts und das Leben ist wirklich viel, viel schöner, wenn man das nicht macht. Und es ist gar nicht so schwer – man muss sich nur trauen. Guckt …
Einleitung
Nur Jenny ist schlimmer als ich. Jenny ist der Super-GAU. Eine reizende Person, wirklich, aber wenn es eine Olympiade im Kopfzerbrechen gäbe, ich würde mein Erspartes auf Jenny wetten. Immer wenn ich sie sehe, kann ich mir ganz beruhigend einreden, dass es bei mir nicht ganz so schlimm ist. Das ist eine dufte Strategie, oder? Man kann immer jemanden kennen, bei dem oder der irgendwas noch schlimmer ist als bei einem selbst. Ich würde sogar sagen, es gibt ein paar Bekanntschaften in meinem Leben, die sind nur dazu da …
Meine Arbeitskollegin Luise zum Beispiel, mit der unterhalte ich mich sehr gerne an der Kaffeemaschine, wenn ich in der Agentur bin – die hat so ein dramatisches und problembehaftetes Liebesleben, das ist eine wahre Pracht. Das höre ich mir an und komme mir dann zwar etwas langweilig vor, aber freue mich insgeheim, dass ich die ganzen Luisenprobleme nicht habe. Eventuell bringt mir dieser Charakterzug keine Karma-Punkte, aber Zufriedenheit kommt vor Karma.
Jedenfalls, immer wenn ich Jenny treffe, wird mir die vollkommene Absurdität des Grübelns eindrucksvoll vorgestellt – von Jenny selber. Sobald sie anfängt zu erzählen, was bei ihr gerade so los ist, blättert sie einen ganzen Katalog von Sorgen auf, die permanent in ihrem Kopf Runden drehen.
Jenny hat eigentlich Krankenschwester gelernt, macht aber jetzt ihren Master in irgendwas mit klinischer Biochemie, das ich nicht begreife. Sie lebt seit Jahren glücklich mit ihrem Freund zusammen, sie hat einen netten Freundeskreis, einen Dackel, sie geht regelmäßig joggen und ernährt sich gesund, sie sieht aus wie eine irische Fee, und von außen betrachtet ist eigentlich alles in Butter. Eigentlich.
Trotzdem ist Jenny immer, wenn wir uns sehen, totalgestresst. »Alles ist zu viel« – das ist ihr häufigster Satz. Klar, denke ich mir, mal nebenbei einen Master hinlegen in was auch immer klinische Biochemie ist, ist bestimmt nicht ohne. Wenn sie dann aber erzählt, was sie so stresst, ist die Lernerei gar nicht das große Problem. Jennys Problem ist ein ganzer verquirlter Haufen an Problemen, die, und das ist der Clou, nicht existieren, noch nicht existieren und vielleicht gar nie existieren werden. Da ist Jennys Sorge, ob sie mit der Weiterbildung die richtige Entscheidung getroffen hat, ob sie den Abschluss schafft, was passiert, wenn sie ihn nicht schafft, warum sie überhaupt Jahre ihres Lebens als Krankenschwester verschwendet hat und nicht gleich nach Höherem strebte, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie einen anderen Weg genommen hätte, und warum sie sich generell mit Entscheidungen so schwertut und sich so viele Gedanken macht. Ob ihr Freund und sie wirklich eine Zukunft haben, warum er sie gestern so komisch angeschaut hat, ob sie eigentlich genug Sex haben, ob er dabei an andere denkt oder sie betrügen würde, wenn er betrunken wäre und sich eine andere Frau an ihn ranmachen würde. Ob sie die Kritik ihrer Freundin gegenüber lieber anders hätte formulieren sollen – und wie genau –, ob diese sie jetzt noch genauso mag und ob es nicht vielleicht ein Anzeichen dafür ist, dass das nicht der Fall ist, weil sie sich seit Tagen nicht gerührt hat. Ob sie genug für die Umwelt tut und ob das überhaupt einen Sinn hat, wie lange der Dackel noch lebt, ob sie zu Hause ist, wenn er stirbt, und ob sie danach jemals wieder einen Hund haben will und ob es vielleicht irgendein Zeichen des Universums ist, dass ihr schon zum dritten Mal das Fahrrad geklaut wurde.
Wenn Jenny mir diesen ganzen Wust von Gedanken vor die Füße legt, bin ich immer völlig platt – und unfassbar altklug. »Das ist doch alles hausgemacht und macht überhaupt keinen Sinn«, doziere ich total gescheit und kann es nicht fassen, dass Jenny das nicht selbst sieht. Für mich sieht das Ganze bildlich so aus:
Ob sie sich einen Kopf macht oder nicht, ist völlig egal! Es hat null Auswirkungen auf ihr Leben. Nichts von dem, was ihr im Kopf herumgeht, nützt ihr irgendwas, bringt ihr neue Einsichten, führt zur Lösung eines Problems oder verändert etwas. Sie kann damit weder die Zukunft kontrollieren noch die Vergangenheit umschreiben oder vermeiden, dass der Dackel altert. (Allein das mit dem Fahrrad scheint mir naheliegend: Vielleicht sollte sie in ein gutes Schloss investieren.)
Das Einzige, was es ihr bringt, ist das Gefühl, gestresst zu sein. So, als müsste sie etwas erledigen, das nicht zu erledigen ist. Wer dieses Gefühl nicht kennt: Das ist so wie im Stau stehen, während man es total eilig hat.
»Es ist«, sagt Jenny, »als würde ich einen ganzen Strauß schwerer, dunkler Wolken an dicken Seilen hinter mir herziehen.« Und das kenne ich nur zu gut. Meine Hirnfürze haben zwar weniger mit Dackeln zu tun, aber sie machen genau das Gleiche, nämlich: mir das Leben schwer.
Erst gestern Nacht kurz vor dem Einschlafen habe ich wieder die Welt vor dem Untergang bewahrt. Ich habe mir Sorgen über die Klimaveränderung und den Rechtsruck in der Welt gemacht und ob die diversen Kriegsschauplätze bis zu uns reichen könnten und was dann zu tun ist – und habe mich prompt schlecht gefühlt, weil ich mich um mich und die Meinen sorge, anstatt als Erstes an das Elend der Leute vor Ort zu denken – aber jetzt habe ich es hinbekommen und das Problem ist gelöst. Außerdem konnte ich dank ausgiebiger Grübeleien darüber, ob ich einmal schwer krank werde und somit als Selbstständige in Armut und Elend ende, genau das endlich ausschließen. Und wenn ich jetzt noch ein paar Mal gedanklich meinen peinlichen Auftritt von Samstagabend Revue passieren lasse, dann verschwindet auch endlich der aus meinem Hirn.
Ihr ahnt es vielleicht: Genau das alles passiert nicht. Stattdessen passiert hinsichtlich Klima, Krieg und Krankheit und letztem Samstagabend (fragt nicht) genau: nichts. Also, es passieren schon Dinge, aber auf nichts davon haben die dunklen Wolken über meinem Hirn Einfluss. Worauf sie aber sehr wohl einen Einfluss haben, ist meine Stimmung …
Mir wurde das vor Kurzem wieder ganz klar, als ich in der Fußgängerzone vor einer Schaufensterscheibe stehen blieb: In dem Geschäft und um mich herum waren jede Menge Leute in Feierabendlaune, Familien mit Kindern und Einkäufen, ausgelassene Teenager – sogar der verzottelte Mann mit Hund, der neben dem Eingang um Geld bettelte, war in alberner Stimmung. Nur mein Spiegelbild war ein 1,68 Zentimeter hoher Haufen Trübsal, mit Mundwinkeln bis zu den Kniekehlen und einer Denkfalte, tief wie der Marianengraben. Man verstehe mich nicht falsch, jede hat mal einen schlechten Tag und auch einige richtig beschissene, manchmal ist man schlecht drauf, und das ist auch alles gar nicht schlimm. Aber ich habe das Gefühl, es herrscht zu oft so eine Schwere, die auf allem (also auf mir) lastet. Eine Art Grund-Trübheit, ein dunkler Schleier, der mich umhüllt, und wenn ich mit sorgloser Leichtigkeit konfrontiert bin, sehe ich ihn umso deutlicher. Ich war doch auch mal so leicht?
Und das Absurde ist: Dabei geht es mir doch gut! Ich habe einen Job, ein Dach über dem Kopf, ein gesundes Kind, einen reizenden Freund, der Kühlschrank ist voll und es läuft so weit alles prima! Sogar der Drucker läuft wieder! Komisch, dass ich mir das immer wieder in Erinnerung rufen muss, um die Wolken zu vertreiben und zu verstehen, wie verdammt gut dran ich eigentlich bin.
Was Jenny und mir so extrem konsequent die Stimmung verhagelt, hat laut Expertenmeinung etwas mit der Art unserer Gedanken zu tun. Also nicht nur unserer, sondern generell der Gedanken, die sich die Leute so machen: Im Durchschnitt geistern uns zirka 6200 Gedanken am Tag durchs Hirn, hat ein kanadisches Forscher-Duo mittels Hirn-Scans herausgefunden1, und das absolut Deprimierende daran ist: Nur ungefähr 3 Prozent davon sind positiv! Ein kleiner Teil, 27 Prozent, ist unwichtiger Alltagsquatsch (Wie viele Kalorien hat eigentlich Mettwurst?), und sagenhafte 70 Prozent unserer Gedanken sind negativ. 70 Prozent!
Diese 70 Prozent sind es, die uns die Stimmung verhageln. Jetzt könnte man sagen: Gut, dieser Großteil kümmert sich eben um unsere Probleme und versucht, sie gedanklich zu lösen – aber nein: Wir drehen uns mit Vorliebe um Probleme und Sorgen, die entweder nie oder zumindest nicht so eintreten werden, und um Dinge, die in der Vergangenheit liegen und die wir eh nicht mehr ändern können. Also kurz gesagt: um nichts und wieder nichts.
Das Hirn hat auf unser Wohlbefinden und unsere Gefühle eine immense Wirkung – und wir lassen es einfach machen, was es will. Und was das Gehirn will, ist mitnichten, uns eine schöne Zeit zu bereiten, sondern nur zwei Dinge:
aunser Überleben zu sichern und
aetwas zu tun zu haben.
Fertig.
Aus diesen beiden Gründen sind wir den lieben langen Tag damit beschäftigt, reelle, aber ebenso oft komplett hanebüchene Katastrophenszenarien zu entwerfen, uns Sorgen zu machen, zu hadern und niemals irgendwo anzukommen. Man kann dabei sogar die Themen wechseln wie Unterhosen.
Profis auf diesem Gebiet können Gedankenketten schmieden, die fangen bei der Mettwurst an, gehen über die Kalorien zum Körperfettanteil, ich mache keinen Sport, ich bin so eine Versagerin und deswegen finde ich auch keinen Partner und werde für immer allein bleiben und das in weniger als fünf Sekunden. Andere werfen das Gedankenkarussell an und reiten ein einziges Thema so oft im Kreis, bis ihnen selbst schwindlig wird – ohne irgendeine brauchbare Lösung am Ende, dafür aber mit hängenden Mundwinkeln und Denkfalte.
Ich kann das alles (hurra) und manchmal, wenn dann noch Stress dazukommt, also ganz realer Stress in der Arbeit, die Mama ist krank, der Drucker ist kaputt und der Nachbar von oben … dann fühlt es sich an, als wäre alles zu viel.
Die gute Nachricht ist: Der reale Stress ist zwar ein Teil unseres Lebens, und den kann man auch nicht vermeiden – aber den schweren Wolken, die wir hinter uns herziehen, denen kann man die Fäden kappen. Und das machen wir. Passend zum Thema ploppt sofort der Satz in meinem Hirn auf:
Und was, wenn es nicht klappt???
Das ist vermutlich der häufigste Satz, der in meinem Gehirn abgespult wird. Danach kommt lange nichts und dann vermutlich irgendwas mit Essen.
Eigentlich ist an diesem Satz »Und was, wenn es nicht klappt???« gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil – die meisten Leute beschäftigen sich mit dieser Frage, bevor sie irgendeine Entscheidung treffen. Das führt dann dazu, dass sie für den Fall der Fälle einen Plan B haben, und das ist vorausschauend und gescheit.
Ich hingegen beschäftige mich mit dieser Frage auf andere Art, sie ist der Startknopf für eine Fahrt in die Hölle – und das ist überhaupt nicht gescheit, sondern ziemlich bescheuert. Ich darf euch dies an einem Beispiel aus der Arbeitswelt mal vorführen:
Sagen wir, die Überlegung Was,wennesnichtklappt??? bezieht sich auf … die Präsentation für eine Klopapier-Kampagne in der Werbeagentur morgen. (Diese Fahrt in die Hölle habe ich so oft absolviert, die kann ich im Schlaf.) Morgen kommt also der Kunde, um zu sehen, was die Werbeagentur, für die ich arbeite, sich ausgedacht hat, um den Verkauf seines Klopapiers anzukurbeln.
Schritt 1:
Stetes, aber unregelmäßiges Aufploppen der Frage Undwas,wennesnichtklappt???, und zwar schon einige Wochen vor dem Termin. In den meisten Fällen kann die Frage durch Kühlschrankputzen oder andere überflüssige, pseudoaktive Tätigkeiten ins Hinterhirn geschoben werden.
Schritt 2:
Und was, wenn es nicht klappt??? ploppt zuverlässig in der Nacht vor dem großen Termin auf und lässt sich nicht beiseiteschieben. Und zwar ab dem Moment, in dem ich ins Bett gehe. Von da an geht es abwärts:
aVermutlich ist meine Idee nicht annähernd so gut, wie ich dachte …
a… ziemlich sicher sogar kompletter Blödsinn.
aSo wie damals die Idee für das Schuppenshampoo …
aIch werde mich vor dem Kunden sowie der versammelten Kollegschaft lächerlich machen.
aManwirdmirkeineeigenenProjektemehranvertrauen.
aMeinen Posten bekommt irgendeine von diesen jungen, energiegeladenen Nervensägen, die sich mit den neuen Medien eh viel besser auskennen.
aIn meinem Alter finde ich auch nichts Neues mehr.
Ab hier nimmt das Ganze ziemlich schnell an Fahrt auf und endet, wie die meisten Fahrten dieser Art, in Armut, Krankheit, Unglück und Tod.
Unnötig zu sagen, dass sich das Szenario Armut, Krankheit, Unglück und Tod bis dato nicht ein einziges Mal bewahrheitet hat.
Diese »Strategie«, mit beunruhigenden Gedanken umzugehen, hat mir schlaflose Nächte eingebracht und unfassbar viele bedrückende Wochen – allerdings auch einen sehr sauberen Kühlschrank. Dass das trotz des immensen Vorteils blitzblanker Haushaltsgeräte eventuell ein bisschen absurd ist, wurde mir bewusst, als eines schönen Tages meine liebe Freundin Jana in der Küchentür stand und sich folgender Dialog entspann:
Jana: »Was machst du da?«
Ich: »Ich mach unter dem Herd sauber!«
Jana: »Warum?«
Ich: »Weil ich vermutlich mal keine Rente bekomme!«
Jana: »Was?«
Zunächst pöbelte ich noch ein bisschen weiter: »Ich muss arbeiten, bis ich umfalle, so wird’s sein. Mit 75 preise ich immer noch Klopapier an …« – und so weiter, bis mich Jana wieder runterbrachte: »Aber es läuft doch gut bei dir, du schreibst Bücher, von der Agentur kommen Jobs und bis zur Rente ist es noch weit«, warf Jana ein. Damit hatte sie natürlich recht – aber die Stimme in meinem Kopf legte sofort los: Jaja–undwas,wennihrnichtsmehreinfällt?DannistsiedieAgenturlos,Bücherschreibtsieauchkeinemehrunddann?Armut,Krankheit,UnglückundTod!
»Die Stimme in deinem Kopf ist eine ganz schöne Schwarzseherin, meine Liebe«, sagte Jana und zog eine Augenbraue nach oben.
Und damit hatte sie schon wieder recht.
Tatsächlich gehe ich meistens vom schlimmstmöglichen aller Fälle aus – nicht mal von dem realen schlimmstmöglichen, sondern von einem komplett ausgedachten und absurden Fall. Und das beschränkt sich mitnichten auf die Arbeitswelt. Ich kann das aus dem Stegreif in jeder erdenklichen Situation. Kommt mein Elfjähriger schon wieder mit einer Fünf in Mathe nach Hause, sehe ich praktisch schon vor mir, wie er das Jahr wiederholen muss, von der Schule fliegt, die falschen Freunde kennenlernt, keinen Job bekommt, sich in Drogen flüchtet und – Armut, Krankheit, Unglück und Tod. Von wem ich das eventuell geerbt habe, wird mir schlagartig klar, als ich mit meiner Mutter im Auto sitze. Wir fahren mit dem Kind zu einem kleinen Ausflugslokal mit Spielplatz, von wo aus ein kleiner Rundwanderweg startet, den wollen wir machen. Es ist frühlingshaft warm, die Sonne scheint, alle sind gut gelaunt (sogar das Kind, dem habe ich vorsorglich noch nichts vom Wandern erzählt), und völlig aus dem Nichts legt meine Mutter los:
»Bestimmt gibt es keinen Parkplatz heute, bei dem schönen Wetter.«
»Ach na ja«, winke ich ab, »es ist ja noch früh, das wird kein Problem sein.« Keine zwei Minuten später geht es weiter: »Vorgestern hat es doch so geschüttet – vermutlich ist der Spielplatz ein einziger Matschhaufen«, das sagt sie nicht mal direkt zu mir, sondern so vor sich hin. Ich gucke kurz rüber zu ihr: Völlig versunken sieht sie nach draußen: »Und die Wanderwege erst – bestimmt sinken wir da bis zu den Knöcheln ein und meine Schuhe … da werden wir schön nasse Füße bekommen.«
Ich verdrehe die Augen. »Ja klar, und dann: Armut, Krankheit, Unglück und Tod, was?«
Währenddessen kommt es von hinten: »Wie, wandern?«
Warum ich diesen Schwank überhaupt erzähle: Nichts von dem, was meine Mutter befürchtete, trat ein. Es gab haufenweise Parkplätze, der Boden war trocken, die Wege von Blumen gesäumt und dank minimaler Erpressung wollte das Kind dann auch wandern, kurz: ein Traum von einem Ausflug! Warum sie im Voraus ein bisschen schlechte Stimmung verbreitet hatte? ICH HABE AUCH KEINE AHNUNG, ABER ICH MACHE DAS AUCH! Vielleicht, damit die Enttäuschung nicht so groß ist, falls es tatsächlich in die Hosen geht. Spoiler: Das funktioniert nicht gut.
Dass diese schwarzen Fahrten in den Untergang völlig automatisch passieren, fällt mir immer mehr auf – und wie oft ich miesepetrigen Gedanken nachhänge, die sich alle darum drehen, wie schlimm genau es eventuell noch kommen könnte. Ich mache mir ganz detailliert ausgeklügelte Sorgen, die wieder zu neuen Sorgen führen und von denen ich sogar weiß, dass sie zu 99,9 Prozent nie so eintreten werden! Das ist doch total krank! Apropos krank, ich sollte dringend mal zum Arzt gehen und diese Stelle am Rücken untersuchen lassen – nicht, dass es was Schlimmes ist –, aber ich mache mir schon wieder zu viele Sorgen … warum mache ich mir eigentlich immer Sorgen, das ist doch verrückt – vielleicht stimmt wirklich irgendwas mit meinem Hirn nicht, ich sollte vermutlich eher zum Therapeuten, ist ja nicht so, dass ich da nicht noch ein paar Baustellen hätte … wenn ich nur daran denke, wie unsicher ich mit fremden Leuten bin. Gerade erst heute Morgen, als ich das Kind in die Schule gebracht habe und da noch ein paar Mütter rumstanden und quatschten … wie verklemmt ich da gegrüßt habe! Kein Wunder, dass die nur kurz genickt haben und sich dann wieder umgedreht haben … bestimmt können die mich nicht leiden.
Bäm! So schnell geht das! Von einem trüben Topf in den anderen!
Ich kann anhand von pessimistischen Gedanken bis zu hundertmal das Thema wechseln! Das ist wie eine Art Superkraft! Nur eben in Scheiße …
Das Krasse ist, dass ich da anscheinend keine Ausnahme bin – und etwas mehr Originalität bei meinen Unzulänglichkeiten hätte ich mir schon gewünscht. Aber nein, die meisten Leute, die ich kenne, machen sich permanent völlig unnütz einen Kopf – wobei: Da gibt es einen ganz großen Gap. Denn das sind eigentlich alles Frauen, zumindest fast. Die große Mehrheit der Männer reagiert auf das Thema mit beneidenswertem Unverständnis. Worüber ich mir stundenlang einen Kopf machen kann, ist anderen keine Sekunde wert:
»Meinst du, ich hätte Denise und Paul anbieten sollen, hier ein paar Tage zu wohnen?«, frage ich zum Beispiel L., meinen Ex-Mann und Vater des Kindes, der trotz getrennter Wohnungen gerne hier vorbeischaut (besonders gerne in meiner Küche, seit er mit der Veganerin zusammen ist).
»Wieso?«, fragt L., während er eine Scheibe geräucherten Schinken in sich hineinstopft, »haben sie denn gefragt?«
Denise und Paul müssen für ein paar Wochen aus ihrer Wohnung, weil diese renoviert wird – ich habe wohlweislich nicht nachgefragt, wo sie in der Zeit bleiben, ich habe nämlich keinen Bock da drauf, und sooo dicke Freunde sind wir auch nicht, aber nun ja.
»Sie haben nicht gefragt, aber … ich hätte vielleicht doch … also zumindest anbieten hätte ich es vielleicht sollen?«
»Aber du willst sie doch gar nicht hierhaben, oder?«, hakt L. kauend nach.
»Nein«, schüttle ich den Kopf.
»Na, dann ist doch alles prima!«, zuckt L. mit den Achseln.
Aber ich finde es überhaupt nicht prima. »Also, nett war es nicht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt …«
»Dann ruf sie an und frag, ob sie bleiben wollen«, sagt L. zum Kühlschrankinneren und hangelt nach der nächsten Scheibe Schinken.
»Aber ich will nicht, dass sie hier wohnen!«
Woraufhin sich L. zu mir umdreht und völlig verständnislos Arme und Augenbrauen hebt. »Ja, was nun?«
Er versteht überhaupt nichts, denke ich mir, und … »Raus aus meinem Kühlschrank!«
Es ist wirklich unfassbar, wie viele meiner männlichen Mitmenschen von diesen Gedankenspiralen völlig verschont bleiben. Wenn eine Frau zum Beispiel feststellt, dass sie etwas zugenommen hat, passiert exemplarisch Folgendes:
Was im Gegenzug passiert, wenn ein Mann bemerkt, dass er etwas zugenommen hat:
Als ich meine Überlegungen beim nächsten Meeting im »Café Einstein« meinen lieben Freundinnen Jana und Anne mitteile (wir nennen es nur Meeting, tatsächlich kippen wir uns einen hinter die Binde), ernte ich zustimmendes Nicken.
»Kenne ich«, sagt Jana, legt den Kopf in den Nacken und schlürft den Rest ihres Weißweins, »ich mache mir meistens Sorgen um die Zukunft. Also die Weltpolitik, ob das ganze System zusammenkracht, ob meine Miete erhöht wird, die Bienen aussterben und wie tief diese Falten an den Augen noch werden können, solche Dinge.«
»Keine Sorge, Falten an den Augen sind toll!«, lächelt sofort Anne. Aber dann stellt sich heraus: Anne macht sich zwar weniger Sorgen um die Zukunft, aber hadert dafür ständig mit Dingen, die schon passiert sind! Also zum Beispiel damit, was sie in einem Gespräch gesagt hat und ihr jetzt dumm erscheint. »Wisst ihr noch, das mit den Bettlaken?«, sieht sie uns an, und wir schütteln beide den Kopf. »Na, als wir mit den anderen essen waren, wisst ihr nicht mehr? Als ich gesagt habe, dass es doch schön ist, wenn Traditionen erhalten bleiben«, und da läuft sie schon rot an, bei mir klingelt immer noch nichts, aber Jana dämmert etwas: »Aaahh, das mit den Bettlaken …«
»Genau«, nickt Anne. Ein Bekannter von L. hatte uns beim Abendessen erzählt, dass seine albanischstämmige Familie bei der Hochzeit der Schwester auf das Vorzeigen des blutbefleckten Bettlakens gedrängt hatte – es solle traditionell gefeiert werden und das Laken gehöre einfach dazu (selbst wenn alle Anwesenden wissen, dass es reiner Fake ist). Daraufhin ließen sich die anwesenden Damen sofort und folgerichtig über diese patriarchalisch-misogyne und menschenverachtende Unsitte aus, einstimmig – bis auf Anne. Die lächelte ihr entrücktes Lächeln und fand Traditionen schön.
Im Nachhinein ist ihr das total peinlich, »das war so doof von mir«, findet sie inzwischen, aber damit ist es nicht genug. Leider. Die Situation fällt ihr immer wieder ein, gerne nachts, wenn das Hirn anscheinend nichts Besseres zu tun hat, als einem die schmachvollsten Momente der letzten Jahre als Kurzfilm zu präsentieren. Das Absurde ist: Alle, die bei diesem Abendessen dabei waren, haben diese Bemerkung längst vergessen – oder hätten es zumindest, wenn Anne sie nicht immer wieder herauskramen würde. Und wie das oft so ist: Anderen gegenüber ist Anne längst nicht so streng wie mit sich selbst. Ich weiß das, denn ich hab sie genau das gefragt:
»Wenn ich das gesagt hätte in dem Moment und es heute anders sehe – würdest du dann denken, ich bin doof?«
»Nein«, schüttelt sie den Kopf, »überhaupt nicht.«
»Das ist absurd.«
»Ja.«
Eigentlich ist es schon so absurd, dass es einem vorkommen kann, als hätte das Hirn eine eigene Stimme, die mit einem selbst nichts zu tun hat, sondern völlig eigenständig überall ungefragt irgendeinen Senf dazugibt.
Und zwar meistens wirklich unschönes Zeug …
Zum Beispiel, wenn ich auf eine Party komme, wo ich keinen kenne: Niemand hier kann dich leiden, sagt es dann zum Beispiel völlig aus dem Nichts, und: Warum hast du diese komische Jacke angezogen, du siehst aus wie ein Sack! Oder ich gehe die Straße entlang, es ist ein schöner Tag und ich denke: »Ach ich bin aber heute gut gelaunt.« Da kommt es plötzlich von oben: Bist du nicht! Und dann sieht es sich um und sagt so etwas wie: Tussi, störender Radler, Tussi mit hässlichem Baby, falsch geparktes Auto, Tussi, Prolet, ELEKTROROLLER, STIRB! Ich erschrecke dann fast vor mir selbst – ich meine, ich würde so was nie sagen! Warum denke ich so was nur?
Unfassbar nervig.