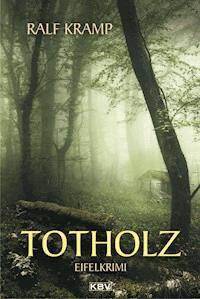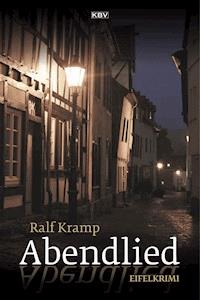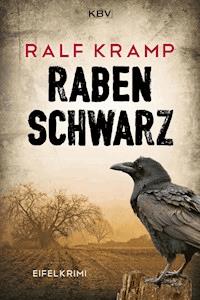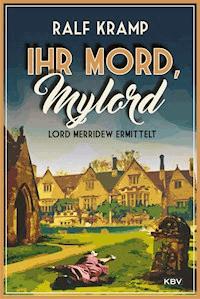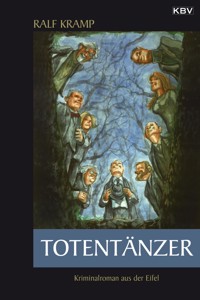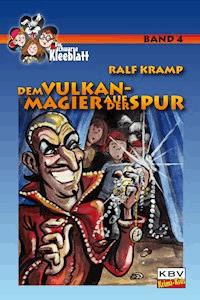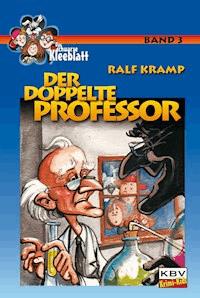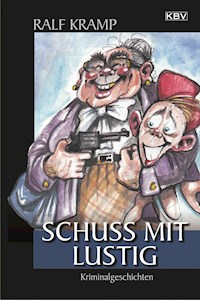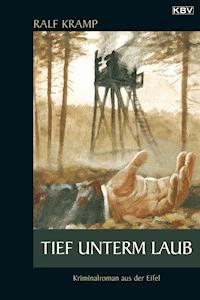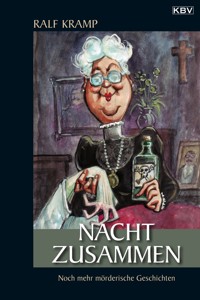Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ob Pistole, Messer oder vergiftete Pralinés, die Methoden, mit denen in diesen 21 teuflischen Kurzgeschichten gemordet wird, sind vielfältig. Ebenso die Motive der Mörder und Mörderinnen: Rache, Habgier oder die nackte Angst treiben sie zu ihren Taten. Und so manches Mal nimmt der scheinbar so gerade verlaufende Weg zur Tat plötzlich eine gänzlich unerwartete Wendung. Ralf Kramp führt seine Leser an der Nase herum, und sie genießen es.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf KrampKurz vor Schluss
Vom Autor bisher erschienene Bücher bei KBV:
»Tief unterm Laub«
»Spinner«
»Rabenschwarz«
»Der neunte Tod«
»Still und starr«
»... denn sterben muss David!«
»Kurz vor Schluss«
»Malerische Morde«
»Abendgrauen« (Hg.)
»Abendgrauen II« (Hg.)
»Wenn Goldfinger rauskommt«
»Hart an der Grenze«
»Ein Viertelpfund Mord«
»Ein kaltes Haus«
»Abendgrauen III« (Hg.)
»Totentänzer«
»Nacht zusammen«
Ralf Kramp, geboren 1963 in Euskirchen, lebt und arbeitet als Karikaturist, Krimiautor und Veranstalter von Krimi-Erlebniswochenenden in der Eifel. Für sein Krimi-Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er 1996 den Eifel-Literatur-Förderpreis. Zusammen mit Manfred Lang ist er Herausgeber der umfangreichen Eifel-Schauergeschichtensammlungen »Abendgrauen«.
Im Jahr 2002 wurde er für den »Rheinischen Literaturpreis Siegburg« nominiert und erhielt den Kulturpreis des Kreises Euskirchen.
Ralf Kramp
Kurz vor Schluss
Mörderische Geschichten
1. Auflage 20012. Auflage 2007
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Redaktion: Dorothee Steuer, Sankt AugustinSatz: Volker Maria Neumann, KölnUmschlagillustration: Ralf KrampISBN 978-3-934638-99-0E-Book-ISBN 978-3-95441-061-3
Für mein Monikächen.
Inhalt
Unter allen Wipfeln ist Ruh’
Radieschen von unten
Die Bierfalle
Jretche
Der letzte Vorhang
Eins Vier
Kurz vor Schluss
Packpapierpaketchen
Fahrendes Volk
Wickert
Pralinen aus Brüssel
Der Koch, der nie etwas anderes sein wollte
Das Gesicht im Nebel
Backe
Hundepension
Puckel
Schottenkaros
De liebe Jung
Maison Morteuil
... die Bösen in den Sack!
Alles kommt wieder
Der blaue Stern von Bethlehem
Der große Knall
Quellen
Unter allen Wipfeln ist Ruh’
Wald. Wuchs, Kraft, Gewalt, Moder und Tod. Hier im Kermeter kämpften seit Jahrhunderten die Naturgewalten einen nie endenden Kampf. Der harte Eifelwind mit seiner unbändigen Zerstörungskraft und die Pflanzenwelt, die ihm trotzte. Dichte Baumbestände, die der Sonne entgegenstrebten, von dem ersten Augenblick an, in dem das Samenkorn in den Waldhumus fiel. Früher dichter Buchenwald, dem aber die Eisenindustrie mit ihren hungrigen Öfen erbarmungslos ein Ende bereitete. Später dann, von den Preußen angepflanzt, Fichten, die in anderthalb Jahrhunderten vom zarten Sprössling zu Kolossen herangereift waren, von denen man nicht annahm, dass ihnen der Sturm noch etwas anhaben konnte.
All das schoss Andres durch den Kopf, als er den gewaltigen Wurzelteller der Fichte vor sich sah, wie er, der Erde entrissen, schief und tot in der Luft hing. Der heftige Sturm vor anderthalb Wochen hatte den mächtigen Koloss getötet, ihn zur Seite gedrückt, bis das Astwerk der umstehenden Bäume ihn gestützt hatte. So hing der Baum nun da, getötet und doch nicht gestürzt.
Andres’ Gedanken kreisten oft um das archaische Spiel der Gewalten, wenn er im Wald war. Esser, so vermutete er, konnte mit solchen Dingen nichts anfangen. Als er sich nach seinem Begleiter umwandte, fühlte er seinen Verdacht bestätigt. Esser war damit beschäftigt, Fichtennadeln von seinem dunklen Mantel abzuklopfen und zeterte über den Schlamm, der an seinen Schuhen klebte. »Schön und gut. Windbruch, tolle Sache, Andres. Aber was willst du mir denn jetzt so Wichtiges zeigen? Es ist arschkalt!«
Andres betrachtete ihn. Sie kannten sich seit ein paar Monaten. Nicht besonders gut. Es gab keine gemeinsamen Interessen. Andres liebte den Wald. Esser liebte die Technik. Er war Teilhaber eines Kölner Ingenieurbüros und verdiente eine Menge Geld. Andres’ Einkommen war bescheiden. Er hatte den kleinen Hof, den er gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftete. Ein bisschen Waldarbeit und Beates Verkauf von Fleisch, Obst und Gemüse ab Hof brachten noch ein paar Groschen ein, ließen aber kaum Zeit zum Leben. Irgendwann kam Esser auf den Hof und kaufte ein. Dann kam er wieder und schwärmte von den Koteletts und Würsten, von dem frischen Quark und den leckeren Eiern. Er kaufte immer alles paarweise ein, obwohl er doch anscheinend allein lebte. Er sei eben noch in der Testphase, hatte er Andres irgendwann erzählt, als er ihm ein paar Tips beim Ausbau des Dachbodens gegeben hatte. »Hier einen Träger rein, das hilft dir auch gleichzeitig, wenn du die Trockenwand befestigen willst. Die Frauen ... Na ja, die Frauen ... Weißt du, Andres. Ich hab die richtige noch nicht gefunden. Es gibt schon tolle Weiber.« Und Esser war ja nun auch ein toller Typ. Ob im Freizeitdress oder im edlen Zwirn, wenn er von der Arbeit kommend einen Abstecher zu ihnen machte. Immer gediegen.
»Du ziehst nach Köln?«, fragte Andres beiläufig und befühlte den rauen Fichtenstamm an der Stelle, an der er sägen musste, damit der Stock wieder in den entstandenen Krater zurückfallen konnte, um dort im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu verrotten und zu vermodern.
»Stimmt ... ja, stimmt tatsächlich«, stotterte Esser überrascht, ohne zu fragen, woher Andres das wusste. Andres hätte ihm nicht gesagt, dass er vom Telefon im ersten Stock alles mit angehört hatte. Er hätte sich dafür geschämt.
»Und Beate willst du mitnehmen?« Er schüttelte die Motorsäge. Sprit war drin. Alles war bereit.
Esser schwieg. Er hatte geahnt, dass es auf eine Aussprache hinauslaufen würde, als Andres ihn am Parkplatz des Kommerner Mühlenparks abgepasst hatte, wo Esser jeden Sonntagmorgen joggte. Verunsichert hatte er den Mantel aus dem BMW geholt, weil Andres ihm dazu geraten hatte. Er hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als auf der Stelle Beate anrufen zu können, um zu erfahren, ob Andres etwas ahnte oder gar wusste.
Jetzt stand er hier mit Andres inmitten der Abgeschiedenheit des riesigen winterlichen Kermeters und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Sag einfach ja oder nein. Sag, ob du sie mir wegnehmen willst oder nicht.« Andres blickte ihn nicht an und hantierte gebückt an den Gerätschaften herum, die er mit hierher gebracht hatte.
»Weißt du, Andres. Das ist anders, als ...«
»Ja oder nein?«
»Ja«, presste Esser hervor und ballte die kalten Hände in den Manteltaschen zu Fäusten. »Silvester wollen wir in der neuen Wohnung sein. Wir wollten morgen mit dir reden. Wir haben die Weihnachtstage abgewartet.« Als er es aussprach, merkte er, wie blödsinnig es klang. Er erwartete eine sarkastische Antwort, etwas Gehässiges, etwas Verbittertes. Aber Andres sprach nicht. Er sprach ohnehin wenig. Er hob nur die schwere Axt hoch und strich kurz mit der Hand über die flache Seite. Dann holte er aus, ließ die Axt weit ausschwingen, ging mit dem ganzen Oberkörper mit und schlug dann zu. Esser versuchte gar nicht erst auszuweichen. Der Schlag zertrümmerte seine Stirn. Er wurde von der enormen Wucht von Andres’ Schlag zurückgeschleudert. Fichtennadeln wurden aufgewirbelt und rieselten auf seinen dunklen Mantel herunter, als er mit einem satten Geräusch auf dem Waldboden aufschlug. Das Blut, das aus seinem Kopf hervorschoss, rann in den Laubteppich und versickerte. Ruhig und bedacht machte sich Andres an die Arbeit. Er kramte Essers Autoschlüssel aus der Tasche und durchsuchte seine Kleidungsstücke nach verräterischen Indizien. Dann schleifte er den Körper zum lichtlosen Spalt, der sich etwa einen Meter breit zwischen dem gewaltigen Wurzelwerk der Fichte und dem Waldboden auftat, und schob ihn hinein. Essers Leiche rollte ganz mühelos in die Schwärze der Vertiefung hinein und war für immer verschwunden. Dann warf Andres die Motorsäge an und versenkte ihre rotierende Kette im frischen Holz des geneigt liegenden Fichtenstamms. Er schnitt von unten nach oben, damit sich die Säge nicht festfraß.
Als er am späten Nachmittag in der Badewanne saß und sich Schweiß und Dreck aus den Poren wusch, kam es ihm so vor, als habe er einen ganz normalen Tag im Wald verbracht. Harte, schweißtreibende Arbeit, die den Geist reinigte. Aber er hatte etwas anderes getan. Nachdem der Fichtenstock mit einem unbeschreiblichen Knacken und Knistern, von dem er nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob es vom dichten Wurzelwerk oder von Essers Leichnam herrührte, in sein altes Bett zurückgepoltert war, war er zum Parkplatz zurückgefahren und hatte Essers Wagen geholt. Keiner beobachtete ihn, als er den Fahrersitz mit Plastikfolie auslegte, um Spuren zu vermeiden. Keiner sah ihn, als er dem Wagen vor Essers Mietwohnung in Mechernich entstieg und Minuten später seine Wohnung betrat. Er trug Handschuhe und hatte sich zwei Plastiktüten um die Schuhe gebunden, damit er keine Walderde auf dem Teppich zurückließ. Er fand nicht viele Indizien, die auf eine Verbindung zu Beate hindeuteten. Ein paar Fotos, ein paar Briefe ... Er vermied es, sie genauer zu betrachten, bevor er sie später auf dem Parkplatz, zu dem er zu Fuß zurückkehrte, verbrannte.
Beate trat ein. Sie sah schlecht aus. Als sie an den beschlagenen Badezimmerspiegel trat, sah er, wie ihre Hände zitterten, als sie über die milchige Glasfläche wischte und sich ihre Locken richtete. Sie war eine schöne Frau. Zu schön für ihn. Das Richtige für Esser wäre sie gewesen. Aber das war vorbei.
Beate trat an die Wanne. Sie betrachtete schweigend ihren ebenfalls schweigenden Mann, sein vom Wetter gebräuntes Gesicht und seine helle Brust und Arme, die aus dem Schaum hervorsahen. Eigentlich sollte sie jetzt mit ihm reden. Es war eine günstige Gelegenheit, aber er würde ohnehin nicht verstehen, was sie von ihm wollte. Andres würde nicht begreifen, dass sie den anderen Mann liebte und mit ihm gehen wollte. Er würde sie niemals gehen lassen. Aber sie musste weg. Weg von ihm. Hin zu Esser. Sie hatte Angst. Es musste so aussehen wie ein Unfall. Sie griff nach dem Föhn, der an einem Haken gefährlich nahe über der Badewanne baumelte.
Radieschen von unten
Zuerst wusste sie nicht genau, was es war. Sie war knapp Siebzig, und ihre Sehkraft ließ immer mehr nach. Ohne Brille war sie blind wie ein Maulwurf. Irgend etwas stimmte da nicht. War was mit den Beeten? Ihr Blick wanderte über das in Reih und Glied angetretene Lauch, die Tomatenspaliere, die gewaltigen Rhabarberblätter. Irgend etwas war hier nicht, wie es sein sollte ...
Dann wandte sie den Blick nach unten. Da waren Blutflecke auf den Gehwegplatten zu ihren Füßen. Mit der Spitze ihres Schuhs kratzte sie daran. Die taufeuchte Luft hatte das Blut am Trocknen gehindert. Es zog Schlieren auf dem nassen grauen Untergrund.
Der Abstand zwischen den Flecken schien fast gleichmäßig. Sie führten schnurgerade auf das kleine Gartenhäuschen am anderen Ende des Schrebergartens zu. Sie zögerte keinen Moment. Das musste herausgefunden werden. In ihrem ganzen Leben hatte Käthe Rommerskirchen noch nicht gezögert. Sie war eine Frau der Tat. Irgend etwas war da in ihrem Gartenhäuschen und blutete, und insgeheim ahnte sie schon, welche Spezies sich dort verborgen hielt. Weder Marder, Katzen, noch Dackel oder Kanarienvögel pflegten die Tür wieder hinter sich ins Schloss zu ziehen.
Ihre Rechte hielt den hölzernen Stiel ihrer Hacke fest umklammert, als sie langsam die hölzerne Tür aufzog.
Es war noch dunstig, und sie war die erste in der Schrebergartensiedlung, aber sie verschwendete keinen Gedanken daran, dass sie sich vielleicht in Gefahr befinden könnte. Sie hatte die Bombenangriffe überlebt und ihren Mann Hubert, der vierzig Jahre lang ihr eintöniges Leben zu einer kleinen Hölle gemacht hatte. Wer konnte ihr schon etwas zuleide tun?
Ein schmaler Streifen grauen Lichts rieselte in das Dunkel der kleinen, unaufgeräumten Hütte. Bis vor wenigen Wochen war dies noch das Reich ihres Mannes gewesen. Oft war er sogar über Nacht geblieben, wenn er mal wieder zu betrunken gewesen war, um Auto zu fahren. Jetzt lag sein ganzes Gerümpel verwaist, den Kartoffeln entwuchsen fingerlange Keime, und die Spinnen machten sich mit Lust daran, das ganze Szenario mit feinen Tüchern zu bedecken.
In der Ecke hinter der Kartoffelkiste regte sich etwas. Sie rückte die Brille zurecht und spähte angestrengt in das Halbdunkel. Als sie die Tür vollends öffnete, entdeckte sie im einfallenden Licht ein Gesicht. Große, angstvoll aufgerissene Augen und schweißnasses, strähniges Haar, ein unrasiertes Kinn und bebende Nasenflügel.
»Was machen Sie da?« fragte sie, und dann entdeckte sie die Blutstropfen, die hier, auf dem staubigen Holzboden, dichter beieinander lagen. Der fremde junge Mann stöhnte.
Und wieder überlegte Käthe Rommerskirchen nicht lange, sondern zog die Tür hinter sich ins Schloss, nicht ohne vorher einen Blick hinausgeworfen zu haben, um sich zu vergewissern, dass niemand sie beobachtete. Sie lehnte die Hacke gegen die Bretterwand und trat furchtlos näher.
Der junge Mann blutete stark am rechten Oberschenkel. Er zog zischend die Luft zwischen den Zähnen ein, als sie sich zu ihm hinunterbeugte und ihn am Bein berührte. Er sagte nichts, und so beschloss sie ihrerseits auch nicht viele Worte zu machen. Sie riss das blutgetränkte Bein seiner Hose auf und legte eine klaffende Wunde am Oberschenkel frei. Käthe schluckte. »Junger Mann, wie ist denn das nur passiert?«
Er biss die Zähne aufeinander und schwieg beharrlich.
»Na gut, dann werde ich mal einen Doktor rufen. Sie müssen ins Spital, junger Mann!«
Als sie sich mühsam wieder aufrichten wollte, ergriff er mit einem Mal kraftvoll ihr Handgelenk und ächzte: »Nein, kein Doktor, kein Krankenhaus, bitte, bitte nicht!«
»Aber wie stellen Sie sich das vor? Sie werden mir doch hier verbluten!« Sie ging zu einem alten Küchenschrank, der im Halbdunkel an der Wand stand und suchte darin herum. Samentütchen in einem staubigen Schuhkarton, Unkrautgifte ... schließlich förderte sie eine halbvolle Schnapsflasche zutage. Das Erbe ihres Verblichenen.
Der junge Mann sah ihr mit gierigem Blick zu, wie sie den Verschluss abschraubte, und ergriff die Flasche mit zitternder Hand. Nach einem tiefen Schluck verspürte er anscheinend augenblickliche Linderung. Sein Körper löste sich allmählich aus der Verkrampfung.
»Es war die Russenmafia!«
»Hier? Bei uns? Die Russen? Ja, aber was wollen die denn von Ihnen?«
Er winkte mit einer fuchtelnden Handbewegung ab.
»Je weniger Sie wissen, desto besser«, sagte er matt und trank erneut. »Sie hätten mich fast erwischt, die Schweine. Gott sei Dank ist es nur ein Streifschuss. Ich hab wirklich verdammtes Glück gehabt. Beim nächsten Mal machen die mich alle!«
»Trotzdem muss das versorgt werden«, sagte Käthe und betrachtete mit verkniffenem Mund die Wunde. »Ich kann so was noch von früher.«
»Lassen Sie mich hier, gnädige Frau«, flehte er. »Hier im Versteck. Nur für ein paar Tage. Dann geben die die Suche auf. Ein, zwei Tage nur, bitte!«
»Wieso verstecken Sie sich gerade in meinem Gartenhäuschen?«
»Es war das erstbeste. Ich bin von der Straße direkt hier rüber. Hinten am Bahnhof hab ich sie abgeschüttelt.« Er setzte wieder sein schiefes Grinsen auf. »Es war nicht wegen Ihrer prächtigen Strauchbohnen, sorry.«
Käthe zog die Stirn kraus. »Sie legen sich auf das Feldbett da hinten«, sagte sie schließlich und zog einen alten beigefarben gemusterten Vorhang vor das kleine Sprossenfenster. »Ich werde in etwa einer Stunde zurück sein. Und bis dahin werden Sie keinen Mucks tun. Hier sind etwa zwanzig Schrebergärten drum herum, und einer von diesen Gärtnern ist neugieriger als der andere.«
»Wohin gehen Sie?« fragte er ängstlich.
»Ich hole Verbandszeug und etwas zum Desinfizieren. Und eine Hose von meinem Mann werde ich auch wieder aus dem Altkleiderbeutel herausholen. Keine Sorge, junger Mann. Kein Doktor!«
Sie sah ihm tief in die Augen, bevor sie ging. Sie waren blutunterlaufen und flackerten nervös. Aber sie strahlten in diesem Moment eine grenzenlose Dankbarkeit aus. Er hätte ihr Sohn sein können, wenn sie jemals einen gehabt hätte. Sie streckte die knochige Hand aus und berührte ihn sanft an seiner stoppeligen Wange. »Keine Sorge«, sagte sie noch einmal sanft und lächelte. In den Mundwinkeln sah er ihre Goldzähne blitzen. »Ich bringe Tabletten mit. Bald wird es Ihnen besser gehen.«
Er setzte ein schiefes Grinsen auf. »Danke«, sagte er leise.
»Die Russenmafia, sagen Sie?« fragte sie noch einmal an der Tür. Er nickte eifrig.
Sie schüttelte fassungslos den Kopf und verließ die Hütte.
Dann schloss sie die Tür hinter sich. Als er hörte, wie sie plötzlich einen Schlüssel im Schloss drehte, befiel ihn für einen Augenblick lang heftige Panik, aber dann dachte er, dass sie das wohl nur tat, damit ihn niemand finden könne. Er hatte verdammtes Glück. Die Alte hatte ihm alles abgekauft. Er würde sie vielleicht am Leben lassen.
Als Käthe wenig später zurückkehrte, brachte sie einen großen Wäschekorb mit.
Er war eingenickt und schreckte hoch, als er das Geräusch des Schlüssels von der Tür hörte.
Aus dem Hintergrund ertönte eine Männerstimme mit schlesischem Akzent. »Wird jetzt aufjereimt, Frau Rommerskirchen?«
»Ja, ja, irgendwo muss ich ja mal anfangen!« rief sie frohgelaunt zurück und trat ein.
Der junge Mann hatte sich beim Klang der fremden Stimme voller Panik von dem vergammelten Feldbett heruntergerollt und sich wieder hinter der Kartoffelkiste verborgen. Sofort kehrten die höllischen Schmerzen zurück und wühlten sich durch sein Bein. Er war benebelt vom Schnaps, aber voller Panik achtete er auf jedes kleine Geräusch. Wenn er doch nur seine Wumme nicht verloren hätte, dann würde er sich viel sicherer fühlen.
Als sie die Tür hinter sich geschlossen und den Wäschekorb auf einem kleinen Campingtisch abgestellt hatte, stemmte sie die Hände in die Hüften und schüttelte missbilligend den Kopf. »Hatte ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen sich hinlegen?«
»Der Mann da draußen ...«
»Klepka, der einbeinige Frührentner im Garten nebenan. Wollen Sie so enden wie er? Ein Bein abgenommen bekommen?« Sie griff ihm kopfschüttelnd unter die Arme und half ihm zum Bett zurück.
»Sie erinnern mich an meine Mama«, log der junge Mann. »Sie sind sehr gut zu mir.«
Käthe Rommerskirchen wurde ein bisschen rot. Dann holte sie eine Schachtel mit Schmerztabletten hervor und Mineralwasser. Er nahm gleich drei.
»Was haben Sie diesen Russen nur getan?« fragte sie, während sie den Verband aus einem alten dunkelblauen Verbandskasten herauskramte. »Die schießen doch nicht aus Spaß auf Sie. Oder machen die so was?«
»Eine Liebesgeschichte. Ich habe mich in die Tochter ihres Chefs verliebt. Und sie in mich. Irina heißt sie. Und sie sieht aus wie eine russische Ikonenmadonna.« Ein beseeltes Lächeln legte sich über seine Züge.
Sie tupfte die Wunde sauber. »Und was hat der Chef gegen Sie als zukünftigen Schwiegersohn? Das ist ja zu tragisch!«
»Er erpresst Schutzgelder von den Gastwirten in der Stadt. Ich habe ihn angezeigt. Mein Bruder und ich, wir haben ein kleines Restaurant. Wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, verstehen Sie?« Er musste über sich selbst grinsen. Der Schmerz schien seine Fantasie zu beflügeln. Sie glaubte ihm jedes Wort. Herzschmerz und Rebellion, das war nach dem Geschmack der alten Mädchen. »Irina und ich wollten fliehen. Zusammen. Er hat uns auf dem Weg zum Flughafen eingeholt. Sie waren zu viert. Irina ist tot. Ein Schuss, der mir galt, hat sie in die Brust getroffen. Aua!!!« Sie war vor Schreck mit dem Wattebausch ausgerutscht.
»Das ist ja schrecklich!«
Eine Träne des Schmerzes quoll aus seinem Auge hervor. Sie wischte sie mit zitternden Fingern weg. »Sie armer, armer Junge. Was ist mit Ihrem Bruder?«
»Sie haben ihm einen Finger abgeschnitten. Er ist nach Frankreich geflohen. Wer weiß, ob ich ihn jemals wiedersehen werde!«
Bedächtig rollte sie den Verband um seine Wunde und betrachtete danach ihr Werk voller Stolz. Dann holte sie eine neue Flasche Schnaps aus dem Korb. »Das ist der gute«, sagte sie. »Ich habe ihn schnell im Geschäft besorgt. Trinken Sie!«
Er nahm einen nicht enden wollenden Schluck und empfand beinahe überhaupt keine Schmerzen mehr, als sie ihm die alte graue Bügelfaltenhose ihres Mannes überzog. Beschämt versuchte sie, den Blick an seiner Männlichkeit im knappen Slip vorbeizulenken. Die Hose war einige Nummern zu groß. Sie musste den Gürtel ins letzte Loch schnallen.
»Braucht Ihr Mann die denn nicht mehr?« fragte er lauernd. Hoffentlich hatte die Alte keinem gegenüber ein Wort verloren.
»Er ist vor ein paar Wochen gestorben. Fast hätte ich seine Kleider schon zur Altkleidersammlung gegeben. Ich will nichts mehr von ihm im Haus haben.«
»So verbittert?« Er schalt sich im nächsten Augenblick für eine so kühne Frage.
»Er hat klammheimlich die Lebensversicherungen gekündigt und das Geld versoffen. Ich habe jetzt nur noch das Nötigste zum Leben.«
›Du alte Schachtel‹, schoss es ihm mitleidslos durch den Kopf, ›was brauchst du denn schon noch? Mit einem Bein im Grab und dann noch mal ordentlich in die Torte hauen, was?‹
Und als hätte sie seine Gedanken gelesen, murmelte sie, während sie mit den Fingern nachdenklich über ein paar vertrocknete Rosenstöcke strich, die in einer Holzkiste vor sich hinmoderten: »Ich würde so gerne einmal reisen. Nach Italien, nach Spanien ... nach Afrika vielleicht sogar. Ich schaue mir viele Fernsehsendungen über diese Länder an, wissen Sie. Wir sind nie hier rausgekommen. Wir haben immer nur das gegessen, was unser kleiner Schrebergarten hergegeben hat, der Hubert und ich.«
Sein Blick war das blanke Bedauern. Er sagte keinen Ton. Dafür zerriss plötzlich ein dumpfes Grummeln die Stille. In seinem Magen herrschte fürchterliche Leere.
Sie schrak auf. »Ach Gottchen, jetzt hätte ich doch beinahe die Suppe vergessen!«
Sie griff erneut in den Wäschekorb und holte ein kleines, blechernes Gefäß heraus. Darin hatte der selige Hubert jahrzehntelang sein Mittagessen mit auf die Baustelle genommen. Sie öffnete die Schnappverschlüsse, und ein verlockender Duft strich durch den kleinen Raum.
»Kürbiscremesuppe«, sagte sie, und reichte ihm eifrig einen Löffel. »Aus dem eigenen Garten.«
Er bemühte sich, seine Gier zu verbergen, als er den Löffel in die blassgoldene, cremige Flüssigkeit tauchte. Sie reichte ihm ein Salamibrot dazu.
»Was für ein Restaurant hatten Sie und Ihr Bruder?«
Er sah sie für einen Moment verwirrt an. »Restaurant? ... spanisch! Ein spanisches Restaurant.« Er grub hungrig seine Zähne in die Stulle.
»Spanisch«, seufzte sie. »Dort isst man scharf gewürzt. Ich mag das.« Dann gab sie sich einen Ruck und nahm die verdorrten Rosenstöcke aus der Holzkiste. »Auf den Kompost damit. Ich muss anfangen, einiges zu ändern!« Dann griff sie erneut in den Korb und holte mehrere Hände voll Blumenzwiebeln hervor, die sie in die Kiste kullern ließ. »Im nächsten Frühjahr soll das ein prachtvoller Blumengarten werden. Ich habe keine Lust, meine letzten Jahre zwischen dem Sellerie herumzukriechen.«
»Gut so!« sagte er kauend. »Was sind das für Blumen?«
»Tulpen. Rote und violette.«
»Irina liebte violette Tulpen«, sagte er weinerlich. Sie seufzte tief und verließ die Hütte, die Rosenstöcke in den Händen.
Er trank Schnaps und ließ ein kleines Jauchzen hören. Die Suppe schmeckte köstlich. Ein bisschen stark gewürzt, für seinen Geschmack. Er mochte es lieber weniger scharf. Er war Däne. Die schwarzen Haare hatte er von seiner Mutter. »Spanisches Restaurant, ha!« Er hätte sich auf die Schenkel geklopft, wenn es nicht so höllisch weh getan hätte. Noch ein paar Tage bei der Oma in Pflege, und er war fit für den weiteren Weg. Raus aus Deutschland und ab auf die Bahamas!
Draußen brabbelte die alte Schachtel wieder mit dem Nachbarn.
Er wurde unruhig. Sie würde ihn nicht verraten, da war er sich sicher. Nicht nach der Geschichte mit Irina, der toten russischen Madonna. Aber womöglich würde sie, wenn sie im Garten ... Er stellte den Blechnapf beiseite und glitt von seinem Ruhelager herunter. Als er zum Fenster robbte, war es ihm, als ginge es schon viel besser als in der letzten Nacht.
Ächzend zog er sich am Fensterbrett hoch und sah vorsichtig über den Rand hinaus ins Freie. Spinnengewebe verschleierten den Blick, aber er erkannte sie ganz deutlich, wie sie dastand, leicht nach vorn gebeugt, und sich mit einem alten Glatzkopf auf der anderen Seite des Bretterzauns unterhielt. Über was sie sprachen, war ihm ziemlich egal. Nur die Tatsache, dass sie sich am Radieschenbeet unterhielten ... Ausgerechnet da! Womöglich würde sie etwas bemerken. Womöglich würden sie ...
Ein scharfer Schmerz wühlte sich durch seine Gedärme. Er presste stöhnend die Hand in die Magengrube. Der Schnaps und die Tabletten vertrugen sich anscheinend nicht.
Auf dem Nachbargrundstück wurde ein Häcksler in Bewegung gesetzt. Es knatterte ohrenbetäubend laut. Der Schmerz wurde stärker, schnitt mit Gewalt durch das Zentrum seines Körpers und ließ ihn das Gleichgewicht verlieren.
Er stürzte zu Boden und wand sich in Krämpfen. Seine Rechte packte nach dem Wäschekorb, schloss sich im Krampf um einen der Griffe. Das Rattern übertönte seinen kraftlosen Ruf nach Hilfe.
Als der Korb umkippte, glitt das Zeitungspapier heraus, das auf dem Boden unter den Tulpenzwiebeln gelegen hatte. Banküberfall konnte er entziffern, und Junger Mann, etwa einsfünfundsiebzig groß, schwarzes Haar. Die Zahl Dreihunderttausend verschwamm vor seinen Augen.
Die Alte hatte ihn gelinkt! Den Bullen war er durch die Lappen gegangen, aber dieser alten Schachtel war er in die Falle gegangen. Sie hatte es von Anfang an gewusst! Vergiftete Suppe, stark gewürzte ... Es schnürte ihm die Kehle zu. Seine Lunge versagte ihren Dienst, er wollte nach Luft schnappen, aber es ging nicht mehr ... Nichts ging mehr ...
Ein Ausdruck der Zufriedenheit legte sich über ihr faltiges Gesicht. Sie atmete zufrieden die kühle Morgenluft ein und betrachtete versonnen das Radieschenbeet, das so glattgeharkt war wie ehedem. Die Pflänzchen würden ein wenig Pflege gebrauchen, nach allem, was sie mitgemacht hatten.
Das Feuerchen war heruntergebrannt, und der letzte Zipfel der dreckverschmierten Tasche war verkokelt. Das Geld ruhte gestapelt und größtenteils unversehrt in dem Wäschekorb unter einer Lage alter Zeitungen.
Das Tor zur Schrebergartenkolonie quietschte. Klepka kam auf seinen Krücken angehumpelt. Er staunte darüber, dass sie schon so früh auf den Beinen war. »Was macht denn de Frau Rommerskirchen schon so früh am Morjen hier draußen?«
Sie erzählte ihm, dass sie schlecht schlief. Sie erzählte auch, dass sie begonnen hatte, die Hütte auszuräumen, womit sie nicht einmal log, und sie sagte ihm, dass sie in nächster Zeit sehr viel auf Reisen sein werde. Herr Klepka versprach, in ihrer Abwesenheit nach ihrem Garten zu schauen. Das sei ja alles vorbildlich in Schuss, nur die Radieschen, so sagte er, die sähen ein bisschen mitgenommen aus.
Die Bierfalle
Leblos taumelten die fetten Schneckenkörper in einem Strudel trüben Biers. Kaspar Kirsch schwenkte das gläserne Behältnis, das den gefräßigen Kriechtieren zur tödlichen Falle geworden war, ganz dicht vor seiner Nase. Der alte Mann runzelte die Stirn und versuchte, die glänzenden Leiber zu zählen. Er hasste dieses unselige Töten, aber andererseits liebte er auch seinen Garten. Sowohl die Blütenpracht der Abteilung »Für Auge, Nase und Seele«, als auch den üppigen Wuchs der Abteilung »Für den Magen«, wie er es nannte.
Vom nahen Fußballplatz drang lauter Jubel. Es klang beinahe so, als wolle die Menschenmenge ihm zu seinem grandiosen Fang gratulieren, aber vermutlich hatte es nur ein Tor gegen die Roderather gegeben, die sich gerade als Gäste der Ginsterfelder Sportwoche einseifen ließen.
Seufzend schüttete der alte Kirsch, in seinem Dorf von allen »Kiersche Käsper« genannt, den Inhalt der Schneckenfalle auf seinen stattlichen Komposthaufen. So wie jeden Tag, nachdem der bislang nasse Sommer die Schneckenpopulation drastisch hatte ansteigen lassen. Nicht nur in Ginsterfeld, sondern in der ganzen Eifel.
Von der Straße drang plötzlich ein ganz anderes Geräusch zu ihm herüber. Ein langgezogenes, professionelles Rülpsen, mit einer tiefen Ouvertüre, einem nahezu burlesken Mittelteil und einer kecken Endung irgendwo in den höheren Regionen der Tonleiter. Kirsch seufzte und füllte seine Bierfalle erneut. Vor seinem geistigen Auge erschien Köbes, sein Nachbar. Fett, unrasiert, besoffen. Eine Landplage. Ein Widerling. Wer schon am Vormittag so rülpste, der hatte vermutlich bereits die ein oder andere Flasche Bier gefrühstückt.
»Irgendwann gerätst du auch in eine Bierfalle«, murmelte Kirsch, schob seine graue Kappe in den Nacken und bohrte den Glasbehälter in die feuchte Erde zwischen Salat und Kohlrabi.
Erneut jubelte die Menge der Fußballzuschauer, und plötzlich mischte sich von der Straße her schrilles Bremsengequietsche und ein beunruhigend dumpfes Aufprallgeräusch zwischen die kollektiven Jubelrufe.
Kirsch beeilte sich, den Natursteinweg entlang zur Straße zu laufen. Über die Spitzen des Staketenzauns, der seinen Garten Eden umstand, beobachtete er Mätthes Krauß, der ebenfalls angelaufen kam. Sein Gesicht spiegelte voller Entsetzen das wieder, was Kirsch wenige Augenblicke später auch sehen konnte, als er durch das Gartentor auf die Straße hinauslief und die Hausecke umrundet hatte:
Ein feuerroter Sierra stand mitten auf der Straße, ein wenig schief, so, als habe er im letzten Augenblick versucht irgendetwas auszuweichen. Der Fahrer, ein junger Mann, den Kirsch nie zuvor gesehen hatte, wahrscheinlich ein Gast der Sportveranstaltung, entstieg langsam, wie in Trance, seinem Fahrzeug. Schon von weitem konnte man einen Fuß erkennen, der zu dem reglosen Körper vor dem Kühler gehörte.
Köbes lag auf dem Rücken. Sein Kopf war unnatürlich zur Seite gedreht. Seine ohnehin hervorquellenden Augen glotzten starr und schreckgeweitet ins Leere. Eine Blutlache sickerte unter seiner auf dem Asphalt ruhenden Schläfe hervor. Mit einer Behendigkeit, die man ihm wegen seines Alters kaum zutraute, war Kirsch auf den Knien und griff nach Köbes’ Handgelenk. Er fühlte keinen Puls mehr.
»Das musste ja irgendwann passieren!«, rief Mätthes atemlos.
»Ich bin net zu schnell jefahren!« stieß der junge Mann heiser hervor. »Dat is ja auch so unübersichtlich hier! Der kam mir direkt vor’t Auto jestolpert. Ehrlich! Ich hab den net jesehen!« Er begann zu zittern, und Mätthes, der Sohn des Ortsvorstehers, der noch den Besen in der Hand hielt, mit dem er jeden Samstag den Platz vor dem Kriegerdenkmal auf Vordermann brachte, fasste ihn beruhigend bei der Schulter.
»Da kannst du nix für. Der war wieder randvoll!«
Betrübt nahm Kirsch den Biergeruch wahr, den der Körper des Toten ausströmte, und murmelte, sehr zum Befremden der anderen beiden: »Wie schon gesagt ... Bierfalle.« Köbes’ Schwester fiel ihm ein. Kätchen, die vermutlich wie stets in der oberen Etage des gemeinsamen Hauses der beiden stumm vor sich hinarbeitete, und gar nicht mitbekommen hatte, dass unten, vor der Haustüre gerade ihr stockbesoffener Bruder überfahren worden war.
Er blickte wieder zu dem Toten hinunter. Köbes hatte endgültig seinen letzten Rülpser getan, und Kirsch konnte sich nicht vorstellen, dass es viele gab, die das traurig stimmen könnte. Nicht einmal Köbes’ Sohn, der irgendwo in der Weltgeschichte herumreiste. Auf der Suche nach dem Glück, das er zuhause nie gefunden hatte.
Und plötzlich bemerkte er ein kleines Schnipselchen Papier, das sich zwischen Daumen und Zeigefinger von Köbes Hand befunden hatte und gerade im Begriff war, von einem Lufthauch davongeweht zu werden. Rasch griff er danach und steckte es intuitiv in die Tasche seiner Cordweste.
»Jetzt guck doch mal genau!« Kirsch drängte seinen alten Freund dazu, noch einmal das Vergrößerungsglas zu nehmen, und den kleinen bunten Papierfetzen erneut zu untersuchen.
Kirsch besuchte Franz Oedekoven nicht all zu oft. Es war keine tiefe Freundschaft, die die beiden alten Männer verband, aber sie schätzten einander, und in den Jahren, in denen Kirsch noch in der Gärtnerei in Blankenheim gearbeitet hatte, war Oedekoven ein regelmäßiger Kunde gewesen.
»Ich glaube fast, du bist nur deswegen hier! Und zieh doch endlich mal diese speckige Kappe aus. Man könnte ja meinen, du gehst mit dem Ding ins Bett!« maulte der pensionierte Lehrer seinen Gast an. »Das mit diesen Dahlienknollen nehme ich dir nicht ab, Käsper. Die hatte ich mir im Frühjahr gewünscht. Da hast du sie mir allerdings nicht gebracht. Was soll ich also jetzt damit?«
»Ach, verwahr sie einfach. Du wolltest sie haben, und ich habe sie gebracht. Es sind gelbe ... oder doch weiße? Na, egal. Jetzt guck doch noch mal!«
Oedekoven seufzte und unterzog das Objekt von Kirschs Begierde einer erneuten Untersuchung. Die beiden saßen da inmitten von Oedekovens aufgeschlagenen Briefmarkenalben und Sammlerkatalogen und versuchten angestrengt, die Herkunft des Fetzchens Papier, auf dem eindeutig ein Stückchen einer Briefmarke klebte, zu erforschen.
»Viel zu winzig«, brummte Oedekoven und beugte sich wieder tief zu dem Fundstück hinunter, blätterte zwischenzeitlich in einem Katalog, und Kirsch, der pausenlos mit seinen knorrigen Gärtnerfingern in den zahlreichen Alben herumblätterte, wollte gerade wieder einmal sagen: »Guck mal hier, könnte das nicht ...?« als Oedekoven plötzlich mit scharfem Zischen die Luft zwischen den Zähnen einsog. »Hier!« stieß er triumphierend hervor. »Das ist sie!«
»Australien ...«, murmelte Kirsch.
»Aus der Serie Pflanzen des australischen Kontinents. Genau das Richtige für dich.«
»Du sagst es. Genau das Richtige.«
Frau Pausewang war ein wenig überrascht, als Kirsch auf ihr gelbes Fahrzeug zugeeilt kam. Meistens arbeitete er im Garten, wenn sie die Post in seinen Kasten warf. Er bekam ohnehin selten Post. Selten Pakete. Ein angenehmer, unauffälliger Kunde. Sie kurbelte die Scheibe herunter und reckte ihm zwei Umschläge entgegen. Überflüssiger Werbemüll. »Morgen, Herr Kirsch!«
»Morgen!« rief Kirsch fröhlich. Seine roten Bäckchen leuchteten. Der Alte schien aufgekratzt. »Darf ich Sie mal was fragen?«
Neugierig streckte Frau Pausewang den Kopf aus dem Postauto. »Klar. Wenn ich Ihnen helfen kann ...«
Kirsch überlegte, ob er diplomatisch oder direkt vorgehen sollte. Er entschied sich für die rasche Offensive.
»Hatten Sie gestern Post für die da?« Er deutete mit dem Zeigefinger auf das Nachbargebäude, dessen Haustüre, in einem Windfang versteckt, von der Straße aus nicht zu sehen war.
Frau Pausewang sah ihn verwundert an. »Aber, Herr Kirsch ...« Sie schüttelte zaghaft den Kopf. »Das kann ich Ihnen doch nicht erzählen. Schon mal was vom Briefgeheimnis gehört?«
Kirsch blickte sie freundlich an. »Nun, ich will doch gar nicht wissen, was drinstand ...«
»Das könnte ich Ihnen ja nun erst recht nicht sagen!« beeilte sich Frau Pausewang entrüstet zu sagen.