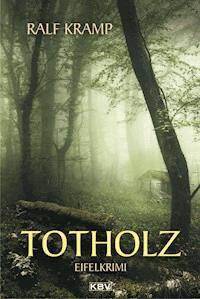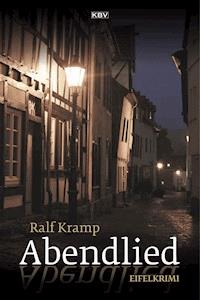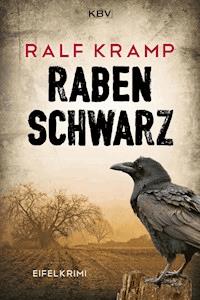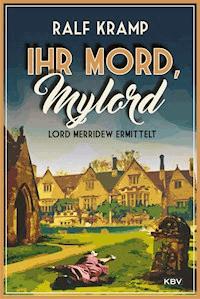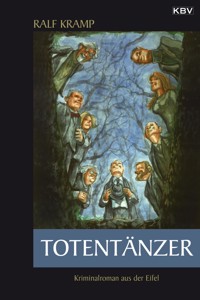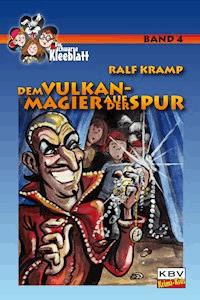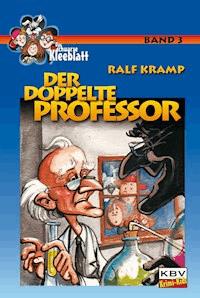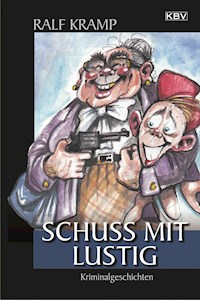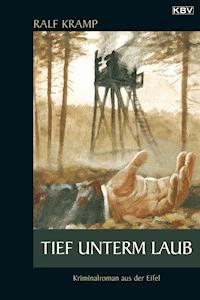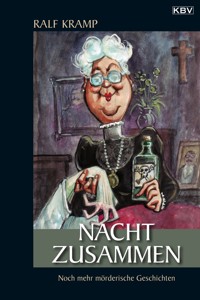Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Herbie Feldmann
- Sprache: Deutsch
Herbie Feldmann ist ein Spinner. Das weiß fast jeder in der Eifel, denn seit seinem Nervenzusammenbruch vor vielen Jahren hat der junge Mann "einen neben sich gehen". Niemand kann ihn sehen, aber Julius wandelt stets an Herbies Seite. Ein brutaler Serienmörder, dem die Presse schon bald den bedeutsamen Namen "Der Motzer" gibt, sucht den friedlichen Landstrich heim. Als Herbie und sein Begleiter eines Tages über ein weiteres Opfer stolpern, beschließen sie, die Suche nach dem Täter mit ihren eigenen Methoden fortzuführen. Eine Jagd beginnt, die zeigt, dass es Spinner gibt, die nicht annähernd so harmlos sind wie Herbie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Kramp
Spinner
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Tief unterm Laub
Spinner
Rabenschwarz
Der neunte Tod
Abendgrauen (Hg.)
Still und starr
… denn sterben muss David!
Kurz vor Schluss
Abendgrauen II (Hg.)
Malerische Morde
Hart an der Grenze
Ein Viertelpfund Mord
Ein kaltes Haus
Abendgrauen III (Hg.)
Totentänzer
Nacht zusammen
Stimmen im Wald
Voll ins Schwarze
Tatort Eifel 3
Ralf Kramp, geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt heute in Flesten in der Vulkaneifel. Für sein Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er den Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen mehrere Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann und seinen unsichtbaren Begleiter Julius, die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit 1998 veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel »Blutspur« Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen hartgesottene Krimifans ihr angelesenes »Fachwissen« endlich bei einer Live-Mördersuche in die Tat umsetzen können.
Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen. Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 26.000 Bänden, dem »Café Sherlock« und der Buchhandlung »Lesezeichen«. www.ralfkramp.de · www.kriminalhaus.de
Ralf Kramp
Spinner
1. Auflage Mai 1997
2. Auflage Oktober 1999
3. Auflage September 2000
4. Auflage Oktober 2002
5. Auflage September 2005
6. Auflage Januar 2011
7. Auflage April 2012
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-9934638-25-9
E-Book-ISBN 978-3-95441-057-6
Für Felix: Wachse, lerne, …und spinne ruhig ab und zu!
Selig die Abgebrochenen,
die Verwirrten, die in sich Verkrochenen,
die Ausgegrenzten, die Gebückten,
die an die Wand Gedrückten.
Selig sind die Verrückten
»Selig sind die Verrückten« aus der CD
»Immer weiter« von Reinhard Mey,
Maikäfer Musik Verlagsgesellschaft mbH, Berlin.
Prolog 1
Rasselnder Lärm zerriss die leere Geräuschlosigkeit vor den Toren des verlassenen Fabrikgebäudes.
Auf der gegenüberliegenden Seite der nächtlich verwaisten Straße wälzte sich Rentner Hans Willi Grunedahl verärgert schnaufend aus seinem Bett und schlurfte zur Toilette, weil er in diesem Moment, genau wie in den letzten Monaten immer wieder, zu nachtschlafender Zeit dem Druck seiner Blase nachgeben musste. In dem kleinen, gekachelten Raum mischte sich sein verärgert geknarztes »Scheiß Künstlerpack!« unter das pullernde Geräusch des Wasserlassens.
Das »Scheiß Künstlerpack«, er nannte sie auch »vergammelte Schmierfinken«, oder aber liebevoll »Pinselquälergesocks«, riss ihn neuerdings immer wieder aus der Nachtruhe, die er sich wohlverdient zu haben glaubte. Vier Jahre Russland, neununddreißig Jahre auf dem städtischen Bauhof und seit zwei Jahren intensive bis fanatische Beackerung eines halben Hektars Nutzgarten … da hatte man sich doch sein bisschen Nachtruhe verdient, oder wie lief das hier?
Mit Schrecken dachte er daran, was geschehen würde, wenn die »Scheiß Künstler« ihn eines Nachts mal nicht zum pünktlichen Pinkeln wach lärmen würden. Er schob den Gedanken verärgert beiseite und betrachtete versonnen seinen Urinstrahl, wie er – mittlerweile nur noch schubweise – in den Tiefen der spärlich beleuchteten Kloschüssel verschwand.
Auf der anderen Straßenseite hatten es die beiden jungen Männer unterdessen beinahe zuwege gebracht, das Eingangsportal des alten Fabrikgebäudes in der Nähe des Mechernicher Bahnhofs zu öffnen. Einer von ihnen, ein magerer Knabe mit fliehendem Haaransatz, bewegte unablässig eine meterlange, oben und unten verschlossene Pappröhre hin und her, in deren Innerem eine Handvoll Erbsen sich mühselig und deutlich hörbar ihren Weg durch ein Labyrinth von knapp sechzig quer durch die Röhre getriebenen Nägeln bahnte. Die Hülsenfrüchte schickten ihre prasselnden Wutlaute durch die schwarze Stille der Sommernacht.
»Mach schon, mach schon!« drängelte der Röhrenrassler und gähnte demonstrativ. »Du bist ja immer noch nicht nüchtern!« Er spielte auf die wilde Sause auf dem Geburtstag ihres Kollegen Raimund an, die sie zwei Tage zuvor in dem alten Ritterkeller gefeiert hatten.
»Dieser hausgemachte Met hatte es aber auch in sich. Hat mir aber nicht geschadet.«
»Warum zappelst du dann wie ein Aal?«
»Bin nervös! Hetz mich nicht.« Der zweite, Bebrillte, war sich seiner Unfähigkeit in Sachen Schlüsselhandhabung anscheinend restlos bewusst. Ab und an warf er einen hektischen Blick auf seinen Kumpanen.
Endlich drehte sich der Schlüssel im Schloss, und die beiden verschwanden rasch in der Toreinfahrt.
»Immer dieses dämliche Auf- und Abgeschließe!« fluchte der Nervöse und schob hinter ihnen das Tor wieder zu. Während er wieder begann, zittrig mit den Schlüsseln herumzufuhrwerken, rasselte das Erbsenrohr erneut mit einem Abstand von zwei Zentimetern an seinem linken Ohr vorbei.
Das melodische Geräusch wurde von der anderen Straßenseite mit heftigem Fensterzuknallen quittiert.
»Nu, los!« nörgelte der Erkahlende jetzt wieder. »Raimund ist bestimmt schon oben und hat die Kokosnüsse aufgehängt.«
Sie sahen genauso aus, wie man sich Künstler vorstellte. Ihre Kleidung und auch ihre Frisuren entsprachen durchaus den gängigen Klischees: grellbunte Klamotten, farbbekleckste Turnschuhe … Der mit der Erbsenröhre krönte den albernen Aufzug mit einer bunt gemusterten Fliege.
Sie öffneten eine weitere Tür, wobei ungeduldig und entschlossen diesmal der andere das Aufschließen besorgte und der Zappelige der Pappröhre hinterherlief, die ihm prompt und geräuschvoll aus der Hand glitt, als er sie festhalten sollte.
Sie waren in der Fabrik mit dem dritten im Bunde verabredet, der unterdessen sicherlich schon an ihrer Monumentalplastik »Scheißwetter über Golgatha II«, einer lebensgroßen Kreuzigungsszenerie, weiterarbeitete. Im ersten Stock hatten sie dank der Großmut des jetzigen Besitzers der ehemaligen Stahlfirma vorübergehend ein Atelier gefunden, das den Ausmaßen ihres voluminösen Gemeinschaftswerkes gewachsen war. Ob sich für diese sagenhafte Auftürmung einer unsäglichen Menge von Müll – denn um nichts anderes handelte es sich im Grunde genommen – jemals eine adäquate Ausstellungsfläche finden würde, war mehr als fraglich. Solche Gedanken bremsten sie allerdings keinesfalls in ihrem Elan und hielten das »Trio Infernale« nicht im mindesten davon ab, auch noch zu nächtlicher Stunde tätig zu werden.
Heute war schließlich die Nacht, in der das mechanisch erzeugte Unwetter in Form einer vor sich hinflimmernden kaputten Hundertwattbirne und dem elementaren Lärm von siebenunddreißig rastlos prasselnden Erbsen über Golgatha installiert werden sollte.
Rolf und Achim eilten das schwach erleuchtete Treppenhaus hinauf. Es roch nach Maschinenöl und Nässe, die Luft war staubig und abgestanden. Ihre knirschenden Schritte, mit denen sie vor lauter Schaffensdrang zwei Stufen auf einmal nahmen, schallten durch das Treppenhaus und verloren sich in den Spinnweben, die wie zart gewebte Tücher von der Decke hingen.
Im ersten Stock angekommen, drang ihnen aus der Räumlichkeit hinter der halb geschlossenen Stahltür mit der Aufschrift »Halle 2« ein flackernder Lichtschein entgegen. Raimund hatte bereits begonnen, das Unwetter heraufzubeschwören.
Sie bemerkten nicht die unnatürliche Stille, die sie erwartete, weil pausenlos die Erbsen ihre Schritte untermalten. Sie erfassten nicht die absolute Starrheit der Szenerie, in die sie gutgelaunt hineingaloppierten.
Erst als sie innehielten und mit den Augen den Raum und die riesenhafte Installation durchmaßen, bemerkten sie, warum alles totenstill und, bis auf die Flackerbirne, unbeweglich war.
Raimund hatte den Mund weit offen stehen. Seine Unterlippe hing schlaff herunter, sein Kopf befand sich in einer scheinbar ausgesprochen entspannten Haltung. Sein links gescheiteltes, üppiges Haar hing ihm in die Stirn und bedeckte zur Hälfte die schief gerutschte Brille. Seine Armhaltung, der eines Buhmannes nicht unähnlich, rührte daher, dass jemand seine Handflächen an den beiden äußeren Enden des Querbalkens des Kreuzes fest gehämmert hatte, das sie erst eine Woche zuvor zu dritt aus einem Damenrad und mehreren leeren Mayonnaiseeimern zusammenmontiert hatten.
Für den Bruchteil einer Sekunde hielten sie es für einen von Raimunds üblichen Scherzen der makabren Sorte, aber als sie näher traten und in Raimunds tote Augen blickten, da wussten sie, dass sie sich getäuscht hatten.
An Raimunds Fuß war ein Zettel befestigt, auf dem, aus Zeitungslettern ausgeschnitten, zu lesen war: »ANS KREUZ MIT DEN MODERNEN KÜNSTLERN! Sie ziehen Euch das Geld aus der Tasche!«
Von Raimunds Unterlippe löste sich ein Tropfen aus Speichel und Blut und troff auf das zerknitterte Blatt an seinem Fuß.
Als Rolf ohnmächtig wurde, entglitt ihm das Erbsenrohr, rollte zurück ins Treppenhaus und trieb auf seiner geräuschvollen Reise aus dem vierten Stock in das Kellergeschoss den Rentner Hans Willi Grunedahl auf der anderen Straßenseite in den Wahnsinn.
Prolog 2
Bauer Heinrich Haspelrath wurde von dem Platzregen auf freiem Feld überrascht. In Sekundenschnelle hatte sich der Sommerhimmel über der Kreisstadt Euskirchen und ihrer Umgebung zugezogen und begann auf der Stelle unter elementarem Gedonner und Geblitze seine geballten Wassermassen auf das ausgedörrte Voreifelland hinunterzuschütten.
Sein Auto stand in diesem Moment natürlich ausgerechnet am anderen Ende des Weizenfelds, wie der Landwirt zähneknirschend feststellen musste. Es war der lang erwartete Regen, der auf den Feldern endlich dem ein Ende bereiten sollte, was ihn heute zu einem kurzen Kontrollbesuch auf dem Feld direkt vor den Toren der Stadt, idyllisch gelegen zwischen Funkkaserne und A1, veranlasst hatte: die knisternde Trockenheit, die die kostbare Bodenkrume in ein krustiges Etwas verwandelt hatte, bei dessen Anblick sich unmittelbar das Verlangen nach einem kühlen Bier aufdrängte.
Jetzt sickerte der Regen auf einen Schlag literweise in die klaffenden Risse, und es sah fast so aus, als wolle er die mickrigen, gelblichen Pflänzchen, die sich ans Tageslicht gekämpft hatten, gleich mit in die Erde spülen.
Haspelrath sprintete los und steuerte den nächstgelegenen Unterschlupf an, in dem er die Unbilden des Sommergewitters abwarten konnte.
Umrahmt von Feldern und Äckern stand dort grau und massiv die »Soda-Brücke«, die so hieß, weil sie einfach nur »so da« stand und über einen mickrigen Wirtschaftsweg hinwegführte. Einst war geplant worden, dass sie eine tragende Rolle bei der verkehrstechnischen Verbindung der Orte Düren und der Bundeshauptstadt Bonn spielen sollte. Da sich dieser Plan aber anscheinend mittlerweile in Luft aufgelöst hatte, weil vielleicht weder Bonn noch Düren eine Annäherung besonders herbeisehnten, weil zahllose Anlieger den Bau einer Trasse durch ihr kostbares Land blockierten oder weil ganz einfach die Geldbörse der zuständigen Stellen mittlerweile so dünn war, dass man die letzten Groschen an fünf Fingern abzählen konnte … Wer wusste es schon? Die Brücke stand, der Autobahnverkehr rauschte an ihr vorbei statt über sie drüber, und der Kreis Euskirchen war um ein wahrhaft gewaltiges, kulturhistorisch ausgesprochen wertvolles Monument reicher.
Sie wurde unterdessen überwuchert von Schlingpflanzen und Kräutern zahlreicher Spezies und bot sich ab und an als Zuflucht für heimatlose Liebespaare mit fahrbarem Untersatz und heute eben für Heinrich Haspelrath an, der auf dem Weg dorthin durch die ein oder andere in Sekundenschnelle entstandene Pfütze torkelte und bald genauso nass war, als hätte er sich auf direktem Weg zum Auto begeben.
Keuchend kam er unter dem soliden Betondach zum Stillstand. Seine letzten Schritte hallten von den nackten Wänden wider. Er lehnte sich an die Wand und holte, nachdem sein Atem wieder einen gleichmäßigen Rhythmus gefunden hatte, ein Päckchen HB hervor und nahm sich eine Zigarette heraus. Als er das Feuerzeug entzündete, tauchte für eine Sekunde ein Blitz die Szenerie in gleißendes Licht.
Haspelrath inhalierte tief und begann mit triefend nassem Schuhwerk in seinem vorübergehenden Gefängnis hin und her zu gehen.
Ein Gegenstand am anderen Ende der Durchfahrt zog ihn an. Bei genauerer Betrachtung entpuppte er sich als Schuh. Nichts Ungewöhnliches. Hier fanden sich von Zeit zu Zeit Dinge wie zerrupfte Pornoheftchen, leere Bier- und Sektflaschen, Strümpfe, Slips … Warum nicht mal ein Schuh?
Aber dieser Schuh war groß, schwarz, säuberlich poliert und anscheinend kaum getragen. Kein Schuh eines Mantakavaliers, kein Treter eines jugendlichen Lovers.
Was den Landwirt in diesem Moment zu einem Blick nach oben veranlasste, konnte er später nicht mehr genau sagen. Vermutlich war es ein ungewöhnlich geformter Schattenriss, den ihm der nächste Blitz direkt von oben vor die Füße warf.
Tatsache war, dass mehrere Meter über ihm der zweite Schuh baumelte, der sich, von nahem betrachtet, wahrscheinlich als ebenso blank poliert herausstellen würde wie der zu seinen Füßen. Der Unterschied zwischen den beiden bestand nur darin, dass in dem Schuh, der über seinem Kopf hin und her pendelte, ein Fuß steckte, … der an einem Bein hing, … das von einem Rumpf baumelte, … der mit einem Hals verbunden war, … um den eine Schlinge lag, … die irgendwo hoch oben außerhalb von Haspelraths Blickfeld über der Brücke angeknotet war.
Um den Hals lag nicht nur die Schlinge, die ihre groben Fasern tief in die Haut des toten Mannes hinein grub, sondern auch noch eine Schnur mit einem Zettel, wie ein Etikett an einer alten Apothekenflasche.
»AN DEN GALGEN MIT DEN AUTOFAHRERN! Sie gefährden sich, die Umwelt und andere!« stand darauf. Aber das konnte Bauer Haspelrath von unten natürlich nicht erkennen.
Als er es später erfuhr, konnte er selbstverständlich immer noch nicht ahnen, dass Georg Martin Seidler vor seiner Tätigkeit als Dekorationsobjekt an einer Schnellstraßenbrücke ohne Schnellstraße als passionierter Raser und Lichthupenbetätiger die bundesdeutschen Autobahnen und die langsamere Sorte ihrer Benutzer unsicher gemacht hatte. Stattdessen fuhr es ihm durch den Kopf, dass er von Zeit zu Zeit auch schon mal imstande war, die Tachonadel seines Benz so richtig zum Rotieren zu bringen. Wenn man allerdings den Rest des Tages auf einem Trecker Marke Ferguson auf dem Acker herumtuckerte und Furche um Furche zog, dann hatte man sich das aber doch auch mal verdient, oder?
Prolog 3
Kommissar Baldus von der Mordkommission zeichnete nervös das Fugenmuster zwischen den Verbundpflastersteinen mit der rechten Schuhspitze nach. Die Hände hatte er auf dem Rücken gefaltet. Niemand sah, dass seine Finger sich ineinander verkrampften, dass sich die Knöchel weiß färbten. Ein Nicken von Zeit zu Zeit, ein teilnahmsloses »Hm« dann und wann, das war alles, was er in den Sermon der kleinen Dame einfügen konnte, die zu ihm aufblickte und seit nahezu einer Viertelstunde ohne Punkt und Komma auf ihn einredete. Dabei war das, was sie zu sagen hatte, in einige kurze Sätze zu fassen: Sie hatte frühmorgens ihren geliebten Pekinesenrüden Jerry (sie sprach das Schärri aus) an den Bäumen vor dem Kaller Rathaus ausgeführt, und als ihr kleiner Liebling gerade sein Geschäft verrichten wollte, da hatte sie den Körper entdeckt.
Akkurate Kleidung, ein leichtes Sommerjackett, die sandfarbene Hose allerdings so tief hängend, dass gut eine Handbreit des verlängerten Rückens sichtbar war. Der Körper hatte eine nahezu kniende Haltung inne, wobei die Knie mehrere Zentimeter über dem Boden schwebten, da Kopf und Hals grotesk verrenkt und in einen Gemeindemüllkorb gezwängt waren. Das war gut so, denn so blieb Mathilde Neffel der Anblick der zertrümmerten Schädeldecke erspart, die, wie der Gerichtsmediziner später feststellte, einer halbvollen Flasche französischen Rotweins nachgegeben hatte. Was da unten in dem Müllbehälter schwamm … Blut oder Rotwein … Wer konnte das noch genau auseinander halten?
Auf dem Rücken klebte der mittlerweile obligatorische Zettel: »AUF DEN MÜLL MIT DEN BEAMTEN! Sie faulenzen auf unsere Kosten!«
»… un deshalb sare ich ja auch immer: Wer früh aufsteht, der hat mehr vom Leben. Verstehen Se, Herr Kommissar?«
Kommissar Baldus nickte und warf einen Seitenblick auf seinen Gehilfen Zettelmeyer, der unterdessen eifrig mitschrieb. Zeugen musste man reden lassen. Das wusste Baldus. Wer Zeugen das Wort abschnitt, der lief Gefahr, irgendwann seine Laufbahn zu beenden, ohne jemals einem wirklich wichtigen Indiz begegnet zu sein.
Zettelmeyer, persönlich befragt, hätte wahrscheinlich zu verstehen gegeben, dass sein Chef vermutlich ein wirklich wichtiges Indiz nicht einmal erkennen würde, wenn es vor seiner viel zu groß geratenen Nase nackt Purzelbäume schlug und dabei sang: »Mit Indiz geht alles besser!« Seine Meinung über seinen groß gewachsenen, großnasigen Chef ließ zu wünschen übrig. »Er vergöttert Sie!« hatte der Polizeichef gesagt und Baldus seinen Neffen dritten Grades wärmstens ans Herz gelegt. »Er hat gelernt und gelernt, und jetzt, wo er alles weiß, da will er etwas Greifbares, da will er was schaffen, Baldus. Das kriegt er bei Ihnen!« Baldus hatte dem Chef den Wunsch nicht abschlagen können. Und jetzt litt er. Dieser Wurm von Zettelmeyer vergötterte ihn keineswegs.
»… wenn ich damals net auf dem Klassentreffen erschienen wäre, dann hätte ich die Hedwig wahrscheinlich niemals wieder gesehen. Die Hedwig Müller-Schenker meine ich, von der ich Ihnen eben erzählt hab. Dabei wohnt die seit Jahren in Keldenich, un ich hab’ die nie erkannt!«
In diesem Moment rutschte Baldus’ Fußspitze aus der Fuge heraus, schnellte unbeabsichtigt nach vorne und traf mit elementarer Wucht das Hinterteil des teilnahmslos vor sich hinhechelnden Jerry.
Mathilde Neffels voluminöser Brust entrang sich ein spitzer Schrei des Entsetzens. »Sie Rohling! Sie Mistkerl! Ene wehrlose Hund zu treten! Dat hab ich mir gleich jedacht, dat Sie so einer sin, der kleine Hunde tritt! Jenau so einer!« Die Szene schickte sich an, zum Handgemenge auszuarten, als sie begann, mit bloßen Fäusten auf den überraschten Kommissar einzuschlagen. Zwei uniformierte Beamte wurden ihrer jedoch in Sekundenschnelle habhaft und beförderten sie samt ihrem winselnden Hundchen auf die andere Seite des rot-weißen Flatterbandes, das den Tatort abgrenzte.
»Eifel«, zischte Baldus und zurrte seine Krawatte zurecht. Er blickte Zettelmeyer zerknirscht an. »Drei Tote in sieben Tagen, jeder Mord skurriler als der vorhergehende, und nun ein Pekinesenfrauchen mit Schlägerattitüden … Gibt’s denn hier nur Irre?« Seine Äußerung kam zu laut, das umstehende Publikum äußerte heftigsten Protest. Alles brave Bürger der Eifelgemeinde, arg sensibilisiert durch die Untaten der vergangenen Tage, die dieser Gegend zu trauriger Berühmtheit verholfen hatten. Er wünschte sich, er hätte nie die Sonderkommission fernab von Bonn übertragen bekommen, die sich mit dem Kosenamen schmückte, den die Öffentlichkeit dem gesuchten Massenmörder vor ein paar Tagen gegeben hatte: »Der Motzer«.
»Hallo, Kommissar Baldus!« Einem Journalisten war es gelungen, an den Uniformträgern vorbei die Absperrung zu überwinden. »Spricht der Motzer nicht vielen Menschen aus der Seele … Ich meine, jetzt mal abgesehen von den Morden?«
Baldus spürte die kalte Wut in sich aufkeimen.
»Was soll die Frage? Abgesehen davon, dass es sicherlich verdientere Mordopfer gibt als Künstler, Autofahrer oder Beamte … Wo kämen wir denn hin, wenn das hier Schule machen würde? Ihre Frage geht doch absolut an der Sache vorbei! Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder, dem was quer liegt, hingeht und Leute umbringt? Da würden ja Politessen an Parkuhren aufgeknüpft, da würden ja Finanzbeamte durch den Reißwolf gedreht, ganz zu schweigen von dem, was unseren Politikern drohen würde …« Die Umstehenden hatten mehrere Patentrezepte für letztgenannte Klientel parat und bekundeten sie durch Zwischenrufe.
»Da wäre ja jeder von uns … Da wäre ja vielleicht sogar ich längst ein, äh, dings … ein Massenmörder.«
Zettelmeyer schloss die Augen. Vor seinem geistigen Auge erahnte er das, was dann auch am nächsten Tag die Bildzeitung ihren hungrigen Lesern fett als Headline hinwarf: »MOTZER – KOMMISSAR BALDUS: ›AUCH ICH BIN VIELLEICHT EIN MASSENMÖRDER!‹«
Erstes Kapitel
Wer Herbie Feldmann zum ersten Mal sah, der ahnte sofort, dass er hier einen waschechten Spinner vor sich hatte.
Es war keineswegs sein Äußeres, das diesen Schluss nahe legte. Er war klein, mager, hatte allem Anschein nach die Dreißig schon seit ein paar Jahren hinter sich gelassen, trug sein leicht wirres, blondes Haar locker von links nach rechts gescheitelt, war glatt rasiert, und auch wenn seine Haltung nicht eben mit kerzengerade, sondern eher mit krumm wie ein Fragezeichen umschrieben werden konnte, auch wenn seine Kleidung nicht dem aktuellen modischen Chic entsprach, so war er keinesfalls eine auffällige Erscheinung.
Auch sein Benehmen und seine Ausdrucksweise deuteten überhaupt nicht darauf hin, dass es sich bei ihm um einen Spinner handelte. Es gab keinerlei Zuckungen, und er war nicht mit irgendwelchen permanenten Entgleisungen der Gesichtszüge behaftet. Er zeichnete sich weder durch eine für die Nordeifel gestelzt unrheinische Sprache aus, noch brabbelte er ein für Ortsfremde ungepflegt klingendes Hocheifelkauderwelsch. Nein, auch das war es nicht, was den Betrachter stutzen ließ, und was ihm in seiner Heimatstadt Euskirchen den Spitznamen »Spinner« eingebracht hatte.
Es war vielmehr die Tatsache, dass er gerade in diesem Moment, in dem er sich in einem Abteil zweiter Klasse auf der Bahnfahrt von der Kreisstadt Euskirchen in das idyllische mittelalterliche Kurstädtchen Bad Münstereifel, seiner früheren Heimat, unbeobachtet wähnte und aufgeregt mit seinem Gegenüber diskutierte, laut auf ihn einredete und heftig mit den Armen gestikulierte.
Wer ihn in diesem Moment beobachtet hätte, der hätte gewusst, warum Herbie Feldmann ein Spinner war: In diesem Abteil saß er alleine.
Es herrschte hochsommerliche Hitze, und selbst der Fahrtwind, der durch das heruntergeschobene Zugfenster in das Abteil wehte, brachte nur mäßige Abkühlung. Draußen raste die Landschaft des Erfttales vorbei. Auch die Natur litt unter der andauernden Hitze. Bäume, Wiesen, jegliches Gesträuch hatte seine satte grüne Farbe verloren, und alles sah ein bisschen so aus, als sei es zu heiß gewaschen worden.
»Ich sage dir, das ist nur die Hitze!« Herbie Feldmann tippte mit dem Finger mehrmals vehement auf die Titelseite der Bild. Er blickte ernst zum Fenster hinaus, als sei alles gesagt, was zu sagen war. Sein Gegenüber bedachte er mit keinem weiteren Blick. Er wusste ohnehin, wie er aussah. Schließlich hatte er schon eine Reihe von Jahren mit ihm zusammen verbracht. Unfreiwillig zwar, aber irgendwann hatte er sich in sein Schicksal ergeben und akzeptiert, dass da jemand war, der sich stets in seiner Nähe aufhielt. Jemand, den nur er sehen und hören konnte, jemand, der in den ungelegensten Situationen auftauchte, jemand, der ihn mit klugen Ratschlägen nervte und der ihn mit ständigen Nörgeleien oft genug fast in den Wahnsinn trieb.
Wahnsinn … ein gewaltiges Wort.
Idiotie, Schwachsinn, Schizophrenie … Wenn jemand mit so was in Zusammenhang gebracht wurde, dann war es klar: Der hatte sie nicht mehr alle beieinander. Herbie Feldmann hatte tatsächlich eine Phase in seinem Leben gehabt, in der er sie nicht alle beieinander gehabt hatte.
Damals, als seine Mutter gestorben war, vor acht Jahren, … oder waren es neun? Er bemühte sich, so wenig wie möglich über die Ereignisse von damals nachzudenken. Und doch mogelten sie sich immer wieder in sein Gedächtnis hinein.
Damals …, als seine Mutter ihm offenbart hatte, dass sein Vater nicht tot war, wie sie ihn über zwanzig Jahre lang glauben gemacht hatte.
Damals …, als er erfuhr, dass sein Vater einer der reichsten Männer des Kreises Euskirchen war und es all die Jahre fertig gebracht hatte, das kurze Techtelmechtel mit Herbies Mutter und die mittlerweile volljährigen Folgen zu verheimlichen.
Damals …, als er miterlebte, dass seine Mutter begann, eben diesen mittlerweile verwitweten Mann wiederzutreffen, der sie und ihr Kind all die Jahre so schmählich verleugnet hatte.
Damals …, als das Auto der beiden in einer klirrend kalten Frostnacht von den Nöthener Tannen kommend, die Luftlinie talwärts wählte.
Damals …, als er mit einem Schlag Vollwaise wurde und plötzlich ein Millionenerbe vor Augen hatte.
Damals …, als seine Nerven plötzlich zusammenbrachen wie ein dreizehnstöckiges Kartenhaus.
Damals …
Herbie Feldmann blickte immer noch aus dem Zugfenster. In Kreuzweingarten waren zwei Leute zugestiegen. Er hoffte inständig, dass sie nicht die Absicht hatten, sich bei ihm im Abteil niederzulassen. Sein Gegenüber würde keine Gelegenheit auslassen, um ihn von einer Verlegenheit in die nächste zu bringen.
Sein Gegenüber hieß Julius.
Er war Herbie zum ersten Mal begegnet, als er zehn Jahre alt gewesen war. Es musste irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Das Wort Kommunion hing damals in der Luft. Es war, soweit er sich erinnerte, einer jener Samstagabende gewesen, an denen Herbie, frisch gebadet, mit vom Badewasser schrumpeligen Fingern und Zehen, vor dem Fernseher saß und in den Spätfilm reingucken durfte. Er wusste heute weder, in welchem Land der Film gedreht worden war, noch wovon er handelte oder wer darin mitspielte. Den Titel kannte er natürlich erst recht nicht. Nur an eine einzige Figur aus diesem Streifen konnte er sich erinnern: Julius.
Ob dieser Name französisch, englisch oder deutsch ausgesprochen wurde, war ihm ebenfalls völlig entfallen. Julius war ein Adliger, daran erinnerte er sich vage. Julius war groß, fett, stets in feinsten Zwirn gehüllt und hatte, soweit er das damals schon zu beurteilen vermochte, tadellose Manieren. Was Julius zum Ablauf des Films beizutragen hatte, ob er verhaftet wurde, heiratete, ob er von der Schwindsucht dahingerafft wurde oder einen Orden bekam für das, was er getan oder gelassen hatte, davon hatte Herbie keinen blassen Schimmer. Schließlich hatte er Julius damals genauso schnell vergessen wie den kompletten Rest des Films auch.
Es sollten erst viele Jahre vergehen, bevor es zu Julius’ grandioser Auferstehung kam.
Herbies Nervenzusammenbruch blieb natürlich nicht ohne tiefschürfende Folgen. Er kam in psychiatrische Behandlung. Zuerst zu einem Nervenarzt in Euskirchen. Als er einen erneuten Zusammenbruch erlitt, scheute er sich nicht, die Praxis des Arztes, der im übrigen selber seine liebe Not mit einem komplett zerrütteten Nervenkostüm hatte, in Schutt und Asche zu legen. Man verfrachtete Herbie zur Beobachtung in eine Abteilung der psychiatrischen Klinik in Düren, und dort blieb er zwei volle Jahre.
Er erinnerte sich an diese spezielle Nacht, als sei es gestern gewesen. Herbie hatte in seinem Bett gelegen. Um ihn herum die Nacht von Düren, erfüllt mit Schritten, die den Gang entlanghallten, Aufzugtüren, die sich öffneten und schlossen, rauschenden Klospülungen, medizinischen Apparaturen, die piepsten, summten und ratterten. Er konnte einfach nicht einschlafen. Und plötzlich war da ein neues Geräusch. Ein Schnaufen, dicht neben seinem Bett. Erst horchte er ein paar Minuten und ließ seinen Nackenhaaren Zeit, sich panikartig aufzurichten. Dann knipste er seine Nachttischlampe an.
Auf dem Stuhl vor seinem Bett saß Julius, riesenhaft, fett, wie damals, als er ihn zum ersten Mal auf der Mattscheibe gesehen hatte, und schnaufte in seinen Bart. Sein grauer Anzug saß tadellos, seine Weste war zart gemustert und von einer goldenen Uhrkette umspannt, seine Hände ruhten vor seinem Bauch auf dem metallenen Knauf eines schwarz glänzenden Spazierstocks.
Hallo Herbie, sagte er damals in seiner unnachahmlich gelangweilten Stimme. Ich bin ab heute bei dir.
Drohung oder Versprechen? Wie oft hatte Herbie seit damals darüber nachgedacht, den Tag verflucht, an dem Julius ihn heimgesucht hatte, und bei anderen Gelegenheiten dann wieder dankbar geseufzt, dass er sein trostloses Leben nicht alleine führen musste. So schwankte er also seit Jahren zwischen Dank und Wut, und längst war ihm sein massiger Schatten zum Alltag geworden. Er plauderte mit ihm, wenn niemand in der Nähe zu sein schien, und wenn ihn dann doch jemand beobachtete, dann ärgerte ihn das zwar, aber dass Herbie Feldmann, der Spinner, einen neben sich gehen hatte, das wusste in Euskirchen ohnehin jeder.
Der frisch zugestiegene Mann, der soeben nervös zwinkernd einen Blick durch fingerdicke Brillengläser in Herbies Abteil warf und ihn dabei ertappte, dass er von seinem unsichtbaren Mitreisenden in ein Zwiegespräch verwickelt wurde, wusste es allerdings nicht. Er zwinkerte verunsichert noch ein bisschen nervöser und suchte das Weite und eben dort einen anderen freien Platz.
Herbie registrierte das im letzten Moment mit Missfallen.
»Du sollst, verdammt noch mal …«
… mich nicht immer ansprechen, wenn Leute in der Nähe sind. Derselbe Satz seit Jahrzehnten. Julius strich sich durch den dichten Bart und hüstelte trocken. Seine Stimme war näselnd und doch klangvoll und wohl tönend tief.
»Warum tust du es dann immer wieder?«
Verzeihung, ich hatte das Brillenmännlein nicht bemerkt.
»Hattest du wohl.« Herbie schaute wieder ärgerlich aus dem Fenster.
Julius schmunzelte. Er liebte es, ihn zu reizen, wenn Herbie ohnehin schon übellaunig war, dies jedoch energisch abstritt. Heute hatte Herbie einen Grund, übellaunig zu sein.
»Bin nur gespannt, was sie wieder will«, murmelte er und trommelte nervös mit den Fingern auf dem kleinen, nikotingelben Fensterbänkchen herum.
Es klang, als handele es sich diesmal tatsächlich um eine Angelegenheit, die mit äußerster Dringlichkeit behandelt werden muss.
»Das ist doch jedes Mal dasselbe: Erst macht sie totale Panik am Telefon, und wenn wir dann bei ihr sind, dann hat sich das Problem von selbst gelöst, oder es ist irgendeine Lappalie, die sie mühelos selber hätte erledigen können. Beim letzten Mal sollten wir zum Hundefriseur. Ich schüttel mich jetzt noch, wenn ich nur dran denke.« Herbie betrachtete das Pflaster an seinem rechten Mittelfinger, das sich bemühte, eine wesentlich größere, verkrustete Narbe zu verdecken. »Bärbelchen, diese kleine Misttöle. Sie weiß, dass ich das Vieh hasse wie die Pest!«
Vice Versa. Herbies verständnislosen Blick notierend, erklärte Julius: Und umgekehrt.
»Pure Schikane jedenfalls. Ich wüsste nur zu gerne, wie man diesen ominösen Motzer zur Abwechslung mal auf eine verhasste Tante ansetzen könnte. Muss doch möglich sein, so was.«
Womit wir wieder beim Beginn unseres Gesprächs angelangt wären. Motivsuche: Was treibt einen Menschen dazu, mit beispielloser Eiseskälte und satanischer Berechnung den Richter zu mimen und stellvertretend für ganze Berufs- und Gesellschaftsgruppen reihenweise Menschenleben auszurotten? In der Tat eine Frage, zu deren Beantwortung man einen Psychologen hinzuziehen müsste.
»Quatsch. Wie ich gesagt habe: die Hitze.«
Wenn der Fall so liegt, dann sollten wir inständigst darum beten, dass uns noch höhere Temperaturen für die Zukunft erspart bleiben mögen, denn sonst greift demnächst jeder zweite zum Messer und spielt sich zum Henker auf. Julius spöttischer Unterton war unüberhörbar.
Herbie erhob den Zeigefinger. »Nimm den Föhn in Bayern zum Beispiel …«
Julius brummte etwas Unverständliches, was darauf hindeutete, dass das Gespräch für ihn bereits beendet war.
Mit kreischenden Bremsen fuhr der Zug in den Münstereifeler Bahnhof ein. Herbie stieg aus und beschattete seine von der unbarmherzig herab brennenden Sonne geblendeten Augen mit der rechten Hand. Er spürte nicht nur Julius’ Anwesenheit hinter sich, sondern auch den neugierigen Blick des Mannes mit der Brille. Als er sich zu Julius umwandte, begann dieser, sein rotbackiges Gesicht zu allerlei albernen Grimassen zu verziehen, um ihn vor dem Fremden erneut in Verlegenheit zu bringen. Herbie übersah seine Faxen und stapfte in Richtung Stadt.
Herbie ächzte, während Julius frohgemut an seiner Seite ausschritt. Des Öfteren schon hatte letzterer die Vorzüge einer sportlichen Erziehung gepriesen. Wenn der eher bequem veranlagte Herbie aus dem letzten Loch pfiff, dann reichte es bei Julius noch allemal zum kraftvoll geflöteten River Quai Marsch.
Hoch über der Stadt, nach etlichen Kilometern beschwerlichsten Fußwegs, erreichten sie ein prachtvolles Neubaugebiet. Die Behausungen, die auf diesem kargen und windzerklüfteten Berghang entstanden waren, der als »Windhecke« bekannt war, bemühten sich, auch nach außen zu präsentieren, dass sie auf einem der kostspieligsten Flecken des Kreises Euskirchen erbaut worden waren. Keine großen Parkanlagen, keine schützenden Buchenhecken und Ahorne, lieber dicht an der Straße, und immer zeigen, was man hat! Wer hier wohnte, dem rieselte bei dem Wort Grundstückspreise kein kalter Schauer den Rücken hinunter.
Hier oben wohnte, oder vielmehr residierte, oder besser noch hielt Tante Hetti Hof.
Die breite, in Naturstein verlegte Einfahrt diente nicht nur der Zufahrt zu der riesigen Doppelgarage, sondern lud auch eine Vielzahl von Fahrzeugen zum ungestraften Parken während der Audienz ein. Bridge am Montag, Teegesellschaft am Dienstag, Pudelfrauchentreff am Mittwoch, nochmals Bridge am Freitag und am Wochenende ganze Konvois, die zu jahreszeitlich und saisonbedingt jeweils wechselnden Anlässen einrauschten. Während sich solcherlei Zusammenkünfte vornehmlich in den Nachmittags- oder Abendstunden abspielten, fand sich zu den übrigen Tageszeiten allerdings stets noch ein vereinzelter Friseur, eine sporadisch auftauchende Masseurin oder auch die Dame von der Kosmetikfirma, die hereinschneite. Nur der lange Donnerstag war heilig und wurde zumeist in Düsseldorf zelebriert.
Während Herbie achtlos über die hochdruckgesäuberten Steinplatten zur Haustür stapfte, ließ Julius anerkennend das Auge über Tante Hettis Anwesen streifen und murmelte, wie stets, ein paar anerkennende Worte in seinen grauen Bart hinein. Er schätzte den Geschmack der alten Dame.
Das erlesene Äußere des Hauses wurde durch seine exquisite Innenausstattung noch übertroffen. Inmitten einer weitläufigen Eingangshalle, die mit kostbaren Gobelins und altenglischen Kirschholzmöbeln verschwenderisch ausgestattet war, baute sich die kleingewachsene, zierliche Henriette Hellbrecht, von ihren Untergebenen, zu denen sich auch Herbie zählte, kurz Hetti genannt, vor den beiden auf und bedeutete ihrem Neffen entnervt, dass es ja nun auch langsam Zeit sei. Dabei trommelte sie nervös mit den Fingerspitzen auf dem Knauf ihrer echt orientalischen Krücke herum, an die sie sich seit ihrer Hüftoperation vor zwei Jahren gewöhnt hatte, und die ihr nun als Dekorationsstück diente, das von Fall zu Fall je nachdem ihre mitleidheischende oder ihre dominante Ausstrahlung unterstrich.
Als sie auf das melodische Läuten der Türglocke im Big-Ben-Stil geöffnet hatte, waren zwischen dem Verklingen des ersten Tones und dem schwungvollen Aufreißen der Tür nur Bruchteile von Sekunden verstrichen. Gerade so, als sei sie ungeduldig hinter der Tür auf und ab getigert. Damit verhielt es sich jedes Mal so, wenn Herbie wieder hierher zitiert worden war, und er ertappte sich manchmal dabei, dass er den kostbaren Teppich auf besonderen Verschleiß an den Stellen beäugte, auf denen Tante Hetti vermutlich ihre rastlosen Runden drehte.
»Ich kann nichts dafür, dass der Zug …«, begann er.
»Ein Glas Wasser?« Sie hatte bereits auf den Absätzen ihrer zierlichen Schühchen kehrtgemacht, fuchtelte mit dem Stock und eilte voran in den Living Room.
»Warum nicht, ich habe einen ganz trockenen …«
»Ach Unsinn … Eine Tasse Tee löscht viel besser den Durst!« korrigierte sie sich, wobei ihre Stimme bereits einige Kilometer weiter von vorne zu kommen schien.
Herbie ließ sich im Wohnzimmer unaufgefordert in einen der riesenhaften brokatbespannten Sessel fallen, die vor dem obligatorischen Kamin samt dazugehörigem Stillleben gruppiert waren und von denen man beinahe bis zur Kniekehle verschluckt wurde. Hinterher hatte man jedes Mal Mühe, wieder hochzukommen. Nur einmal war er pfeilgerade wieder in die Höhe geschossen, als ihm schmerzhaft bewusst geworden war, dass er auf Bärbelchen, einer lavendelfarben getönten Pudeldame – seiner Erzfeindin – Platz genommen hatte.
»Wir nehmen den Tee im Garten!« Tante Hettis Stimme schien sich wieder zu nähern.
Verärgert kämpfte er sich wieder aus dem stoffgewordenen Menschenfresser hervor und trottete durch die riesige Panoramaglasfront ins Freie. Julius, der die ganze Zeit über still geblieben war, folgte in gemessenem Abstand, ließ hier einen Kennerblick über einen alten Stich streifen, streichelte dort den Kopf eines Porzellanhundes und fühlte sich sichtlich wohl. Gespannt beobachtete Herbie, der sich bereits niedergelassen hatte, wie Julius sich anschickte, auf einem der zierlichen Gartenstühlchen Platz zu nehmen, die auch auf der Terrasse einen Hauch von Luxus wehen ließen. Julius war nicht aus Fleisch und Blut, er konnte nicht stürzen oder sich verletzen, und er konnte erst recht keinen realen Gegenstand bewegen, geschweige denn einen weißlackierten Peddigrohrsessel unter seinem monströsen Hinterteil zusammenfalten, aber dennoch reagierte Herbie aufmerksam. Seiner Tante, die von hinten zu ihnen stieß, ein Silbertablett balancierend, wobei die Krücke munter in der Armbeuge baumelte, entging sein Blick nicht. Sie schaute zu dem leeren Stuhl, sah fragend Herbie an, der erschrocken zu ihr aufblickte, und augenblicklich kräuselten sich Sorgenfalten auf ihrer Stirn. »Herbert! Es ist doch nicht etwa …?«
Er winkte eilig ab: »Nein, nein, nicht, was du denkst, Tante. Keine Sorge, wirklich nicht! Das ist vorbei! Du weißt das doch.«
Hetti seufzte erleichtert und schenkte Tee ein. »Für einen Moment glaubte ich, du würdest wieder mit diesem Unsinn anfangen … mit diesem Ruprecht, oder wie der fette Kerl hieß.« Sie rührte klimpernd in ihrer Tasse. Julius’ Miene verfinsterte sich, und nun war es an Herbie, ein breites Grinsen aufzusetzen.
Seit Tante Hetti als Schwester seines Vaters und als einzige nähere Verwandte vor vielen Jahren zu seinem Vormund und Vermögensverwalter bestellt worden war, hatte sie versucht, ihm den Glauben an den allgegenwärtigen Begleiter auszutreiben. Dabei ging es ihr viel weniger um sein geistiges Wohlbefinden als vielmehr um den eigenen Leumund, denn einen Spinner in der Verwandtschaft zu haben war zwar heutzutage keine Schande mehr, aber eine rechte Zierde war ein verwirrter Neffe nun auch eben nicht. Irgendwann hatte Herbie dann seinen Julius verleugnet. Er war es ganz einfach satt, die fortwährenden Predigten und Exorzismen über sich ergehen zu lassen. Darüber hinaus stellte er fest, dass sich von diesem Tag an auch in monetärer Hinsicht einiges zum Besseren wendete. Er musste seiner Finanzverwalterin zwar immer noch jeden Pfennig einzeln aus den Rippen leiern, aber immerhin reichte es nun für die kleine Wohnung in Euskirchen und für die Bahncard, auch ohne dass er sich mit Gelegenheitsjobs etwas dazuverdienen musste.
Er beschloss, seiner Tante bei der Formulierung ihres hochdringlichen Auftrags ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Das konnte bedeuten, dass ihm ein halbstündiges Vorgeplänkel und zahllose peinliche Verhörfragen in Sachen Finanzhaushalt und Lebensführung erspart blieben. Es konnte aber auch bedeuten, dass Tante Hetti sofort die Schotten dichtmachte und beschloss, ihn schmoren zu lassen.
Heute schien sie leutseliger Laune zu sein. Als er sich munter auf die Schenkel klopfte und forsch fragte: »Na, was gibt’s denn so Wichtiges, Tantchen?« erschlug sie ebenso munter eine Wespe, die sich am Rohrzucker verlustierte, und sagte: »Du musst für mich zum Flughafen fahren, Herbertchen.«
»Zum Flughafen?«
»Morgen früh. Du musst dort jemanden abholen. Sie macht ein oder zwei Wochen Ferien bei mir, und ich wäre froh, wenn du dich in dieser Zeit ein wenig um sie kümmern könntest. Du weisst, dass mir meine Termine …«