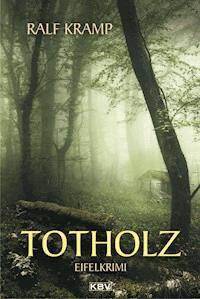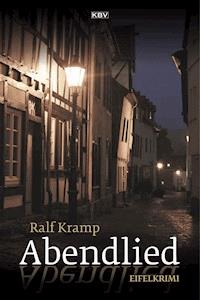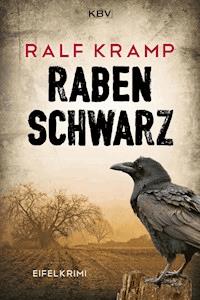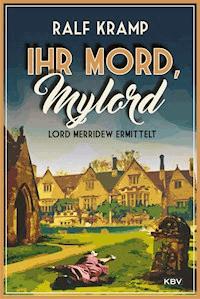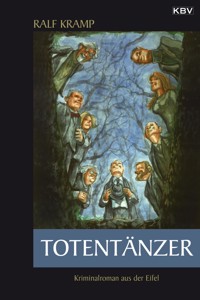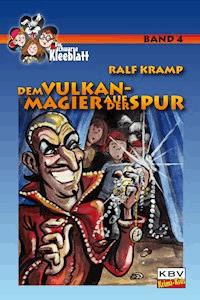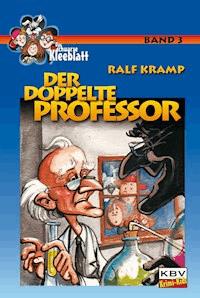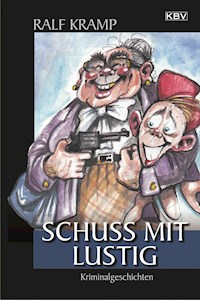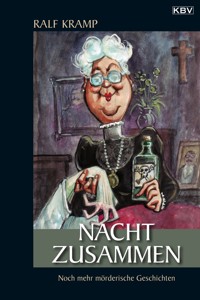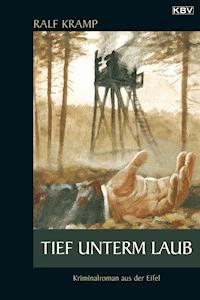
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein alter Mann wird überfahren. Nur ein Unfall? Kurze Zeit später kommt sein ehemaliger Zivi beim Sturz aus dem Fenster seiner Dachwohnung ums Leben. Selbstmord? Laurentius Bock, Besitzer eines kleinen Copy-Shops, wird unfreiwillig in den rätselhaften Fall hineingezogen. Zusammen mit Lindy, der Freundin des jungen Mannes, versucht er, die Hintergründe der seltsamen Geschehnisse aufzudecken. Die Spur führt sie zu einem Antiquitätenhändler und damit von Köln in ein kleines Eifeldorf. Doch hier sind sie offensichtlich nicht willkommen. Bald schon finden sie heraus, dass auch in der Eifel die Welt nicht mehr in Ordnung ist, und das schon seit vielen, vielen Jahren...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Kramp
Tief unterm Laub
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Tief unterm Laub
Spinner
Rabenschwarz
Der neunte Tod
Still und starr
… denn sterben muss David!
Kurz vor Schluss
Malerische Morde
Hart an der Grenze
Ein Viertelpfund Mord
Ein kaltes Haus
Totentänzer
Nacht zusammen
Stimmen im Wald
Voll ins Schwarze
Die Liste seiner anderen Titel (keine Kriminalliteratur) finden Sie unter: http://eyfalia.kbv-verlag.de
Ralf Kramp, geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt heute in Flesten in der Vulkaneifel. Für sein Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er den Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen mehrere Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann und seinen unsichtbaren Begleiter Julius, die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit 1998 veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel »Blutspur« Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen hartgesottene Krimifans ihr angelesenes »Fachwissen« endlich bei einer Live-Mördersuche in die Tat umsetzen können. Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen.
Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 26.000 Bänden, dem »Café Sherlock« und der Buchhandlung »Lesezeichen«. www.ralfkramp.de · www.kriminalhaus.de
Ralf Kramp
Tief unterm Laub
1. Auflage April 19962. Auflage September 19963. Auflage März 19974. Auflage Oktober 19995. Auflage Oktober 20026. Auflage März 20057. Auflage November 20068. Auflage Januar 20109. Auflage Dezember 2011
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Satz: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-934638-11-2
E-Book-ISBN 978-3-95441-056-9
Für Wölkchen,die derweil auf dem Sofa lag und schlief.
1. Kapitel
Die Hand tastete auf der sanft gewellten Fläche der Bettdecke umher. Sie strich über die Dünung des weißen Lakens, wie die Hand eines Ertrinkenden durch die Wellen fährt, auf der Suche nach einem Halt.
Eine alte, knochige Hand war es, die Hand eines alten Mannes, der im Begriff war zu ertrinken.
Er trieb dahin in einer See der Schwerelosigkeit.
Medikamente.
Immer wieder tauchte er unter, und bald, schon sehr bald, würde er ertrinken.
Eine zweite Hand legte sich auf die seine, und er hielt mit den ruhelosen, fahrigen Bewegungen inne. So fest er es noch vermochte, umklammerte er diesen Halt, die Hand des jungen Mannes, der zu seiner Seite am Krankenbett saß.
Das Zittern der knöchernen Finger ließ langsam nach. Nur ein Zucken durchlief hin und wieder die Hand, ein letztes Aufbäumen der Nerven.
»Ist gut«, sagte der junge Mann besänftigend. »Sie sind nicht alleine. Alles okay?« Seine Stimme war ein wenig heiser vor Aufregung. »Alles okay?«
Scheiße, nichts ist okay! dachte er verbittert. Hier lag ein alter Mann vor ihm in einem grau-weißen Krankenhausbett in einem grau-weißen Zimmer des Kölner Severins-Krankenhauses und wartete auf das Ende. Er schauderte. Wie jämmerlich der Tod doch war! Keine Spur von Erhabenheit oder Würde, nur ein von Schmerzen geschundener Körper, ein schwindender Geist.
Das sonst so akkurat gescheitelte Haar hing dem Sterbenden wirr und strähnig in die Stirn. Seine Augen waren tief in ihre Höhlen gesunken und warfen nervöse Blicke umher. Der Mund, zahnlos und eingefallen, formte fortwährend lautlose Silben. Eingefallene Wangen, Knochen wie mit Leder überzogen, ein unrasiertes Kinn in einem schweißnassen Gesicht.
Und dann die Hände!
Diese zittrigen, sehnigen Hände!
Die Linke begann aufgeregt hin- und herzufahren. Ein kehliger Laut quälte sich zwischen den schmalen Lippen hervor.
»… gesehen?«, ächzte er.
»Alles okay?«, wollte sein Besucher gerade erwidern, um ihm zu verstehen zu geben, dass es ratsam war, nicht zu reden, da ergriff der Alte mit beiden Händen die seine und packte viel fester zu, als es ihm noch zuzutrauen war.
»… gesehen?«, zischte er und riss die müden Augen weit auf. »Er war da.« Rasch fuhr seine Zunge über die trockenen Lippen. »… hab ihn gesehen.«
»Schon gut, Herr Menzler«, beeilte sich der junge Mann zu sagen. »Alles okay?«
»… Bauers … Bauersfrau! … gesehen! Hör zu! Du musst ihn finden … finden, hörst du?« Die Augen schlossen sich, und ein Zucken um die Mundwinkel zeigte, dass der Schmerz sich durch die Betäubung kämpfte.
»… Bauersfrau …«, presste er hervor.
Wilde Phantasien schienen sich im Kopf des Alten im Kreis zu drehen, und immer wieder murmelte er, dass irgendetwas oder jemand gefunden werden müsse.
»… finden.«
Jetzt deutete seine zitternde Linke ungelenk auf die Schublade des klobigen, fahrbaren Nachttisches. Ein stummer Wink, den der junge Mann jedoch sofort verstand. Er öffnete die Schublade und tastete im Inneren herum. Ein paar Utensilien waren darin, die Menzler anscheinend bei seiner Einlieferung nach dem Unfall bei sich getragen hatte. Eine Armbanduhr, seine Brille und eine Brieftasche.
»Die Brille?«, fragte er, erinnerte sich aber sofort wieder daran, dass dies Herrn Menzlers Lesebrille war. Und die brauchte er in diesem Moment wirklich nicht.
Menzler winkte ab.
»Die Brieftasche?«
Ein Nicken. Menzler öffnete die Augen. Aufgeregt beobachtete er, wie der junge Mann die Brieftasche nahm und öffnete. Schon beim Aufklappen rutschte etwas heraus. Es war eine Fotografie. Eine alte Schwarzweißaufnahme, vergilbt und stellenweise bis zur Unkenntlichkeit zerknittert.
Ein junges Paar war darauf zu erkennen. Ein freundliches Arm-in-Arm-Bild, das anscheinend vor dem Krieg aufgenommen worden war.
»Nimm das«, hauchte Menzler. »Nimm du das.«
Er öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, als ein neuer Schmerz ihn aufstöhnen ließ. Seine Brust bäumte sich auf, und seine Finger gruben sich in den Bettbezug.
Der junge Mann zögerte einen Augenblick und drückte dann rasch den Knopf, der die Krankenschwester rief. Es wurde ernst.
Während er wenige Minuten später auf dem grauweißen Flur des Krankenhauses stand und gedankenverloren die Fotografie in den Händen hin und her wendete, ahnte er bereits, dass er Menzler in diesem Moment zum letzten Male lebend zu Gesicht bekommen hatte. Von nun an würde er nur noch in seiner Erinnerung lebendig sein.
Als eine Viertelstunde später auch der Stationsarzt wieder aus dem Krankenzimmer herauskam und ihm mit ruhiger Stimme erklärte, es sei nun vorbei, Herr Menzler sei tot, da wusste er es schon längst.
»Sind Sie ein Verwandter?«, fragte der Arzt. Schattschneider verneinte. »Herr Menzler hatte keine Angehörigen. Er war ein einsamer alter Mann.«
Das war auch der Grund gewesen, weshalb er, Thomas Schattschneider, Menzler auch nach seiner Zeit als Zivi beim Mobilen sozialen Hilfsdienst Köln 1 weiterhin besucht hatte. Irgendwie hatte er es immer geschafft, sich neben dem Geschichtsstudium und den Nebenbeijobs noch Zeit für ihn zu nehmen, denn ihm lag etwas an dem alten Mann. Menzler hatte ihn mit seinen Erzählungen, seiner klugen Art und seiner herzlichen Ausstrahlung vom ersten Tag an gefangengenommen. Nichts von all den kleinen Schikanen, dem Altersstarrsinn und den nörgeligen Extrawünschen, die alte Menschen oft für ihre Helfer bereithielten.
Warum nur war das alles so plötzlich zu Ende?
Die Polizei hatte ihn angerufen. Anscheinend hatte Menzler seine Nummer irgendwo bei sich getragen.
Der alte Mann war einfach losgelaufen! Auf der vierspurigen Nord-Süd-Fahrt war er einfach durch einen Pulk wartender Fußgänger bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen. So schnell und so entschlossen, dass niemand damit rechnete und rechtzeitig bremsen konnte. Und das bei seiner übertriebenen Vorsicht und seiner angeborenen Behutsamkeit! Zwei Autos erfassten ihn nahezu gleichzeitig. Ein Wunder, dass er nicht sofort tot gewesen war.
Reifenquietschen – Polizei – Telefonnummer – Krankenhaus.
Alles ging ihm wieder und wieder durch den Kopf. Und irgendwie hatte er das Gefühl, es gäbe da noch etwas anderes, weshalb Menzler ihn noch kurz vor seinem Tod hatte sehen wollen. In seiner Tasche ertastete er die alte Fotografie, und als er später das Krankenhaus verließ, da musste er fortwährend daran denken, wie viel Menzler daran gelegen hatte, dass er das Bild an sich nahm, und dass er ihn wieder und wieder aufgefordert hatte, etwas Bestimmtes zu finden. Sollte es das Paar auf dem Foto sein, das er finden musste? Waren es Verwandte? Aber warum hatte Menzler ihm dann immer erzählt, er habe keine lebenden Angehörigen mehr?
Es war dunkel geworden in Köln. Seine Schritte hatten ihn, ohne dass er es gemerkt hatte, zu der Stelle geführt, an der am Nachmittag die Tragödie ihren Anfang genommen hatte. Zu der Stelle, an der ein vernünftiger alter Mann plötzlich alle Vorsicht abgelegt und sich aus heiterem Himmel vor die nächste Autokolonne des Kölner Feierabendverkehrs gestürzt hatte.
Als er den Fußgängerüberweg erreichte, den am Nachmittag auch Gottfried Menzler benutzt hatte, hatte sich der Verkehr gelegt.
Vom Unfall selber war nichts mehr zu sehen. Die Scherben der Autoscheinwerfer hatte man aufgekehrt, und wenn es da Blutflecke gab, dann schluckte sie die Dunkelheit. Thomas Schattschneider sah sich um, holte eine Zigarette hervor und zündete sie an. Er war kein Kettenraucher, aber seit er das Krankenzimmer verlassen hatte, hatte er sich eine nach der anderen angesteckt, und die Schachtel war beinahe leer. Die ganze Geschichte ging ihm mächtig an die Nieren.
Er blies den Qualm in die Abendluft und sah sich um.
Ein Möbelhaus, eine Blumenhandlung, nicht gerade die Straße Kölns, auf der man einen Einkaufsbummel machte, aber eben die Straße, die Menzler immer kreuzte, wenn er von einem Rheinuferspaziergang nach Hause ging.
Thomas Schattschneider hatte ihn oft begleitet und dabei seinen unzähligen Geschichten zugehört. Immer waren sie hier vorbeigekommen, aber nie war Menzler auf die Idee gekommen, bei Rot die Straße zu überqueren. Nicht einmal, wenn sie frei war. »Man muss es den Kindern ja nicht auch noch vormachen«, hatte er immer gesagt und dabei den Zeigefinger gehoben, wie er es früher einmal getan haben musste, als er noch Dorfschullehrer in der Eifel gewesen war.
Warum hatte der Herr Lehrer heute den Kindern so etwas Schreckliches vorgemacht?
In diesem Moment streifte sein Blick etwas, das ihn zusammenfahren ließ. Er stand vor dem Antiquitätengeschäft, an dem sie schon so oft vorbeigegangen waren.
Eine dezente Beleuchtung im Inneren des verschlossenen Ladens und das fahle Licht der Leuchtreklame erhellten die Schaufensterdekoration. Zwischen allerlei kostbaren Silberund Glasgefäßen, Kerzenleuchtern und Porzellanfiguren stand etwas in der Auslage, das ihn magisch anzog.
Ein überdimensionales Ölgemälde im üppigen Barockrahmen nahm beinahe ein Drittel des Schaufensters ein. In freundlichen Farben, mit kraftvollen Pinselstrichen auf die Leinwand gebracht, zeigte es eine blauäugige Bäuerin mit rosigen Wangen und einem blitzsauberen Lachen vor einem Hintergrund, in dem eine Mittelgebirgslandschaft in Rot-, Gelb- und Brauntönen förmlich zu ertrinken schien. Ein Schinken, wie er in der Mitte des Jahrhunderts gerne gesehen wurde. Kitsch, der niemals unter die Kategorie »entartet« gefallen war.
Eine Bauersfrau!
Er sah wieder Menzlers verkrustete Mundwinkel vor sich, durch die er mühsam dieses Wort hervorpresste: »Bauersfrau«.
Schattschneider warf seine halbgerauchte Zigarette fort und trat näher an das Schaufenster heran.
Ein Zettel, am unteren Rand des Bilderrahmens befestigt, bestätigte seine Einschätzung: Hans-Paul Roggenbeck, Eifelherbst, 1931. Und darüber war ein kleiner Zettel aus rotem Karton angeklebt: Verkauft.
Er atmete tief durch. Irgendetwas verursachte ein beklemmendes Gefühl in seiner Brust. Er konnte nicht sagen, was es war. Schön, ein Bild, das Menzler offensichtlich gesehen hatte, war verkauft worden. So weit, so gut. Aber das war wohl kaum ein Grund, sich vor das nächste Auto zu stürzen, oder?
Was zum Teufel war hier passiert? Und was sollte er unbedingt »finden«?
Er kramte das Foto aus der Innentasche seines Mantels, und als er es im Schein der Schaufensterbeleuchtung noch einmal genau betrachtete, da entdeckte er plötzlich etwas, was er zuvor anscheinend in seiner Verwirrung übersehen hatte: Der junge Mann auf der Fotografie war Menzler! Jünger, dichtes Haar, ein strahlendes Lachen auf den vollen Lippen, aber bei genauem Hinsehen deutlich zu erkennen.
Natürlich, es lag ja auch nahe! Aber … er verwarf den folgenden Gedanken sofort wieder. Die junge Frau im geblümten Sommerkleid an seiner Seite hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der drallen Dame in Öl. Sie hatte im Gegensatz zur flachsblonden Bäuerin dunkles, langes Haar, das zum Zopf gebunden war. Mutlos steckte er das Bild wieder in die Manteltasche.
Was war so wichtig, dass Menzler es ihm unbedingt noch hatte sagen wollen?
Er steckte seine letzte Zigarette an und schlenderte zurück, an der Schaufensterfront vorbei, und er wusste, dass Menzler denselben Weg genommen hatte. Als er die Fußgängerampel wieder erreicht hatte, sprang sie auf Grün um, und er dachte daran, dass sie am Nachmittag vor dem Unfall wahrscheinlich gerade auf Rot umgesprungen war. Menzler hatte es offensichtlich nicht bemerkt.
Vielleicht … Ein Gedanke formte sich in seinem Kopf. Vielleicht hatte er ja versucht, jemanden einzuholen, den er im Antiquitätenladen entdeckt hatte und der noch bei Grün über die Ampel geeilt war. Vielleicht … vielleicht war es aber auch ganz anders, und er beschloss, am nächsten Tag dem Geschäft an der Nord-Süd-Fahrt einen Besuch abzustatten.
Kurz bevor die grüne Ampelleuchte erlosch, überquerte er die Straße, obwohl dies nicht sein Weg war.
Vielleicht einfach nur, weil er das unbestimmte Gefühl hatte, etwas ändern zu müssen, was nicht mehr zu ändern war.
2. Kapitel
Laurentius Bock pfiff die feierlichen Takte eines Brandenburgischen Konzerts von Bach halblaut vor sich hin. Er beugte seine spitze Nase tief hinunter zum Schreibtisch, bis er beinahe auf das Schriftstück stieß, das seine Augen hinter der Nickelbrille eifrig studierten. Angespannt legte der großgewachsene, schlanke Mann die hohe Stirn in Falten und spitzte den schmallippigen Mund. Ein Beobachter dieser Szenerie hätte seinen Verstand förmlich rattern hören können, aber das einzige, was ratterte, war eine voluminöse, alte Druckmaschine, die soeben das erste fertiggedruckte Papier ausgespuckt hatte, das Bock gerade intensiv nach den letzten Fehlern durchsuchte.
Aber er fand keine mehr. Der Text war reif durch die Maschine zu laufen, und der Moment, vor dem er sich jedesmal ein wenig fürchtete, war vorbei. Es war der Moment, in dem die Vorbereitungsphase abgeschlossen war, die langwierige Suche nach dem passenden Schriftbild, dem Papier und tausend anderen Dingen, die ein Buch am Ende zu einem Schmuckstück machen konnten. Wieder und wieder hatte er den Text nach Fehlern durchforstet, und immer noch fand er vereinzelte Exemplare im Dickicht der Buchstaben und brachte sie zur Strecke.
Laurentius Bock blies geräuschvoll die Luft aus den Backen, als er sich auf einen alten, abgewetzten Drehstuhl sinken ließ und sich vor der tosenden Geräuschkulisse der Maschine einen Rest Kaffee einschüttete. Er verzog das Gesicht. Kalt! Natürlich. Er hatte ja schon Stunden hier zugebracht.
Aber es hatte sich gelohnt, und ein sensationelles Werk wie Net nur Halve Hahn … eine Sammlung kölscher Kochrezepte, war schon bald bereit zum Start in die Bestsellerlisten. Er schmunzelte. Der Inhalt war ihm mehr oder weniger einerlei. Hauptsache, der Druck stimmte, der Kunde war zufrieden mit dem äußeren Erscheinungsbild seines Machwerkes, und – vor allen Dingen – er selbst war damit zufrieden. Wenn ihm das gesamte Werk, die Komposition aus Form und Farben, gelungen war, dann war das, was folgte, das Aufpressen der Farbe auf die voluminösen Papierbögen, so etwas wie eine Geburt. Hier erblickte etwas das Licht der Welt, an dem er lange gearbeitet, das er Tag und Nacht mit sich herumgetragen hatte. Wenn er drucken konnte, war Laurenz Bock ein glücklicher Mensch.
Seine Kunden allerdings konnte sich Bock, dessen eigentlicher Vorname Laurentius schon im zarten Alter von vier Jahren, zur Zeit seiner Einbürgerung in Köln, dem volkstümlicheren Laurenz hatte weichen müssen, schon lange nicht mehr aussuchen. Seine Eltern hatten damals das Haus auf der Luxemburger Straße geerbt und waren aus Bremen hierher gezogen. In eine unsichere Zukunft, wie sich nach der Gründung der Druckerei im Erdgeschoss des Hauses aus der Jahrhundertwende herausstellte. Die Kundschaft hatte ihnen nie die Tür eingerannt. Und Vater Bock pflegte seinem Zögling damals, nach einem langen, arbeitsamen Tag, wenn er versuchte, seine Hände mit Sandseife und einer Wurzelbürste von der Druckerschwärze zu reinigen, die doch schon viel zu tief saß, immer wieder zu sagen, dass es zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel sei, was er verdiene.
Eines Tages hatte es dann doch zum Sterben gereicht, und Bock verlor seine Eltern kurz nacheinander.
Die einzige Chance, das Geschäft zu retten, hatte er vor knapp zwanzig Jahren ergriffen, als er die Menge der Druckgerätschaften auf ein Minimum reduzierte und in das Hinterzimmer verbannte und im vorderen Teil des Ladenlokals ein paar Fotokopiergeräte aufstellte. Wartung und Reparaturen an den Geräten waren nicht eben billig, und die Universität lag zu weit fort, als dass man das Geschäft mit seinen großen Schaufenstern als überlaufen hätte bezeichnen können, aber die damalige Maßnahme brachte ein paar zusätzliche Mark ein, die Bock bestens gebrauchen konnte.
Im Moment sparte er, um sich einen Farbkopierer leisten zu können, denn der gehörte heutzutage in jeden Copy-Shop.
Und von Zeit zu Zeit verirrte sich ein Kunde in seinen Laden, der sich mit dem Gedanken trug, einen Katalog oder eine Broschüre drucken zu lassen, und in ganz seltenen Fällen war es auch schon mal ein Buch.
Dies war ein Buch. Sein Verfasser schien kein Anwärter auf den Nobelpreis für Literatur zu sein, aber immerhin gestattete es die Arbeit an seinem Manuskript, wieder einmal einzutauchen in die Atmosphäre von Papierduft und Druckerschwärzegeruch.
Laurenz Bock spülte den letzten Schluck kalten Kaffee herunter und schüttelte sich, als durch die Tür das Läuten der Ladenglocke ertönte. Mit einem Blick auf die Druckmaschine überzeugte er sich, dass alles ordnungsgemäß lief, und ging dann in den Kopierraum.
Ein junger Mann stand an einem Kopierer und zog bei Bocks Eintreten rasch seine Hände davon zurück.
»Guten Tag«, sagte Bock. »Kann ich etwas für Sie tun?«
»Äh …« Der junge Mann schien sich nicht ganz schlüssig zu sein. Er war ungefähr Mitte Zwanzig, großgewachsen und hatte einen straffen Seitenscheitel. Bock war sich beinahe sicher, dass er hin und wieder schon einmal etwas hatte kopieren lassen.
»Ich wollte mich eigentlich nur mal umsehen.«
Bock war leicht irritiert. Was gab es da schon großartig umzusehen? Unwillkürlich ließ er den Blick, genau wie der junge Mann, durch den Laden schweifen. Vier Kopierer, von denen einer in der nächsten Woche unbedingt gereinigt werden musste, ein paar Poster und Schaustücke an den Wänden … Sein Kopiercenter war ordentlich, aber nicht gerade üppig eingerichtet.
Peinlich berührt stellte er fest, dass er vor lauter Druckarbeit verbummelt hatte, die völlig verdreckten Schaufenster zu putzen, vor denen gerade ein dicker, bärtiger Herr mit Fliege stand und interessiert die Auslage betrachtete.
»Sie drucken doch?« sagte der junge Mann, als sei das eine außergewöhnliche Begabung oder ein außergewöhnliches Vergehen. Er machte einen Schritt auf Bock zu, der überrascht bejahte.
»Können Sie auch Einladungskarten herstellen, ich meine, haben Sie da vielleicht irgendwie … na, irgendeine Art Katalog oder so?«
»Selbstverständlich, ich hole ihn nur rasch.«
Bock kehrte ihm, immer noch verwirrt über das seltsame Auftreten seines Kunden, den Rücken zu und wechselte wieder in die Geräuschkulisse des Druckraumes hinüber.
Als er einen Ordner mit Entwürfen aus einem Regal herauskramte, versuchte er die ganze Zeit, sich daran zu erinnern, wann der junge Mann schon einmal bei ihm gewesen war. Es wollte ihm nicht einfallen. Verärgert über seine Vergesslichkeit, blies er eine Staubschicht von der Sammelmappe, bevor er die Tür zum Laden wieder öffnete.
Er blieb im Türrahmen stehen und sah sich verdutzt im Geschäft um. Es war leer. Keine Spur von dem merkwürdigen Besucher. Laurenz Bock zog die Stirn kraus. Er trat ans Schaufenster und blickte die Straße nach beiden Seiten hinunter, aber sein Kunde war bereits zwischen den vorbeigehenden Fußgängern verschwunden.
Schließlich wandte er sich kopfschüttelnd um, verstaute die Mappe wieder im Regal und ging zu der Druckmaschine. In einer Stunde hatte er Feierabend, und er hatte keine große Lust, länger über solche Merkwürdigkeiten nachzudenken.
Da der Druckvorgang nun ohne sein Zutun reibungslos abzulaufen schien, überlegte er einen Moment, ob nicht Zeit genug war, die Schaufenster zu reinigen, aber diesen Gedanken verwarf er schnell wieder. Er musste heute pünktlich abschließen, da er bereits um sieben Uhr in der Balthasarstraße erwartet wurde. Walter Lembach, sein Vetter zweiten Grades, war der einzige Verwandte, den er im Rheinland hatte. Und Walter feierte an diesem Abend seinen fünfzigsten Geburtstag »im trauten Familienkreise« – das bedeutete Margas unbeschreiblich langweilige Sippschaft und Walters ebenso laute wie gewöhnliche Kegelbrüder. Laurenz war an diesem Abend nicht nach Feiern – er hätte sich viel lieber der Fertigstellung seiner Kölner Koch-Fibel gewidmet -, aber Walter machte jedes Mal ein Mordstheater, wenn Laurenz mal wieder eine Verabredung absagte. Um sich also nicht erneut den Zorn seines Vetters zuzuziehen, musste er spätestens um halb acht auf der Matte stehen.
Bis zum Geschäftsschluss verirrten sich noch ganze zwei Kunden in seine Räumlichkeiten, denen Bock beim besten Willen nicht viel Freundlichkeit entgegenbringen konnte. Es handelte sich beide Male um ein paar Fotokopien. Zuerst kam ein hässliches junges Mädchen, das mit einer Akne gesegnet war, die jeden Betrachter erschauern ließ. Sie besuchte sein Geschäft nahezu jede Woche, um sich irgendwelche Kopien aus Schulbüchern zu machen. Offensichtlich eine Streberin, die ihre Schulhefte durch diese Illustrationen aufzuwerten gedachte. Als Nächstes erschien ein älterer Herr im Laden, der ein paar Zeitungsartikel für seinen Karnevalsverein kopieren wollte.
Als der Mann, der einen unangenehmen Schweißgeruch ausströmte, allerdings das Blatt mit den aufgeklebten Artikeln in den Kopierer einlegen wollte, zog er etwas unter der Deckklappe des Gerätes hervor, das er Bock sofort überreichte.
»Das lag im Kopierer«, sagte er. »Ist ‘ne Art Brieftasche oder so was.«
Bock betrachtete die kleine Mappe, die wesentlich größer und dicker als eine normale Geldbörse war. »Hat sicher ein Kunde verloren«, murmelte er.
»Mir gehört sie jedenfalls nicht«, erläuterte der Mann, bei dem Bock jetzt große Schweißflecken in der Achselbeuge bemerkte.
Bock legte das Mäppchen auf den Tresen, und als der Kunde sich wenig später entfernt hatte und sich auch der herbe Duft langsam verflüchtigte, öffnete er den Reißverschluss der Mappe und sah nach, ob er im Inneren etwas fand, was auf den Besitzer hindeutete. Ein wenig merkwürdig war es ja schon, so etwas ausgerechnet im Kopierer zu vergessen. Die Mappe war glatt und schmucklos, seines Erachtens auch nicht als Motiv für einen dieser skurrilen Kopierkünstler von der Uni geeignet. Er fand lediglich ein paar Fotografien, eine Packung Marlboro und ein Bic-Feuerzeug. Im nächsten Moment stieß er auf einen Personalausweis.
Augenblicklich erkannte er auf dem schlechten Passfoto den jungen Mann wieder, der vor einer Dreiviertelstunde so überstürzt seinen Laden verlassen hatte.
Der Pass war auf den Namen Thomas Bernhard Schattschneider ausgestellt, und auf der Rückseite der Plastikkarte fand er die Adresse des jungen Mannes: Maybachstraße 97.
Bock kratzte sich am Kopf. Den Ausweis zu verlieren war unangenehm, das wusste er aus eigener Erfahrung. Zwar war er sich ziemlich sicher, dass der junge Mann in den nächsten Tagen hier auftauchen und seine Mappe wieder an sich nehmen würde, aber wenn er doch ohnehin in diese Gegend musste …
Er beschloss, dort vorbeizugehen und das Etui persönlich abzugeben. Außerdem interessierte ihn schon, warum dieser Schattschneider sich so mir nichts, dir nichts in Luft aufgelöst hatte.
Seufzend sah er auf die Uhr. Noch vierzehn Minuten.
Er ging wieder ins Hinterzimmer, um nachzusehen, ob die letzten Druckbögen fertig waren.
Es regnete wie aus Eimern, als Laurenz Bock aus dem Treppenaufgang der U-Bahn-Station auf den Hansaring heraustrat. Er fand gerade genug Zeit, seinen Regenschirm aufzuspannen, bevor er durchnässt wurde. Das Geschenkpapier um die Flasche Rémy Martin, die er unter den Arm geklemmt hatte und die er gleich seinem Vetter überreichen wollte, begann in Sekundenschnelle aufzuweichen.
Am Parkhaus des Saturn vorbei erreichte er schließlich die Maybachstraße. Dort blickte er sich kurz um und stellte erleichtert fest, dass das Haus mit der Nummer 97 unmittelbar auf seinem Weg in Richtung Balthasarstraße lag. In Anbetracht des Wolkenbruchs, der seit einer Viertelstunde auf Köln niederprasselte, hatte er es bereits bereut, dass er seinem mysteriösen Besucher dessen Mappe hinterhertrug.
Es war kurz nach acht und schon reichlich dunkel.
Die Regenwolken bedeckten schwarz und wuchtig den Himmel über der Stadt. Die Tage waren kürzer geworden, und der fortwährende Regen und das unappetitliche Wetter des zu Ende gehenden Tages ließen ahnen, dass der Herbst nach den vergangenen sonnigen Tagen noch ein paar Tiefs bereithielt. Bock schlug den Kragen seines Lodenmantels hoch, als er die Straße hinaufging und gegen den stürmischen Regen ankämpfte, der Laub über den Gehweg wusch und in Böen um die hohen Straßenlaternen herumwirbelte. Die Szenerie hatte etwas Trostloses.
Die Maybachstraße lag düster und verlassen vor ihm. Bis auf einen riesigen, alten Backsteinbau, der ehedem einmal etwas mit dem Güterbahnhof zu tun gehabt haben musste, war sie nur einseitig bebaut. Um diesen düsteren Klotz aus Backsteinen erstreckte sich auf der linken Seite das weite Bebauungsgebiet des Mediaparks. Durch die zunehmende Dunkelheit und die regengetrübte Luft konnte man jedoch nicht die volle Größe der aufwendigen Baustelle erkennen. Laurenz Bock hatte schließlich die Hausnummer 97 erreicht und blickte an der dunklen, ergrauten Gründerzeitfassade hinauf, die irgendein bedauernswerter Zeitgenosse nicht nur verkommen ließ, sondern darüber hinaus auch noch im Erdgeschossbereich mannshoch mit einem schäbigen Kachelmantel verunziert hatte, an dem jetzt der Regen herunterrann. Das Haus hatte vier Stockwerke. Hie und da war ein Fenster beleuchtet, und einige Rollläden waren bereits herabgelassen worden.
Er trat an die Briefkästen neben der Haustür heran und holte die Mappe hervor. Als er schließlich einen Briefkasten und eine Türklingel mit dem Namen Schattschneider gefunden hatte, stellte er fest, dass er richtig vermutet hatte: Der Briefschlitz war zu eng, als dass er das dicke Mäppchen hätte hineinstecken können.
Er sah auf die Uhr, überlegte kurz und drückte dann den Klingelknopf. Eine Weile wartete er und blickte durch den dichten Regenschleier hinüber zur Baustelle.
Er wollte gerade erneut klingeln, als die Haustür geöffnet wurde und ein dicker Mann im Rahmen erschien.
Eine Windbö fegte einen Regenschauer an der Häuserfront vorbei, und der Mann zog seinen Hut tief in die Stirn und spannte rasch den Regenschirm auf. Dann stapfte er mit großen Schritten davon.
Bock nutzte eilig die Gelegenheit und schlüpfte in den Hausflur, wo er nun seinerseits den Schirm schloss. Er schüttelte ihn aus und begann, die alte Holztreppe hinaufzusteigen. An der Wohnungstür würde er nochmals klingeln, und wenn ihm auch dort nicht geöffnet wurde, würde es bestimmt irgendeine Möglichkeit geben, die Mappe für ihren Besitzer abzugeben oder zu deponieren. Beim Treppensteigen wurde seine Befürchtung bestätigt: Thomas Schattschneider hatte seine Wohnung unterm Dach. Bocks Uhr zeigte Viertel nach acht an, als er vor der weißgestrichenen Wohnungstür stand und nach erneutem Klingeln darauf wartete, dass ihm geöffnet wurde. Minuten vergingen, und obwohl aus der Wohnung laute Rockmusik erklang, deren dumpfe Bass-Rhythmen den Fußboden leicht vibrieren ließen, tat sich nichts. Er wollte gerade aufgeben, als sich die Treppenhausbeleuchtung automatisch ausschaltete.
In diesem Augenblick bemerkte er einen Lichtstrahl, der in das dunkle Treppenhaus fiel. Die Tür war nur angelehnt.
Vorsichtig schob er sie einen Spalt auf und blickte in einen unaufgeräumten Flur. Kleidungsstücke und Bücher lagen auf dem Boden herum, ein Garderobenständer war umgefallen. Bock klopfte an der Tür. »Hallo!« rief er. »Ist jemand da?«
Aber nur der Heavy-Metal-Sound dröhnte ihm entgegen.
Schritt für Schritt bahnte er sich seinen Weg durch die herumliegenden Gegenstände und erreichte die Tür zum Wohnzimmer, die weit offenstand. Als er hineinblickte, bot sich ihm eine chaotische Szenerie: Stühle waren umgekippt, die Inhalte der Wandregale lagen auf dem Boden verstreut, Poster waren von den Wänden herabgerissen worden, und über allem tobte ein ohrenbetäubendes Schlagzeugsolo, wie es Bock selten zuvor gehört hatte.
Für einen Moment schoss ihm der absurde Gedanke durch den Kopf, der junge Mann habe derart intensiv nach seiner Briefmappe gesucht, aber dann merkte er plötzlich, wie ihn ein eigentümliches Gefühl beschlich. Ihm dämmerte mit einem Mal, dass sich hier etwas höchst Unangenehmes ereignet hatte. Seine Rechte verkrampfte sich um den Griff seines Regenschirms. »Hallo!« rief er erneut. »Herr Schattschneider! Sind Sie zu Hause?« Beinahe hätte er auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre hinausgelaufen, aber einem inneren Impuls folgend, griff er nach der Stereoanlage und schaltete den Plattenspieler aus. Eine E-Gitarre wurde abgewürgt.
Die nun folgende Stille war noch schlimmer. Aus dem Schlafzimmer auf der anderen Seite des Flurs ertönte ein krachendes Geräusch. Es war das Klappern eines Fensterflügels, der im Sturm auf- und zugeschlagen wurde. Als Bock in den Raum eintrat, nicht ohne vorher an der angelehnten Tür angeklopft zu haben, blies ihm ein kalter Luftzug entgegen. Durch das offene Fenster prasselte ungehindert der Regen ins Schlafzimmer. Der Boden und der Teppich davor erschienen im schwachen Licht der Nachttischlampe schwarz vor Nässe. Auch hier lagen wahllos Gegenstände auf dem Boden verstreut, das Bett war durchwühlt, und auf dem Nachttisch … Bock trat näher heran, und obwohl er niemals etwas mit diesen Dingen zu tun gehabt hatte, erkannte er sofort, worum es sich handelte.
Im Lichtkegel der Nachttischlampe lag ein kleines Tütchen, in dem sich ein weißes Pulver befand. Ein Teil des Pulvers war über den Nachttisch verstreut. Eine Art Strohhalm aus Papier lag daneben und kullerte in dem leichten Windhauch, der vom offenen Fenster her kam, sanft von einer Seite auf die andere.
Er spürte, wie ein Gefühl des Grauens langsam wie eine kalte Hand seinen Nacken hinauffuhr.
Ein Windstoß fuhr durch das Zimmer, und der Fensterflügel schlug krachend gegen die Außenfassade. Durch den Luftzug wurde das Pulver aufgewirbelt, das Röhrchen kam vollends in Bewegung und kullerte auf den Rand des Nachttisches zu. Bock löste sich aus seiner Erstarrung und fing es auf. Als er es wieder hinlegte, merkte er, wie seine Linke nervös zitterte.
Langsam trat er auf das Fenster zu und blickte hinaus. Augenblicklich wurde seine Nickelbrille von einem Schauer von Regentropfen besprenkelt.
Viel konnte er nicht sehen, da der Hinterhof, auf den dieses Fenster hinausging, nicht beleuchtet war. Nur der matte Lichtschein, der durch ein Fenster im dritten Stock nach draußen drang, erhellte ein wenig den nassen Asphalt. Aber trotz der Dunkelheit erkannte Bock die Umrisse einer Gestalt auf dem Boden.
Zunächst sah es so aus, als sei der Mann nackt. Aber er trug eine Unterhose und lag mit dem Bauch nach unten auf dem Boden, Arme und Beine in bizarrer Haltung vom Körper abgewinkelt, als sei er mitten im Versuch, den Hof kriechend zu überqueren, versteinert.
Die Blutlache, in der Thomas Schattschneider lag, konnte Bock nicht sehen. Der nasse Asphalt um ihn herum hatte die gleiche schwarze Farbe.
Laurenz Bock stand einige Sekunden am Fenster und streckte seinen Kopf in die stürmische Nacht hinaus. Fassungslos starrte er auf das Bild, das sich ihm in der Tiefe bot.
Das plötzliche Ertönen einer Stimme ließ ihn aufschrecken.
»Machen Sie verdammt nochmal dat Fenster zu! Dat Jeklapper raubt einem ja de letzte Nerv!« Eine alte Frau streckte ihren Kopf aus dem Fenster im Stockwerk unter ihm. Sie reckte den Hals und sah zu ihm hinauf. »Un die Musik leiser jemacht! Die hör ich ja durch et Fernseh!«
Blitzschnell trat er einen Schritt zurück. Sein Atem ging stoßweise. In diesem Moment beschloss er, den Schauplatz dieses Dramas so schnell wie möglich zu verlassen.
Er stolperte durch die Unordnung auf den Ausgang zu und lief ins Treppenhaus. Hinter sich zog er die Tür zu, die krachend ins Schloss fiel.
Auf dem ersten Treppenabsatz stieß er mit einer jungen Frau zusammen, die gerade die Treppe hinaufstieg. Etwas Buntes baumelte im Dunkeln an ihren Ohren. Bock murmelte eine hastige Entschuldigung und lief weiter. Er hatte nur ein Ziel: weg von dieser Katastrophe! Er liebte es nicht, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten einmischte, und umgekehrt hielt er es genauso mit den Geschichten anderer Leute. Er war schon immer Meister darin gewesen, sich rauszuhalten. Wenn jemand im Drogenrausch zuerst die Wohnung verwüstete und dann den Drang verspürte, sich aus dem Fenster zu stürzen – das war nicht sein Problem. Helfen konnte er dem armen Teufel ja doch nicht mehr. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er zuerst gar nicht merkte, dass er den Regenschirm noch nicht wieder aufgespannt hatte und bereits triefend nass war. Seine Schritte lenkte er ganz automatisch wieder in Richtung U-Bahn. Er hatte jetzt nicht das mindeste Interesse, seinen ewig grinsenden Vetter zu sehen. Das hatte er eigentlich sowieso nicht gehabt. Es war ohnehin ein Fehler gewesen, hierherzukommen. Hätte er doch diese Mappe in seinem Laden verstauben lassen!
Die Mappe! Er ertastete sie in der großen Seitentasche seines Lodenmantels. Für einen Moment hielt er inne und blickte auf das Haus Nummer 97 zurück, aber dahin würde er jetzt auf keinen Fall zurückgehen.
Er setzte seinen Weg nach Hause fort. Dort würde er den Anruf seines Vetters abwarten und sich erst einmal einen Schluck aus der Cognacflasche genehmigen, die er immer noch unter den Arm geklemmt trug und deren Geschenkpapier sich mittlerweile endgültig in seine Bestandteile aufgelöst hatte.
3. Kapitel
In der Nacht wälzte sich Bock fortwährend von einer Seite auf die andere, ohne Schlaf zu finden.
Wieder und wieder erschien ihm das Bild des leblosen Körpers inmitten des nächtlich-düsteren Hinterhofs.
Tod – er hatte in seinem Leben noch nicht oft Bekanntschaft mit ihm gemacht. Seine Mutter hatte seinen Vater tot im Bett gefunden. Er selber saß währenddessen in der Berufsschule und versuchte, mathematische Formeln zu begreifen, die scheinbar dazu auserkoren waren, Zeit seines Lebens ein unlösbares Rätsel für ihn zu bleiben. Er hatte ihn nicht mehr gesehen, und wenn er ehrlich war, hatte es ihn auch keinesfalls danach gedrängt.
Seine Mutter starb im Krankenhaus. Es war nicht viel später gewesen. Sie erlitt einen Herzschlag, mitten im Winterschlussverkauf, und war bereits tot, als er eintraf. Er sah sie nur kurz. Wieder hatte er versäumt, im letzten Augenblick dabeizusein, in dem Moment, in dem der kümmerliche Rest des Lebens den Körper verließ.
Gegen drei Uhr morgens richtete er sich plötzlich kerzengerade in seinem Bett auf. War es diesmal wieder zu spät gewesen, oder war er, im Gegenteil, zur rechten Zeit dagewesen? War Thomas Schattschneider vielleicht noch gar nicht tot gewesen, als er seinen Körper auf dem durchnässten Pflaster in der Tiefe liegen gesehen hatte?
Hatte er vielleicht noch gelebt – so gerade eben?
Und ein zweiter Gedanke hängte sich sofort hintenan und ließ ihm die Nackenhaare zu Berge stehen: Hätte er helfen können?
Bock war hellwach. Er stand auf, zog seinen Bademantel über und begann ziellos in der Wohnung herumzuwandern. Pausenlos hämmerte diese eine Frage in seinem Kopf herum: Hätte er helfen können?
Er öffnete das Fenster und ließ frische, kühle Luft ins Zimmer. Luft, die nach Regen roch. Er atmete tief durch. Eine halbe Stunde später nahm er zwei Schlaftabletten und legte sich wieder ins Bett. Aber seine Gedanken machten keine Pause. Wieder und wieder versuchte er abzuwägen, was nicht abzuwägen war: Hatte es sich um eine Leiche gehandelt, oder war das, was er da unten im Hof gesehen hatte, ein Mensch gewesen, der mit fürchterlichen Verletzungen und unter qualvollen Schmerzen einen langsamen Tod starb?
Erst nach halb fünf schlief Bock ein.
Vom geöffneten Fenster her mischte sich das Prasseln des Regens unter das Geräusch seines Atems, der wie unter einer zentnerschweren Last mühsam und langsam ging.
Um halb acht piepste gnadenlos der Wecker. Der schrille Signalton bohrte sich tief in sein gemartertes Hirn, und er beeilte sich trotz seiner Schlaftrunkenheit, das kleine Gerät auszuschalten.
Als er die schmerzenden Augen öffnete, waren augenblicklich die Ereignisse des letzten Abends wieder da. Das Geschehene wirkte noch seltsam fern, irgendwie unwirklich, aber von Minute zu Minute manifestierte es sich wieder deutlicher vor seinem geistigen Auge, je wacher er wurde.