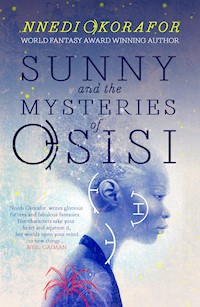Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Chaos bricht aus, nachdem im Internet verbreitet wird, dass vor der Küste der fünft bevölkerungsreichsten Stadt der Welt Außerirdische gelandet sind. Bald darauf versuchen das Militär, religiöse Führungspersönlichkeiten, Diebe und Wahnsinnige zu kontrollieren, was für Informationen auf YouTube und in den Straßen verbreitet werden. In der Zwischenzeit beraten die politischen Supermächte über einen nuklearen Präventivschlag, der die Eindringlinge auslöschen soll. Alles, was zwischen siebzehn Millionen Einwohnern und dem Tod steht, sind ein außerirdischer Botschafter, eine Biologin, ein Rapper, ein Soldat und ein Mythos, bei dem es sich um eine gigantische Spinne handeln könnte, oder um einen offenbarten Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAGUNE
Nnedi Okorafor
Ins Deutsche übertragen von Claudia Kern
Die deutsche Ausgabe von LAGUNE wird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,
Übersetzung: Claudia Kern; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Kerstin Feuersänger und Gisela Schell;
Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Umschlag-Artwork: Greg Ruth.
Printausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice.
Titel der Originalausgabe:
LAGOON
Copyright © Nnedi Okorafor 2014. All rights reserved.
German translation copyright © 2016, by Amigo Grafik GbR.
Print ISBN 978-3-86425-873-2 (Oktober 2016)
E-Book ISBN 978-3-95981-252-8 (Oktober 2016)
WWW.CROSS-CULT.DE
Gewidmet den verschiedenartigen und tatkräftigen Bewohnern von Lagos in Nigeria – den Tieren, Pflanzen und Geistern
Alles lässt sich mit Salzwasser heilen – mit Schweiß, Tränen oder der See.
Isak Dinesen (Pseudonym der dänischen Autorin Baronin Karen Blixen)
Lagos na Land von keinem. Niemand gehört Lagos, na wir alle kriegen. Eko o ni baje!
(Das Land von Lagos gehört niemandem. Lagos gehört niemandem. Uns allen gehört Lagos. Lagos wird nie zerstört werden!)
Ein Demonstrant aus dem Ajegunle-Viertel im Interview mit Lokalreportern am Abend, an dem alles geschah
Lagos, die Stadt, in der nichts funktioniert, aber alles geschieht.
Eine weiße Amerikanerin am falschen Ort zur falschen Zeit
Willkommen in Lagos, Nigeria.
Die Stadt verdankt ihren Namen dem portugiesischen Wort für »Lagune«.
Die Portugiesen landeten im Jahr 1472 auf der Insel Lagos. Anscheinend fiel ihnen kein kreativerer Name ein. Sie kamen auch nicht auf die Idee, Einheimische um Vorschläge zu bitten.
Und so dreht sich die Welt unter den Masken von Millionen Namen, Verkleidungen und sich ändernden Geschichten.
Es war schön, dem zuzusehen.
Meine Entwürfe werden kompliziert.
Inhalt
Erster Akt: WILLERKSTOERAMKTMEN
Prolog: MUUM!
Kapitel 1: DIE FAUST
Kapitel 2: DER JUNGE UND DIE DAME
Kapitel 3: MIRI
Kapitel 4: WAS WÜRDEST DU TUN?
Kapitel 5: DAS LABOR
Kapitel 6: ROTWEIN
Kapitel 7: INTERVIEW
Kapitel 8: MAMA?
Kapitel 9: MOZIZ
Kapitel 10: DER PLAN
Kapitel 11: WAHALA
Kapitel 12: MÖGE DER HERR DIR WEITER SEINE GUNST SCHENKEN?
Kapitel 13: CHIN CHIN
Kapitel 14: DIE SCHWARZE VERBINDUNG
Kapitel 15: ALKOHOL, MEIN NYASH
Kapitel 16: KOPFLOS
Kapitel 17: CASHEWS, REINES WASSER UND CHIN CHIN
Kapitel 18: IGBO RAUCHEN
Kapitel 19: OFFENES MEER
Kapitel 20: BELAGERUNG
Kapitel 21: DIE KUH DER SEE
Kapitel 22: GANZ RUHIG
Kapitel 23: SEID GEGRÜSST
Kapitel 24: SEID GEGRÜSST
Kapitel 25: DER VERBOTENE STRAND
Zweiter Akt: ERWACHEN
Prolog: DER KNOCHENSAMMLER
Kapitel 26: PAPA
Kapitel 27: FISAYO
Kapitel 28: DERKOCHBANANENBAUM
Kapitel 29: DAS EKO-HOTEL
Kapitel 30: KREUZZUG
Kapitel 31: DER RHYTHMUS
Kapitel 32: STILVOLL, TEUER UND EINZIGARTIG
Kapitel 33: BOHNENSTANGE
Kapitel 34: FISAYO
Kapitel 35: CHRIS UND DIE KINDER
Kapitel 36: SIEHST DU MICH, SEH ICH DICH
Kapitel 37: DER JUNGE AUF DER STRASSE
Kapitel 38: UDIDE SPRICHT
Kapitel 39: CODENAME: LEGBA
Kapitel 40: STRASSENMONSTER
Kapitel 41: AFRIKANISCHES CHAOS
Kapitel 42: MMIA
Dritter Akt: SYMBIOSE
Prolog
Kapitel 43: YAWA GIBT GAS
Kapitel 44: DIE BEGRÜSSUNG DER ERZÄHLERIN
Kapitel 45: AUF DEM WASSER
Kapitel 46: DAS GLASHAUS
Kapitel 47: FEMI
Kapitel 48: ACHTUNG, MONSTER
Kapitel 49: RESPEKTIERT DIE ÄLTESTEN
Kapitel 50: ZWEITKONTAKT
Kapitel 51: DIE MAGISCHE NEGERIN
Kapitel 52: UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN
Kapitel 53: DENKEN SIE GROSS
Kapitel 54: DIE FÄDEN DER SPINNE
Kapitel 55: GUTER JOURNALISMUS IST NICHT TOT
Kapitel 56: DER SCHWERTFISCH
Kapitel 57: SPINNE DIE KÜNSTLERIN
GLOSSAR
DANKSAGUNGEN
Erster Akt
WILLKOMMEN
Prolog
MUUM!
Sie durchschneidet das Wasser und stellt sich vor, sie wäre ein tödlicher Strahl aus schwarzem Licht. Die Strömung streichelt über ihre glatte, geschmeidige Haut. Wenn ein Fisch ihren Weg kreuzt, wird sie ihn aufspießen und weiterschwimmen. Sie hat eine Aufgabe. Sie ist wütend. Sie wird erfolgreich sein und dann werden sie für immer weggehen. Sie brachten den Gestank der Trockenheit mit, dann brachten sie den Lärm, und die Welt blutete schwarzen Schleim, der giftige Regenbögen auf der Wasseroberfläche hinterließ. Sie sieht diese Regenbögen oft, wenn sie aus dem Wasser springt, um die Sonne zu berühren. Sie brennen und stechen in ihren Kiemen.
Die grabenden und bauenden Wesen, von denen die Regenbögen stammen, kommen vom Land und niemand kann etwas gegen sie unternehmen. Außer ihr. Das wäre nicht das erste Mal. Damals hörten sie für viele Monate auf. Sie gingen weg. Jetzt macht sie es noch einmal.
Sie steigert ihre Geschwindigkeit.
Sie ist das größte Raubtier in diesen Gewässern. Ihren Gewässern. Selbst wenn sie umherzieht, gehört dieser besondere Ort immer noch ihr. Jeder weiß das. Sie wurde nicht hier geboren, aber nach all ihren Wanderungen ist sie hier am glücklichsten. Sie vermutet, dass einer von denen, die sie erschaffen haben, an diesem Ort geboren wurde.
Sie schwimmt noch schneller.
Sie ist blaugrau und es ist Nacht. Sie kann zwar nichts sehen, aber das muss sie auch nicht. Sie weiß, wohin sie gehen muss. Ihr Ziel ist das Ding, das wie eine große, tote Schlange aussieht. Sie erinnert sich an Schlangen; sie hat in ihrem früheren Leben viele davon gesehen. Im Sonnenlicht hat diese tote Schlange die Farbe von verrottendem Seetang mit einer Haut so rau wie Korallen.
Gleich ist es so weit.
Sie ist fast da.
Sie kommt schnell heran.
Sie sticht hinein.
Von der Spitze ihres Speers über ihr Rückgrat bis zu ihren Flossen erfüllt sie rot glühender Schmerz. Der Aufprall ist so hart, dass sie sich nicht bewegen kann. Doch dies ist ein Sieg; sie spürt, wie die riesige, tote Schlange zusammensackt. Sie stößt ihr schwarzes Blut aus. Ihr eigener, perfekter Körper wird taub und sie fragt sich, ob sie gestorben ist. Dann fragt sie sich, welchen neuen Körper sie nun bewohnen wird. Sie erinnert sich an ihre letzte Gestalt, einen gelben Affen. Selbst in jenem Körper schwamm sie gerne. Das Wasser hat sie stets zu sich gerufen.
Alles wird schwarz.
Sie erwacht. Rasch, aber vorsichtig zieht sie ihren Speer heraus. Aus dem Loch, das sie hinterlässt, spritzt ihr schwarzes Blut ins Gesicht. Sie wendet sich von dem bittersüß schmeckenden Gift ab. Nun werden sie bald weggehen. Als sie triumphierend und glücklich davonschwimmt, lässt das lauteste Geräusch, das sie je gehört hat, das Wasser vibrieren.
MUUM!
Der Knall breitet sich mit solcher Gewalt im Ozean aus, dass sie von ihm mitgerissen wird und glaubt, er müsse sie zerreißen.
Dann beruhigt sich das Wasser. Zutiefst erschüttert schwimmt sie an die Oberfläche. Sie hebt den Kopf aus dem Wasser und schwimmt langsam durch die Körper, die im Mondlicht glitzern. Einige kleinere Fische, Quallen, sogar Krebse treiben zerfetzt oder mit dem Bauch nach oben an ihr vorbei. Viele kleinere Wesen sind wahrscheinlich einfach vernichtet worden. Aber sie hat überlebt.
Sie schwimmt zurück in die Tiefe. Schon nach ein paar Dutzend Zentimetern riecht sie es. Sauber, süß, süß, süß! Die Süße überwältigt ihre Sinne. Das ist das süßeste Wasser, das sie je geatmet hat. Sie schwimmt voran und genießt das Wasser, das durch ihre Kiemen fließt. In der Dunkelheit spürt sie, dass andere in ihrer Nähe sind. Andere Fische. Große wie sie und kleine … also haben auch kleine überlebt.
Nun sieht sie viele. Sogar einige mit scharfen Zähnen und ein paar Massenmörder. Sie kann sie gut erkennen, denn etwas unter ihr leuchtet. Eine gewaltige sich bewegende, schimmernde Sandbank. Aus ihr fließt das süße, saubere Wasser. Sie hofft, dass die Süße die schwarze Fäulnis der toten Schlange, die sie erstochen hat, vertreiben wird. Sie glaubt, dass es so sein wird. Sie hat ein sehr gutes Gefühl.
Die Sonne ist aufgegangen und schickt ihre warmen Strahlen ins Wasser. Sie sieht, wie alle in das leuchtende Ding unter ihr schwimmen, treiben und kriechen. Da sind Haie, Seekühe, Shrimps, Oktopusse, Buntbarsche, Kabeljaue, Makrelen, fliegende Fische, sogar Seetang. Wesen aus den Untiefen, Wesen vom Strand, Wesen aus der Tiefe, alle sind gekommen. Eine einzigartige Versammlung. Was geschieht hier?
Aber sie bleibt, wo sie ist. Wartend. Zögernd. Beobachtend. Das Ding ist nicht hoch, aber breit. Es befindet sich rund siebzig Meter unter der Oberfläche. Vor ihren Augen verändert es sich. Von blau zu grün zu durchsichtig zu purpurrosa zu leuchtend golden. Doch angezogen wird sie von seiner Größe und Form. Bei ihren Reisen stieß sie einst auf eine riesige Welt aus Nahrung, Schönheit und Geschäftigkeit. Das Korallenriff war blau, rosa, gelb und grün. Meereswesen aller Art bewohnten es. Das Wasser war köstlich und weit und breit war kein trockenes Wesen zu sehen. Sie lebte viele Monde lang an diesem Ort, bevor sie schließlich in ihre Lieblingsgewässer zurückkehrte. Bei ihrer nächsten Reise suchte sie nach dem Paradies, das sie verlassen hatte, aber sie fand es nie wieder.
Nun befindet sich etwas noch Wilderes und Lebendigeres als dieses Paradies in ihrem Zuhause. Und wie dort ist auch hier das Wasser rein und klar. Sie weiß nicht, wo es endet. Doch eines ist ihr klar: Was sie hier sieht, stammt nicht aus den Tiefen des Ozeans oder den trockenen Orten. Es kommt von weit, weit weg.
Immer mehr Wesen schwimmen zu ihm. Als sie näher kommen, sieht sie, wie die Farben pulsieren und sie umarmen. Ihr fällt ein Oktopus auf, dem ein Tentakel fehlt. Er schwimmt auf das Ding zu, leuchtet plötzlich purpurrosa auf und streckt all seine Tentakel aus. Vor ihren Augen wächst der fehlende Tentakel nach und dann sprießen knochenartige Dornen aus seinem weichen Kopf. Der Oktopus wirbelt herum und schießt davon, hinab zu einer der skelettartigen Höhlen in dem sanft gewellten, korallenhaften Ding unter ihr.
Als ein goldener Tropfen aufsteigt, um sie kennenzulernen, schwimmt sie nicht auf ihn zu. Aber sie flieht auch nicht. Die Süße, die sie schmeckt, und seine sanften Bewegungen sind beruhigend und nicht bedrohlich. Als er mit ihr kommuniziert und ihr eine Frage nach der anderen stellt, zögert sie. Doch schon bald verwandelt sich Misstrauen in Begeisterung. Was für gute Fragen er stellt. Sie sagt ihm genau, was sie will.
Alles verändert sich.
Sie hat ihre glatte, graublaue Haut immer geliebt, aber nun ist sie unverwundbar und so golden wie das Licht, das das Neue Volk abgibt. Die Farbe erinnert sie an ein anderes Leben, in dem sie das Wasser genoss und die Sonne und die Luft ertragen konnte.
Ihr schwertartiger Speer ist länger und an der Spitze so scharf, dass er singt. Sie haben ihre Augen so verändert, dass sie wie schwarzer Stein aussehen, und mit ihnen kann sie tief in den Ozean und hoch in den Himmel blicken. Wenn ihr danach ist, kann sie Knorpeldornen auf ihrem Rücken sprießen lassen, als wäre sie ein Wesen aus tiefen Ozeanhöhlen und uralten Zeiten. Als Letztes bittet sie darum, ihre Größe zu verdreifachen und ihr Gewicht zu verdoppeln.
Das tun sie.
Sie ist kein großer Schwertfisch mehr. Sie ist ein Ungeheuer.
Obwohl aus der Mystras der FPSO Rohöl in den Ozean fließt, ist das Wasser vor Lagos, Nigeria, nun so sauber, dass man mit einem Glas dieser salzig-süßen Wohltat die schlimmsten menschlichen Krankheiten heilen und hundert mehr hervorbringen kann, die der Menschheit noch unbekannt sind. Seit Jahrhunderten war es nicht mehr so lebendig, und es wimmelt vor Außerirdischen und Ungeheuern.
Kapitel 1
DIE FAUST
Der Moment, als Adaora und die beiden fremden Männer, kurz bevor es geschah, an diesem speziellen Ort eintrafen, war unheimlich. Exakt drei Meter vom Wasser entfernt um genau 23:55 Uhr am 8. Januar 2010. Adaora kam von der Nordseite des Strandes. Der große, verschleierte Mann kam von Osten. Der blutige Mann in der Armeeuniform von Westen. Sie schlenderten in die Richtung, die sie eingeschlagen hatten, und musterten einander, als deutlich wurde, dass ihre Wege sich kreuzen würden.
Nur Adaora zögerte. Dann ging sie wie die beiden anderen weiter. Sie war in Lagos geboren und aufgewachsen und sie trug gut sitzende Jeans und eine unauffällige Bluse. Wahrscheinlich hatte sie an diesem Strand mehr Zeit verbracht als die beiden Männer zusammen.
Sie wischte sich die Tränen von den Wangen und richtete den Blick nach vorn. Das offene Meer war rund fünfhundert Meter von ihr entfernt. Dort breitete sich der Atlantik über den Sandbänken aus. Wann immer etwas Schlimmes geschah, führten ihre Füße Adaora hierher, an den Bar Beach von Lagos.
Man könnte sagen, dass Bar Beach die nigerianische Gesellschaft perfekt widerspiegelte. An diesem Ort vermischte sich alles. Der Ozean vermischte sich mit dem Land und die Reichen mit den Armen. Bar Beach zog Drogenhändler, Obdachlose, verschiedene Akzente und Sprachen, Möwen, Müll, Sandmücken, Touristen, alle möglichen religiösen Eiferer, fliegende Händler, Prostituierte, Freier, ins Wasser vernarrte Kinder und ihre unaufmerksamen Eltern an. Die beliebtesten Treffpunkte waren die Strandbars und kleinen Restaurants. Das Meer vor Bar Beach war für ernsthafte Schwimmer jedoch zu gefährlich. Selbst den besten drohte wegen der vielen Ripströmungen ein nasses Grab.
Adaora hatte ihre Sandalen ausgezogen. Wahrscheinlich war das keine gute Idee, denn die Nacht war dunkel. Bisher war sie jedoch weder in Holzsplitter, rostige Nägel, Glasscherben noch scharfe Steine getreten. Sie sehnte sich so sehr danach, den kühlen Sand zwischen den Zehen zu spüren, dass sie bereit war, das Risiko einzugehen. Trotz des ganzen Mülls haftete Bar Beach immer noch etwas Heiliges an.
Am 12. Juni 1993, dem Tag, an dem die demokratischsten Wahlen in der Geschichte Nigerias abgehalten worden waren, hatte Adaora ihren Vater zum Strand begleitet und gesehen, wie er vor Freude weinte. Am 23. Juni hatte ihre Mutter sie hierher gebracht, weil ihr Vater und ihre Onkel zu Hause fluchten und schrien, nachdem das Militär diese Wahlen annulliert hatte.
Sie war hierhergekommen, um zu vergessen, dass ihre beste Freundin mit ihrem Biologieprofessor schlief, um seinen Kurs zu bestehen. An dem Tag, an dem ihr von der Universität Lagos der Doktortitel in Meeresbiologie verliehen worden war, war sie hierhergekommen, um den höheren Mächten dafür zu danken, dass sie ihr geholfen hatten, während der Arbeit daran nicht den Verstand zu verlieren (und dafür, dass sie mit niemandem hatte schlafen müssen, um diesen Titel zu bekommen).
Letztes Jahr war sie hierhergekommen, um zu weinen, nachdem ihr Vater zusammen mit dreißig anderen Menschen beim gescheiterten Überfall auf einen Luxusbus ums Leben gekommen war. Der Überfall hatte auf dem Lagos-Benin Expressway stattgefunden, einer der vielen, vielen, vielen gefährlichen Straßen Nigerias. Die Banditen hatten den Passagieren befohlen, den Bus zu verlassen und sich auf die zu diesem Zeitpunkt leere Straße zu legen. Sie waren so dumm gewesen, dass sie nicht auf die Idee gekommen waren, ein Lastwagen könne auftauchen und (aus Angst vor den bewaffneten Banditen Gas gebend) alle überfahren, inklusive der Banditen.
Und nun ging Adaora am Strand entlang, weil ihr geliebter, perfekter Ehemann, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet war, sie geschlagen hatte. Hart geschlagen. Nur wegen eines Hip-Hop-Konzerts und eines Priesters. Zuerst hatte sie verletzt und benommen dagestanden, die Hand auf die Wange gelegt und gehofft, dass die Kinder nichts gehört hatten. Dann hatte sie ausgeholt und zurückgeschlagen. Das hatte ihren Ehemann so wütend gemacht, dass er sich auf sie gestürzt hatte. Doch sie war vorbereitet gewesen. In diesem Moment hatte sie nicht mehr an die Kinder gedacht.
Sie wusste nicht, wie lange sie und ihr Mann sich wie wilde Hunde auf dem Boden gewälzt hatten. Und wie der Kampf geendet hatte … das war nicht normal gewesen. Einen Moment lang hatten sie noch gerauft, im nächsten wurde ihr Mann mysteriöserweise zu Boden gedrückt, als hielten starke Magneten seine Hand- und Fußgelenke dort fest. Während er sich wand und schrie, war Adaora aufgestanden, hatte ihre Schlüssel gegriffen und war aus dem Haus geflohen. Zum Glück lebten sie auf Victoria Island, nur wenige Minuten von Bar Beach entfernt.
Sie rieb sich die geschwollene Wange. Trotz ihrer dunklen Haut würde die Röte auffallen. Sie streckte das Kinn vor und versuchte, die beiden Männer, die von rechts und links auf sie zukamen, zu ignorieren. Nach dem, was sie gerade mitgemacht hatte, würde sie sich von keinem Mann den Weg versperren lassen. Doch als sie näher kam, musterte sie die beiden verstohlen.
Sie runzelte die Stirn.
Der Mann in der Armeeuniform sah aus, als hätte er einen Tag mit »viel, viel Pfeffer« hinter sich. Er erinnerte Adaora an einen geprügelten Löwen. Er machte sich nicht die Mühe, das Blut, das ihm aus der Nase tropfte, abzuwischen. Und sein halbes Gesicht war geschwollen. Doch sein Blick war fest und ungebrochen. Bei dem anderen Mann handelte es sich um einen großen, dunkelhaarigen Kerl, dürr wie eine Vogelscheuche, der einen schwarz-weißen Schleier trug. Vielleicht war er ein Muslim. Er musterte den näher kommenden, erschöpft wirkenden Soldaten eindringlicher als Adaora.
Sie gingen weiter in gerader Linie aufeinander zu. Adaora sah den Mann mit dem Schleier aus zusammengekniffenen Augen an. Irgendetwas ist mit ihm, dachte sie, während sie auf das Meer zuging. Aber was? Doch sie wurde nicht langsamer. Und so trafen sie alle drei aufeinander. Der große Mann sagte als Erster etwas. »Entschuldigung …«
»Sagen Sie mir, dass das ein Witz ist«, unterbrach ihn Adaora, als sie erkannte, weshalb ihr der Mann aufgefallen war. »Sind … sind Sie … darf ich fragen, ob …«
Der große Mann seufzte genervt und entfernte seinen Schleier. »Das bin ich«, sagte er, ohne sie ausreden zu lassen. »Aber nennen Sie mich nicht Anthony Dey Craze. Ich wollte nach dem Konzert noch etwas spazieren gehen. Heute Nacht möchte ich nur Edgar genannt werden.«
»Na wao!«, rief sie lachend aus und legte die Hand auf ihre schmerzende Wange. »Den Schal hatten Sie auf Ihrem Albumcover an, richtig?« Nach dem, was zu Hause geschehen war, überraschte es sie, dass sie lachen konnte. Doch das tat gut. »Ich hätte eigentlich auf Ihrem Konzert sein sollen!«
Irgendwann hatte ihr Mann Chris seine Entscheidung, sie mit ihrer besten Freundin Yemi zu Anthony Dey Crazes Konzert »gehen zu lassen«, wohl bereut, denn er hatte ihr den Weg versperrt, als sie das Haus verlassen wollte. »Seit wann muss ich dich überhaupt um Erlaubnis fragen?«, hatte sie verblüfft zu ihm gesagt. Da hatte er sie geschlagen.
»Bitte«, sagte der blutende Soldat. Er zog das grüne Barett von seinem glatt rasierten Kopf und wrang es in seinen zitternden Händen. »Hat einer von Ihnen ein Handy? Ich muss dringend meinen Vater anrufen. Ich bezahle Sie auch gut dafür.«
Adaora hörte ihm kaum zu, sondern betrachtete ihn zum ersten Mal aus der Nähe. Er war nicht nur verletzt, er war auch zutiefst verstört. Das Blut, das aus seiner Nase lief, glänzte im Licht der Straßenlampen und dem des Monds. Sie nahm die Hand von ihrer brennenden Wange und streckte sie nach ihm aus.
»Hey, mein Freund«, sagte Anthony und sah den Soldaten besorgt an. Er zog sein Handy aus der Tasche. »Sie bluten! Brauchen Sie Hilfe? Geht es Ihnen …«
»Nein!«, fuhr der Soldat ihn an.
Adaora wich zurück und hob instinktiv die Fäuste.
»Mir geht es nicht gut! Sehe ich aus, als ginge es mir gut?« Er streckte die Hand nach Anthonys Handy aus. »Ich muss sofort jemanden anrufen! Meine Fam…«
MUUM!
Anthony ließ sein Handy fallen und sie alle drei warfen sich in den Sand, die Hände auf den Kopf gepresst. Adaora sah entsetzt zuerst den blutenden Soldaten, dann Anthony an. So ein Geräusch hörte man nicht an Bar Beach oder sonst irgendwo in Lagos. Die lautesten Geräusche an Bar Beach wurden normalerweise von Frauen verursacht, die Männer anschrien, oder von den Fehlzündungen alter Autos auf den Straßen. Dieses Dröhnen war so tief, dass Adaora es in der Brust spürte. Es ließ ihre Zähne klappern und verstopfte ihr die Ohren. Als Adaora sich umsah, bemerkte sie, dass der Lärm alles zu Boden drückte. Einen Meter entfernt fielen zwei benommene Möwen aus dem Nachthimmel in den Sand. Etwas Schwarzes prallte von Anthonys Kopf ab und landete neben ihm.
»Fledermaus?«, fragte Adaora. Alles klang dumpf, als spräche sie unter Wasser.
Anthony betrachtete die Fledermaus. Fell bedeckte ihren Körper. Sie hatte Knopfaugen und schwarze Flügel. Sie lebte noch und schlug schwach mit den Flügeln im Sand. Anthony hob das arme Tier auf und ergriff Adaoras Hand. Mit der Hand, in der er die Fledermaus hielt, berührte er die Schulter des Soldaten.
»Kommen Sie!«, schrie er. »Das kam vom Wasser. Wir müssen hier weg!« Sie standen auf.
Doch etwas geschah mit dem Ozean. Die Wellen, die sich am Strand brachen, hatten ihren Rhythmus verloren und breiteten sich mit jedem neuen Schwung weiter über den Sand aus. Dann erhob sich eine mehr als einen Meter hohe Welle. Adaora war davon so fasziniert, dass sie reglos stehen blieb. Anthony zog sie nicht weiter und trieb auch den Soldaten nicht mehr zur Eile an. Blut tropfte in dessen Augen, als er seinen Blick auf die Dunkelheit des Wassers richtete. Die Welle bewegte sich auf sie zu. Schnell und so leise wie ein Flüstern. Sie war nun fast drei Meter hoch. Schließlich drehten sich die drei doch um und rannten los. Die Faust aus Wasser war schneller. Adaora ergriff die Hand des Soldaten. Anthony warf die Fledermaus hoch in die Luft und hoffte, dass das reichen würde, um sie zu retten. Dann, als das Wasser schon auf sie herabstürzte, ergriff er Adaoras Beine.
KLATSCH!
Das Salzwasser stach in Adaoras Augen, riss an ihrer Kleidung und zog sie auf das Meer zu. Sie krallte ihre Hände in den Sand, der unter ihr davongeschwemmt wurde. Kiesel ritzten ihre Haut, die See zog an ihren Beinen. Der Soldat hielt sich verzweifelt an ihrer Hand fest und Anthony schlang seine Arme um ihre Beine. Sie war nicht allein. In der Schwärze konnte sie die Lichter der Bars und der nahe gelegenen Gebäude sehen. Sie flackerten und wurden immer kleiner.
Luftblasen kitzelten an ihren Ohren, als sie versuchte, an die Wasseroberfläche zu kommen. Aber es kam ihr so vor, als hätte der Ozean sein riesiges Maul geöffnet und sie und die beiden Männer verschlungen. Sie konnte nicht atmen. Sie hörte das Blubbern von Luftblasen und das Rauschen und Zischen des Wassers. Und sie spürte den Druck, der auf ihrer gequälten Lunge lag, und den Sog des Wassers. Aman iman, dachte Adaora schwach. In der Tuaregsprache Tamashek hieß das »Wasser ist Leben«. Sie hatte einmal bei einer Tauchexpedition mit einem Tuareg zusammengearbeitet. »Aman iman«, hatte er geantwortet, als sie ihn gefragt hatte, was einen Mann aus der Sahara veranlasst hatte, Profitaucher zu werden. Trotz ihrer schmerzenden Lunge und der alles verschlingenden Dunkelheit lächelte sie. Aman iman.
Die drei hielten sich aneinander fest. Tief, tief, tief sanken sie.
Kapitel 2
DER JUNGE UND DIE DAME
Nur zwei Personen am Strand beobachteten, wie Adaora und die beiden Männer vom Wasser geraubt wurden. Bei der einen handelte es sich um einen kleinen Jungen. Kurz vor dem Knall stand er einige Meter von seinem Vormund entfernt, der sich gerade mit dem Besitzer eines Standes, an dem hauptsächlich Getränke wie Coca-Cola und Fanta verkauft wurden, stritt. Der Junge starrte etwas anderes an. Sein Magen knurrte, aber er vergaß seinen Hunger einen Moment lang.
Im Mondlicht konnte er das Wesen nicht richtig erkennen, aber als es das Wasser verließ, wusste er, dass es kein Mensch war. Sein Verstand konnte es nur mit dem Wort »Rauch« beschreiben. Zumindest bis das Wesen in das flackernde Licht eines Restaurants trat. Da war es bereits zu einer nackten, dunkelhäutigen Afrikanerin mit langen schwarzen Zöpfen geworden. Sie erinnerte den Jungen an eine Frau, deren Handtasche er einmal gestohlen hatte.
Sie stand einige Momente lang da und beobachtete die drei Menschen, die sich aus unterschiedlichen Richtungen näherten und schließlich aufeinandertrafen. Dann lief das seltsame Frauenwesen lautlos zurück ins Wasser und tauchte hinein wie Mami Wata.
Der Junge kratzte sich an seinem juckenden Kopf und entschied, dass er sich das alles nur einbildete. Das passierte ihm oft, wenn er verwirrt war. Er versuchte, in die Realität zurückzukehren, indem er die Nasenflügel aufblähte und durch den Mund atmete. Der laute Knall erschütterte sein Gehirn noch stärker. Auf ihn folgte eine Welle, die wie die Hand eines mächtigen Wassergeists aussah. Der Junge sah, wie sie die drei Menschen, einer war eine Frau, die anderen beiden waren Männer, ergriff. Doch kurz bevor das geschah, sah er, wie einer der Menschen einen schwarzen Vogel in die Luft warf, der sich fing und in die Nacht davonflatterte.
Er konnte all diese Beobachtungen jedoch weder aussprechen noch verarbeiten, denn er war stumm und geistig behindert. Er starrte auf die Stelle, an der die drei Menschen gewesen waren und an der nun niemand war. Dann lächelte er und Speichel glitzerte in seinem linken Mundwinkel. Irgendwo in den Tiefen seines gefesselten Gehirns erkannte er, dass die Dinge um ihn herum sich für immer verändern würden, und diese Vorstellung gefiel ihm sehr.
Die Entführung wurde außerdem von einer jungen Frau namens Fisayo beobachtet. Bei Tag war sie eine hart arbeitende, Bücher lesende Sekretärin, bei Nacht eine Prostituierte. Auch sie bemerkte das Frauenwesen, das aus dem Wasser kam. Auch sie dachte an das Wort »Rauch«, aber auch an »Gestaltwandler«.
»Ich sehe den Teufel«, flüsterte sie sich selbst zu. Sie wandte sich ab und fiel auf die Knie. Sie trug einen kurzen, engen Rock und der Sand fühlte sich auf ihren Schienbeinen und Knien weich und warm an.
Sie betete zu Unserem Herrn Jesus Christus um die Vergebung ihrer Sünden und einen Platz im Himmel, denn dies musste der Tag der Entrückung sein. Als der Knall kam, schloss sie die Augen und versuchte, noch intensiver zu beten. Der Todesschmerz würde ihre Sühne sein. Doch im tiefsten Inneren wusste sie, dass sie eine Sünderin war und nichts daran je etwas ändern würde. Sie kam auf die Füße und drehte sich genau in dem Moment um, als die Frau und die beiden Männer von der gewaltigen Wasserfaust ergriffen wurden. Kurz bevor das geschah, setzte einer der Männer etwas Schwarzes und Böses in der Luft frei wie ein Gift.
Sie stand da und starrte auf die Stelle, an der sie gewesen waren und an der nun niemand mehr war. Sie wartete darauf, dass das Wasser auch sie holte. Bei der Faust musste es sich um die Hand des Satans handeln, und sie war eine der größten Sünderinnen der Welt. Oh, was sie alles getan hatte, immer und immer wieder. Manchmal nur, um ihren leeren Bauch zu füllen. Sie zitterte und schwitzte. Ihre Achselhöhlen kribbelten. Sie hasste ihren winzigen Rock, das enge Tank-Top, die roten Pumps, die kratzende Perücke aus langem, glattem Haar, die auf ihrem Kopf saß. Als nichts weiter geschah, ging sie in die nächstbeste Bar und bestellte einen Wodka Cranberry. Ihrem nächsten Freier, einem Geschäftsmann aus den USA, erzählte sie verstört, was sie gesehen hatte. Aber er war nicht an dem interessiert, was sie zu sagen hatte. Er wollte ihren Mund füllen, nicht die dummen Worte hören, die er hervorbrachte.
Aber sie vergaß nichts. Und als es begann, wurde sie zu einer der lautesten Unheilverkünderinnen in Lagos.
Kapitel 3
MIRI
Die Brise kühlte Adaoras nassen Rücken durch ihre trocknende Bluse. Sie hörte, wie Leute nervös redeten, manche in Yoruba, einer in Igbo, zwei in Hausa, die meisten in Pidgin-Englisch.
»Beeilung, biko-mu! Wir müssen weg hier!«, sagte jemand.
»Ich weiß nicht. Vielleicht na Selbstmordattentäter, o!«
Es klickte und klackerte, als Leute zusammenpackten und ihre Geschäfte und Bars rasch abschlossen. Und da war das Geräusch der Brandung. Adaora verkrampfte sich. Zum ersten Mal in ihrem Leben machte ihr das Geräusch Angst. Jemand berührte ihre Schulter und sie zuckte zusammen.
»Erwache«, sagte eine Frauenstimme.
Adaora öffnete die Augen und setzte sich rasch auf. Sie versuchte, aufzustehen, aber ihr wurde schwindelig und sie fiel zurück in den Sand. »Nicht«, murmelte sie. »Fass mich nicht an.« Dann sah sie die beiden anderen, die immer noch schlafend oder bewusstlos oder im Drogenrausch oder was auch immer sie mit ihnen gemacht hatten, im Sand lagen. Nicht weit entfernt flackerte eine trübe Straßenlampe. Die meisten anderen Lichter waren ausgegangen, sodass Dunkelheit Bar Beach einhüllte.
»Das werde ich nicht«, sagte es. Adaora musterte es im flackernden Licht … nein, nicht »es«, »sie«. Die Frau sah aus, als sei sie mit Adaora verwandt – dunkelhäutig, breitnasig, mit dunkelbraunen, vollen Lippen. Ihr buschiges Haar war so lang wie Adaoras, aber anstelle von vielen, vielen ordentlichen, schulterlangen Dreadlocks hatte sie es zu vielen, vielen ordentlichen braunen Zöpfen geflochten, die an ihrem Rücken herabhingen.
Als die Brise ihr ins Gesicht wehte, wandte sich Adaora dem Wasser zu. Sie atmete ein. Die Luft roch wie immer, nach Fisch und Salz und ein wenig nach dem Rauch, der von der Stadt heranwehte. Aber das Wasser stand viel zu hoch. Fast drei Meter den Strand hinauf! Es war nur dreißig Zentimeter von ihren Zehen entfernt. Die Besitzer und Angestellten der Bars und Restaurants richteten in der Dunkelheit den Lichtstrahl ihrer Taschenlampen ängstlich auf das Wasser, während sie hastig alles abschlossen. Ihre Gäste schienen geflohen zu sein. Sie sollten mehr als nur ein bisschen Angst haben, dachte Adaora. Sie schloss die Augen und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Wie viel Zeit ist vergangen? Stunden? Ein paar Minuten?
»Getan ist getan«, sagte die Frau. »Wir sind hier. Nun …«
»Nun … solltet ihr gehen«, sagte Adaora undeutlich.
»Nein. Wir bleiben.«
Adaora sah die Frau an und es gelang ihr nicht, sich über sie zu ärgern. Sie schloss erneut die Augen und zwang sich zu rationalen, ruhigen und analytischen Gedanken, die zu der Wissenschaftlerin, die sie ja war, passten. Sie wusste, dass vieles von ihren Reaktionen abhängen würde. Doch wenn sie die Frau ansah, kam ihr ein unwissenschaftlicher Gedanke.
Die Frau war gleichzeitig attraktiv und abstoßend und das verwirrte Adaoras Sinne. Ihr Haar war lang; die vielen Zöpfe waren perfekt geflochten und glänzten, doch das waren eindeutig ihre echten Haare. Sie hatte stechende braune Augen, die auf Adaora ähnlich gruselig wirkten wie der Anblick einer großen schwarzen Spinne. Ihre Gesten waren zu ruhig, fließend und … fremd. Adaoras Ehemann Chris hätte die Frau aus all diesen Gründen gehasst. Er hätte in ihr eine »Meereshexe« gesehen. Ihr Ehemann glaubte an weiße Hexen, körperliche Hexen und Meereshexen. Alle waren böse, aber die Meereshexe war die mächtigste, weil sie Wasser beherrschte, also die Substanz, die siebzig Prozent eines Erwachsenenkörpers und fünfundsiebzig Prozent von dem eines Kindes ausmachte. Wasser ist Leben, dachte Adaora erneut.
Sie grinste. Sie könnte die Frau problemlos als ihre Cousine ausgeben. Und die Vorstellung, sich an ihrem Mann zu rächen, indem sie ihm Todesangst einjagte, gefiel ihr. Und sie hatte sich ein Labor im Keller eingerichtet. Sie konnte einige Tests an dieser … »Frau« durchführen. Auf diese einfache, unkomplizierte und diskrete Weise konnte sie herausfinden, ob das, was sie hier erlebte, real war oder eine durch Stress ausgelöste, bizarre Halluzination.
»Wie soll ich dich nennen?«, fragte Adaora seufzend, während sie sich die Stirn rieb. Sie berührte ihre Wange. Immer noch geschwollen und empfindlich.
Die Frau machte eine Pause und lächelte dann wissend. »Mir gefällt der Name Miri.«
Adaora blinzelte überrascht. Sie hatte auch an diesen Namen gedacht. Die Frau konnte wirklich ihre Gedanken lesen. Der Name »Miri« würde ihren Mann bestimmt noch tiefer in den Wahnsinn treiben; er war das Sahnehäubchen. Doch etwas in Adaora sträubte sich dagegen. Sie brauchte einen Namen, der ein wenig subtiler als das Igbowort für »Wasser« war.
»Nein«, sagte sie. »Was hältst du von dem Namen …« Sie hielt inne, als ihr der Name »Ayodele« einfiel. Das war ein Yorubaname, der Chris misstrauisch machen würde, da Adaora eine Igbo war. Außerdem war Ayodele eine Spielkameradin von Adaora gewesen, die im Alter von acht Jahren umgekommen war, als sie versucht hatte, eine stark befahrene Straße zu überqueren. Adaora hatte sie so gern gehabt. Sie sah die Frau stirnrunzelnd an. »Weißt du, an welchen Namen ich gerade denke?«
Das Wesen … die Frau lächelte. »Nein.«
Adaoras Mann würde sich auch noch an ihre Freundin Ayodele erinnern. Er hatte so sehr geweint wie Adaora, als sie starb. Der Name würde ihn stärker verunsichern als »Miri«. Ja.
»Du brauchst eine Unterkunft«, sagte Adaora.
»Ja«, meinte sie. »Ich hätte gerne eine.«
»Gut«, sagte Adaora. Ihre Stimme wurde härter. »Dann heißt du jetzt Ayodele.«
Kapitel 4
WAS WÜRDEST DU TUN?
Sie gingen alle. Adaora, Anthony, Ayodele und Agu … Adaora kannte mittlerweile den Namen des Soldaten. Sie wusste eine Menge über Anthony und Agu und sie wussten eine Menge über sie. Adaora fuhr.
Was würdest du tun, wenn dir das passierte?
Agu, der Soldat, war, kurz nachdem Adaora dem Wesen einen Namen gegeben hatte, aufgewacht. Sein noch geschwollenes Gesicht war mit Meeressalz und Blut, das aus seinen Wunden getropft und nach ihrer Rückkehr an Land getrocknet war, verkrustet. Seine Gedanken kreisten nur um seine Familie, die, wie er sagte, im Dorf war. »Hast du kein Handy?«, fragte er Adaora erneut.
»Das liegt im Auto«, sagte sie. »Lass uns zuerst Anthony wecken.«
Agu umklammerte seinen Kopf mit seinen großen Händen und schloss die Augen. Bilder dieses fremden Orts unter dem Meer, an dem er aus irgendwelchen Gründen hatte atmen können, an dem er tausend Fragen hatte beantworten müssen … Fragen, die ihn zum Weinen, zum Lachen und zum Nachdenken brachten, versuchten, seinen Geist zu verwirren. Würdest du an Agus Stelle in die Kaserne zurückkehren, in der deine Kameraden dich gerade verprügelt haben, nachdem du versucht hast, sie davon abzuhalten, eine Frau zu überfallen? Wenn dein Vorgesetzter gedroht hat, bezahlte Killer auf deine Familie zu hetzen und sie umzubringen? Er wollte nicht in die Kaserne zurückkehren, jedenfalls nicht gleich.
Anthony erwachte, als Adaora ihm sanft auf die Wange klopfte. In dem trüben, flackernden Licht hielt er sie im ersten Moment für eine Fischfrau, da ihre Dreadlocks wie Seile herabhingen und sie ihn aus wimperntuscheverschmierten Augen durchdringend ansah. Dann erinnerte er sich an die Musik, die er an diesem riffartigen Ort unter dem Meer gehört hatte und die er immer noch hörte. Die Wesen hatten ihn »Bruder« genannt. Er hatte mehrere Brüder und so genannt zu werden, erinnerte ihn an zu Hause. Und diese Frau, die ihn nun ansah, war mit ihm dort gewesen, so wie der verprügelte Soldat. Er war froh, dass sie alle noch lebten. Er war auch froh, dass sein Handy nur wenige Meter entfernt im Sand lag.
Alle drei blieben zusammen. Alle drei waren dabei. Es war der 9. Januar, kurz vor 1 Uhr.
Kapitel 5
DAS LABOR
»Beeilt euch«, sagte Adaora, während sie das Licht einschaltete und rasch die Treppe hinunterging. »Mein Mann hat einen tiefen Schlaf, aber meine Kinder wachen beim kleinsten Geräusch auf.« Sie ging zur Rückseite des Labors und schaltete auch dort das Licht ein. Dies war ihr Privatbereich und es fühlte sich seltsam an, Fremde hierher zu bringen, vor allem die eine, die so … fremd war. Normalerweise kamen nur ihre achtjährige Tochter und ihr fünfjähriger Sohn hierher. Seit Kurzem mied ihr Mann das Labor, das er mittlerweile als ihren »Hexenbau« bezeichnete.
»Schließ die Augen«, hatte Chris ihr vor vielen Jahren gesagt, als Adaora abends nach ihrem ersten Arbeitstag als Dozentin am nigerianischen Institut für Ozeanografie und Meeresforschungen nach Hause gekommen war. Sie hatten beide gekichert, als er sie die Treppe hinuntergeführt hatte. Als sie die Augen geöffnet hatte, hatte sie sich auf die Stufen setzen müssen. Er hatte den Raum völlig verändert.
Chris war ein wohlhabender, viel beschäftigter Buchhalter, der für eine internationale Textilfabrik arbeitete. Für seine Firma reiste er durch die ganze Welt. Dass er sich die Zeit genommen hatte, ihr zusammen mit seinen ebenso viel beschäftigten Collegefreunden dieses Labor einzurichten, war ein echter Liebesbeweis. Ihre Fachbücher, Monografien und Zeitschriften standen in Regalen, es gab Haken, an denen sie ihre Tauchausrüstung aufhängen konnte, und einen nagelneuen Computer mit einem riesigen, hochauflösenden Widescreen-Fernseher, der als Monitor fungierte, und einer im Allgemeinen zuverlässigen Breitband-Internetanbindung. Neben einem großen, stabilen Labortisch standen ein starkes Mikroskop, jede Menge Reagenzgläser und Objektträger und an der Rückwand des Raums hing ein gigantischer Flachbildfernseher, der zur Entspannung diente. In die Mitte des Raums hatte er sogar ein 800-Liter-Aquarium mit tropischen Fischen gestellt. Adaora sah Seeanemonen, die sich im Wasser wiegten, umherschießende Korallenfische, geschäftige Garnelen, herumschleichende Krebse und drei große, verwirrt aussehende Kofferfische.
»Das Institut kann dir nicht alles geben, was du brauchst«, hatte Chris gesagt. »Ich schon.«
Adaora war sprachlos gewesen. Damals hatte er sie so sehr geliebt. Doch seitdem war viel passiert. Die Kinder waren gekommen. Der Stress. Chris reiste immer mehr, bis er fast ein Drittel des Jahres unterwegs war. Seine unzufriedene Mutter mischte sich in ihre Ehe ein. Ein von Turbulenzen erschütterter Flug verängstigte Chris so sehr, dass er zwei Tage später, als er an einem Gebetszelt vorbeiging, beschloss, »wiedergeborener Christ« zu werden (worüber sogar seine aufdringliche Mutter die Stirn runzelte). Dann kam das Fasten. Dann kamen die Eifersucht und die Anschuldigungen.
Die Frau, der Adaora den Namen Ayodele gegeben hatte, ging langsam die Treppe herunter. Anthony und Agu folgten ihr.
»Setz dich bitte«, sagte Adaora.
Ayodele ging ohne zu zögern zum Computer und setzte sich in den schwarzen Ledersessel. Anthony und Agu sahen sich an und folgten Ayodele vorsichtig. Sie wollten ihr nicht zu nahe kommen.
»Nette Hütte«, sagte Anthony.
»Ja«, meinte Agu. »Was macht dein Mann noch gleich?«
»Er ist Buchhalter«, sagte sie, während sie in einer Schublade mit Laborzubehör herumwühlte. »Ich bin Professorin an der UNILAG. Uns geht es also nicht schlecht.«
Agu nickte und sah sich einige Bücher im Regal an.
Als Ayodele den Flachbildmonitor des Computers berührte, flackerte das Hintergrundbild (ein drohend wirkender, drachenartiger Rotfeuerfisch in einem blauen Ozean) ein winziges bisschen. »Dein Volk hat seine eigenen …« Sie kicherte, ein unheimlich klingendes Gurren wie das einer Taube, bei dem sich die Härchen an Adaoras Armen aufrichteten. »… kleinen Erfindungen.«
»Ja«, sagte Adaora. »Das ist ein Computer. Kennt dein, äh, Volk die nicht?«
Ayodele lachte darüber.
»Sie brauchen keine«, murmelte Anthony, während er sich müde das Gesicht rieb und sich den Schleier über den Kopf zog.
Adaora legte einen sauberen Objektträger neben das Mikroskop. Sie warf einen Blick auf Ayodele und zögerte. Jedes Mal, wenn sie das tat, gab es einen kurzen, verstörenden Moment, in dem sie nicht wusste, was sie da eigentlich sah. Das dauerte nie länger als eine halbe Sekunde, aber es passierte. Dann sah sie wieder die »Frau« Ayodele.
Adaora räusperte sich und verdrängte diese Beobachtung ebenso wie die Gedanken an das, was sie im Wasser gesehen hatte. »Komm her, Ayodele«, sagte sie. »Ich … ich würde gern eine Hautprobe nehmen.« Als sie Ayodele ein Wattestäbchen reichte, stellte sie sich die Größe, das Aussehen und die Farbe vergrößerter Wangenzellen vor. So war es schon immer gewesen. Wenn sie Angst hatte, nervös war oder sich unwohl fühlte, halfen ihr Gedanken an die Wissenschaft, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Dieses Mal war es auch so.
»Du glaubst nicht, dass ich bin, was ich sage?«, fragte Ayodele, während sie das Wattestäbchen betrachtete. Sie hielt es hoch und berührte die weiche, weiße Baumwollspitze.
»Ich … glaube dir. Aber … es ist wichtig, dass ich es mit eigenen Augen sehe«, sagte sie. Um sicherzustellen, dass ich sehe, was ich zu sehen weiß, und weiß, dass ich weiß, was ich weiß, dachte sie hektisch. »Dann werden wir dir etwas zu essen besorgen. Du … isst doch, oder?« Sie verzog das Gesicht, als sie erkannte, wie albern das klang.
»Essen?« Ayodele hielt inne und schien darüber nachzudenken. »Okay.«
Adaora nahm ein Wattestäbchen, öffnete ihren Mund und rieb mit der Spitze über die Innenseite ihrer Wange. »Tupf deinen Mund von innen so ab«, sagte sie.
Als Ayodele das getan und Adaora das Wattestäbchen zurückgegeben hatte, ging Ayodele zum Aquarium und stellte sich neben Anthony.
»Ich müsste längst wieder im Club sein, chale«, sagte Anthony, während er den umherschießenden Korallenfisch beobachtete. »Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen, weil ich Kopfschmerzen hatte.«
»Zu viel Rhythmus?«, fragte Ayodele.
Er runzelte die Stirn und drehte den Kopf, um sie anzusehen. Sie lächelte freundlich. Immer so freundlich.
»Ich weiß, warum die Ältesten dich mögen«, sagte sie.
Anthony hielt ihren Blick einen Moment lang, dann ließ er ihn wieder zum Aquarium schweifen. »Kannst du dich in eine von denen verwandeln?«, fragte er Ayodele und zeigte auf eine rote Garnele mit weißen Streifen.
»Das kann ich.« Sie presste ihr Gesicht an das Glas. »Du weißt das.«
Anthony nickte. »Ihr könnt euch selbst verändern, aber auch die Fische, richtig?«
»Genau«, sagte Ayodele. »Wir geben ihnen, was sie wollen.«
»Verdammt!« Dann nickte er und lächelte ein wenig. »Respekt.«
Adaora schob den Objektträger unter das Mikroskop und betrachtete ihn. Schon bald sah sie, was sie hatte sehen wollen. Zur Sicherheit studierte sie die Proben noch einmal durch das Objektiv mit der stärksten Vergrößerung. Sie lachte leise in sich hinein. Die Aufregung ließ etwas tief in ihrem Magen schmerzen. »Ach du Scheiße«, flüsterte sie.
Erneut verbannte sie die aufdringlichen Erinnerungen an das, was sie unter dem Meer beobachtet hatte, aus ihrem Verstand. Dass sie in einer seltsamen Vorrichtung, die auf einem riffartigen Konstrukt angebracht worden war, geschwebt und geatmet hatte. Dass eines der Wesen ihren Arm berührt und sie zugesehen hatte, wie wunderschön schillernde Schuppen darauf wuchsen und ihre Finger Schwimmhäute bekamen. Dass sich diese Veränderung wie eine starke Vibration angefühlt hatte, aber nicht schmerzhaft gewesen war. Dass sie gewusst hatten, wie Adaora ihren Mann in Angst und Schrecken versetzen wollte. Dass sie sie mühelos zurückverwandelt hatten. Sie kniff die Augen zusammen. Konzentration, Konzentration, Konzentration, dachte sie.
Agu saß auf dem Hocker neben ihr.
»Was siehst du da?«, fragte er.
Adaora trat zur Seite. »Sag du’s mir«, sagte sie und zeigte auf das Mikroskop.
Er hielt sein Auge an das Objektiv.
»Weißt du, wie Zellen normalerweise aussehen?«, fragte Adaora.
»Ja, das habe ich in der Schule gelernt.«
Während er in das Mikroskop blickte, musterte Adaora Ayodele, die wiederum die Fische betrachtete. Ihr Blick traf auf Anthonys, und sie nickt ihm kurz zu. Er legte den Kopf schief und sagte lautlos: »Das ist irre.«
Adaora nickte zustimmend. Sie beide sahen Ayodele an, die den Blick nicht von den Fischen nahm.
»Und, Agu?«, fragte Adaora nach einer Minute. »Was siehst du?«
»Ich weiß nicht so recht«, sagte er, ohne den Kopf zu heben.
»Du … du siehst sie aber, richtig?«
»Die Kugeln? Die sich bewegen und irgendwie … vibrieren?«
Adaora nickte aufgeregt. »Ja! Das ist ihre Haut … vergrößert.«
Ein Ausdruck tiefer Verunsicherung trat auf Agus zerschlagenes Gesicht. »Aber …«
»Ich glaube nicht, dass es sich dabei um Zellgewebe handelt.« Sie lehnte sich an den Labortisch.
Agu berührte seine geschundene Nase. »Heißt das …«
»Tausendfach!«, flüsterte Adaora und ignorierte dabei Agu. »So stark ist die Vergrößerung. Ayodele besteht aus winzig kleinen metallartigen Kugeln. Das muss Metall sein.
Bestimmte Metallpulver sehen zweihundertfach vergrößert so aus. Ich denke, dass sie deshalb … ihre Form auf diese Weise verändern kann. Du hast ja gesehen, wie … wie … als wir …«
Agu sah ihr nicht in die Augen. »Ja, das habe ich gesehen.«
»Die Kugeln sind nicht miteinander verbunden wie unsere Zellen«, sagte Adaora.
Agu sah sie nur reglos an.
»Eines habe ich mich immer schon gefragt«, fuhr Adaora fort. »Die berühmtesten nichtirdischen Objekte, hauptsächlich herabgestürzte Meteoriten, sind hier gefunden worden. In Nigeria.« Sie sprach nun eher mit sich selbst. »Letztes Jahr ist ein großer in die Tarkwa-Bucht eingeschlagen. Ich habe dort das Wasser auf Verschmutzungen untersucht, als das geschah …« Sie sah sich um. »Ich sollte das alles aufschreiben!« Sie holte einen Kugelschreiber und Papier und fing an, sich Notizen zu machen. Sie konzentrierte sich auf jedes Wort, das sie schrieb, um sich nicht auf Agu konzentrieren zu müssen. Wenn sie sich auf ihn konzentrierte, würde ihre Welt zerfallen. Sie spürte, dass er sie ansah. Sie atmete tief durch und kämpfte mit den Tränen, als sie an den Streit mit ihrem Mann dachte. »So … was ist mit deinem Gesicht passiert?«, fragte sie.
»Es wurde geschlagen.«
»Das sehe ich, aber von wem?«
»Von meinen ahoa«, sagte er. Als Adaora ihn fragend ansah, fügte er hinzu: »Meine ahoa … meine Kameraden, andere Soldaten.« Er zog Luft durch die Zähne. »Tu nicht so, als hättest du nicht zugehört, als ich aus dem Auto anrief.«
Das hatte sie, sie alle hatten das. Agu hatte mit ihrem Handy seine Eltern in der Kleinstadt Arondizougu angerufen. Er hatte ihnen gesagt, sie müssten ihr Haus sofort verlassen und sich bei Verwandten verstecken, da man Killer auf sie hetzen würde. »Sag Kelechi und seiner Frau auch Bescheid. Lasst die Yams zurück. Die könnt ihr wieder anbauen, euer Leben nicht, o!«
Adaora hatte Agu bemitleidet und sich auch ein wenig geschämt, als er ihr das Handy zurückgab. Ein paar Minuten lang hatten alle im Auto geschwiegen, sogar Ayodele.
»Aber was hast du getan?«, fragte Adaora nun. »Warum sind sie hinter deiner Familie her?«
Agu sah sie mit seinem ganz geöffneten Auge an und kniff das angeschwollene zusammen. »Ich habe versucht, einen meiner ahoa davon abzuhalten, eine Frau zu vergewaltigen.« Ein Ausdruck des Ekels trat auf sein Gesicht, als er sich daran erinnerte. »Wir hatten sie auf dem Lagos-Benin Expressway angehalten. Diese vornehme Frau, sie war betrunken. Lance Corporal Benson, mein Vorgesetzter, konnte sich bei ihr nicht beherrschen. Ich … ich schlug ihm in den Magen.« Er sah Adaora in die Augen. »Er flog weg wie ein Sack voller Federn!«
Adaora wurde kalt. »Was? Wie meinst du das?«
Agu nickte. »Genau! Ich bin kein Schwächling. Ich halte mich fit. Und ich war schon bei ein paar Schlägereien dabei. Aber … er flog weg. Weil ich ihn geschlagen hatte. Eine Weile lag er reglos da. Die anderen ahoa stürzten sich auf mich. Sie schlugen auf mich ein wie auf einen Hund und ließen mich bewusstlos am Straßenrand zurück. Dabei habe ich wohl mein Handy verloren, denn …«
Geräusche aus dem Fernseher unterbrachen ihre Unterhaltung. Anthony hatte ihn für Ayodele eingeschaltet, die sich auf das Sofa gesetzt hatte. Sie seufzte leise, als das Bild erschien.
Ein Nachrichtenbanner nahm das untere Ende des Bildschirms ein. Über ihm stand eine Sprecherin, die einen modischen Hosenanzug und eine weiße Bluse trug. Im Hintergrund sah man Bar Beach. Soldaten stellten im wehenden Wind Absperrungen auf.
»Zeugen berichten, dass sie um kurz nach 21 Uhr an Bar Beach eine gewaltige Explosion hörten, die den Boden erbeben ließ und vom Wasser heranwalzte wie eine Sturmflut«, sagte die Nachrichtensprecherin. »Autoscheiben und Fenster platzten. Einige Menschen klagen seitdem über Schwerhörigkeit. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Terroranschlag, aber darüber will ich nun mit Lance Corporal Benson Shehu sprechen, der sich für uns Zeit genommen hat.«
Neben ihr stand ein streng aussehender Hausa, der eine scharf geschnittene Uniform trug und ein grünes Barett, das auf seinem Kopf saß, als wäre es dort angewachsen. Eine Hand lag auf seiner Hüfte. Es schien ihm schwerzufallen, gerade zu stehen.
Agu zeigte auf den Fernseher. »Das ist er! Das ist mein …«
»Psst, psst, psst«, zischte Anthony mit gerunzelter Stirn.
»Außerdem sind Sie ein Neffe des Präsidenten«, fügte die Nachrichtensprecherin hinzu.
»Ja, aber das ist nur ein Zufall und hat mit der Sache nichts zu tun«, fuhr Benson sie an. Er verzog das Gesicht und presste die andere Hand auf eine Stelle unterhalb seiner Rippen.
Die Nachrichtensprecherin nickte, während Benson in die Kamera sah und die Augen zusammenkniff, als würde die Sonne ihn blenden. »Es gibt keine Zerstörungen oder Ähnliches. Das war keine Bombe, sondern wahrscheinlich ein Überschallknall. Äh … etwas, das beim Durchbrechen der Schallmauer entsteht. So was in der Art. Das war kein Selbstmordattentäter. So einen Blödsinn gibt es in Lagos nicht. Aber wir betrachten das trotzdem als Angriff«, sagte er.
»Einen Angriff? Auf Nigeria?«
»Ja«, sagte er und wandte sich der Nachrichtensprecherin zu.
»Von wem?«
»Das wissen wir nicht«, antwortete er. »Wir wissen gar nichts. Aber wussten die Amerikaner von Anfang an, wer die Türme des World Trade Centers zerstört hatte?«
Die Nachrichtensprecherin nickte. »Gutes Argument. Aber das bringt mich zurück zum Präsidenten. Wo ist er? Wird er eine Presse…«
»Morgen früh wissen wir hoffentlich mehr«, unterbrach sie Benson. »Kein Rauch ohne Feuer.« Er verlagerte sein Gewicht schmerzerfüllt von einem Fuß auf den anderen. »In diesem Fall sollte es heißen: Kein Lärm ohne Quelle. Wir raten den Menschen, erst einmal so weiterzumachen wie bisher. Verhalten Sie sich normal, es gibt keinen Grund für wahala …«
»Sie wissen gar nichts«, sagte Adaora abwinkend und kehrte zu ihrem Mikroskop zurück.
»Das stimmt«, sagte Agu, der ihr zum Tisch folgte. »Und selbst wenn Benson etwas wüsste, wäre er zu blöd, um das zu verarbeiten. Der Präsident muss zurückkommen. Glaub mir, Benson ist der Letzte, der an Bar Beach das Kommando führen sollte. Wieso haben sie ihn überhaupt interviewt?«
Adaora zuckte mit den Schultern. »Aber du hast ihm schon gehörig zugesetzt.«
»Das hat er auch verdient.«
»Wenigstens weißt du jetzt, dass du ihn nicht umgebracht hast.«
Agu sah in Adaoras Mikroskop, während sie sich weiter Notizen machte.
»Sie können alles sein und sind nichts«, meinte sie, während sie schrieb. »Vom Prinzip her ist sie ein Gestaltwandler.« Sie lächelte. »Ich wünschte, meine Großmutter könnte das noch erleben.«
»Warum?«
»Sie war sich so sicher, dass es auf den Märkten von Hexen, Gestaltwandlern, Zauberern und Ähnlichem nur so wimmelte. Das würde sie umhauen, sha.« Sie schnippte plötzlich mit den Fingern, was Agu zusammenzucken ließ. »Ah, über was für eine Technologie sie verfügen müssen.«
»Brauchen sie die überhaupt?«, fragte Agu. »Genau genommen sind sie Technologie. Sie kön…«
Jemand lief die Treppe herunter.
»Was ist … Adaora, was sind das für Leute?«, wollte Adaoras Mann Chris wissen. Er trug immer noch dieselben Jeans und dasselbe zerknitterte Anzughemd, das er bei ihrem Streit angehabt hatte. Obwohl er seit zwei Wochen nur Wasser und Brot zu sich nahm, wirkte er trotzdem einschüchternd, als er die Treppe herunterging. Er rutschte auf der letzten Stufe aus und musste fluchend nach dem Geländer greifen, um nicht zu stürzen. Adaora stöhnte beschämt. Ihr wurde übel. Anthony versteckte seine Erheiterung nicht, sondern lachte laut und murmelte: »Kwasiasem. Blödsinn.«
Chris sah Agu, der neben Adaora stand, wütend an. Agu entfernte sich einen Schritt von ihr und Adaora zuckte zusammen.
»Während ich schlafe?«, sagte Chris und ging mit langen Schritten auf Adaora zu. »In meinem eigenen Haus? Während unsere Kinder oben sind?«