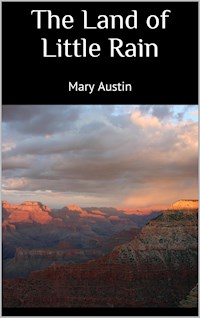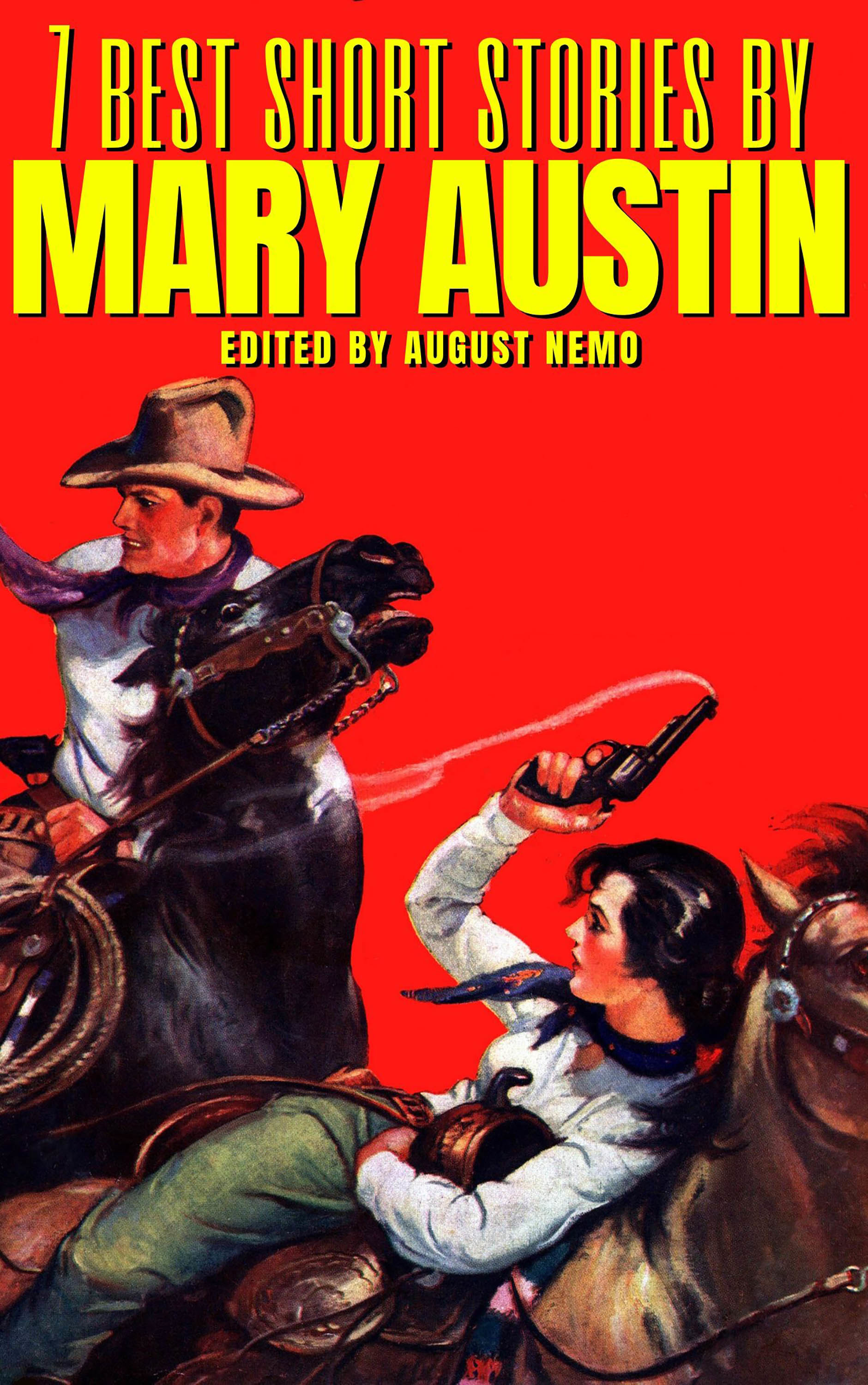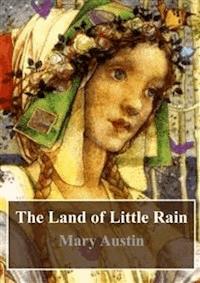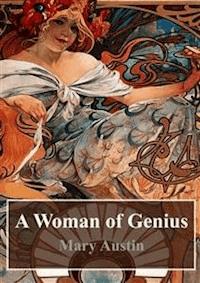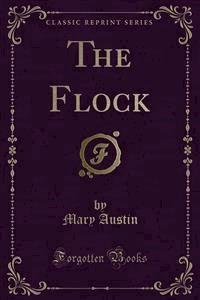Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass die Wüste ein karger und trostloser Ort sein soll, entlarvt Mary Austin in ihrer erstmals 1903 erschienenen Naturkunde des US-amerikanischen Südwestens als bloßes Vorurteil: In vierzehn Vignetten schildert sie das Land of Little Rain des Death Valley und der Mojave-Wüste als ein Reich von harscher Schönheit, in der sowohl Menschen als auch eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt nicht nur überleben, sondern sich den widrigen Umständen hervorragend angepasst haben. Dabei tritt Austin in ihren Erkundungen nicht als distanzierte Naturbeobachterin oder gar Touristin auf, sondern als engagierte, zeitweilige Wüstenbewohnerin, die mit den Lebensweisen der ansässigen indigenen Bevölkerung ebenso vertraut ist wie mit denen der Immigranten, Farmer und Bergleute, die alle auf ihre eigene Weise versuchen, sich im dürren Land out west einzurichten. Einfühlsam und kenntnisreich zeichnen die Beschreibungen das präzise Porträt einer übersehenen Landschaft, die bis dahin kaum als Kulturraum wahrgenommen wurde. Nur wenige Jahre nach Veröffentlichung des Buches sollte das Land, das Austin als so lebendig beschrieben hatte, tatsächlich verwüstet werden: In einem dubiosen Verfahren erwirbt die wachsende Metropole Los Angeles Wasserrechte von den Farmern des Owens Valley und besiegelt damit seine Zerstörung. Heute verdeutlicht uns Austins faszinierendes Porträt der kalifornischen Wüste daher umso eindringlicher, wie unerlässlich es ist, für die Bewahrung von Naturräumen einzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARY AUSTIN
LAND des kargen REGENS
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und kommentiert von Dieter Fuchs
Mit einem Nachwort von Solvejg Nitzke
NATURKUNDEN No 92 herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Vorwort
Land des kargen Regens
Wasserpfade des Ceriso
Die Aasfresser
Der Einschlussjäger
Shoshonenland
Jimville. Eine Bret-Harte-Stadt
Das Feld meines Nachbarn
Der Mesatrail
Die Korbmacherin
Die Straßen der Berge
Wassergrenzen
Andere Wassergrenzen
Zöglinge des Himmels
Die Kleine Stadt der Weinreben
ANHANG
Anmerkungen
Nachwort
Literatur
Für Eve1»Die Trösterin der Erfolglosigkeit«
Vorwort
Ich muss gestehen, dass ich die indianische2 Art der Namensgebung ungemein schätze: Jeder Mann trägt die Bezeichnung, die sein Wesen für den jeweiligen Bezeichner am besten wiedergibt. So kann er je nachdem, ob von Freund oder Feind benannt, Mächtiger Jäger oder Hat-Angst-vor-Bären heißen, oder auch Narbengesicht für diejenigen, die ihn nur mit dem Auge erhascht haben. Keine andere Vorgehensweise, denke ich, passt so gut zu den unterschiedlichen Wesen, die uns innewohnen, und wenn ihr das auch so seht, dann leuchtet euch sicher ein, warum hier nur wenige Namen so geschrieben sind wie in der Geografie üblich. Denn weil ich einen See gern mit dem Namen bezeichne, den ihm sein Entdecker gegeben hat – weil er sich etwa durch seine dicht am Ufer stehenden Kiefern aufdrängt –, dann findet ihr ihn in meinem Bericht hier genau so angeführt. Sind jedoch die Indianer vor mir dagewesen, bekommt ihr deren Namen, der immer sehr gut passt und nicht in dem traurigen Menschenwunsch nach Beständigkeit gründet.
Aber es gibt auch Gipfel, Cañons3 und offene Grasflächen, die sich über eine Benennung durch Wörter erheben und den Ruhm vornehmer, großer Menschen besitzen, denen wir ebenso wenig einen Alltagsnamen geben. Von diesen geleitet, mögt ihr vielleicht mein Land erreichen und je nachdem, was in euch liegt, das hier Vorhandene finden oder auch nicht. Vielleicht sogar mehr. Die Erde ist keine Dirne, die jedem Besucher ihr Bestes preisgibt, sondern hält für jeden eine süße, ganz persönliche Innigkeit parat. Aber findet ihr alles anders vor als von mir beschrieben, solltet ihr weder mich für wenig vertrauenswürdig noch euch selbst für wenig schlau halten. In Herzensangelegenheiten ist eine bestimmte Art von Täuschung erlaubt, genau wie man illustrierend sagt: »Ich kenne einen Mann, der …«, um sein intimstes Erlebnis zu offenbaren und ihn doch nicht zu verraten. Und ich habe keineswegs vor, euch an schöne Orte zu führen, die euch vielleicht nicht so kostbar vorkommen wie mir. Also halte ich durch diese Art des Benennens dem Land die Treue – und erweitere meinen eigenen Besitz um ein riesiges Territorium, auf das niemand mehr Anspruch hat als ich.4
Das Land, in dem das hier Aufgeschriebene betrachtet und erlebt werden kann, beginnt in den hohen Sierras5 südlich von Yosemite6 und erstreckt sich nach Osten und Süden über eine gewaltige Ansammlung zerklüfteter Bergrücken bis jenseits des Death Valley und dann endlos in die Mojave-Wüste hinein. Von Süden her erreicht ihr es mit der Postkutsche, was einen gewaltigen Zeitsprung mit sich bringt, oder von Norden her mit der Eisenbahn, indem ihr die Hauptroute in Reno verlasst. Der beste Weg ist jedoch über die Sierra-Pässe, mit Packtieren die Saumpfade entlang, sehend und staunend. Nur wird man sich dem Herz und Wesen dieses Landes nicht in einem einmonatigen Urlaub nähern. Man muss mit ihm sommern und wintern und seine Ereignisse abwarten. Kiefernwälder, deren Zapfen erst nach der zweiten oder dritten Saison ausgereift sind, Wurzeln, die sieben Jahre ruhig im Sand liegen und auf einen Regen zum Wachsen warten, oder Tannen, die fünfzig Jahre alt werden und erst dann blühen – niemand hier reißt sich um neue Bekanntschaften. Aber wenn ihr es jemals erreicht und bis zu dem Städtchen7 kommt, das in einer Senke am Fuß des Kearsarge8 liegt, geht nicht weg, ohne an die Tür des braunen Häuschens zu klopfen, das unter der Weide am Ende der Dorfstraße steht: Dort werdet ihr über das Land, seine Pfade und das, was sich hier regt, so viele Neuigkeiten erfahren, wie einer seiner Liebhaber einem anderen weitergeben kann.
Land des kargen Regens
Östlich der Sierras und südlich von Panamint und Amargosa9, also manch ungezählte Meile weiter östlich und südlich, liegt das Land der Verlorenen Grenzen10.
Ute, Paiute, Mojave und Shoshonen bewohnen seine Ränder, genau so weit ins Innere hinein, wie ein Mann vorzudringen wagt. Nicht das Gesetz, sondern das Land selbst bestimmt diese Grenze. Wüste ist der Name, den es auf den Landkarten trägt, aber das indianische Wort dafür ist besser. Wüste ist ein schwammiger Begriff für ein Land, das den Menschen nicht ernährt; ob es zu diesem Zweck aufgezäumt oder zugeritten werden kann, ist nicht erwiesen. Ohne Leben ist es aber nie, so trocken die Luft und so tückisch der Boden auch sein mögen.
Das ist das Wesen dieses Landes. Es gibt hier Berge, die abgerundet, plump, verbrannt, aus dem Chaos gequetscht und chromfarben-zinnoberrot gestreift sind und zur Schneefallgrenze streben. Dazwischen liegen ganz plan aussehende Ebenen unerträglich grellen Sonnenlichts oder enge Täler, die im blauen Dunst versinken. Die Berghänge sind von Aschenverwehungen und schwarzen, kaum verwitterten Lavaströmen durchzogen. Nach einem Regen sammelt sich in den Senken kleiner geschlossener Täler Wasser und hinterlässt beim Verdunsten harte, ausgedörrte Flächen reiner Wüstenei, die hier als Trockenseen bezeichnet werden. Wo die Berge steil und die Regenfälle heftig sind, wird der Tümpel nie ganz trocken, sondern nur dunkel, bitter und von kristallisierten Alkaliresten umrahmt. Eine dünne Kruste davon säumt den Morast über einer Vegetation, die weder Schönheit noch Frische besitzt. Auf den breiten Ödflächen, die schutzlos dem Wind ausgeliefert sind, driftet der Sand als Häufchen durch die niedrigen Büsche, und dazwischen zeigt der Boden salinische Spuren. Die Gebirgsskulptur ist hier weniger Werk des Wassers denn vielmehr des Windes, auch wenn die kurzen Regenstürme sie manchmal heftiger entstellen, als sogar mehrere Jahre wiedergutmachen könnten. An allen Wüstenrändern des Westens finden sich Miniaturversuche des berühmt-berüchtigten Grand Cañon, den man, durchquert man das Land nur lang genug, irgendwann auch erreicht.
Da dies Hügelland ist, erwartet man, hier auch Quellen zu finden, nur darf man sich nicht auf sie verlassen; wenn überhaupt entdeckt, sind sie oft brackig und ungenießbar oder unendlich träge Rinnsale in durstiger Erde. Hier findet man das heiße Becken des Death Valley und hohe, wogende Hügelregionen, wo die Luft immer leicht nach Frost riecht. Hier gibt es die langen, starken Winde und atemlose Windstillen auf den geneigten Mesas11, wo Sandhosen tänzeln und in einen weiten, hellblauen Himmel aufsteigen. Hier gibt es keinen Regen, wenn die Erde danach schreit, oder kurze Regengüsse, die wegen ihrer Heftigkeit Wolkenbrüche heißen. Ein Land der verlorenen Flüsse und mit kaum etwas, das man lieben könnte; aber ein Land, zu dem man, einmal besucht, zwangsläufig zurückkehren muss. Wäre es anders, gäbe es wenig darüber zu berichten.
Dies ist das Land der drei Jahreszeiten. Von Juni bis November liegt es heiß, brütend und unerträglich da, ganz krank vor heftigen Unwettern ohne jede Linderung; von da bis zum April kalt, reglos, den kargen Regen und noch kargeren Schnee trinkend; und vom April bis zur heißen Jahreszeit blühend, strahlend und verführerisch. Die Monatsangabe ist nur ganz grob; ob später oder früher, irgendwann kommt wassergetränkter Wind vom Golf her durch das Schleusentor des Colorado, und das Land markiert seine Jahreszeiten durch den Regen.
Die Wüstenflora beschämt uns durch ihre unbekümmerte Anpassung an die saisonalen Beschränkungen. Ihre einzige Pflicht besteht darin, zu blühen und Früchte zu tragen, und sie erfüllt sie entweder selten oder in tropischer Üppigkeit, je nachdem, was der Regen zulässt. Im Bericht der Death Valley Expedition12 steht, dass nach einem Jahr mit übermäßigen Regenfällen in der Colorado-Wüste eine drei Meter große Amarantpflanze gefunden wurde. Im Jahr darauf erreichte die gleiche Spezies am gleichen Ort aufgrund der Trockenheit nur eine Höhe von zehn Zentimetern. Man hofft ja, dass das Land so gedeiht, wie Qualitäten das bei seinen menschlichen Abkömmlingen tun, indem nämlich nicht nur »versucht«, sondern tatsächlich gehandelt wird. Aber nur selten erreicht eine Wüstenpflanze das volle Potenzial ihrer Art. Extreme Trockenheit und extreme Höhe besitzen denselben Hemm-Effekt, weshalb wir in den hohen Sierras und im Death Valley verwandte Arten in Miniaturform finden, während sie bei mittlerer Temperatur zu ansehnlicher Größe heranwachsen. Äußerst einfallsreich sind die Wüstenpflanzen bei Hilfsmitteln gegen die Verdunstung – sie drehen die Blätter hochkant zur Sonne, lassen seidige Haare wachsen oder sondern klebriges Gummiharz ab. Der Wind, der nicht müde wird zu blasen, quält sie und hilft ihnen gleichzeitig. Er häuft um die gedrungenen Stämme Dünen an, die sie umschließen und schützen, und oberhalb der Dünen, die etwa beim Mesquitebaum dreimal so hoch wie ein Mensch werden können, blühen die Äste und tragen Früchte.
Es gibt in der Wüste viele Stellen, an denen sich nur ein paar Fuß unter der Oberfläche trinkbares Wasser befindet, angezeigt vom Mesquite oder einem Büschel Tropfengras (Sporobolus airoides). Es ist die Nähe der ungeahnten Hilfe, die Wüstentode so tragisch macht. Wie es heißt, fand der endgültige Zusammenbruch der armen Reisenden, die dem Death Valley zu seinem furchterregenden Namen verhalfen, an einem Ort statt, an dem unterirdische Quellen die Rettung bedeutet hätten. Aber wie konnten sie das wissen? Entsprechend ausgerüstet, kann man diesen unwirtlichen Einschnitt sicher durchqueren, und doch fordert er jedes Jahr seinen Todestribut und finden Männer dort sonnenverdörrte Mumien, von denen keine Spur oder Erinnerung erhalten blieb. Den eigenen Durst zu unterschätzen, einen bestimmten Orientierungspunkt rechts oder links zu verfehlen oder eine ausgetrocknete Quelle zu finden, wo fließendes Wasser erwartet wurde – für all das gibt es keine Hilfe.
Man ist überrascht, an Quellen oder versunkenen Wasserläufen die feuchtigkeitsliebenden, in nasser Erde üppig wachsenden Pflanzen zu entdecken, aber die wahre Wüste bringt ihre eigenen Varianten hervor, jede in ihrem ganz speziellen Lebensraum. Die Neigung des Abhangs, die Ausrichtung eines Berges und die Beschaffenheit der Erde bestimmen die Pflanze. Nach Süden zeigende Hänge sind so gut wie unbewachsen, und die untere Baumgrenze ist hier eintausend Fuß höher als anderswo. Cañons, die von Ost nach West verlaufen, haben eine kahle Wand und eine, die bedeckt ist.
Um ausgetrocknete Seen und Marschen herum pflegt der Pflanzenbewuchs eine feste, säuberliche Anordnung. Die meisten Arten haben eine klar umrissene Wachstumszone, was der beste Hinweis ist, den das stumme Land dem Wanderer zur Orientierung geben kann.
Solltet ihr aus irgendeinem Grund zweifeln, sei euch hiermit gesagt, dass die Wüste mit dem Kreosotbusch anfängt. Dieser unsterbliche Strauch zieht sich hinunter ins Death Valley und hinauf zur unteren Baumgrenze – stark duftend und heilkräftig, wie schon der Name vermuten lässt, dazu stabförmig und mit schimmerndem Blattgewirr. In einer Wildnis aus grauen bis grünlich weißen Sträuchern wird sein leuchtendes Grün vom Auge dankbar aufgenommen. Im Frühling sondert er ein harziges Gummi ab, das die Indianer hier mit pulverisiertem Gestein vermischen, um an ihre Pfeile Spitzen zu zementieren. Wenn jemand die Möglichkeiten der Pflanzenwelt kennt, dann die Indianer!
Nichts, was die Wüste produziert, drückt sie besser aus als der unglückliche Wuchs der Yuccabäume. Gepeinigte, spärliche Wälder davon stehen trostlos auf den hohen Mesas, speziell in dem Dreieck, das sich von dort Richtung Osten zieht, wo die Sierras und die küstennahen Berge aufeinandertreffen und sich erstere ins südliche San Joaquin Valley13 krümmen. Der Yuccabaum ist voll mit bajonettartigen Blättern, in stumpfem Grün, beim Älterwerden immer zotteliger und mit stinkenden, grünlich blühenden Rispen. Nach seinem Tod, einem langsamen Tod, macht die gespenstische, hohle Gestalt seiner holzigen Skelette, die kaum mehr die Kraft zum Verrotten haben, das Mondlicht zu etwas Bedrohlichem. Bevor die Yuccas aufblühen und noch ihre cremefarbenen, kegelförmigen Knospen tragen, so groß wie ein kleiner Kohlkopf und voll zuckrigem Saft, drehen die Indianer sie geschickt aus ihrem Zaun aus Dolchen und rösten sie zu ihrem eigenen Genuss. Aus diesem Grund sieht man dort, wo Menschen wohnen, nur selten junge Exemplare des Yucca arborensis. Andere Yuccas, Kakteen, niedrige Kräuter, findet man in tausendfacher Ausführung, wenn man von den küstennahen Bergen ostwärts reist. Für den spärlichen Wüstenbewuchs ist keine Kargheit des Bodens oder der Arten verantwortlich, sondern einfach der Umstand, dass jede Pflanze mehr Platz braucht. Soundsoviel Erde muss beansprucht werden, um soundsoviel Feuchtigkeit extrahieren zu können.
Der eigentliche Kampf um die Existenz, das eigentliche Gehirn der Pflanze, ist unterirdisch; oben gibt es genügend Platz für dralles, gesundes Wachstum. Im Death Valley, dem angeblichen Kern der Trostlosigkeit, gibt es fast zweihundert identifizierte Arten.
Jenseits der unteren Baumgrenze, die gleichzeitig die Schneefallgrenze ist, findet man ausgedehnte Flächen mit Piñon-Kiefer14 und Wacholder, gemeinsam dicht am Boden kauernd, dazu Flieder, Salbei15 und verstreute Weymouthkiefern.
Es gibt kein besonderes Übermaß an selbstbefruchteten oder windbestäubten Pflanzen, dafür allerorten den Bedarf an, und Beweis von, Insekten. Wo aber Pollen und Insekten sind, gibt es auch Vögel und kleine Säugetiere, und wo diese auftreten, folgt dann die schleichende, scharfzahnige Sorte, die Jagd auf sie macht. Geht in das Herz eines einsamen Landes, so weit ihr euch traut, nur werdet ihr nie so weit kommen, dass ihr nicht Leben und Tod vor euch hättet. Bunte Echsen schlüpfen in Felsspalten und wieder heraus, hechelnd auf dem weißen, heißen Sand. Vögel, auch Kolibris, nisten im Kakteengestrüpp; Spechte pflegen freundlichen Umgang mit den dämonischen Yuccas; aus der kargen, baumlosen Einöde erklingt die Musik der nächtens singenden Spottdrosseln. Wenn Sommer ist und die Sonne tief steht, ruft der Präriekauz. Seltsam pelzige und verspielte Dinge huschen über die offenen Flächen oder sitzen reglos in den Kommandotürmen der Kreosotbüsche. Der Dichter mag zwar »alle Vögel ohne Gewehr bestimmt« haben,16 nicht jedoch das elfenfüßige, bodenbewohnende und im Verborgenen hausende Kleinvolk der regenlosen Gegenden. Sie sind zu viele und auch zu schnell; wie viele, würde man gar nicht glauben, sähe man nicht ihre Fußspuren im Sand. Fast alle sind sie Nachtarbeiter, denen die Tage zu heiß und zu hell sind. In der Wüstenmitte, wo es kein Vieh gibt, leben auch keine Aasvögel, aber geht man bis weit in diese Richtung, wird man durchaus vom Schatten ihrer angewinkelten Flügel gestreift. Nichts, was so groß ist wie ein Mensch, bewegt sich unentdeckt in diesem Land, und sie wissen genau, wie das Land einen Fremdling behandelt. Manches hier lässt erkennen, wie das Land seinen Bewohnern neue Verhaltensweisen aufzwängt. Die schnelle Sonnenzunahme am Frühlingsende überholt die Vögel manchmal beim Nisten und bewirkt eine Umkehrung der normalen Brutgewohnheit. Es wird nötig, die Eier nicht warm, sondern kühl zu halten. Eines drückend heißen Frühjahrs hatte ich im Little Antelope17 Gelegenheit, regelmäßig am Nest eines Wiesenlerchenpaars vorbeizugehen, das wenig glücklich hinter einem schlanken Grasbüschel platziert war. Brüten sah ich die beiden nur vor Einbruch der Nacht, aber zur Mittagszeit standen oder lagen sie darüber, halb ohnmächtig und mit offenem Schnabel, um ihren Schatz vor der Sonne zu schützen. Manchmal erzeugten beide einen Schatten, mit ausgebreiteten und halb erhobenen Flügeln – bei Temperaturen, die mich schließlich dazu bewegten, ihnen aus reinem Mitgefühl als dauerhaften Schutz ein Stück Stoff zu überlassen. In dieser Gegend gab es einen Zaun, der eine Viehweide umschloss, und entlang seiner fünfzehn Meilen aus Pfählen konnte man sicher sein, in jedem Schattenstreifen ein oder zwei Vögel zu sehen; manchmal den Sperling und den Bussard, mit hängenden Flügeln und geöffnetem Schnabel, in der weißen Waffenruhe des Mittags matt vor sich hindösend.
So man sich anfangs vielleicht fragt, weshalb in dem verlassensten Land, das Gott je geschaffen hat, so viele Bewohner sind, was sie dort tun und warum sie bleiben, fragt man sich das nicht mehr, wenn man selbst dort gelebt hat. Nichts anderes als das ausgedehnte, braune Land selbst ist der Grund für die Zuneigung. Die Regenbogenberge, der zartblaue Dunst und der leuchtende Glanz des Frühlings besitzen den Lotoszauber. Sie betrügen das Zeitgefühl so, dass man dort zwar lebt, aber immer weggehen will – und gar nicht bemerkt, dass man es nicht getan hat. Menschen, die dort gelebt haben, Minenarbeiter und Viehzüchter, werden einem – nicht ganz so schön, aber mit Nachdruck – Folgendes sagen, das Land verfluchen und wieder zurückgehen. Vor allem gibt es die himmlischste, sauberste Luft, die man auf Gottes Erde überhaupt atmen kann. Eines Tages wird die Welt das verstehen, und die kleinen Oasen auf den windigen Berggipfeln werden Zufluchtsort für die Genesung ihrer leidenden, der Behausungen müden Nachkommen sein. Es gibt die Verheißung großer Reichtümer in Goldadern und seltenen Erden, die aber, weit entfernt von Wasserwegen und geeigneten Bedingungen, gar keine Reichtümer darstellen – und trotzdem verfallen die Menschen ihrem Bann und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.
Ihr solltet Salty Williams erzählen hören, wie er achtzehn- und zwanzigköpfige Maultiergespanne von den Boraxmarschen18 nach Mojave19 geführt hat, die Wagen voller Wasserfässer. An heißen Tagen wurden die Mulis so wahnsinnig vor Durst, dass das Klappern der Fässer sie grässliche, entstellte Laute ausstoßen und an ihren Geschirrketten rütteln ließ, während Salty auf dem Fahrersitz saß, die grelle Sonne in den Augen und mit sanfter, unbeteiligter Stimme Flüche der Beruhigung äußernd, bis der Aufruhr sich allein durch die Erschöpfung wieder legte. Entlang des Weges gab es eine Reihe flacher Gräber; man rechnete damit, von jedem neuen Arbeitstrupp, der in der heißen Jahreszeit hierhergebracht wurde, den einen oder anderen einzubüßen. Aber als er seinen Gehilfen verlor, der ohne Vorwarnung bei der Mittagsrast umkippte, warf Salty die Arbeit hin; wie er sagte, reichte es ihm mit dieser »Affenhitze«. Den Gehilfen begrub er am Wegrand mit Steinen, damit ihn die Kojoten nicht wieder ausbuddelten, und sieben Jahre danach las ich die Aufschrift auf dem Kopf brett aus Kiefernholz, deutlich und kein bisschen verwittert.
Aber noch davor fuhr ich auf der Mojave-Kutschroute20 und begegnete Salty, der wieder einmal durch Indian Wells21 kam, sein Gesicht vom hohen Fahrersitz aus gegerbt und rotverbrannt wie ein Erntemond, hoch über der goldenen Staubwolke seiner achtzehn Mulis. Das Land hatte ihn gerufen.
Im fast schon greifbaren Mysterium der Wüstenluft entstehen Legenden, meist von verborgenen Schätzen. So man ihnen glauben will, gibt es hier einen Berg voller Nuggets; einen anderen, der mit unberührtem Silber durchwirkt ist; ein altes, lehmiges Gewässer, aus dem die Indianer Erde für ihre Tongefäße schöpften, die daraufhin mit reinen Goldkörnern verziert waren. Alte Bergleute, die an den Rändern der Wüste herumstreifen und so verwittert wie die gelbbraunen Hügel selbst aussehen, erzählen einem solche Geschichten mit vollster Überzeugung. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Land glaubt man ihnen. Es ist fraglich, ob man nicht lieber von der gehörnten Schlange22 gebissen wird, die sich seitlich fortbewegt und ohne Aufrollen angreift, als von der Legende um eine verborgene Mine.
Und trotzdem – und trotzdem: Will man denn nicht lediglich Erwartungen erfüllen, wenn man beim Schreiben über Wüstenei in die tragische Tonart verfällt? Je mehr man davon wünscht, desto mehr bekommt man auch, und verliert dabei viel ihrer Freundlichkeit. In diesem Land, das am Fuß der Sierra-Ostseite beginnt und sich über immer niedrigere Bergrücken bis zum Great Basin erstreckt, kann man mit großer Begeisterung leben, rotes Blut und erlesene Freuden haben und bei seinen täglichen Verrichtungen ein Gebiet durchqueren, das einem Staat an der Ostküste entspricht – ohne jede Gefahr und entsprechend unserer Denkweise auch ohne große Schwierigkeit. Obwohl die Menschen nicht in die Wüste gingen, um Legenden zu bilden, erfanden sie dennoch den sagenumwobenen Hassayampa, dessen Wasser, so es welches gibt, sie die Dinge nicht mehr als nackte Tatsachen, sondern in der leuchtenden Farbe der Romantik sehen lässt. Ich, die ich in den zweimal sieben Jahren meiner Wanderungen davon getrunken haben muss, kann nur versichern, dass es sich lohnt.
Für allen Tribut, den die Wüste den Menschen abfordert, bietet sie reichhaltige Entschädigung: tiefe Atemzüge, tiefen Schlaf und die Gemeinschaft mit den Sternen. In den Pausen der Nacht fällt einem wieder ein, dass die Chaldäer ein Wüstenvolk waren. Nur schwer entkommt man dem Eindruck der Meisterschaft, wenn die Sterne am weiten, klaren Firmament zu unverdeckten Auf- und Untergängen ziehen. Sie sind groß und ganz nah und sehen aus, als würden sie pochen – als dienten sie einem würdevollen Zweck, der keiner Erklärung bedarf. Indem sie an ihre Himmelspositionen wandern, machen sie das armselige Weltgeschehen bedeutungslos. So bedeutungslos wie dich, der du daliegst und sie betrachtest, und auch den mageren Kojoten, der unweit von dir im Gestrüpp steht und heult, heult, heult.
Wasserpfade des Ceriso
Zum Ende der trockenen Jahreszeit sind die Wasserpfade im Ceriso23 nur noch weiße Bänder durch das geneigte Gras, kaum sichtbar und fächerartig ausgebreitet in Richtung der Heimstätten von Ziesel, Erdratte und Bodenhörnchen. Aber so schwach sie für das menschliche Auge auch sein mögen, sind sie doch deutlich genug für die behaarten und gefederten Wesen, die sie benutzen. Würde man sich auf die Augenhöhe von Ratten und Bodenhörnchen begeben, hätte unsereins etwas vor sich, das man leicht für breite und gewundene Straßen halten könnte, lägen sie nur in dichtem Baumbewuchs von dreifacher Mannsgröße. Es braucht nicht mehr als einen dünnen Strich der Unfruchtbarkeit, um im Wald der Grasnarbe einen Mäusepfad entstehen zu lassen. Für das kleine Volk sind die Wasserpfade geradewegs Landstraßen, mit Fährten als Wegweisern.
Es scheint, als sei die Mannsgröße die unglücklichste aller Höhen, um nach Pfaden zu suchen. Besser ist es, am Hang eines hohen Bergs aufzusteigen, etwa am Vorsprung des Black Mountain24, und von dort in die Mulde des Ceriso zurück- und hinunterzusehen. Merkwürdig, wie lange die Erde Spuren einer kontinuierlichen Begehung bewahrt, sogar nachdem wieder Gras darüber gewachsen ist. Zwanzig Jahre ist es her, dass eine kurze Bergbau-Blüte am Black Mountain für eine Postkutschenstraße durch den Ceriso sorgte, und doch sind die parallelen Linien, die Spuren der Räder, aus der Höhe dunkel und gut ausgeprägt zu erkennen. Ist man aber zu Fuß dort unterwegs, sucht man vergeblich danach. Dementsprechend sind die Wege, die die Wildtiere bei ihrem Gang zur Lone-Tree-Quelle benutzen, von dieser Höhe aus weißlich aufgezeichnet – und das ist genau die Höhe der Bussarde.
Auch im besten Fall gibt es im Ceriso wenig Wasser, und selbst das Wenige ist noch brackig und übelriechend, nur in der Nähe eines einsamen Wacholders, wo der Rand des Ceriso zum niedrigeren Gelände hin abbricht, fließt zwischen üppigem Gras und Brunnenkresse ein ständiges Rinnsal mit frischem, süßem Trunk. In der trockenen Jahreszeit findet sich für eine lange Menschentagesreise kein anderes Wasser. Am östlichen Fuß des Black Mountain gibt es, genau wie nördlich und südlich, die zahllosen Baue kleiner Nager, etwa Ratten oder Bodenhörnchen. Unter dem Salbeigestrüpp sind die flachen Kuhlen der Hasen, und in den trockenen Hängen von Auswaschungen, genau wie zwischen den verstreuten Fragmenten des Black Rock25, die Höhlen von Luchs, Rotfuchs und Kojote.
Der Kojote ist der wahre Wasser-Zauberer – einer, der auch an der kleinsten, nach Feuchtigkeit riechenden Stelle so lange schnüffelt und gräbt, bis er das verborgene Nass aus der Erde befreit hat. Viele Wasserstellen werden nur auf diese Art entdeckt, nämlich vom schlanken Hobo der Hügel und an Orten, an denen nicht einmal ein Indianer suchen würde.
Nach Meinung vieler kluger und geschäftiger Leute verbringen die Hügelbewohner das zehnmonatige Intervall zwischen dem Ende und dem erneuten Beginn der Winterregen ohne Trunk; aber der wahre Müßiggänger, der ganze Tage und Nächte an den Wasserpfaden verbringen kann, wird das nicht unterschreiben. Die Pfade beginnen, wie gesagt, weit hinten und ganz schwach im Ceriso und vereinigen sich an der Quelle zu einem spannbreiten, weißen, festgetretenen Weg. Und warum Pfade, wenn es in diese Richtung keine Wanderer gibt?
Das Land muss ich erst noch finden, das nicht von den schmalen, langen Wegen der Kaninchen und was sonst noch für Pelztierchen gezeichnet ist. Riskiere es, ein einsames Wasserloch zu suchen, und solange die Pfade in deine grobe Richtung verlaufen, halte dich unbedingt an die Karte, aber wenn sie auch nur einen Hauch davon abweichen und auf einen Punkt irgendwo links oder rechts deines Ziels weisen, vertraue ihnen mehr als der Karte oder deinem Gedächtnis; sie wissen Bescheid.
Tagsüber ist es im Ceriso ganz still, und wären da nicht die weiß ausgetretenen Wege, könnte er auch als Wüste durchgehen. Die Sonne ist in der trockenen Jahreszeit heiß, und die Tage sind von ihrem grellen Licht erfüllt. Ab und zu sendet ein unsichtbarer Kojote von irgendwoher ein langgezogenes, schmerzerfülltes Jaulen an sein Rudel, aber vor der Mitte des Nachmittags bewegt sich so gut wie gar nichts. Erst wenn die Bussarde anfangen, über dem Salbei zu kreisen, ist das ein Zeichen dafür, dass das kleine Volk seine Geschäfte aufgenommen hat.
Wie leichtfertig von uns, über wildlebende Tiere zu reden, als würden natürliche Abläufe durch ihre Beschränkungen verhindert. Wenn wir das eine oder andere als Nachtstreuner bezeichnen, heißt das letztendlich nur, dass das, wovon es sich ernährt, im Dunkeln leichter zu bekommen ist und es sich problemlos an Bedingungen anpassen kann, bei denen tagsüber mehr Nahrung vorhanden ist. Und sein gewohntes Verhalten beruht in großem Maß auf einem scharfen Auge, noch schärferen Geruch, schnellen Ohr und der noch besseren Erinnerung an Ansichten und Geräusche, als ein Mensch für sich zu beanspruchen wagt. Sieh zu, wie ein Kojote aus seiner Höhle kommt und sich überlegt, wo er heute töten will. Man kann nicht recht sagen, was ihn zu seiner Entscheidung bringt, aber dass