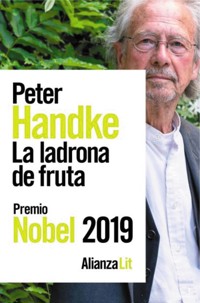8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den hier versammelten, zwischen 1980 und 1992 entstandenen Texten sind die Erfahrungen des Autors beim Lesen, Schreiben und Übersetzen zu verfolgen. Den Leser versteht Peter Handke als »notgedrungenen, lustvollen, freudigen Entzifferer und Gefährten der Bücher, wobei Not, Lust und Freude einander bedingen«. Zu verfolgen ist in diesen »Gesammelten Verzettelungen« also, wie Peter Handke Emmanuel Bove dem deutschen Leser zugänglich macht, wie er das Werk von Jan Skácel, Philippe Jaccottet, Alfred Kolleritsch, Gustav Janus, Nicolas Born und John Berger liest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Handke
Langsam im Schatten
Gesammelte Verzettelungen 1980-1992
Suhrkamp Verlag
Eine Erzählung aus vierzehn und einem Guß
Auf halber Höhe über St. Moritz im Engadin, auf der Terrasse des aufgelassenen Eislaufplatzes bei dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Berghotels »Chantarella«, standen in diesem Winter, bei Tag und bei Nacht, in Sonne, Nebel und Schneefall, mehr als ein Dutzend Riesenfiguren, wie in den großen Kreis da hingewürfelt, und erzählten in der Stille, jede nach ihrer Art und Form, eine von Augenblick zu Augenblick und so fort und so weiter sich ereignende Geschichte (eine der Überlebensgrößen tat das gleichsam hingestürzt, mit jedem Blick wieder wie gerade zur Erde gekracht, und noch eine andre stand im Erzählen nicht aufrecht, sondern in einer Schräge, und eine dritte erzählte fast aus dem Lot geraten). Wovon das Erzählen der dunkelbronzenen, auf Betonsockeln ruhenden, von Betonblöcken rückengedeckten Gestalten handelte, war in keine Wörter-Sprache zu übersetzen, und der Betrachter, als der Gast solcher Gigantenerzählung, empfand das, je länger er in den Zwischenräumen, auf dem Schneefeld umherging, innehielt, aufnahm, mit der Zeit desto kräftiger als ein Glück ‒ als eine Art von Befreiung. Er war hier einmal nicht gezwungen, sich kleinklein etwas erzählen zu lassen, er machte sich, an der Hand, mit der Hilfe der so mächtigstillen wie ihn in Ruhe lassenden »Morphen« seine Erzählung selber ‒ eine, die, statt Sätze und Bilder, nichts war als Materie und Schwung, und die, statt in meiner oder deiner persönlichen Vergangenheit (und das war das »Unerhörte« an dieser Begebenheit mit den Figuren auf der Bergschanze), in einer unpersönlichen Vorzeit und zugleich jetzt spielte, in den Augenblicken, von hier nach dort, da eins jener Wesen im Umkreis sozusagen das andere gab.
Fast als eine Störung dieses wort- und namenlosen, weithin über das Hochtal schwingenden Erzähltakts erlebte es der Teilnehmer, daß dessen Verkörperungen im einzelnen Titel hatten wie Lady Macbeth oder Cromwell, oder Untertitel wie »Si tacuisses …« (hättest du geschwiegen …), oder daß an die in Bronze gegossene Palme, welche gleichsam den Auftakt der großen Erzählung machte, wie ein Lotsenschild eine Schrift angebracht war »I went to Tangiers and had dinner with Paul Bowles« ‒ fast eine Störung, nicht tatsächlich, denn solche nebensächlichen Anekdoten trugen doch bei zur Leichtigkeit des ganzen Spiels?
Es gab keinen Vergleich für diese Vorzeit-Giganten-Erzählung, es sei denn, den einen: In den Bergbächen ragen hier und dort regelmäßig Steinblöcke aus dem Sturzwasser heraus, welches an diesen Stellen, statt als Gischt dahinzubrausen, glatt und durchsichtig darüber hinwegschießt und sich aus dem elementaren Rauschen, Klirren und Tosen auch, wenn man genauer hinhört, als etwas Stimmhaftes heraushebt. Menschenstimmen lassen sich an solch musikalischen Steinen aus dem Fließen heraushören, nicht nur ein Gurgeln und gutturales Zungenschlagen und -schnalzen, sondern ein Murmeln, sich immer wieder aufschwingend zum Singsang, zum Vibrato, einem vielstimmigen Psalmodieren. So ist es mit der Zeit, als seien Felsmasse und Wasser ständig dabei, eine vergessene und verschwiegene Erzählung zu intonieren, stammelnd, begeistert, jeden Moment nah am Verständlichwerden ‒ und dann aber gerade im Unverständlichbleiben, in der Unübersetzbarkeit die Erzählung bedeutend. Und ebenso war es auch mit dem Erzählen der vielgestaltigen Bronzeriesen auf dem Oval der Chantarella-Terrasse ‒ nur daß das Element des Wassers ersetzt war durch das der Luft, und schon das bloße Schauen der Riesenformen, in ihrem Verhältnis zueinander, jenes gleichmäßig-ruhige Stammeln der Erzählung halluzinierte. (Dazu trug vielleicht bei, daß die Formen, so wie die Blöcke im Wasser, nicht skulpturiert wirkten, auch das mit Bedacht Skulpturierte daran hatte den Anschein von Natur, oder Fund, mit Hilfe der Natur.) Und so wie die Stimmen an den Märchensteinen im Sturzbach suggerierte solch Erzählen, ohne besondere Begebenheit, doch so etwas wie ein Sich-Begeben: des stetigen Anfangs, des stetigen ersten Auftritts, und so ging es von Augenblick zu Augenblick weiter, und so blieb es. Erzählen? Ein rhythmisches Beseelen des Gastes der Figuren, kraft deren Vielfalt wie Eintönigkeit, und auch mit der Hilfe, vor allem, der Zwischenräume, Passagen, Durchlässe, wodurch er (der Gast) auf dem Platz hoch über der Talschaft ungezwungen »schön gehen«, »schön dableiben« konnte: Die Figuren ließen ihn auf eine Weise zwischen sich gehen, in Geraden, im Zickzack, in Spiralen, daß die Idee des Labyrinths etwas Schönes wurde. Bald werden diese sanften Machthaber ihre Schanze auf der Chantarella verlassen und wohl einzeln, jeder für sich, in verschiedene Weltrichtungen und -märkte verschwinden: kein Erzählen-Anfangen in Gemeinsamkeit wird dann mehr von ihnen zu erahnen sein wie jetzt noch, im Winter 1990/91, in ihrer Enklave, geld- und geschichtsfern, des Schnees. Aber im Augenblick ändern sich noch mit der Luft die Farben der Güsse, spielen miteinander bei dunklem Himmel über vom Gelbbraun ins Blau; schrumpfen die Formen unter der Sonne, bekommen gemeinsam Schultern im Nebel; bestimmt, was sie allesamt sagen, mit auch die Leere zwischen den fünfzehn (oder vierzehn) Gestalten bei gleichwelchem Licht ‒ dem des Föhns und des Mondes; knistern und knacken und tönen sie von den Flocken, der Mittagswärme, dem Schnaufen der zu ihnen hinaufgestiegenen Besucher. Ein junger Mann, nach dem Umhergehen zwischen ihnen, eine schöne Zeitlang, wandte sich dann um und um, zu den Nachbarhängen, hinauf zum Piz Nair, hinab zum gefrorenen See, und rief immer wieder nach dem Taktgeber (oder Aufspürer?) dieser Erzählung, aus Leibeskräften, ins Leere hinein, gegen die verfallenden Fassaden der Berghäuser: »Julian Schnabel! Julian, wo bist du? Schnabel! Julian!« Und wie lautete dazu des so Gerufenen höchstpersönliches Motto? »Follow the enthusiasm!« Wind kam auf, und aus einer einzelnstehenden, braunglänzenden Bergkiefer, die doch ganz frei vom Schnee schien, staubte plötzlich eine weiße Schwade heraus und schwebte lange noch weiter, glitzernd.
Die Open-Air-Ausstellung »Julian Schnabel-Sculptures« der Galerie Bruno Bischofberger, Chantarella, St. Moritz, Winter 1990/91, Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zürich
Über Lieblingswörter
Jetzt habe ich Camus' zehn liebste Wörter verloren, recht so. Denn erst einmal haben die sicher in deutsch einen grundandern Schein als in seinem Französisch. Und dann ist es eher ein Recht der Jugend, für einzelne Wörter zu schwärmen. Später wird so ein Schwarm gefährlich; je öfter der erwachsene Autor Wörter wie Lieblinge herbeiruft, desto mehr ziehen sie sich mit der Zeit zurück; in der Folge, versteift der Schreiber sich auf sie, stechen sie gar und sterben, oder, anders gesagt, werden gegenstandslos; und kann sein, der Liebhaber stirbt mit ihnen. Ist es Camus selber nicht so ähnlich ergangen? So vernarrt war er in »soleil«, »enfant«, »mer«, daß Sonne, Kind und Meer zuletzt aus seinem Schreiben entschwanden; es blieb nichts mehr zu erzählen als der nachtdunkle monologische »Fall«, la chute, und danach, wie jung war er da noch, nicht einmal mehr die Nacht. Ich sage das aus Mit-Erfahrung. »Heraus aus der Sprache ‒ bleib bei den Dingen, und ihrem Schein!« Eine der Anstrengungen des Schriftstellers ist es vielleicht, nicht dem Magnetismus der Wörter zu verfallen; dieses »Nicht« ist wohl überhaupt das Autor-Zeichen. Die Wörter, anders als für die Sprecher, stehen ihm nicht zur Verfügung; er gebraucht sie jeweils nicht ‒ er entdeckt sie, besser es, das, ein (1) Wort, und nur für jetzt, an dieser einen Stelle im Text, nie zum Weiterleiern. Auch sind die Wörter der deutschen Sprache für unsereinen vielleicht noch gefährlicher als andere; vergiftet ‒ gerade die wesentlichen, ohne die das Poetische nicht auskommt ‒ durch die Geschichte, schlagen sie zurück; wer sich auf sie einläßt, wird möglicherweise von ihnen getötet; aber das Schreiben dessen, der sich nicht auf sie einläßt, gilt nicht? Ich muß mich auf sie einlassen? ‒ Bei allem nenne ich nun doch ein Wort, das ich noch ein paarmal in den Verlauf des Erzählens, wenn sich nur der Moment ergibt, einfließen lassen möchte; ich habe es erst einmal benutzt, nichts als das entsprechende Ding vor Augen, ohne mir einer Ausgefallenheit des Wortes bewußt zu sein, und es ist mir ans Herz gewachsen dadurch, daß ein geschätzter Kritiker es dann lachhaft fand, in seinen Augen fast so verstiegen wie »Kelchschaft«: es ist das Wort »Talschaft«, altes, übliches Wort für eine Gegend aus einer Mehrzahl von Tälern (ich habe es gebraucht für die Talschaft Wochein in Slowenien). Also, Leser, Achtung! ‒ Freilich aber kann ich dies und jenes mir liebe Wort in einer fremden Sprache aufzählen, ich verwende sie, nicht als Schreiber, sondern als Alltagsmensch, noch und noch; zum Beispiel: ataraxia, altgriech., Unerschütterlichkeit; phalatrsnawairagya, wohl indisch?, gefunden beim Lesen vom Mircea Eliade und auswendiggelernt ‒ es bedeutet etwa das gleiche wie das griechische; ecuanimidad, spanisch; und dann natürlich einige slowenische Wörter wie domotožje, Heimweh, oder hrepenenje, Sehnsucht. Solche Litaneien helfen dem Unterzeichneten manchmal halbwegs durch seinen Tag, in seinen Tag.
Langsam im Schatten: Der Dichter Philippe Jaccottet
Die Wahl des Petrarca-Preisträgers für das Jahr 1988 hatte, neben den üblichen Varianten, eine Besonderheit: Keiner von uns vieren, die wir die sogenannte Jury bilden, weder Peter Hamm noch Alfred Kolleritsch, weder Michael Krüger noch ich, kannte den Dichter Philippe Jaccottet, auf den, nach der gemeinsamen Lektüre, bald die Wahl gefallen war, in Person. Ich zum Beispiel wußte nur aus einer kleinen Bemerkung eines französischen Freunds, Jaccottet lebe, nebenher im Brotberuf eines Übersetzers ‒ warum hat übrigens dieses Wort »Brotberuf« solch einen unschönen Beiklang? ‒, in dem Dorf eines südöstlichen Departements, zurückgezogen, hell entschlossen (wieder solch ein Ausdruck, diesmal aber mit einem guten Beiklang, und passend im übrigen für das Werk Philippe Jaccottets), also »hell entschlossen«, sich von keiner, gleich welcher, Veranstaltung der Literaturwelt von seinem Ort, seinem Garten, seinem Haus und seinem Fenster abbringen zu lassen. Nun bin ich gleich nach der Wahl Jaccottets, bevor dieser noch gefragt werden konnte, ob er den Petrarca-Preis annehme, vom Vorsitzenden unserer Viererbande, als die ich uns gerne sähe, freilich nur, was diesen ohnehin befristeten Preis betrifft, zum Laudator bestimmt worden. Im ersten Schrecken war ich einverstanden, aber mir war bald mulmig zumute, aus dem angeführten Grund, und auch, weil vor Jahren, als ich, ausgeschickt nach L'Isle-sur-la-Sorgue in der gleichen Angelegenheit zu René Char, endlich, ohnedies mutlos und wohl in mir gar nicht entsprechendem Gesandten-Tonfall, unser Ansinnen vorbrachte, der argwöhnisch-gütige Dichter mir gleich ins Wort fiel und nur kurz meinte, wie schade es sei, daß ich ihm inmitten eines so freundschaftlichen Gesprächs von nichts als Dingen, Bildern und Wörtern auf einmal mit diesem Preiszeug käme. Noch heute trage ich an jener jähen Grämlichkeit und Enttäuschtheit im Gesicht René Chars, nach der ich mich, wenn auch nur für Momente, als unerwünschter Besuch fühlen mußte. So war es diesmal eine Erleichterung, als wir über einen Vermittler erfuhren, daß Philippe Jaccottet zumindest nichts gegen unseren Preis hatte; allerdings sogleich wieder die Bedenken, kam sein Einverständnis nicht eher aus einer Art Amor fati oder aus der Höflichkeit des Weisen als aus der besonderen Person? Hier wurde nun zum ersten Mal die Frage nach dem uns unbekannten Menschen Philippe Jaccottet gestellt, und zwar an einen Mann, der an dem Tag der Wahl später noch dazukam und, wie sich herausstellte, mit dem Dichter manchmal Umgang hatte. Wir hätten vielleicht nicht fragen sollen; denn die Antwort, im übrigen bestimmt von scheuer Begeisterung für den, um den es ging, widersprach oder, genauer gesagt, verengte das Bild, das, jedenfalls in mir, bei der Lektüre der Poeme und Prosastücke Jaccottets ohne meinen Willen entstanden war. Das vordringlichste der Charakteristika, welche der Gefragte gebrauchte, war nämlich: »Ein Zen-Mönch.« Unsere schematischen Zen-Mönch-Vorstellungen und die wohl nicht viel wahrhaftigeren Impressionen einmal beiseite: Es ist mir noch nie recht gelungen, einen Künstler sozusagen hauptpersönlich als einen buddhistischen Mönch zu sehen (als einen christlichen freilich noch weniger, weder Hieronymus Bosch noch Hugo van der Goes ‒ nicht einmal den Fra Angelico).
Zwar gehörte jener japanische Cineast, dem es vielleicht als dem einzigen gelungen ist, Stille im Film nicht als Ankündigung einer Bedrohung oder als Nachhall einer Katastrophe, sondern als die größere oder große Gegenwart erscheinen zu lassen, Yasuhiru Ozu, extern einer Klosterbruderschaft an, aber all seine Familienszenen (die auch darum so universell und gegenwärtig wirken, weil sie frei oder leer von jeglicher Szene sind) werden in der Regel geerdet durch das immerwiederkehrende Trinken des Sake, und ebenso ist es bei dem japanischen Erzählmeister Yasushi Inoue, auch er angeblich Angehöriger von etwas wie einem dritten Zen-Orden und gewiß einer der ganz seltenen, dem der Leser die Erleuchtungen nachleben und nachdenken kann, indem sie bildhaft an den Sinnendingen, dem Mond, den Azaleen, dem bei dem eigenen Feuerwerk sich keinmal zum Himmel hebenden Kopf eines Feuerwerkers, erfahren und mit keiner anderen Absicht, als davon gewissenhaft zu berichten, niedergeschrieben sind: Bei allem Filigranen, allem Abstandhalten und -wahren, sind bis heute kaum so welt- und körperverstrickte Mann-Frau-Geschichten erzählt worden wie etwa im Stierkampf, in der Eiswand, oder in den Höhlen von Dun-Huang dieses Zenbuddhisten Iasushi Inoue, der als Hauptperson eben doch Schriftsteller ist …
Doch nun habe ich, im Versuch einer Annäherung an die Person Philippe Jaccottet, gerade auf meinem Umweg über die beiden japanischen Künstler, ein wenig von der Leichtigkeit des Anfangs verloren. Vielleicht eine kleine Glosse als Brücke dahin zurück und auch zurück zu uns nach Europa: Vor Jahren las ich ein paar Kriminalromane eines niederländischen Schriftstellers. Und in dessen Biographie war angegeben, er habe als junger Mann eine Zeitlang als eine Art Novize in einem japanischen Kloster gelebt (schon wieder bin ich da!); seine Weltsicht und seine Schreibweise seien von jenen fernöstlichen Erfahrungen beeinflußt. Der Leser schlug die Bücher, auch das zweite und dritte, mit Neugier auf und war am Ende ein jedes Mal enttäuscht, beim letzten dann gar ergrimmt. Das zuletzt Empörende an all den Geschichten war weniger, daß sie keine wie auch immer beschaffene »Weltsicht« offenbarten, sondern eher, daß sie eine Sicht oder auch nur den Blick auf gleichwelche Welt verstellten, verstümmelten, ablenkten und vernichteten, weil die Dialogsätze pausenlos Witze, die erzählenden ein Springen von Bild zu Bild, und die reflektierenden jeweils lückenlos Glied einer Begründung zu sein hatten. Die Folge: im Witzzwang Verlust der menschlichen Körperlichkeit; im Bildzwang Wegblenden der Einzel-Dinge und Verlust jeder Räumlichkeit; im Beweiszwang und Psychologisieren der übliche Kleinkrieg gegen das stille offene Denken der Phantasie. Vielleicht bin ich mit solch einem Satz auch schon nah an diesen Zwängen und helfe mir jetzt heraus mit einem Satz von Philippe Jaccottet: »Vielleicht ist Stille nur ein anderer Name für Raum.«
Ja, und nun kann ich endlich ganz zu dem kommen, um den es hier geht, obwohl das Wesentliche an ihm schon bei der Betrachtung der beiden japanischen Meister mitspielte, und auf andere Weise, als das Gegenbild, in der Kritik an der Vorgehensweise des holländischen Schriftstellers. Was Jaccottet in den etwa vierzig Jahren seiner dichterischen Arbeit geschaffen hat, ist nämlich gerade ein Gewährenlassen, Zur-Geltung-Bringen und In-Schwebe-Halten: der Räume, der Dinge, der Stille und vor allem des uns umgebenden Lichts (in Abwandlung einer im Spaziergang unter den Bäumen als Beispiel höchster, das heißt bilderloser Kunst zitierten Gedichtzeile Hölderlins: »Und mit Gerüchen umgaben Bäum' uns«). Wie aber schafft Philippe Jaccottet solch ein Gerechtwerden, solche ‒ in seiner angemessen lakonischen Sprache ‒ justesse, angesichts seiner Welt, die bei ihm einmal »die Welt der wunderbaren Ungewißheit« heißt? Was ist seine Weise?
Als Hauptantrieb seiner poetischen Aktivität erscheint mir ein energisches Sich-Nichteinmischen in den Gegenstand, ein entschlossenes In-Ruhe-Lassen (auch um die eigene »ewige Unruhe« zu stillen). Der Ausgangsort eines jeden seiner Texte ist das: »Höre! Schaue! Schweige!« Hör das Schrillen der Schwalben über den Häusern. Heb den Kopf zu ihrem Kurven im Himmel. Entsprich mit deinen Sätzen und Strophen dem Schweigen, das beides in dir erzeugt, und das doch gerade der Anfang zu deinem Schreiben ist. Der Dichter Jaccottet hat, wie er es im Spaziergang unter den Bäumen einmal ausdrückt, als »Entzifferer« angefangen, ist aber im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte davon abgegangen und zum bloßen »Diener des Sichtbaren« geworden: »das bloße Nennen der sichtbaren Dinge, in einem Schwebezustand zwischen Anspannung und Abgelöstheit, (welches) von meinem Geist zur Welt hin ein unsichtbares Netz knüpfte …, dank dessen die Welt, indem sie aufhörte, mir feindlich zu sein oder auch nur sich zu entziehen, mir Beistand, Aufenthalt und Schatz wurde.« Die reinen Namen also? Nein, »das Gebet des Namens«, wie Jaccottet dazu einen indischen Dichter des 17. Jahrhunderts zum Zeugen beruft.
Hier ist jetzt ein letzter kleiner Umweg angebracht, in dem Sinn jenes Satzes wieder aus dem Spaziergang, der lichtesten aller Poetiken dieses Jahrhunderts: »Ich mußte weitermachen, durfte keinen Umweg unbegangen lassen.« Es ist, auch in den ernsten Zeitungen, üblich geworden, von ‒ gleichwie ‒ öffentlichen Personen so etwas wie Psychogramme umlaufen zu lassen. Meister des journalistischen Metiers fingern da ihrer Leserschaft mit geübten Griffen aus der Alltagspsychologie die Charakterzüge eines gerade aktuellen Menschen auf. Das hat sich längst eingebürgert bei Politikern und Sportlern, ist in der jüngsten Zeit aber auch eine Methode bei Kulturjournalisten geworden, gegenüber ‒ sagen wir einmal für diese vielfältigen Leute, für die ich keinen Namen habe ‒ »unsereinem«. Wie fragwürdig dergleichen auch ist, so kann es doch hin und wieder recht sein, wenn die Person einmal die Hauptsache ist, sei es in ihrer Art des Auftritts oder ihrem Abtreten, dem Tod. Unrecht jedoch (ein sehr mildes Wort) wird daraus, sowie ein derartiges Psychogrammieren losgeht auf die einzelne Arbeit. Dieser ‒ wie es mir jedenfalls vorkommt ‒ neumoderne Feuilletonistenzug ersetzt die Kritik an der Sache vollständig durch das Psychologisieren, welches ausschließlich ein Psychiatrisieren ist, exekutiert von selbsternannten Gerichtsgutachtern, und ausschließlich in der Absicht, die jeweilige Person als Schuldigen, als Delinquenten erscheinen zu lassen und seine Sache, statt als das aus ihm Hervorgekehrte, von ihm Erarbeitete, als bloßes Beweisstück, als ein nur das Gericht angehendes corpus delicti. »XY hat dieses Ding nur deswegen gedreht, weil er …« (folgt das psychiatrische Gutachten). Was da eingerissen ist, betrifft mich, wann immer ich darauf stoße, auch wenn es um andere geht, schmerzhafter als zum Beispiel jene eselige Brücke »Leben ‒ Werk« in dem beliebten Mozartfilm, wenn das Gezeter der dummen Künstler-Schwiegermutter übergeht in die schrillen Töne der Königin der Nacht: Hier geschieht, unter dem Vorwand der Aufklärung, fortgesetzt Tabuverletzung, und dieses verletzte Tabu, auch wenn ich selber nicht betroffen bin, verwundet etwas tief in mir, und revoltiert mich, mag ich mir auch immer wieder vorsagen, daß es statt dessen Teil der Arbeit von unsereinem wäre, solch ein Tabu förmlich wiedereinzusetzen und, ja, frisch zu weihen.
So habe ich jedenfalls, über diesen Umweg, versucht, mir ein Psychogramm vorzuspielen, wie es solch ein neuer Meister der Seelenkunde, allein aufgrund der »einschlägigen« Lektüre, gegen die ihn (und uns) unbekannte Person des Philippe Jaccottet ausstellen könnte. Nein, da ist nichts zu versuchen, dieses Spiel bleibt für mich ein Verbotenes; und außerdem würde es durch die Arbeit Jaccottets, Zeile für Zeile, schon im Ansatz entkräftet: das Zaghafte oder Zagende, das so jemand da herauslesen könnte, hat doch ‒ und das macht das Spiel gleich unmöglich ‒ jedesmal seine Form und erscheint dergestalt gewendet und aufgehoben in etwas Allgemeines, Gesetzmäßiges ‒ das vermeintliche Zagen als jenes sanft-gebieterische Zögern und Sichzeitnehmen des Poeten, als eine durch die Schrift erst geschaffene Haltung des Abstands, der Scheu und der Geduld ‒ wenn das »Zagheit« sein soll, so habe ich mir beim Lesen der Gedichte einmal gedacht, dann ist es eine wunderbare. »Reden ist also schwer, wenn es Suchen ist … was suchen?« heißt es in einem, und in einem anderen: »Suchen wir eher außer der Reichweite …«
Und ebenso unmöglich wäre es, aus den Büchern Jaccottets etwa das Konterfei eines schwärmerischen Individuums herauszuzerren; die Satzteile, welche zu solch einem Verdacht den Anlaß gäben, könnten allein grammatikalisch gar nicht so dastehen ohne den ergänzenden, widersprechenden, vielleicht selbstkritischen, jedenfalls ernüchternden anderen Satzteil. Und wieder wird durch die poetische Sprache das Als-ob-Schwärmerische, das Als-ob-Persönliche gelichtet und gelüftet, zum Beispiel oder zum Gleichnis: in diesem Fall zu Beispielen für die uns vielleicht allen gemeinen Momente des Aufschwungs, durchkreuzt schon im Erleben von der »ewigen Enttäuschung« (wie das Patricia Highsmith genannt hat). »Ich empfand das Glück einer Neugeburt, aber ich war nicht weise genug, sie geheimzuhalten« ‒ so steht es im Spaziergang unter den Bäumen.
Und schließlich: »Entlarvt« oder »verrät« ‒ beliebte Kulturseitenwörter ‒ sich dieser Jaccottet in seinen Texten nicht als ein völlig passives Individuum, welches Tag und Nacht, sommers und winters, nichts tut, als aus seinem Fenster zu schauen, welches einmal gar zu »unserem Schatz« stilisiert wird, nichts tut, als auf die Vögel, den Wind und die Bäume zu hören? Gerade daß er, laut eigenen Angaben, einmal kurz vor die Tür tritt, um Holz zu hacken! Und was heißt »La promenade sous les arbres«? Als wir uns das Buch dieses Titels vornahmen, ist uns kein einziges Mal die Vergegenwärtigung eines richtigen Spaziergangs unter die Augen gekommen! Muß da nicht der Verdacht geäußert werden, daß dieser Kontemplationist und Ich-Sager nicht einmal aktiv-gewandert ist, sondern einfach so mit den Augen, und mit der Hand über bloßes Papier?
Jetzt aber im Ernst: Philippe Jaccottet hat es, anders als die meisten von uns, durch seine zarteste Aktivität, jene des Formgebens ‒ Ruck der Begeisterung von der Sache und langausdauerndes Maßnehmen ‒, erreicht, daß die von ihm geschaffenen Dinge von der Person des Poeten, des Machers, kein Bild, nicht einmal einen Umriß oder einen Schatten geben. Vollkommen übergegangen in Sprache, ist er der unsichtbare Dritte, und lehrt, ohne es zu wollen, den Lesenden anhand der Probleme, von denen er so vollkommen spricht, und der Fragen, die er so durchlässig stellt, was der Künstler oder, warum nicht, Dichter in seiner Arbeit ist: der gesetzmäßige Mensch, ohne Stimmungen und ohne Launen.
An einem Vergleich mit jenem anderem, der immer wieder zu Jaccottets Vorfahren gezählt wird, sei das kurz verdeutlicht: Senancour und dessen Oberman. Ich denke, daß die scheinbaren Gemeinsamkeiten geradezu Gegensätze sind. Jenes Ich namens Oberman ist ein empfindsamer Einzelner, der Sprecher bei Jaccottet aber ein empfindlicher Allgemeiner, und ich bestehe auf dem Unterschied zwischen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit, mag das auf den ersten Blick auch spitzfindig wirken. Oberman überläßt sich seinen Launen und wird dadurch zum Typus, abhängig von den jeweiligen Landschaften, den Jahreszeiten und besonders dem Licht ‒ in einer unteren Spielart: dem Wetter; und sein Autor gibt diesen zahllosen Stimmungssprüngen seines zweiten Ich unter einem jetzt wolkenlosen, jetzt bewölkten Himmel jedesmal fast eifrig nach. Auch bei Jaccottet meldet sich immer wieder dieses zweite, lichtabhängige Ich, zum Beispiel in den folgenden Zeilen der Gedanken unter den Wolken: »Es ist wahr, all diese Tage hat man kaum die Sonne gesehen, / unter so viele Wolken zu hoffen, ist weniger leicht …«. Dann jedoch, anders als Oberman, erkennt er seine Abhängigkeit, und die Tätigkeit des Gedichtes wird es, sich davon loszusagen; der Laune abzuschwören: »Wie wenig Kraft müssen wir haben / daß wir aufgeben, nur weil die Sonne fehlt … / Wie kindisch müssen wir geblieben sein / uns vom Blau des Himmels gerettet zu glauben / und bestraft von dem Gewitter oder der Nacht.« Es gibt geradezu eine Regel der drei Schritte in den Poemen Jaccottets, vor allem den späteren: Lobpreis des sichtbaren, äußeren Lichts; Einverständnis mit der Nacht und Finsternis; Anruf des unsichtbaren Lichts: »Das Wasser, das man nicht trinken wird, das Licht / das diese zu schwachen Augen nicht werden sehen können, / ich habe den Gedanken daran noch nicht verloren …« Ebenso wird man, anders als bei Oberman, von dem Sprecher Jaccottets nie auch nur einen Ansatz des Jammerns, des Sich-Beschwerens, Sich-Beklagens finden; mag es um das Altern gehen, oder um einen geliebten sterbenden Menschen: die Stimme, die spricht, bleibt sozusagen ohne jeden Tonfall, ohne Schwankung, ist die der Klage selbst, de profundis, wie etwa zu jenem alten Sterbenden: »In dem / wieder zu groß gewordenen Bett, / Kind ohne die Zuflucht zu den Tränen.« Man könnte demnach den bei Philippe Jaccottet am Ende immer das Wort Behaltenden, den Akteur, den an der Sprache Tätigen, anders als Senancours zweites Ich Oberman, das »Dritte Ich« nennen ‒ eben der Künstler als der gesetzmäßige, von Launen freigedachte allgemeine Mensch.
Aber es sind doch aus den Texten zwei Rückschlüsse möglich (und hier nötig) ‒ nicht auf die Besonderheiten des Individuums, sondern des Künstlers Philippe Jaccottet: der eine kommt aus der Geographie, der andre aus der Historie (der Künste), und recht bedacht, gehören beide zusammen. Jaccottet ist Schweizer, geboren im Kanton Waadt, aufgewachsen in Lausanne am Genfer See ‒ von daher vielleicht die Vergleiche mit Senancour? Jedenfalls hat seine Poesie gemeinsame Wesenszüge mit einigen großen Schweizer Autoren dieses Jahrhunderts. So fiel mir bei dem, was mir als seine »wunderbare Zagheit« erschienen ist (besser wäre wohl das Wort »Zögern«), immer wieder die freilich mit grundanderer Gebärde auftretende Bedächtigkeit Ludwig Hohls ein und vor allem dessen Verwerfen des schreiberischen »Übermuts«. (Nur kein Übermut ‒ der war für Hohl geradezu ein Dichtfrevel.) Keine einzige sozusagen übermütige Stelle ist auch bei Jaccottet zu finden, höchstens »ein nicht immer sicherer, doch von Begeisterung beflügelter Gang«, der, gemäß einer anderen Gedichtzeile, vielleicht um einen Schritt vorankommt, indem er, nach und nach, »den Schmerz vermischt mit dem Licht«, von dem wir aber, so in jener Klage um den Sterbenden, nicht erwarten sollen, daß er »das Licht vermählt mit diesem Eisen«. Wie verschieden ist solche Haltung doch zu der unseres alten Goethe, dessen West-östlicher Divan