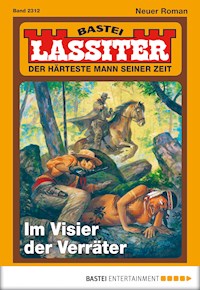
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Das Haus der Witwe Mayfield lag in nächtlicher Schwärze, als die vier Männer durch das Kellergitter in das vornehme Anwesen eindrangen. Sie trugen langläufige Waffen bei sich und bewegten sich mit äußerster Wachsamkeit. Vor der Treppe hinauf zum Erdgeschoss machten sie Halt und schauten sich nach ihrem Anführer um. Der Mann im schmal geschnittenen Gehrock machte eine ungeduldige Handbewegung und erklomm die ersten Stufen. Er schritt weiter bis zur Kellertür, lauschte daran und drückte sie behutsam mit dem Knie auf. Plötzlich drang leiser Gesang zu den Männern hinunter. Es war der Gesang der Todgeweihten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Im Visier der Verräter
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Taylor/Bassols
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-3861-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Im Visier der Verräter
Das Haus der Witwe Mayfield lag in nächtlicher Schwärze, als die vier Männer durch das Kellergitter in das vornehme Anwesen eindrangen. Sie trugen langläufige Waffen bei sich und bewegten sich mit äußerster Wachsamkeit.
Vor der Treppe hinauf zum Erdgeschoss machten sie Halt und schauten sich nach ihrem Anführer um. Der Mann im schmal geschnittenen Gehrock machte eine ungeduldige Handbewegung und erklomm die Stufen zur Kellertür, lauschte daran und drückte sie behutsam mit dem Knie auf.
Plötzlich drang leiser Gesang zu den Männern hinab.
Es war der Gesang der Todgeweihten …
Die Gestalt war schmal und stand in dichtem Nebel. Sie erinnerte Monaseetah an die Silhouette eines abgestorbenen Baumstamms, den sie einmal im Morgengrauen in den Sümpfen erblickt und der sie zu Tode geängstigt hatte.
Der tote Stamm hatte sich nicht bewegt. Die Gestalt jedoch tat es.
Sie glitt immer weiter auf Monaseetah zu, die mit ihren Füßen im Schlamm stand und sich aus unerfindlichen Gründen nicht rühren konnte. Das Herz schlug der Cheyenne bis zum Hals.
»Mutter«, sagte die Gestalt und streckte die Hand nach ihr aus. »Mutter, wo bist du gewesen?«
Ehe die feingliedrigen Finger der Gestalt Monaseetah jedoch berührten, schrak sie in ihrem Bett auf. Das Nachthemd klebte auf ihrer schweißnassen Haut. Sie spürte den kühlen Luftzug, der um diese Jahreszeit durch die Fensterritzen kroch und wie ein Todeshauch nach ihr griff.
Seit fünf Monden schon erschien ihr Yellow in ihren Träumen.
Die dunkelhaarige Cheyenne-Squaw stand auf, schlüpfte in die beiden Pantoffel, die sie von ihrer Dienstherrin erhalten hatte, und lief zur Kommode hinüber. Sie zog die oberste Schublade aus dem Möbelstück, nahm zwei heruntergebrannte Kerzenstumpen daraus hervor und setzte sie vor sich ab. Als sie ein Zündholz anriss, fiel flackernder Lichtschein auf die Kommode.
Hinter den Stumpen befand sich eine Art Totenschrein. Er war aus geflochtenen Graszöpfen zusammengesteckt, die sich kreisrund um die verblasste Ambrotypie eines Indianerknaben rankten. Rechts und links des Bildnisses lagen Messer und Perlenschmuck, davor ein Brief in englischer Sprache und das dazugehörige Kuvert. Die Kerzenstumpen hüllten den Schrein in tanzendes Zwielicht.
»Yellow«, flüsterte Monaseetah und schloss die Augen. »Yellow Swallow, ich rufe dich!«
Monaseetahs Sohn war vor etwas mehr als fünf Wintern zu Tode gekommen, nicht weit entfernt von Harrisburgh, Pennsylvania, durch die Hand einer Weißen. Sein Tod war ungesühnt geblieben. Der Sheriff hatte Yellows Mörderin nach einer halben Stunde wieder auf freien Fuß gesetzt.
Wäre Yellows Vater ein unbedeutender Mann gewesen, Monaseetah hätte sich mit dem Gedanken getröstet, dass die meisten Morde an den Angehörigen ihres Volkes aus Hass und Niedertracht geschahen. Sie hätte am Grab ihres Sohnes sitzen und trauern können, und nichts hätte diese Trauer gemindert außer der Einsicht, dass ein Indianerleben weniger galt als das eines Hundes.
Doch Yellows Vater hatte die Schlacht am Little Bighorn angeführt.
Sein Vater war General George Armstrong Custer.
Yellow Swallow, ich rufe dich …
Die zuvor geflüsterten Worte der Indianerin gingen in meditierendes Sinnen über, mit dem sich Monaseetah von ihrem Körper löste und in die Welt ihrer Ahnen eintrat. Sie begegnete dem ehrwürdigen Sitting Bull, der stumm in seinem Tipi saß und lediglich die Hand zum Gruß hob. Er hatte sie unzählige Male getröstet, als sie gebrochen vor Kummer an Yellows Grab draußen im Garten gesessen hatte.
Mutter …
Die Umrisse ihres Sohnes schälten sich aus der Dunkelheit und wurden zu jenem stattlichen jungen Mann, als den Monaseetah ihn in Erinnerung hatte. Die Züge des Cheyenne-Kriegers waren ebenmäßig und glatt und verströmten friedliche Ruhe.
Yellow …
Ohne ein weiteres Wort traten sie aufeinander zu und fassten sich bei den Händen. Sie waren eins für einen Augenblick, spürten den Herzschlag und den sich hebenden Brustkorb des anderen. Die Indianerin fühlte mit ihrer ganzen Seele, dass sie ihren Sohn so vor sich hatte, wie er gestorben war. So unbescholten und rein wie zu dem Zeitpunkt, als ihn die Kugel von Elizabeth Custer getroffen hatte.
Gräm dich nicht, Mutter.
Wie ein flüchtiger Schatten verschwand Yellow aus Monaseetahs Blickfeld und wich einem schlichten Holzsarg, in dem der zerschossene Leib eines Stammeskriegers lag. Die Hand des Toten ruhte auf dem Sargrand und troff vor Blut. Sie hatten Yellow im Totenhaus aufgebahrt, aber außer Monaseetah war niemand erschienen, um von ihm Abschied zu nehmen.
Es war Notwehr, Ma’am.
Mit diesem Satz hatte der Sheriff von Harrisburgh ausgesprochen, worüber sich sämtliche Wochenschriften in Pennsylvania seit Tagen einig gewesen waren. Die Witwe von Elizabeth Custer hatte Monaseetahs Sohn in Notwehr erschossen. Sie hatte vier Kugeln in seine Brust gefeuert, nachdem Yellow mit einigen Männern in ihr Anwesen eingedrungen war.
Von Custers Schuld hatte nichts in den Artikeln gestanden.
Kein einziger Schreiberling hatte es gewagt, über jenes Gerücht zu schreiben, das in den Monaten zuvor durch die Rauchsalons und Sitzungssäle von Washington D. C. gegeistert war. Nicht mit einem Satz hatte man die heimliche Romanze erwähnt, die Monaseetah und General Custer am Washoe River verbunden hatte und deren einziges verräterisches Zeichen die Geburt von Yellow Swallow gewesen war.
Es war Notwehr, Ma’am.
Der bedauernde Blick des Sheriffs hatte Bände gesprochen und jede Hoffnung Monaseetahs auf Gerechtigkeit zerschlagen. Sie hatte noch im gleichen Augenblick gewusst, dass ihr Sohn als lausiger Verbrecher beerdigt und sein Andenken von dieser Erde getilgt werden würde. Sie hatte gewusst, dass zum Schluss die rachsüchtige Witwe von Custer triumphieren würde.
Stumm schob Monaseetah die brennenden Kerzenstumpen vor das Bildnis ihres Sohnes. Sie stimmte eine indianische Weise an, die vom Kojoten handelte, der einen toten Hasen am Wegrand fand. Über ihre Wangen liefen Ströme bitterer Tränen.
Plötzlich krachte ein Stiefeltritt gegen die Kammertür.
Das Türbrett flog auf und schlug schallend gegen die Wand. Auf der Schwelle stand ein Mann mit einem Gewehr und funkelte die Indianerin finster an. Er hatte vier oder fünf Begleiter bei sich, die hinter ihm in der Finsternis warteten. »Bist du Monaseetah?«, knurrte er und schwenkte das Gewehr auf sie. »Custers verdammte Cheyenne-Braut?«
Monaseetahs Gedanken sprangen zu dem Army-Colt, der unter ihrem Kopfkissen versteckt war. Würde es ihr gelingen, ihn zu erreichen?
»Gib uns Antwort!«, knurrte der Fremde auf der Schwelle. »Bist du’s oder nicht?«
Unmerklich ging Monaseetah in die Knie und streckte die Finger nach dem Kopfkissen hinter ihrem Rücken aus. Sie schüttelte den Kopf und lächelte höflich.
Dann riss sie den Revolver hoch.
***
Das Wrangler’s Inn im Herzen von Miles City war nicht nur wegen seines herausragend guten Whiskeys berüchtigt, sondern bot jeden Abend die schönsten Cancan-Tänzerinnen auf, die man in diesem öden Teil Montanas zu Gesicht bekommen konnte. Die Shows fanden um acht und zehn Uhr am Abend statt und füllten den zweistöckigen Holzbau oft bis auf den letzten Platz. Den geschickten Verhandlungskünsten seines Besitzers Lou Morgan verdankte das Etablissement, dass selbst namhafte Sängerinnen von der Ostküste zwischen den leicht bekleideten Tänzerinnen auftraten.
»Miss Samantha Scott!«, verabschiedete Morgan an diesem Abend seine jüngste Errungenschaft. Er breitete die Arme aus und genoss den aufbrandenden Beifall. »Die Rose aus Boston! Der Schmetterling vom Charles River!«
Die anwesenden Rindertreiber und Viehhändler jubelten abermals und pfiffen der braunhaarigen Schönheit neben Morgan zu. Die junge Frau mit dem gelockten Haar und dem prall geschnürten Dekolleté bedankte sich mit einem artigen Knicks und ging zur Seite über eine Treppe ab. Sie schien in Eile zu sein, nahm man die Geschäftigkeit zum Maßstab, mit der sie sich ihres Kostüms entledigte. Sie war bereits bis auf den Unterrock entkleidet, als sie in ihrer Garderobe anlangte.
Hinter der Garderobentür wartete ein Mann auf sie. Er war groß gewachsen und breitschultrig und zögerte nicht damit, auch die restlichen Sachen von Samanthas Leib zu reißen. Die Sängerin wehrte sich nicht, sondern stöhnte auf und warf sich ihm mit wogendem Busen in die Arme. Sie strahlte ihren Liebhaber aus funkelnden Augen an. »Wie lange ist es her, Lassiter? Zwei Jahre? Drei vielleicht?«
Der Mann mit dem dunkelblonden Haar wusste keine Antwort und küsste die Sängerin leidenschaftlich. Er glitt mit den Händen an ihrem schlanken Leib hinab und verharrte zwischen ihren Schenkeln. »Wen kümmert’s, Sammy? Ich bin froh, dass wir wieder zueinander gefunden haben.«
»Du hättest mich in Billings nicht zurücklassen dürfen.« Sie wandte das Gesicht ab. »Sieh nur, was aus meiner Jugend geworden ist!«
»Du bist ebenso schön wie damals«, versicherte Lassiter und liebkoste die Sängerin. »Uns bleiben nur ein paar Stunden.«
Der Mann der Brigade Sieben war der schönen Bostonerin vor Jahren bei einem Auftrag in Billings begegnet. Er hatte damals einer Bande von Viehdieben nachgespürt, die sich an der transkontinentalen Eisenbahnstrecke herumgetrieben hatte. Als er einen der Männer nach einer Schießerei festnahm, war Samantha mit einigen Frauen auf der Straße gewesen. Die Sängerin hatte ihm schöne Augen gemacht, und in der Nacht darauf war eins zum anderen gekommen.
»Mehr als genug Zeit!«, hauchte Samantha und räkelte sich vor ihm im Bett. Sie schloss die Augen und legte den Kopf zurück. »Ich musste auf der Bühne ständig an dich denken. An dich und deinen …«
Blind fasste ihre rechte Hand nach Lassiters Hosenbund und ließ den Knopf daran aufspringen. Sie glitt unter das raue Rindsleder und griff nach seinem steifen Pint. Als Samantha die pralle Männlichkeit unter den Fingern erfühlte, stöhnte sie lüstern auf.
Lassiter streifte die Hose ab, warf sich zwischen Samanthas Schenkel und fing sein Gewicht mit den Armen ab. Sein Gesicht schwebte über dem ihren. »Auf der Bühne solltest du an vernünftigere Dinge denken.«
»Wie könnte ich!«, seufzte Samantha und zuckte bei seinem ersten Stoß zusammen. Sie zog die Schultern zurück und erschauerte wohlig. »Mach schon … Gib’s mir kräftiger!«
Die Garderobenkammer schallte vom rhythmischen Keuchen wider, das Lassiter und seine Geliebte verband und sie für eine gute Viertelstunde in Bann schlug. Sie wechselten einige Male die Stellung, teils im Eifer ihrer Lust, teils auf Drängen von Samantha. Zuletzt kniete die Sängerin vor Lassiter und reckte ihm ihren wohlgeformten Po entgegen.
»Halt still!«, ächzte Lassiter und umgriff die porzellanweißen Backen mit beiden Händen. Er legte den Kopf in den Nacken und zwang sich zur Ruhe. »Sonst kommt es mir.«
Als hätte sie seine Worte nicht gehörte, setzte Samantha das betörende Schauspiel fort. Sie drückte den Rücken durch, presste ihren Po fest gegen Lassiters Lenden und fasste sich erregt zwischen die Schenkel. »Noch einen Stoß, Lassiter, nur noch einen! Ich schwöre dir, ich … ich …«
Weiter kam die Sängerin nicht. Sie fuhr am ganzen Körper zusammen und wurde von peitschenden Lustwellen heimgesucht. Sie kam mit solcher Wucht zum Höhepunkt, dass Lassiter sie stützen musste, während eine Woge nach der anderen durch ihren schlanken Körper brandete. Dann sank Samantha auf die Kissen und blieb erschöpft liegen. »Was ist mit dir, Lassiter?«
Im nächsten Moment erübrigte sich die Frage.
Ein tiefes Stöhnen entrang sich Lassiters Kehle und kündete seine Erlösung an. Er war noch immer in ihr und spürte die pulsierende Glut ihrer Liebesgrotte. Es hatte ihn Kraft und Beherrschung gekostet, seinen eigenen Trieb zu bezähmen. Jetzt ließ er sich gehen und flutete Samanthas Lustgrotte.
Einige Sekunden lang verharrte das Paar noch in dieser Stellung, ehe Lassiter sich erschöpft zur Seite rollte.
»Teufel noch eins!«, schnaufte Samantha glücklich. »Du verstehst dein Handwerk, mein Lieber.« Sie blickte ihn an. »Bleibst du noch ein Weilchen?«
»Ich habe noch was zu erledigen, wie du weißt«, brummte Lassiter und starrte zur Decke.
»So war es damals auch«, erwiderte Samantha und lächelte dünn. »Du hattest Erledigungen und ich habe dich nie wiedergesehen.«
»Bei Edwin Burrus gibt es nichts zu erledigen«, sagte Lassiter. Er musste achtgeben, dass seine Tarnung nicht aufflog. Die Sängerin glaubte, dass er als Eilkurier für die Regierung arbeitete. »Er hat ein Telegramm für mich. Wo finde ich ihn?«
»Zimmer 12«, sagte Samantha und zog sich die Decke bis unter den Hals. »Du musst mit Engelszungen auf ihn einreden. Er ist ein komischer Kauz.«
***
Ob es sich bei Edwin Burrus tatsächlich um einen komischen Kauz handelt, konnte Lassiter bis zu seiner Ankunft vor Zimmer Nr. 12 nicht mehr ermitteln. Es hätte ihn auch nicht gekümmert. Die Telegraphenstation in Terry hatte ihm ein vertrauliches Memorandum zugestellt, in dem Burrus als Vertrauter des Präsidenten und Mittelsmann der Brigade Sieben geführt wurde. Es hätte Lassiters Pflichtgefühl widersprochen, sich voreilig ein Bild von Burrus zu machen.
Der Mann in Zimmer Nr. 12 jedoch war wahrhaftig ein Sonderling.
Seine spindeldürren Beine steckten in schmalen Wildlederstiefeln mit rostigen Schnallen, die Taille schnürte eine deutlich zu enge Weste ein. Über dem verzurrten Oberleib thronte ein silberhaariges Köpfchen mit wachen, tief in den Höhlen sitzenden Augen.
»Mr. Burrus?«, fragte Lassiter und tippte sich an den Hut. »Ich möchte mit Ihnen sprechen.«
Burrus’ Stimme ähnelte einer knarrenden Stalltür. »Mr. Lassiter, nehme ich an? Sie wollen zu mir, ja? Nun ja … Kommen Sie herein! Ich … erwarte Sie bereits.«
Der grauhaarige Alte gab den Weg frei und wies auf die beiden Lehnstühle, die hinter ihm im Zimmer standen. Zwischen den Stühlen befand sich ein Beistelltisch, auf dem ein aufgeklapptes Buch und ein Zigarrenetui lagen. Das Bett an der Wand war mit Kleidungsstücken und ausgebreiteten Wochenzeitungen bedeckt.
»Sie haben einen Auftrag für mich?«, erkundigte sich Lassiter, nachdem Burrus und er sich niedergelassen hatten. Er wollte die Zeit nicht mit Belanglosigkeiten vergeuden. »Einen Auftrag aus Washington?«
Auf den knochigen Zügen erschien ein schmales Lächeln, das allmählich Burrus’ erstaunlich weiße Zähne zu Tage förderte. »Sie können es kaum abwarten, was? Ich bin nicht gerade das, was man einen gewöhnlichen Mittelsmann der Brigade Sieben nennt.«
Die Blicke der Männer streiften einander kurz, ehe sich kühles Misstrauen in den Raum schlich. Einen Augenblick lang dachte Lassiter darüber nach, ob er nicht besser einen Schlussstrich unter dieses Gespräch zog. »Was meinen Sie damit, Burrus? Sie arbeiten doch für die Brigade Sieben?«
Ein tiefes Seufzen drang aus Burrus’ Kehle. »Sie fragen mich, ob ich für die Brigade Sieben arbeite? Ob ich für den Präsidenten arbeite? Für das Kriegsministerium?« Er lachte glucksend. »Ich war in meinem Leben im Sold einer solchen Zahl von Leuten, dass ich vergessen habe, wem meine Loyalität tatsächlich gehört. Ich stelle meine Arbeit in den Dienst dieses Landes, nicht aber in den Dienst seiner Repräsentanten.«
Die Antwort stellte Lassiter nicht im Mindesten zufrieden. »Sie vergeuden Ihre und meine Zeit. Ich erwarte einen Auftrag der Brigade Sieben.«
Der hagere Alte lachte erneut und erhob sich schwerfällig. Er trat vor das Bett und zog unter den Wochenschriften darauf ein versiegeltes Briefkuvert hervor. Er betrachtete das Wachssiegel nachdenklich und kehrte zu seinem Lehnstuhl zurück. »Ich bin mir sicher, Mr. Lassiter, dass Sie den Namen Monaseetah schon einmal gehört haben.«
Ein Gefühl von Unbehagen stieg in Lassiters Brust auf und verstärkte die Abneigung gegen Burrus. Er kannte den Namen besser als jeden anderen. »Monaseetah ist eine Squaw aus dem Volk der Cheyenne. Ich bin ihr vor einigen Jahren am Little Bighorn River begegnet.«
»Sie versetzen mich in Erstaunen«, gab Burrus zurück. Der verschmitzte Ausdruck in seinem von Falten zerfurchten Gesicht erlosch unvermittelt. »Sie hatten eine unsittliche Affäre mit dieser Frau. Sie hatten damals am Little Bighorn den Auftrag, sie zu General Custer zu bringen.«
Die plötzliche Schärfe in Burrus’ Stimme ließ Lassiter hellwach werden. Er beugte sich nach vorn und fixierte den Mittelsmann. »Woher wissen Sie das? Von meinem Verhältnis zu Monaseetah stand nichts in den Protokollen.«





























