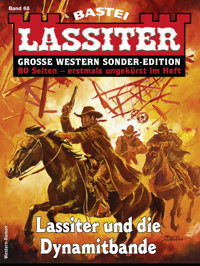
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Plötzlich war die Hölle los. Lassiter hörte von drei Seiten ein scharfes Zischen. Blitzschnell warf er sich flach auf den heißen Steinboden, presste sich dagegen und verschränkte die Arme schützend über dem Hinterkopf. Ein höllisches Inferno umtoste ihn. Er fühlte sich von einer unsichtbaren Riesenfaust hochgehoben, mehrmals herumgewirbelt und durch die Luft geschleudert. Das ist das Ende!, schoss es Lassiter durch den Kopf. Diese verdammte Dynamitbande ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
LASSITER UND DIE DYNAMITBANDE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Vorschau
Impressum
LASSITER UNDDIE DYNAMITBANDE
Sie hatten ihn in die Enge getrieben wie ein wildes Tier. Es schien nicht mehr den geringsten Ausweg zu geben für den großen Mann, der soeben mit einem letzten verzweifelten Satz das Portal der alten Missionskirche erreichte und im Halbdunkel des Kirchenschiffs untertauchte. Es war eine alte, halbverfallene Kirche, einziges Überbleibsel der Missionsstation von Hachita in Neu-Mexiko.
Die letzten Schüsse verstummten, als der Mann in dem Gebäude verschwunden war. Die Verfolger sahen ein, dass ein blindwütiges Weiterstürmen mindestens für einige von ihnen tödlich sein würde.
Der Mann erblickte die Reste eines Altars. Zwischen dem großen Felsquader und der Wand befand sich ein schmaler Zwischenraum.
Ohne zu zögern, glitt der Mann hinein. Es war die einzige Stelle, an der er eine halbwegs gute Deckung finden konnte.
Keuchend lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand. Er blutete aus mehreren Wunden. Keine davon war tödlich, in seinem Körper steckte keine Kugel. Trotzdem brannten an einigen Stellen höllische Schmerzen, und der Blutverlust würde ihn mehr und mehr schwächen.
Er öffnete den Verschluss seiner Winchester und schob neue Patronen in die leergeschossenen Kammern des Magazins. Die Munition holte er aus dem gekreuzten, mit vielen Schlaufen versehenen Gurt, der um seine Schultern hing.
Er sah aus wie ein Mexikaner, trug eine schmutzige, zerlumpte Kleidung. Eine ehemals weiße Leinenhose, ein blutverschmiertes Hemd, das ebenfalls nur noch an einigen Stellen weiß war. Um den Kopf hatte er sich ein Halstuch als provisorischen Verband geschlungen.
Der Mann war Lassiter.
Er befand sich auf der Flucht. Und jetzt hatte er wahrscheinlich das Ende seiner rauen Fährte erreicht.
Draußen lauerten seine Feinde und beratschlagten, wie sie ihn am besten erledigen konnten, ohne sich selbst in allzu große Gefahr zu begeben.
Es gab verschiedene Möglichkeiten, ihn fertigzumachen. Beispielsweise konnten sie ihn einfach so lange belagern, bis er vor Hunger und Durst von selbst aufgab.
Was ihm dann blühte, konnte er sich nur zu gut ausmalen. Diese Grenzlandbanditen hatten eine Menge übler Sachen von den Apachen abgeschaut. Und in ihrem Hass konnten sie schlimmer als eine Horde Teufel sein.
Dass sie von grenzenloser Wut gegen ihn erfüllt waren, war nur zu verständlich. Immerhin hatte Lassiter ihnen übel mitgespielt.
Er hatte alles auf eine Karte gesetzt, um seinen Auftrag zu erledigen. Beinahe wäre es ihm sogar gelungen, das Unmögliche möglich zu machen. Buchstäblich in letzter Sekunde war es dann schiefgegangen. Jetzt sah es ganz so aus, als wäre alles umsonst gewesen.
Er befand sich in einer kleinen verfallenen Missionskirche im Grenzland von Neu-Mexiko. Völlig auf sich allein gestellt. Umzingelt von einer skrupellosen Horde.
Draußen herrschte noch immer tiefe Stille. Sonnenlicht fiel durch das schadhafte Dach. Es war erstickend heiß. Die Luft war wie flüssiges Blei und machte jeden Atemzug zur Qual.
Für einen Augenblick schloss Lassiter die Augen und dachte an alles zurück, was hinter ihm lag.
Er erinnerte sich an Alexandra Durango, die bildschöne junge Mexikanerin, die das Wesen eines Teufels und eines Engels in sich vereint zu haben schien. Er sah wieder El Sacramento vor sich, den gefürchteten Boss der Grenzlandbanditen. Das Gesicht des mächtigen Harold McCafferty stieg vor ihm auf – und viele, viele andere Gestalten wurden wieder lebendig vor seinem geistigen Auge.
Den Auftrag hatte er von Harold McCafferty angenommen. Im Grunde genommen gegen seinen eigenen Willen. Es kam ganz darauf an, von welcher Warte man es betrachtete. Wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war, musste er auch zugeben, dass ihn das Abenteuer gereizt hatte. Alexandra Durango war wie ein aufpeitschendes Rauschgift für ihn gewesen, das ihn immer wieder vorantrieb.
Nun gut, es standen auch noch zwanzigtausend Dollar für Lassiter auf dem Spiel, aber diese Tatsache betrachtete er als völlige Nebensache. Geld hatte für Lassiter eigentlich noch nie eine dominierende Rolle gespielt. Ein Mann, der genug besaß, sollte sich um Geld niemals besondere Sorgen machen.
Es gab wichtigere Dinge im Leben.
Lassiter grinste vor sich hin, als er an all diese Dinge dachte. Er musste bei sich zugeben, dass er zu viele Fehler gemacht hatte, Fehler, die wieder einmal auf seinen schwachen Punkt zurückzuführen waren: Frauen!
Er leckte sich über die rissig gewordenen, völlig ausgetrockneten Lippen und verspürte brennenden Durst.
Wie lange konnte er das hier noch aushalten? Vielleicht bis zum nächsten Tag, wenn er Glück hatte. Länger auf keinen Fall.
Es kam nur darauf an, was die Banditen für Pläne gefasst hatten. Möglicherweise würden sie ihn auch auf andere Weise wie einen Fuchs aus diesem Bau treiben. Beispielsweise mit ein paar Sprengstoffladungen. Er dachte an Dan Daggard, den Texaner aus dem Big Bend. Er war der Sprengstoffexperte in El Sacramentos Höllenschar. Dynamit-Dan wurde er von den meisten genannt. Es war nur fraglich, ob er noch am Leben war.
Lassiter hatte mindestens sieben Verfolger aus den Sätteln geholt während seines wilden Ritts von Süden herauf. Er war der Meinung, unter anderem auch Dan Daggard getroffen zu haben, doch das stand nicht mit absoluter Sicherheit fest.
In Gedanken versunken hielt Lassiter die Winchester so, dass die heiße Mündung sein Kinn berührte.
Ein finsterer Entschluss begann sich in ihm zu formen.
Wenn alles verloren war, würde er zum allerletzten Mittel greifen. Auf keinen Fall wollte er lebend in die Hände der Banditen fallen, denen er so schlimm zugesetzt hatte.
»Lassiter!«, gellte eine Stimme durch die heiße Luft des sonnendurchglühten Nachmittags. »Hörst du mich, Lassiter?«
El Sacramento hatte gerufen. Seine Stimme klang kalt und klar, ein Zeichen dafür, dass er inzwischen getrunken und sich erfrischt hatte.
»Was willst du, Sacramento?«, rief Lassiter zurück. Seine Stimme war heiser und krächzend. Mit dem völlig ausgetrockneten Mund hatte er Mühe, verständliche Silben zu formen.
Sacramento lachte dröhnend. Er wusste genau, in welcher Verfassung sich sein erbitterter Feind befand, und das bereitete ihm eine teuflische Freude.
»Wir werden dich gleich holen, Gringo!«, schrie er.
»Nur zu!«, knurrte Lassiter, aber das konnten die Banditen nicht hören. »Kommt nur, verfluchte Hundesöhne!«
»Was ist los, Gringo Lassiter? Willst du dich nicht lieber freiwillig ergeben? Wir könnten dann noch ein wenig verhandeln. Beispielsweise würdest du uns dann vielleicht gerne verraten, wo du das Geld versteckt hast. Was hältst du davon, Gringo Lassiter?«
Lassiter antwortete nicht.
Es war sinnlos, noch einmal mit den Banditen zu verhandeln. Sie würden ihn so oder so töten. Er würde auch dann nicht verschont werden, wenn er ihnen verraten konnte, wo sich das Gold und die vielen Dollars befanden, hinter denen die Bande her war.
Dieser Schatz war inzwischen in Sicherheit. Zusammen mit Stella McCafferty, der Tochter von Big Harold.
Aber das war noch nicht Lassiters ganze Aufgabe gewesen. Er kehrte noch einmal zurück, nachdem der erste Teil erledigt gewesen war. Zurück in die Berge nördlich vom Rio Casas Grandes, wo sich das Hauptquartier von El Sacramento befand.
»Zum Teufel mit dir, Lassiter!«, brüllte El Sacramento. »Trotzdem bekommen wir dich lebendig. Aber vorher sollst du in der Hölle schmoren! Pass auf, Gringo!«
»Nein!«, knurrte Lassiter. »Lebend bekommt ihr mich nicht!« Plötzlich war die Hölle los.
Er hörte von drei verschiedenen Seiten ein scharfes Zischen. Blitzschnell warf er sich flach auf den harten Steinboden, presste sich dagegen und verschränkte beide Arme schützend über dem Hinterkopf.
Schon folgten die Detonationen. Drei schmetternde, berstende Donnerschläge, von denen eine immer die nächste auszulösen schien.
Ein höllisches Inferno umgab Lassiter. Er fühlte sich von einer unsichtbaren Riesenfaust hochgehoben, mehrmals herumgewirbelt und wie ein hilfloses Bündel durch die Luft geschleudert.
Um ihn herum drehte sich alles in rasender Geschwindigkeit.
Die schmetternden Detonationen erweckten ein Gefühl der Taubheit in seinen Ohren. Er prallte hart auf dem Steinboden auf, sah um sich herum zuckende Blitze, fliegende Gesteinsbrocken und schwarze Staubwolken, die den Himmel verdunkelten.
Hilflos lag er da, wie gelähmt.
Er hörte nichts anderes als ein dumpfes Brausen in seinen Ohren. Nur mit den Augen nahm er noch seine Umgebung wahr.
Wieder versuchte er, sich aufzurichten. Aber er konnte kein Glied bewegen. Und die Wolke von Staub und Gestein hüllte ihn mehr und mehr ein, senkte sich schließlich wie eine alles erdrückende Wand auf seinen Körper hinab.
Jetzt war es endgültig aus und vorbei.
El Sacramento hatte seine Drohung wahrgemacht.
Wenn nicht doch noch ein Wunder geschah, würde Lassiter lebend in die Hände der Grenzlandbanditen fallen.
Er konnte sich jetzt auf einen Tod vorbereiten, der schlimmer als alles andere sein würde, was er oder ein anderer Mensch jemals erlebt hatte.
Noch immer zuckten hier und da die Blitze von kleineren Detonationen auf. Lassiter glaubte Gestalten zu sehen, dann tauchten Gesichter vor ihm auf.
El Sacramento war dabei. Und Alexandra Durango.
Lassiter schloss die Augen.
Er sah Bilder an sich vorbeifliegen, die es schon längst nicht mehr gab. Szenen aus der Vergangenheit der letzten zwei Wochen.
Angefangen hatte alles mit Alexandra Durango ...
II
Sie war schwarzhaarig und langbeinig. Ihre Bewegungen erinnerten an den schleichenden Gang einer Raubkatze. Die Stimme war rauchig und einschmeichelnd zugleich. Sie verstand es, zu locken und einen Mann in einen heißen Sinnesrausch zu versetzen.
Das war Alexandra Durango, Tochter eines reichen Hacendadas aus dem Süden von Chihuahua. Jedenfalls behauptete sie es, und Lassiter prüfte es nicht nach. Ihm war es egal, ob sie von einem reichen Hacendada oder einem armen Peón abstammte.
Er sah sie zum ersten Mal, als er die Bodega von Pablo Casorali betrat. Sie saß zusammen mit drei bärtigen, schwerbewaffneten Mexikanern und musterte ihn mit einem schnellen, aber gründlichen Blick.
Lassiter hatte einen langen Ritt hinter sich, und er war entsprechend durstig. Deshalb stellte er sich an die schäbige Theke und ließ sich als erstes Getränk einen Krug mit Wein geben.
Er trank gemächlich und merkte, dass die Blicke der schönen Frau immer wieder zu ihm herüberwanderten.
Ihm war, als ob vom ersten Augenblick an eine unsichtbare Verbindung zwischen ihnen bestehen würde. Das Mädchen – oder war es eine Frau? – interessierte ihn. Trotzdem erwiderte er ihre Blicke nicht. Er hatte zwar keine Angst vor den drei Mexikanern, aber er hielt es für schlecht, wegen einer Frau unnötigen Ärger anzufangen. Das war noch nie seine Art gewesen.
Er setzte gerade zum zweiten Mal den Weinkrug an die Lippen, als die Tür erneut aufgestoßen wurde.
Vier Mann kamen herein, und es waren diesmal keine Mexikaner. Das waren Americanos, Gringos, wie sie von den Mexen genannt wurden.
Es war vom ersten Augenblick an klar, was sie wollten.
In solchen Sachen kannte Lassiter sich aus.
Die vier blieben nebeneinander stehen, und ihre Haltung drückte harte Kampfbereitschaft aus.
»Stehen Sie auf, Madam!«, sagte einer von ihnen. »Treten Sie zur Seite! Wir möchten nicht, dass Sie gefährdet werden. Das hier ist eine Sache, die unter Männern ausgetragen wird.«
Die Frau machte einen ängstlichen Eindruck. Ihre vollen Lippen wurden zu schmalen Strichen, als sie langsam aufstand.
»Gehen Sie dort hinüber!«, befahl der Anführer der Americanos und zeigte in die Richtung, wo Lassiter stand. »Dort sind Sie am sichersten.«
Er grinste blitzend und sah Lassiter fragend an. »Ich nehme an, dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben, Mister.«
Lassiter behielt den Weinkrug in der Rechten und nickte nur.
Die schwarzhaarige Frau setzte sich langsam in Bewegung. Sie war gerade erst drei Schritte vom Tisch entfernt, als es losging.
Sieben Männer rissen gleichzeitig ihre Revolver aus den Holstern und begannen wild zu feuern. Das Donnern der Schüsse und die Schreie der Männer erfüllten die Bodega.
Die Frau rannte, so schnell sie konnte.
Dicht vor Lassiter blieb sie mit angstverzerrtem Gesicht schweratmend stehen.
»Helfen Sie mir!«, keuchte sie. »Wer immer auch diesen Kampf gewinnt, Sie müssen mir helfen!«
Lassiter wusste im Augenblick nicht, was er dazu sagen sollte. Sicher, die Frau gefiel ihm. Aber er hatte andererseits keine Ahnung, was hier überhaupt los war.
In den letzten Wochen hatte er schon genug Kummer gehabt. Was sollte er sich jetzt noch in die Schwierigkeiten anderer Leute einmischen!
»Zur Seite!«, befahl er schnell und schob sie mit dem Arm weg, um eine bessere Übersicht zu bekommen.
Die Frau gehorchte sofort.
Sie stand kaum hinter Lassiter, als die letzten Schüsse in der Bodega fielen.
Von sieben Männern stand nur noch einer auf den Beinen. Die anderen waren tot oder verwundet. Das Stöhnen der Verwundeten erfüllte die Luft.
Der Mann, der als einziger nichts abbekommen hatte, war der Anführer der vier Americanos. Es war ein großer, hagerer und gefährlicher Bursche. Das hatte Lassiter schon längst erkannt.
»Kommen Sie, Madam!«, sagte der Mann in der schleppenden Redeweise der Texaner. »Ich bringe Sie zurück.«
Die Frau wies auf den verletzten Partner des Hageren.
»Wollen Sie sich nicht zuerst um Roscoe kümmern, Mortimer? Der Junge braucht einen Doc. Los, worauf warten Sie! Besorgen Sie einen Arzt für Johnny Roscoe! Das ist ein Befehl!«
Mortimer schüttelte unbeirrt den Kopf.
»Das hat Zeit bis später, Madam«, sagte er hart. »Zuerst muss ich Sie in Sicherheit bringen. Das allein ist im Augenblick wichtig.«
Die Frau lachte bitter auf.
»Was sagen Sie da, Mortimer? Mich wollen Sie in Sicherheit bringen? Wozu denn das? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass ich in Gefahr bin?«
Mortimer runzelte die Stirn.
»Madam«, sagte er gefährlich leise. »Ich habe einen Auftrag von Louis McCafferty. Diesen Auftrag werde ich auch ausführen. Und wenn ich dabei über Leichen gehen müsste.«
Sie blies verächtlich die Luft aus.
»Gehen Sie zum Teufel, Mortimer! McCafferty soll selbst kommen, wenn er etwas von mir will. Freiwillig gehe ich auf keinen Fall mit Ihnen.«
Mortimer wollte etwas sagen, kam aber vorerst nicht dazu. Von den Mexikanern waren zwei Mann verwundet, und beide waren noch in der Lage, einen Revolver in die Hand zu nehmen und abzudrücken.
Im selben Moment, als sie das taten, wirbelte Mortimer herum. Er war so schnell, dass nur ein geübter Mann seine Bewegungen mit den Augen verfolgen konnte.
Er feuerte zweimal hintereinander. Die beiden Mexikaner bäumten sich auf und sackten leblos in sich zusammen.
Aber auch Mortimer wurde getroffen. Ein Geschoss war in seine Schulter geschlagen. Er taumelte zurück und fand erst an der Wand neben der Tür wieder Halt.
»Kommen Sie Madam!«, ächzte er. »Das hat doch alles keinen Sinn. Sie müssen mich begleiten. Es ist ungemein wichtig.«
Die Frau schüttelte den Kopf. Sie trat dicht hinter Lassiter und berührte leicht seine Schulter.
»Helfen Sie mir!«, bat sie beschwörend. »Wenn Sie mir nicht helfen, bin ich verloren. Sie sehen nicht aus wie ein Mann, der eine Frau im Stich lässt, die in Not ist. Sie werden es nicht bereuen, das schwöre ich Ihnen. Ich werde Ihnen alles geben, was Sie von mir verlangen. Alles, Mister!«
Lassiter sah fragend zu Mortimer hinüber. Der Mann lehnte noch immer an der Wand und hielt den Revolver in der Hand.
»Ich warne Sie, Hombre!«, sagte Mortimer gepresst. »Wenn Sie der Frau helfen, packen Sie ein Eisen an, das Sie verbrennen wird.«
Wieder stieß die Frau Lassiter an.
»Hören Sie nicht auf Mortimer, Fremder! Ich flehe Sie an um alles in der Welt! Helfen Sie mir!«
Lassiter grinste leicht.
Ihm gefiel diese ganze verdammte Situation nicht. Er hatte hier das sichere Gefühl, in eine Sache hineinzurutschen, an der er sich wirklich sämtliche Finger und noch mehr verbrennen konnte.
Trotzdem interessierten ihn die Zusammenhänge. Die Neugier war in ihm geweckt worden.
Mortimer hob langsam den Revolver an.
»Ich warne Sie, Mann!«, zischte er. »Eine Kugel ist noch drin für Sie. Wollen Sie etwa den Mexen auf dem Stiefelhügel Gesellschaft leisten?«
Lassiter hielt noch immer seinen Weinkrug und nahm einen kleinen Schluck.
»Schon gut, Mortimer«, sagte er einlenkend. »Es ist wirklich nicht meine Art, mich in fremder Leute Angelegenheiten zu mischen. Von mir aus können Sie mit der Lady verschwinden.«
Mortimer nickte zufrieden. »Ich habe geahnt, dass Sie vernünftig sein würden, Mister. Es ist auch wirklich besser so. – Kommen Sie jetzt, Madam. Wir werden reiten.«
Lassiter zeigte auf Johnny Roscoe, den Verwundeten.
»Haben Sie es wirklich so eilig, Mortimer? Ist die Sache so wichtig, dass Sie Ihren Partner hier verbluten lassen wollen? Denken Sie auch an sich selbst. Sie brauchen ebenfalls einen Arzt, der Ihnen das Geschoss herausholt. Oder haben Sie keinen weiten Weg vor sich?«
Mortimer wurde unsicher. Er blickte auf Johnny Roscoe hinab, der die Augen geschlossen und das Bewusstsein verloren hatte. Er zögerte ein paar Sekunden und fragte dann heiser: »Sie stellen sich nicht gegen uns? Geben Sie mir Ihr Wort, Mister?«
»Nein«, antwortete Lassiter trocken. »Das wäre zu viel verlangt. Ich verspreche Ihnen nur, dass ich mich nicht einmischen werde, solange mich diese Sache nichts angeht.«
Mortimer zögerte noch ein paar Sekunden. Aber schließlich sah er ein, dass es für ihn keine andere Möglichkeit gab, als auf Lassiters Rat einzugehen.
Langsam schob er den Revolver ins Holster zurück.
Von der Straße her kamen Männer in die Bodega. Sie hatten draußen gewartet, bis sie ganz sicher waren, dass der Kampf vorüber war.
Mortimer zeigte auf seinen bewusstlosen Partner.
»Helft mir, Leute!«, sagte er. »Der Junge muss zum Doc. Hier ...«
Er hatte in die Tasche gegriffen und ein Zehn-Dollar-Goldstück hervorgeholt. Das war eine Menge Geld für diese Männer. Dafür würden sie noch mehr tun, als nur einen Verwundeten zum Arzt zu bringen.
Einer der Männer streckte die Hand aus. »Geben Sie schon her!«, forderte er. »Ich sorge dafür, dass alles richtig verteilt wird. Die Toten schaffen wir ebenfalls weg ...«
Nach wenigen Minuten war Lassiter allein mit der schönen Frau in der Bodega von Pablo Casorali.
»Wer sind Sie?«, fragte Lassiter. »Was wollen diese Männer von Ihnen? Warum bitten Sie mich um Ihre Hilfe?«
»Ich heiße Alexandra Durango. Mein Vater besitzt eine große Hazienda im Süden von Chihuahua. Ich bin vor Monaten entführt worden. Vor ein paar Tagen aber ist mir die Flucht gelungen. Die drei Mexikaner, die vorhin erschossen worden sind, haben mir geholfen. Und ... Nun ja, das andere wissen Sie ja selbst.«
Sie stand plötzlich so dicht vor Lassiter, dass ihr heißer Atem sein Gesicht traf und die lockende Ausstrahlung ihres Körpers ihn gefangen nahm.
Erregung stieg ganz von selbst in ihm auf. Er machte aber auch nicht den Versuch, dagegen anzukämpfen.
Leicht drehte er den Kopf und blickte zum Wirt hinüber. »Hast du ein Zimmer, in dem ich mich mit der Lady ungestört unterhalten kann?«
Der Wirt nickte beflissen.
Fünf Minuten später war Lassiter mit Alexandra Durango allein. Es war ein winziges, karg möbliertes Zimmer, aber das störte weder Lassiter noch die Frau.
Wie aus einem jähen Impuls heraus schlang sie die Arme um seinen Nacken und presste ihren schlanken, festen Körper gegen ihn. Sie war wie eine Ertrinkende, die in Lassiter ihre allerletzte Hoffnung sah.
»Du gefällst mir«, flüsterte sie verlangend. »Ich habe auf den ersten Blick erkannt, was für ein Mann du bist. Wie heißt du?«
Er sagte es ihr. Nur flüchtig dachte er daran, dass ihr Verhalten nichts anderes als Berechnung war. Das andere war ihm wichtiger.
In seinem Blut rumorte das Verlangen.
Und diese Frau faszinierte ihn auf unerklärliche Weise.
»Wirst du mir helfen, Lassiter?«, fragte sie. »Wirst du dich als der Mann erweisen, für den ich dich vom ersten Augenblick an gehalten habe? Oder ...«
Er schob sie von sich weg.
»Zieh dich aus!«, sagte er trocken.
Sie zeigte weder Verwunderung noch Verlegenheit. Sie lächelte nur zufrieden und öffnete die Knöpfe ihrer knappsitzenden Bluse.
»Es gibt also doch noch richtige Kerle«, murmelte sie. »So ist es richtig, wie du das machst. Jede Chance packen, die sich einem bietet. Ob im Kampf oder bei einer Frau.«
Lassiter begann ebenfalls, sich auszuziehen. Es dauerte nicht lange, bis beide auf dem schmalen, harten und quietschenden Bett lagen. Er brauchte nicht lange zu warten. Alexandra war heiß und voller Leidenschaft, wie er es vermutet hatte.
»Wer ist Mortimer?«, fragte er später, als er wieder zu klarem Denken fähig war. »Was will er von dir?«
»Er reitet für Harold McCafferty«, antwortete sie leise. »Ist dir der Name ein Begriff?«
Lassiter nickte. Er hatte schon von McCafferty gehört. Das war ein schwerreicher Mann, der eine Riesenranch besaß.
»Hat er dich entführt?«, wollte er wissen.
»Nicht direkt entführt«, gab sie unsicher zurück. »Ich bin zum Teil selber schuld. Bin ihm auf den Leim gegangen, auf seine schönen Sprüche hereingefallen. Er hat mir den Himmel auf Erden versprochen, aber dann hat er sich als Schuft erwiesen.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Ich war nichts anderes als eine Hure für ihn. Von echter Liebe war keine Spur. Er nahm mich, wenn er Lust dazu hatte. Mich hat das alles angewidert. Er hat mich erniedrigt, wo er nur konnte. Eines Tages bin ich ihm dann davongelaufen. Diese drei Männer haben mir dabei geholfen.«
»Pistoleros?«
»Ja. Sie ritten für McCafferty. Gehörten zu seiner Leibgarde. Da es Landsleute von mir waren, habe ich mich ihnen anvertraut. Und sie haben mir geholfen, heimlich zu fliehen.«
Sie ließ eine Hand streichelnd über seinen Körper gleiten. Er hatte das Gefühl, dass einiges nicht stimmte an ihrer Erzählung. Aber dieses Gefühl wurde sofort wieder in den Hintergrund gedrängt durch die prickelnde Nähe Alexandras. Sie verstand es einzigartig, einen Mann alles andere vergessen zu lassen.





























