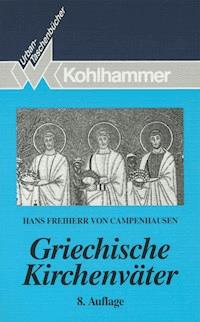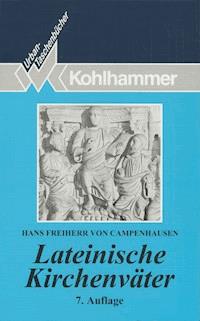
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 1995
Für das Werden der christlichen Kirche ist die Epoche der Patristik besonders wichtig, weil bei den Kirchenvätern die Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, ihrer Philosophie, Sittlichkeit und Kultur beginnt und damit der Grund gelegt wird für die gesamte spätere kirchen- und geistesgeschichtliche Entwicklung. In sieben Kapiteln werden die wichtigsten Gestalten der alten Kirche des Westens behandelt: Tertullian, Cyprian, Lactantius, Ambrosius, Hieronymus, Augustin und Boethius.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für das Werden der christlichen Kirche ist die Epoche der Patristik besonders wichtig, weil bei den Kirchenvätern die Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, ihrer Philosophie, Sittlichkeit und Kultur beginnt und damit der Grund gelegt wird für die gesamte spätere kirchen- und geistesgeschichtliche Entwicklung. In sieben Kapiteln werden die wichtigsten Gestalten der alten Kirche des Westens behandelt: Tertullian, Cyprian, Lactantius, Ambrosius, Hieronymus, Augustin und Boethius.
Hans Freiherr von Campenhausen (1903-1989) lehrte Historische Theologie, Patristik und Neues Testament an der Universität Heidelberg.
Hans Freiherr von Campenhausen
Lateinische Kirchenväter
Siebente, unveränderte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Umschlagbild: Christus, der Lehrer, thront zwischen den Zwölf im himmlischen Jerusalem (Ausschnitt). Theodosianischer Sarkophag, um 380. Mailand, S. Ambrogio
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Campenhausen, Hans Frhr. von: Lateinische Kirchenväter / Hans Frhr. von Campenhausen. - 7., unveränd. Aufl. - Stuttgart ; Berlin ; Köln : Kohlhammer, 1995
(Urban-Taschenbücher ; Bd. 50 : Theologie, Religionswissenschaft) ISBN 3-17-013504-X
NE: GT
Siebente Auflage 1955 Alle Rechte vorbehalten © 1960 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Berlin Köln Verlagsort: Stuttgart Umschlag: Data Images
audiovisuelle Kommunikation GmbH
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-013504-8
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-031375-0
epub:
978-3-17-031483-2
mobi:
978-3-17-031484-9
VENERANDO ORDINI THEOLOGORUM UNIVERSITATIS OSLOENSIS HOC LEBELLO GRATIAS TESTATUR MAXIMAS AUCTOR PIE MEMOR PRIORIS COMMERCII QUO CUM ILLO AMICE ERAT CONIUNCTUS HONORISQUE SUMMI QUO FACTUS EST THEOLOGIAE DOCTOR
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: DIE LATEINISCHEN KIRCHENVÄTER UND DIE GRIECHEN
1. Kapitel: TERTULLIAN
2. Kapitel: CYPRIAN
3. Kapitel: LACTANTIUS
4. Kapitel: AMBROSIUS
5. Kapitel: HIERONYMUS
6. Kapitel: AUGUSTIN
7. Kapitel: BOETHIUS
ZEITTAFEL
PERSONENREGISTER
Einleitung DIE LATEINISCHEN KIRCHENVÄTER UND DIE GRIECHEN
Ein früheres Bändchen dieser Reihe war den griechischen Kirchenvätern gewidmet. Das, was über den Begriff des Kirchenvaters und der Väterkunde dort gesagt ist, soll hier nicht wiederholt werden. Der vorliegende Band ist für sich lesbar, bildet aber der Sache nach die Fortsetzung des älteren. Die lateinische Väterliteratur beginnt fast hundert Jahre nach der griechischen. Die lateinischen Väter sind die jüngeren Schüler der Griechen; diese sind zunächst die Lehrer ihres christlichen Glaubens und Denkens, ihrer gesamten Theologie. Bei der üblichen rein chronologischen Anordnung, die die griechischen und lateinischen Kirchenväter zusammenfaßt, wird dieses Verhältnis oft nicht genügend deutlich. Wie durch die gesamte Kulturwelt fließt auch durch die Kirche des Altertums ein ununterbrochener Strom geistiger Anregung von Ost nach West; einer reichen lateinischen Übersetzungsliteratur im wörtlichen wie im übertragenen Sinne entspricht keine vergleichbare Rückwirkung von Westen nach Osten. Dennoch entwickelt sich im Abendland sehr schnell eine neue, kräftige und eigenartige Form kirchlichen Lebens und christlicher Theologie, die hinter der griechischen schließlich nicht zurücksteht und sie in ihrer weltgeschichtlichen Wirkung vielleicht sogar überflügelt hat. Die Entstehung dieser lateinischen Kirchlichkeit ist die erste Umschmelzung in neue geistige Formen, die das Christentum im großen erfahren hat, und schon darum beachtenswert.
Obschon Jesus und seine ersten Jünger nicht griechisch, sondern aramäisch gesprochen haben, ist das Christentum keine „jüdische Religion“. Die Kirche erwächst aus „Juden und Griechen“, und die griechischen Väter waren durchaus im Recht, wenn sie ihren Glauben als eine neue Wahrheit verstanden, die das Judentum wie das Griechentum übersteigt. Das Neue Testament ist griechisch geschrieben, und wie stets so ist auch in diesem Falle die Sprache mehr als ein äußerliches Gewand. Griechischer Geist hat das Christentum schon im Entstehen berührt und mitbestimmt. Dieses Element hat die weitere Entwicklung auf Kosten der alttestamentlich-hebräischen Grundlagen nicht ohne Einseitigkeit weiter verstärkt. Auch dort, wo die alte Kirche über die Reichsgrenzen hinaus missionierend in den Osten drängt und sich scheinbar reorientalisiert, bleiben die griechischen Voraussetzungen des Bibeltextes, der Bekenntnisse und des gesamten theologischen Denkens bestehen und erweisen sich als unverwischbar. Es gibt auch orientalische Kirchenväter; aber sie haben die lateinischen an selbständiger Kraft und Bedeutung nicht von ferne erreicht.
Das „lateinische“ Abendland – im wesentlichen kommt für die alte Kirche nur dieses in Betracht – war beim Eindringen des Christentums von der griechischen Kultur und vom griechischen Denken selbst schon seit langem beeinflußt und durchdrungen; dadurch ist die schnelle geistige Entwicklung der westlichen Kirche erst möglich geworden. Aber so gut das Römertum im Hellenismus nicht einfach untergegangen ist, sondern in der ständigen Auseinandersetzung mit ihm seine Eigenart bewahrt, ja überhaupt erst eine eigene geistige Form gewonnen hat, gilt dies entsprechend und sogar in noch höherem Maße auch von der lateinischen Kirche und von ihrer theologischen Selbständigkeit. Die lateinischen Kirchenväter sind, wie gesagt, durch ihre griechischen Lehrer unterwiesen und gebildet worden; aber sie besitzen von Anfang an ihren eigenen Zugang zur Bibel und hier vor allem zum Alten Testament. Gegenüber der philosophischen Gesinnung und den metaphysisch-spekulativen Tendenzen des Griechentums zeigen sie eine Sprödigkeit und Zurückhaltung, die erst am Ende des vierten Jahrhunderts überwunden wird. Dies führt dann zur großen Blüte der lateinischen Vätertheologie, vor allem durch Augustin. Aber auch diese neue, „philosophische“ Theologie gibt die Grundlagen des lateinischen Denkens darum nicht preis. Sie verbindet sich nicht zufällig mit einer Wiederentdeckung des Paulus und einer Aufnahme der für Paulus charakteristischen Frage nach dem Glauben im Gegensatz zum „Gesetz“. Das ist ein Gesichtspunkt, den die griechische Theologie kaum je beachtet hatte, der ihr in seiner ursprünglichen Bedeutung jedenfalls ganz fremd geblieben war. Die merkwürdige Wahlverwandtschaft, die das römische Wesen mit dem Judentum besitzt, machte die lateinische Kirche gerade durch ihre „Nüchternheit“ und praktische Gesetzlichkeit dazu fähig zu begreifen, was für sie das „Evangelium“ bedeutete.
Indessen wird von diesen Dingen im vorliegenden Bändchen nicht ausführlich die Rede sein. Es bietet wieder nur eine Reihe biographischer Skizzen und möchte keine Theologie- und „Dogmen“-geschichte ersetzen. Auch die Auswahl der geschilderten Persönlichkeiten ist wieder eng begrenzt. Sie reicht nicht über das Ende der alten Kulturwelt hinaus (deren Untergang hat auch kirchengeschichtlich Epoche gemacht). Doch steht hinter meinem Versuch die Überzeugung, daß sich das geschichtliche Leben selbst vorzüglich durch Persönlichkeiten verwirklicht oder zum mindesten in solchen am unmittelbarsten zu fassen und am deutlichsten zu begreifen ist.
Wie bei den griechischen Kirchenvätern seien auch hier einige allgemeine literarische Hinweise hinzugefügt:
Seit 1866 müht sich die Wiener Akademie der Wissenschaften um eine kritische Ausgabe sämtlicher lateinischer Kirchenväter im „Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum“ (CSEL). Bis jetzt sind 75 Bände erschienen. Ihr ist seit 1953 das schneller arbeitende „Corpus Christianorum (Series latina)“ der St. Peters-Abtei in Steenbrugge (Belgien) an die Seite getreten (CC). Daneben muß die umfassende, bis Innozenz III. reichende Sammlung von J. P. Migne„Patrologiae cursus completus, Series latina“ (Migne), Paris 1844 ff. noch immer benutzt werden. Sie wird jetzt von A. Hamman durch kritische Ergänzungsbände („Supplementum“) vervollständigt: 1958 ff.
Eine Übersicht über das ganze Material (Titel und Verzeichnis der besten Ausgaben und der kritischen Ergänzungen dazu) bieten E. Dekkers und E. Gaar, Clavis patrum Latinorum (= Sacris Erudiri III, 1951). Eine größere Auswahl deutscher Übersetzungen findet sich in der zweiten Auflage der Kemptener „Bibliothek der Kirchenväter“ (1911 ff.), neuerdings auch in den zweisprachigen Texten der Darmstädter „Wissenschaftlichen Buchgesellschaft“ (1956 ff.).
Die stoffreichste „Geschichte der altkirchlichen Literatur“ in fünf Bänden (19132–1932) stammt von O. Bardenhewer. Im Rahmen des von W. Otto neu herausgegebenen „Handbuchs der klassischen Altertumswissenschaft“ ist die lateinisch-christliche Literatur von G. Krüger behandelt worden (III3 1922; IV 1–2 1914/20). Eine knappe, aber vorzügliche Gesamtdarstellung von „Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter“ (mit weiteren Literaturangaben) findet man bei B. Altaner, Patrologie, 19606).
Die wichtigsten Darstellungen der alten Dogmengeschichte in deutscher Sprache sind: A. v. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte I/III (19325–1909/104); R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte I–II (19534); Fr. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte I–II (19596, herausgegeben von K. Aland). Seit 1951 erscheint (in thematischer, nicht chronologischer Anordnung) das katholische „Handbuch der Dogmengeschichte“, herausgegeben von M. Schmaus, P. Geiselmann und H. Rahner.
Von allgemeinen Darstellungen der alten Kirchengeschichte seien genannt: K. Müller, Kirchengeschichte I 1 (19413 in Gemeinschaft mit H. v. Campenhausen); H. Lietzmann, Geschichte der alten Kirche I–IV (19532/3); die ersten vier Bände des Sammelwerkes „Histoire de l’Eglise“ (Paris 1935 ff.), herausgegeben von A. Fliche und V. Martin.
Bei den Zitaten aus den Schriften der Väter habe ich ältere Übersetzungen oft stillschweigend genutzt. Ich bitte meine Vorgänger, dies nicht als Diebstahl anzusehen. Auch sonst wäre es natürlich möglich gewesen, an unzähligen Stellen ältere Autoren zu nennen, denen ich bewußt und unbewußt gefolgt bin. Doch halte ich es lieber mit Cervantes, der in der Vorrede zu seinem „Sinnreichen Junker Don Quixote von la Mancha“ auf Zitate, Noten und andere vornehme Dinge dieser Art ausdrücklich Verzicht leistet, „teils, weil ich mich nicht für geschickt und gelehrt genug halte, und teils, weil ich zu faul bin, um dasjenige bei andern Schriftstellern aufzusuchen, was ich selbst ohne sie wohl sagen könnte.“
1. Kapitel TERTULLIAN
Eine Christengemeinde in Rom gab es schon zur Zeit des Apostels Paulus, aber eine römische Gemeinde war sie damals noch nicht. Die Weltstadt umschloß Zugezogene aus aller Welt, nicht zuletzt aus dem griechisch redenden Osten. Von da stammten auch die ersten Missionare und Anhänger des neuen Glaubens. Jedenfalls war und blieb die Sprache der Christen im ganzen Abendland über hundert Jahre lang ausschließlich das Griechische. Dies war nicht nur die Folge des östlichen Ursprungs der Kirche; es spiegeln sich darin auch die allgemeinen Verhältnisse des Reiches wider, das zu einem einzigen Reich des Mittelmeeres und seiner Kultur geworden war. Griechisch war nicht nur die Sprache der Gebildeten, wie früher bei uns das Französische; es war zugleich die bevorzugte Sprache des Handels und Verkehrs. In jeder größeren Stadtgemeinde des Westens wurde das Griechische nicht nur verstanden, sondern wohl auch als Umgangssprache gesprochen. Für eine von vornherein von nationalen Bindungen gelöste, den Einzelnen in eine neue Gemeinschaft einfügende Religion der Stadtleute wie das Christentum war die griechische Kultus- und Kirchensprache somit das Gegebene.
Wenn sich dieser Zustand gegen Ende des 2. Jahrhunderts langsam zu ändern beginnt, so merkt man daran das Breiterwerden der geistigen und sozialen Basis, das Volkstümlich- und Bodenständig-Werden der abendländischen Kirche. Die Gemeindeglieder reden untereinander Latein und höchstens mit den führenden Geistlichen griechisch. Die lateinische Predigt beginnt, und wir stoßen auch schon auf die Anfänge einer bescheidenen lateinisch-christlichen Gebrauchsliteratur: Bibelübersetzungen, Märtyrerberichte, ein Kanonsverzeichnis sind uns erhalten. Wann und wo aber beginnt die selbständige höhere Entwicklung? Als erstes lateinisches Dokument von Rang gilt einigen Gelehrten der Dialog „Octavius“, nicht zufällig eine „Apologie“, die außerchristliche Leser ins Auge faßt. Sie hat einen römischen Rechtsanwalt namens Minucius Felix zum Verfasser. Es sieht wenigstens so aus, als neige sich die Waage im alten Prioritätsstreit heute zu seinen Gunsten und gegen den Vorrang seines Berufskollegen Tertullian. Wir beginnen trotzdem mit diesem und können den sonst unbekannten Minucius getrost beiseite lassen. Der erste lateinische Theologe, die erste profilierte christliche Persönlichkeit, die wir im lateinischen Abendland wirklich kennen, ist auf jeden Fall Tertullian, und Tertullian erhellt mit der Fülle seiner lebhaften und originellen Schriften zugleich die ganze Welt, in der er lebt und wirkt. Insofern steht er am Beginn der gesamten lateinischen Kirchengeschichte.
Tertullian ist Afrikaner, d. h. ein Bürger der römisch besiedelten Provinz Afrika, des heutigen Tunis. Hier ist Quintus Septimius Florens Tertullianus bald nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts in der Hauptstadt Karthago geboren. Sein Vater war Subalternoffizier; das Römische ist ihm von Haus aus selbstverständlich – wiewohl in jener charakteristisch afrikanischen Form des Römertums, das die Disziplin mit Kritik, den Ordnungssinn mit Spott und Leidenschaft zu verbinden liebt und in der Bereitschaft zur Selbsthilfe eher rebellisch wird, als daß es blindlings folgt und gehorcht. Der junge Tertullian erhält eine gute rhetorische und juristische Ausbildung, hält sich zeitweise auch in Rom auf und mag eine Anwaltspraxis eröffnet haben. Daß er mit dem berühmten, in den Digesten zitierten Juristen Tertullianus identisch wäre, ist wenig wahrscheinlich. Tertullian ist kein Gelehrter, obwohl er vieles liest und weiß und seine Leser gerne mit entlegenen Kenntnissen verblüfft; er ist, mit Harnack zu reden, „ein philosophierender Advokat“, in dessen Munde auch die exakte Sprache der Juristen zu einem Mittel der Rhetorik wird. Sein scharfer Intellekt ist ständig in Bewegung; aber für ein beschauliches Leben ist er verloren. Alles, was Tertullian denkt, sagt und tut, hat die wirkliche Welt im Auge und drängt auf eine praktische Entscheidung zu. Das bestimmt ihn auch in seinem geistigen Wesen. Tertullian ist stürmisch, heißblütig, mitunter gewollt rücksichtslos; er klagt selbst darüber, daß er die edle Tugend der Geduld niemals erlernen könne, und Hieronymus, der in mancher Hinsicht eine verwandte Natur gewesen ist, nennt ihn einmal einen Mann, der immer in Glut war (vir ardens). Aber Tertullian hat gleichwohl nichts Primitives an sich; er verliert nie die Herrschaft über sein Temperament, vielmehr: je mehr er sich in Zorn redet, je leidenschaftlicher und persönlicher er sich für das einsetzt, was ihm richtig erscheint, umso geschliffener werden seine Gedanken und sein Stil, umso raffinierter wirkt seine Taktik, und umso sprühender wird sein grausam treffender Witz. Römische Zucht, juristische Klarheit und militärische Disziplin sind im heißen, hochstrebenden Sinn und Herzen Tertullians in ein Element des Geistigen und des Gewissens verwandelt worden.
Wir kennen die Umstände nicht, die Tertullian zum Christentum hingeführt haben. Gewöhnlich denkt man vor allem an die Wirkung der christlichen Martyrien, die nach seinem eigenen Zeugnis die stärkste Werbekraft besitzen, überhaupt den moralischen Eindruck, welchen die unerschütterliche, in sich geschlossene Gemeinde inmitten der sie umbrandenden Welt großstädtischer Zügellosigkeit ausübte. Aber sicher darf man auch das geistige Gewicht der christlichen Lehre und Verkündigung daneben nicht übersehen. Die Botschaft von dem einen, schaffenden und gebietenden Gott, der kein Gedankenwesen ist, sondern den ganzen Weltlauf regiert, der die Dämonen durch Christus um ihre Macht gebracht hat und jetzt alle Menschen zur letzten Entscheidung ruft, ist Tertullian zum bestimmenden Erlebnis geworden. Dagegen gehalten enthüllt sich die gebildete Theorie und Weisheit der Philosophen als ein nichtiges, unwirksames Geschwätz. Die Wahrheit Gottes kann im Grunde kein vernünftiges Wesen leugnen, und doch ist sie offensichtlich nur den Christen wahrhaft offenbart und wirklich bekannt geworden. Sie kennen Gottes Sohn, und durch ihn, seine Lehre und sein Wort kennen sie Gottes ganzen Willen, Wesen und Gesetz. Tertullian muß schon früh auf die Bibel gestoßen sein, und sie ist es, an die er sich zeitlebens hält. Er kennt sie sozusagen in- und auswendig, er zieht sie bei jeder Gelegenheit ausdrücklich heran und legt sie, gegebenenfalls nach dem griechischen Urtext, selbständig aus. Darin, daß er in den Worten der Propheten, in den Worten des Heilands und seiner Jünger durchweg die unmittelbare Stimme Gottes vernimmt, ist Tertullian natürlich nicht originell; den Glauben an die „Schrift“ teilt er mit den Christen seiner Zeit. Aber weit mehr als alle Zeitgenossen hat er auch ein unmittelbares Gefühl für die wirkliche Eigenart der Bibel. Er weiß es und spricht es immer wieder aus, daß sie ganz und gar anders ist als aller Geist und alle vornehme Weisheit dieser Welt. Sein schroffer, kantiger Realismus entdeckt mit kongenialem Spürsinn die unklassische Glut und harte Nüchternheit der heiligen Schrift, ihren konkreten, paradoxen und keiner religiösästhetischen Idealisierung zugänglichen Charakter, und indem er sie in dieser ihrer Eigenart annimmt und in ihrer Fremdheit liebt, wird er zum originellsten und in vieler Hinsicht eindringlichsten Exegeten der ganzen alten Kirche, dessen Genauigkeit und Verständnis im einzelnen von keinem späteren Theologen übertroffen wird. Die Grenzen, an die er zuletzt stößt, sind die Grenzen seiner religiösen Gesamtauffassung des Glaubens, d. h. die Grenzen seiner stolzen, an die eigene Strenge erbarmungslos gebundenen Natur.
Zur Zeit, da wir Tertullian kennen lernen, ist er bereits ein angesehenes Glied der karthagischen Christengemeinde. Er steht in den besten Jahren, ist glücklich verheiratet und befindet sich in einer wirtschaftlich vielleicht nicht glänzenden, aber doch unabhängigen und sicheren Position. So hat er sich für den Unterricht der Katechumenen, der Taufanwärter und Neuchristen, zur Verfügung gestellt. Er mag auch sonst gelegentlich „gepredigt“, d. h. geistlich belehrende Ansprachen vor der Gemeinde gehalten haben. Aber vor allem betätigt sich Tertullian als freier Schriftsteller und setzt sich so vor Christen und Heiden zum Besten der christlichen Sache ein. Z. T. hat er seine Schriftstellerei noch auf Griechisch betrieben – „unseren Theaterästheten zuliebe“, wie er selbst ironisch bemerkt (coron. 6); aber es ist bezeichnend, daß sich keine seiner Schriften in griechischer Fassung erhalten hat. Für einen Autor, der so wie Tertullian auf die unmittelbare Wirkung und Anrede aus war und appellierend und dozierend vor allem seine nächsten Brüder und Mitbürger erreichen wollte, war der Übergang zum Latein das Gegebene. Aber was ist das für ein Latein, das Tertullian auf einmal zu schreiben wagt! Etwas Derartiges war auf dem literarischen Felde bis dahin unerhört. In Tertullians Schriften stoßen wir auf die lebendige Sprache der damaligen Christen, das Latein der werdenden lateinischen Kirche, eine Sprache, in der es dementsprechend von Lehnworten und Neubildungen wimmelt, um die neuen Dinge und Vorstellungen des christlichen Alltags zu bezeichnen, und zugleich bis ins Grammatische hinein die wirklich gesprochene Sprache der Gesellschaft und des Volkes von Karthago, das Tertullian kennt, beobachtet und sucht. Vor allem aber: es ist die eigene Sprache Tertullians, Ausdruck seiner gewalttätigen Gestaltungskraft, die nichts unerprobt läßt, um das neue, selbstgesteckte Ziel zu erreichen.
Tertullian versteht sein Handwerk von Grund auf. Er verzichtet auf kein Kunstmittel der bewährten Rhetorik, die er mit den feinsten Überraschungen, Wortspielen, Reimen, Stabreimen und rhythmischen Klauseln, allen Eigenarten und Unarten der modernen Schule zu verbinden weiß. Er erscheint seinem älteren Zeitgenossen und afrikanischen Landsmann Apuleius darin einigermaßen verwandt. Mit der glatten, klassizistischen Eleganz eines Minucius Felix, der seine christliche Schutzschrift im Stile Ciceros dargeboten hatte, hat Tertullian jedenfalls nichts zu tun. Er will die Wirklichkeit seiner Zeit treffen und entlarven, er will seine Hörer vor allem fassen, fesseln und festnageln. Darum drückt er sich lebendig, anschaulich und oft über die Grenze des Geschmackvollen hinaus drastisch aus. Aber sein Vulgarismus ist gleichwohl nie einfach gemein, weil er von der Sache her, im Sinne Tertullians: durch die Wahrheit selber gefordert ist. Das verleiht dem Krassen, scheinbar Vulgären seiner Rede die Würde eines höheren Auftrags und die Weihe des wirklichen Ernsts. Dieser Eindruck eines unnachgiebigen, heroischen Realismus steigert noch das gewollt Gedrängte, kurz Abgehackte und dann wieder sich stoßweise Entladende seiner Sätze. Fast jedes Wort Tertullians wird nach dem Ausspruch eines altkirchlichen Kritikers zur Sentenz, und diese aphoristisch-sentenziöse, politurlose Knappheit kann mitunter an Tacitus erinnern. Aber „das Pathos, das Tacitus mit vornehm verhaltener Indignation zurückdämmt, wird bei ihm zu einer alles Widerstrebende mit sich wirbelnden Sturmflut“. Kein anderer antiker Autor, sagt Eduard Norden in diesem Zusammenhang, hat „das höchste Gesetz antiker Kunstanschauung, die Unterordnung des Individuellen unter das Traditionelle“, so unaufhörlich verletzt wie Tertullian, dem sich Christus, wie er einmal sagt, eben „nicht als Gewohnheit, sondern als Wahrheit“ offenbart hatte (virg. vel. 1, 1). Das Schwerverständliche seiner Schriften ist schon im Altertum beklagt worden, und für uns ergibt sich als weitere Folge seines Stils, daß Tertullians Sätze schlechterdings in keine moderne Sprache, nicht einmal ins Englische, angemessen zu übersetzen sind. Nur das ursprüngliche Latein bewahrt den harten Stoß und Klang dieses Funken sprühenden Metalls.
Es gibt in der damaligen Kirche kaum eine Frage, zu der Tertullian nicht Stellung genommen und sich irgendwie geäußert hätte. Die etwa dreißig verschiedenen Schriften, die wir heute von ihm besitzen, sind denkbar vielseitig. Tertullian liebt es, thematisch zu gestalten und seinen bestimmten Gegenstand ohne Weitschweifigkeit zu erschöpfen. Die damals aufkommende Form des gleichmäßig fortlaufenden Bibelkommentars hat er sich nicht angeeignet. Seine Publikationen reichen vom kurzen, geistreich-krausen Flugblatt oder Essay bis zu umfangreichen theologischen Abhandlungen, die auch nach modernem Verständnis „Bücher“ darstellen und durchaus wissenschaftlichen Charakter tragen. Immer sind sie vorzüglich disponiert und behalten das vorgesetzte Ziel scharf im Auge. Sie orientieren den Leser in geschickter Weise, kommen seinen möglichen Einwänden zuvor, machen ihn auf die Tragweite und Bedeutung bestimmter Gedanken aufmerksam und reißen ihn unaufhaltsam mit sich fort. Tertullian besitzt eine unter Theologen seltene Eigenschaft: er versteht nicht, langweilig zu sein. Das gilt auch für die rein erbaulich-unterweisenden Abhandlungen, die zumeist wohl den Niederschlag katechetischer Erfahrungen darstellen. So schreibt er einen berühmten Traktat über das Gebet, „das allein Gott besiegt“, mit einer schönen und eindringlichen Auslegung des Vaterunsers, oder er belehrt seine Leser über den Sinn und die rechte Übung der Taufe oder der Buße; er beschreibt, wie eine christliche Ehe zu führen ist, oder er preist in einem eigenen Schriftchen die – ihm selber fehlende – Geduld. Was er so vorträgt, kann nicht immer neu sein; aber immer ist es selbständig durchdacht, in neuer Weise angefaßt und so dargestellt, daß jedermann die Aktualität der Frage begreift. Tertullian ist auch dort, wo er fremde Arbeiten nutzt, niemals ein bloßer Abschreiber, sondern stellt sich auf die wirklichen Leser ein, und das gibt seinen Schriften für das damalige kirchliche Leben den unvergleichlichen Quellenwert.
Die große Masse seiner Schriften trägt indessen einen anderen Charakter; sie sind polemisch und wenden sich kämpfend nach außen gegen die Feinde und Verfolger, die Irrlehrer und Verführer der Kirche, und hier erst kommen all seine Gaben und überlegenen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung. Tertullian weiß, wie man als Redner seine Hörer überzeugt, für sich gewinnt und gegen andere aufbringt. Er erscheint überall als der Mann, der wirklich Bescheid weiß, während seine Gegner lauter bösartige, verstockte und bornierte Gesellen sind, die vor einem urteilsfähigen Publikum kaum der Widerlegung bedürfen. Aber gleichzeitig spielt er gerne den noblen Polemiker, der seine Fechterstöße zurückhält, weil er nichts ungeprüft verurteilen möchte und jedem Andersdenkenden zunächst sein Recht, ja mehr als sein Recht zu lassen bereit ist. Er bringt seine Gründe nacheinander ins Spiel, er weiß, sie eindrucksvoll zu steigern, und gibt sich dabei immer den Anschein, als böte er nur eine Auswahl dessen, was er auf Lager hat. Oft läßt er den schon geschlagenen Gegner noch einmal frei, gönnt ihm scheinbar noch eine Chance, indem er seine schon als falsch erwiesenen Thesen unter Vorbehalt dennoch akzeptieren will, um seine Position auch so noch zum zweiten, dritten und vierten Mal unter dieser und unter jeder denkbaren Voraussetzung immer weiter zu zertrümmern und ihn zuletzt der Verachtung und völliger Lächerlichkeit preiszugeben, während die siegreiche Wahrheit unverletzt wie ein Phönix aus der Asche steigt. Es kann nicht ausbleiben, daß sich eine derartig advokatorisch geübte Beweistechnik auch überschlägt, und da Tertullian seine überscharf formulierten, angeblich ganz unverbrüchlichen Grundsätze je nach seinen Absichten stets neu zu arrangieren pflegt, gerät ein Leser, der bei ihm nach wirklich bestimmenden logischen, hermeneutischen und theologischen Prinzipien fahndet, leicht in Verzweiflung. Sein geistreicher Scharfsinn verführt dazu, ihn ernster zu nehmen, für tiefsinniger und tiefer zu halten, als er in Wirklichkeit ist. Aber dies bedeutet trotzdem nicht, daß es Tertullian mit dem, was er verficht, nicht ernst gewesen wäre. Die antike Rhetorik hält in der Polemik auch sonst vieles für erlaubt, was uns heute als illoyal oder bloße Spiegelfechterei erscheint. Tertullian nutzt die Möglichkeiten, die ihm seine Schulung und sein unvergleichliches Talent bieten, nur bis zum äußersten aus. Er ist kein Zyniker; aber er ist ein Meister der geriebensten Dialektik und spitzfindiger Ironie. Jedesmal, wenn er nach solchen Ausfällen mit einem oft prachtvollen, niemals schwülstigen Pathos zu seinem eigentlichen Gegenstande zurückkehrt, fühlt auch der moderne Leser unmittelbar, daß der ganze Mann mit Herz und Willen hinter seinem Zeugnis steht, und er begreift auch, warum er sich so schroff und hitzig, in so wilder Maßlosigkeit dafür eingesetzt hat.
Die frühesten Schriften, die wir von Tertullian besitzen, gelten der Verteidigung des Christentums gegen das heidnische Mißtrauen, gegen die Verleumdung und die blutige Verfolgung. Das war damals die erste, sozusagen klassische Aufgabe eines christlichen Literaten. Seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts verfaßten die griechischen „Apologeten“ ihre mehr oder weniger umfangreichen „Schutzschriften“ an die Kaiser, die in Wirklichkeit wie alle solche Literatur natürlich viel mehr von den Christen als von den Heiden gelesen wurden, für die sie bestimmt waren. Ihnen hatte sich noch Minucius Felix angeschlossen. Tertullian hat seine verschiedenen Vorgänger offenbar gründlich studiert und den Grund ihrer Erfolglosigkeit sofort erkannt: sie alle stellen sich nicht wirklich auf ihren Gegner ein, sie wollen zu viel auf einmal und konzentrieren sich nicht auf die sachlich und psychologisch entscheidenden Punkte. Außerdem erreichen sie auch literarisch und geistig nicht das für eine solche Auseinandersetzung erforderliche Niveau. Wir können noch die Etappen verfolgen, durch die Tertullian seiner Aufgabe in einem neuen Stil zu entsprechen sucht. Wir haben einen ersten Anlauf, den er liegen läßt, in dem zweigeteilten Werk „an die Heiden“; dann folgt das große „Apologeticum“, nicht mehr wie sonst an die unerreichbaren Kaiser, sondern an seine unverständigen Statthalter und Beamten gerichtet, in einer früheren und vielleicht in einer von ihm selbst nochmals überarbeiteten Fassung; schließlich noch originelle Variationen von Einzelthemen aus späterer Zeit.
Die große „Schutzschrift“ gilt mit Recht als das unübertroffene Meisterwerk der frühchristlichen Apologetik. Sie wurde alsbald sogar ins Griechische übersetzt, eine Auszeichnung, die auch in späterer Zeit nur ganz wenigen Schriften lateinischer Kirchenväter zuteil geworden ist. Tertullian wählt für die Apologie mit Bedacht die Form einer durchgeführten Gerichtsrede, wie sie den Christen zu halten in Wirklichkeit längst nicht mehr möglich war. Schon dieser Umstand, meint er, zeige die ganze Verwerflichkeit des gegen sie befolgten unwürdigen Verfahrens. Aber: „Die Wahrheit sucht nicht, ihre Lage durch Bitten zu ändern. Sie wundert sich auch gar nicht über ihr Schicksal. Sie weiß, daß sie auf Erden nicht zu Hause ist und unter einem Volk, das ihr fremd ist, bald genug auf Feinde stoßen muß, und weiß auch, daß sie ihren Ursprung, ihre Heimat, Hoffnung, Ehre und Würde im Himmel besitzt. Vorläufig verlangt sie nur eins: man soll sie kennenlernen, ehe man sie verurteilt“. Das ist, fügt Tertullian sarkastisch hinzu, für das herrschende Recht wohl kein Schade: vielleicht bilden sich die Machthaber noch mehr darauf ein, wenn sie die Wahrheit sogar gehört und dann trotzdem verdammt haben (apol. 1, 2 f.).
So beginnt die Verteidigung. Tertullian zerpflückt auf seine Weise das ganze juristische Vorgehen und zeigt, daß es Wahnsinn sei, die vertrauenswürdigsten Bürger des Reiches im Namen einer Religion zu verfolgen, die, selbst auf Lug und Trug gegründet, sonst nirgends mehr wirklich befolgt und ernstgenommen wird, und er wird nicht müde, den Nachweis zu führen, daß all die Scheußlichkeiten und Verbrechen, die man den Christen fälschlich zuschreibt, bei den Heiden von jeher geübt und geduldet wurden. Aber er unterläßt jetzt den ungeschickten Versuch, diese Polemik mit einer ausdrücklichen Werbung für das Christentum und zum Übertritt zu verbinden. Diese Folgerung mag der Leser von sich aus ziehen, wenn er die Lehre, die sittlichen Ordnungen und das Verhalten der Christen so kennengelernt hat, wie sie wirklich sind. Die dazu erforderlichen Nachweise und Aufklärungen werden jeweils an ihrer Stelle geboten. Tertullian hat nichts von dem Material fallen lassen, das die alte Apologetik zu bieten pflegte, er hat es sogar wesentlich erweitert; aber indem er den Rahmen einer fingierten Gerichtsrede bis zum Schlusse festhält, erscheint jetzt alles viel knapper und übersichtlicher, spannend und klar. Der Leser folgt den überraschenden Darlegungen und Enthüllungen mit angehaltenem Atem, und ehe er sich’s versieht, ist er beim Schlußwort angelangt, mit dem Tertullian, als hielte er weitere Bemühungen für zwecklos, scheinbar vorzeitig das Plädoyer abbricht: „Aber nur zu, ihr prächtigen Männer der Regierung, macht euch nur beim Volk beliebt, indem ihr ihm Christen schlachtet! Quält, foltert, verurteilt, vertilgt uns – euer Unrecht ist der beste Beweis unserer Unschuld. Darum duldet ja Gott, daß wir dies alles erdulden ... Und doch: die ausgeklügeltste Grausamkeit nützt euch gar nichts. Ihr macht nur Reklame für unsere Vereinigung. Wir nehmen zu, weil ihr uns immer von neuem niedermäht: ein Same ist das Blut der Christen (semen est sanguis Christianorum)“. Wir sind euch nur dankbar, daß ihr den Prozeß so schnell zu Ende bringt. Es stehen sich gleichsam zwei Gerichtshöfe im Kampfe Gottes und der Menschen gegenüber, und „wenn ihr uns verurteilt, spricht Gott uns frei“ (apol. 50, 12 ff.).
Der entscheidende Gedanke, mit dem Tertullian das staatliche Verfahren aus den Angeln hebt, ist danach nicht juristischen, sondern theologischen Ursprungs. Es ist die Überzeugung von der Nichtigkeit der Vielgötterei und von der Wirklichkeit des einen, offenbarten Gottes. Was die Machthaber und die besessenen Massen verehren, beruht auf Lüge, Menschenanbetung und leerem Wahn; dahinter aber stehen die gefährlichen Dämonen als die eigentlich treibende, verblendende und verführende Macht. Sie sind die natürlichen Feinde der Wahrheit und haben das irrsinnige Vorgehen gegen die Christen darum auch in Gang gebracht. Damit stürzt das religionspolitische System, die bisherige selbstverständliche Geltung einer herrschenden Staatsreligion, mit einem Schlage zusammen. Wie kann man denen, die den wahren, allmächtigen Gott erkannt haben, das verderbliche Götzen- und Dämonenopfer immer noch abverlangen? Wie kann man denen mangelnde Loyalität und Treue vorwerfen, die nur die offizielle Lüge nicht mitmachen wollen und, statt den Kaiser mit einer teuflischen Anbetung zu schädigen, vielmehr den wahren Gott zu seinen Gunsten anrufen und ihm selbst in allen Stücken wahrhaft ergeben sind? Darum waren die guten Herrscher von jeher den Christen auch wohlgesinnt, und nur die schlechten haben sie verfolgt. Diese alte Tendenzlegende, die einen unerfüllten Wunsch der Christen zur Wirklichkeit machen will, gewinnt im Munde Tertullians insofern doch etwas mehr an Wahrscheinlichkeit und Gewicht, als er jetzt über die unteren Verwaltungsstellen hinweg in aller Loyalität an die guten Kaiser appellieren kann, die über das Vorgehen ihrer ausführenden Organe und den Mißbrauch, der mit ihrem Namen getrieben wird, vielleicht gar nicht richtig ins Bild gesetzt sind.
All diese taktischen Deklamationen haben indessen eine noch weiter greifende, grundsätzliche Bedeutung. Wir stehen hier bei den Anfängen eines neuen Staats- und Gehorsamsbegriffs, den es vor dem Einbruch des Christentums in der Welt nicht gegeben hatte und der in eine ferne, fürs erste noch ganz unerreichbar scheinende Zukunft vorausweist. Die Herrscher und das staatliche Wesen überhaupt verlieren ihre unmittelbare religiöse Gewalt. Dafür bildet sich ein neuer Begriff des konkreten, innerweltlichen Gehorsams, der als solcher im Namen des wahren Gottes in neuer Weise verpflichtend und unausweichlich wird.„Was den Menschen fördert, das ist Gottesdienst“ (paen. 2, 7). Das bisherige, bei allem praktischen Liberalismus grundsätzlich sakrale, direkt religiöse Verständnis des Staates wird im Lichte des neuen, radikalen Glaubens und Glaubensgehorsams entdämonisiert und erscheint jetzt als eine einzige Unwahrhaftigkeit und Heuchelei. Wer, fragt Tertullian, hält denn den Kaiser in einem ernsthaften, d. h. christlich radikalen Sinne noch für einen Gott? und wer hält ihm noch von Herzen die Treue, wenn es nicht die Christen tun? Er scheut sich nicht, auf die ständigen Palastrevolutionen und Morde anzuspielen, und meint, wenn die Brust der Bürger und Politiker aus durchsichtigem Glase gemacht wäre, bekäme man ohne Zweifel recht unerwünschte Dinge zu sehen. Und ist es nicht überhaupt ein Unding, von Staats wegen Gesinnungen vorzuschreiben? ist der Glaube nicht seinem Wesen nach frei? Der Versuch, eine Gottesverehrung mit Gewalt zu fordern, ist wider menschliches und natürliches Recht, „und es ist auch nicht religiös, Religion erzwingen zu wollen“ (ad Scap. 2, 2). Man spürt hier die Berührung mit den Gedanken der philosophischen Aufklärung. Aber der neue Glaube an einen wirksam in der Welt offenbarten Gott befreit nicht nur den einzelnen von der äußeren Autorität des „Tyrannen“ – er droht, die gesamte religionspolitische Ordnung in Frage zu stellen und von der Wurzel her in einer Weise zu verändern, wie es die philosophische Staatslehre und Kritik weder gewollt noch jemals gekonnt hätte.
Im übrigen stellt es Tertullian so dar, als bedeute die Anerkennung der Christen durch das Reich überhaupt kein praktisches Problem. Sie sind ja nicht, wie man behauptet, „die Feinde des Menschengeschlechts, sondern nur die Feinde des Irrtums“ (apol. 37, 10). Es gibt darum gar keine besseren Untertanen als sie. Christen begehen keine Verbrechen, nicht einmal solche, die das Gesetz frei läßt; sie gehorchen jedem gerechten Befehl, zahlen ohne Unterschleif ihre Steuern und machen bei den politischen Umtrieben nicht mit. Auch was man über die sozialen und wirtschaftlichen Gefahren ihrer Lebensweise verbreitet, ist völlig kindisch. Die Christen nehmen selbstverständlich am gesamten bürgerlichen Dasein in allen Zweigen des Geschäfts- und Erwerbslebens wie jedermann teil. Überall – nur nicht gerade im Tempel! – sind sie zu finden. „Wir sind doch keine Brahmanen oder indische Gymnosophisten, keine Waldmenschen oder Sonderlinge, die das Leben fliehen!“ Wer an den Schöpfer glaubt, verschmäht nicht seine Gaben, sondern nur die Ausschweifung und das Übermaß. „Wir sollen euren Handel zerstören, obgleich wir mit euch und von euch leben – das begreife ein anderer!“ (apol. 42, 1 f.). Theologisch sind solche Sätze interessant; aber in der konkreten politischen Situation zeigen sie Tertullian – als Apologeten. In Wirklichkeit weiß er sehr wohl, daß die von ihm behauptete Lebensgemeinschaft mit der heidnischen Gesellschaft keineswegs so einfach zu haben, ja daß sie, strenggenommen, für den Christen eine Unmöglichkeit ist. Das heidnische Leben ist nun einmal der Wirkbereich der Dämonen; man kann nicht daran teilnehmen, ohne auf Schritt und Tritt ihrem Einfluß, ihrem Kultus und ihren Symbolen zu begegnen. Wo Tertullian zu Christen spricht, sucht gerade er ihr Gewissen gegen alle Kompromisse, die leider versucht werden, aufs äußerste zu schärfen, und schreckt vor keiner Konsequenz zurück. Nur für den heidnischen Lehrbetrieb macht er eine bezeichnende Ausnahme. „Hier dient der Notstand als Entschuldigung.“ Die Christen können den weltlichen Unterricht nicht vermeiden, weil auch die religiöse Bildung ohne ihn nicht auskommen kann und weil sie, über den wahren Gott belehrt, das heidnische Gift um so bestimmter zurückweisen werden. Aber auch hier gilt die Entschuldigung nur für die Schüler, nicht für die Lehrer, die die mythologischen Stoffe und alles, was damit zusammenhängt, unmöglich behandeln könnten (idol. 10). Die Grenzen des Erlaubten sind überall so eng wie nur möglich gezogen. Ein christlicher Handwerker oder Kaufmann darf nichts herstellen und nichts verkaufen, was auf irgendeinem Wege vielleicht dem Götzendienst, dem Opferwesen oder auch nur dem Luxus und heidnischer Sittenlosigkeit zugute kommen mag. Ein öffentliches Amt darf man unter gar keinen Umständen annehmen; denn wie will man dort den vorgeschriebenen Zeremonien und Feierlichkeiten, den Libationen und dem Weihrauchdampfe entgehen, die immer mit ihm verbunden sind? Wie will man vollends als Soldat es vermeiden, der Götzenstandarte die geforderte Verehrung zu erweisen? Ein Richter muß überdies noch Foltern verhängen und Todesurteile vollstrecken lassen. Tertullian will damit nicht sagen, daß diese Berufe schlechterdings ungerecht wären und reformiert oder abgeschafft werden sollten. Die Welt muß so sein, wie sie ist, und „die Römer, das heißt: die Nichtchristen“ (apol. 35, 9), brauchen natürlich ihre Verwaltung, ihre Beamten und ihre Kaiser. Aber was geht das die Christen an, die keine Kaiser werden, so wie die Kaiser notwendigerweise keine Christen sind (apol. 21, 24)?! Mag man sie weiter verfolgen und zu Märtyrern machen – am Tage des jüngsten Gerichts wird sich’s zeigen, wer den klügeren Entschluß gefaßt und zur besseren Fahne geschworen hat!
Es sind alte, urchristliche Gedanken von der Fremdlingschaft der Christen, von der Notwendigkeit ihres Leidens in der Welt und der alles bestimmenden Zukunft Gottes, die bei Tertullian mit neuer Kraft zum Leben erwachen – nur gewinnen sie jetzt einen einseitig polemischen, grimmigen und unversöhnlichen Ton und einen unüberhörbaren, fast politisch drohenden Akzent. Das geschieht z. T. mit Absicht – Tertullian möchte die Verfolger durch seine Warnungen womöglich zurückschrecken; aber es entspricht doch zugleich auch seiner inneren Wesensart, die weniger lieben als kämpfen, lieber brechen als biegen will und die den „Dienst“, die militia Christi, die er gerne in kriegerischen Bildern beschwört, gerade darum mit Freuden ergriffen hat, weil es hier nicht um Ausgleich, sondern um Entscheidung geht. Das Heidentum ist für Tertullian keine Torheit, die sich aufklären, kein Vorurteil und keine Verirrung, die sich zerstreuen oder positiv zurechtbringen ließe, sondern es ist „die Welt“ und als solche eine große, dämonische Einheit, die man als Ganzes erkennen, zurückstoßen und verwerfen muß.
So ist es kein Zufall, daß Tertullian in den letzten Kapiteln des Apologeticum auch noch eigens auf die Philosophie zu sprechen kommt, die höchste und scheinbar ideale Verkörperung des antiken Geistes und Lebens. Auch hier, wo sich die griechischen Apologeten fast durchweg bemüht hatten, eine gewisse Verständigungsbereitschaft zu zeigen, eine positive Gemeinsamkeit in den sittlichen Maßstäben und in der Erkenntnis der Wahrheit herauszuarbeiten, sieht er nur den Gegensatz und die gesteigerte Gefahr einer Verführung und Verwirrung in dem, worauf es ankommt. Philosophen sind für Tertullian „Sophisten“, die nicht die Wahrheit suchen, sondern den eigenen Ruhm und Erfolg. Ihre dialektischen und rhetorischen Künste sind eitel und verwickeln sie selbst in immer neue Widersprüche und Uneinigkeiten. Ihre Erkenntnis ist trügerisch und ihr Lebenswandel mangelhaft. Selbst das heiligste Symbol der philosophischen Unabhängigkeit und Freiheit, der Tod des Sokrates, flößt Tertullian keine Bewunderung ein: der Gleichmut vermeintlicher Weisheit war erkünstelt und floß nicht aus der Gewißheit eines wirklichen Wahrheitsbesitzes (anim. 1, 2 ff.). Es gibt keine Gemeinsamkeit „zwischen einem Philosophen und einem Christen, zwischen einem Schüler Griechenlands und dem Schüler des Himmels“ (apol. 46, 18) oder, geschichtlich formuliert, zwischen „Athen und Jerusalem, Akademie und Kirche“ (de praescr. 7, 9).
Natürlich übersieht auch Tertullian nicht die Übereinstimmungen, die sich damals für jeden gebildeten Christen zwischen seinen Überzeugungen und vielen überlieferten, insbesondere platonischen Lehren zu zeigen schienen. Er „will sie nicht leugnen“ (anim. 2, 1) und ist viel zu sehr ein Apologet, um sich nicht mitunter auf sie auch zu berufen. Aber er erklärt sie dann, einer älteren, ursprünglich jüdischen Theorie gemäß, aus der Benützung des Alten Testaments durch die Philosophen, dem „Diebstahl“, den die Hellenen an Gottes Weisheit begangen hätten; oder er führt sie im Sinne der Stoiker auf die „sensus communes“ zurück, die Elemente vernünftiger Einsicht, an denen von Natur aus jedermann teilhat. Was sich so ergibt, ist dann regelmäßig eine neue Bestätigung der christlichen Offenbarung und beileibe keine Empfehlung der Philosophen oder der Philosophie. Die Philosophen haben die Wahrheit immer auch mit ihren Irrlehren und Irrtümern vermengt. Es wäre ein durchaus verkehrter, gefährlicher Umweg, das Richtige bei ihren Mutmaßungen lernen zu wollen, statt es dort anzunehmen, wo die Wahrheit vollständig und lauter gegeben ist. Wer von Gott reden will, muß von Gott gelehrt sein. Ein Christ soll seinen Glauben darum „nicht auf fremdem, sondern auf dem eigenen Grund erbauen“ (anim. 26, 1).
Was den modernen Leser immer wieder in Verwirrung bringt, ist der Umstand, daß Tertullian trotz dieser radikalen Ablehnung der Philosophie, doch immer wieder von seinem eigenen philosophischen Schulsack Gebrauch macht, sogar dort, wo er sich auf durchaus theologischem Gebiet bewegt. Er beruft sich auf „Vernunft“ und „Natur“, spricht von Substanz, Akzidenz und „status“ eines Gegenstandes, er stellt methodische Grundsätze auf und gibt dialektische Unterscheidungen – nicht zu reden von den zahllosen Fällen, da er die Voraussetzungen seines Beweises bewußt oder unbewußt der philosophischen, besonders der stoischen Schultradition seiner Zeit entnimmt und sie für mehr oder weniger selbstverständlich hält, wie z. B. die stoische Lehre von der Körperlichkeit alles Wirklichen, die „Person“ Gottes nicht ausgenommen. Allein der Widerspruch, der sich so zu ergeben scheint, beruht auf einem Mißverständnis dessen, was Tertullian unter Philosophie versteht. Für Tertullian bezeichnen Glaube und Philosophie einen vor allem inhaltlich unterschiedenen Besitz prinzipiell gleichartiger Erkenntnis, die auf verschiedenen Wegen gesucht und angeeignet wird. Der Glaube hält sich an das, was Gott offenbart hat, während der Philosoph in der Einbildung lebt, auch solche Fragen, die über den menschlichen Horizont hinausreichen, von sich aus ergründen zu können. Was Tertullian fordert, ist nicht eigentlich das „sacrificium intellectus“, sondern eine sachgemäße Begrenzung der intellektuellen Hybris des Menschen, nach dem Maßstab von Gottes Wort. Gott tut gewiß nichts Unvernünftiges (paen. 1, 2); aber der Mensch ist vor allem zum Hören und zum Gehorchen geschaffen (paen. 4, 4 ff.). Es handelt sich im Verhältnis von Offenbarung und Philosophie noch nicht um die spätere, formale Unterscheidung von Glaube und Vernunft oder „Glauben und Denken“. Der Glaubende denkt unter Anerkennung der göttlichen Offenbarung nicht weniger logisch, vernünftig und „wissenschaftlich“ wie ein Philosoph; nur daß er das Ziel auf seinem Wege auch tatsächlich erreicht. Insofern kann man das Christentum auch als die wahre oder „bessere Philosophie“ bezeichnen (pall. 6, 2), obschon Tertullian dieser den Apologeten sonst geläufigen Vorstellung für gewöhnlich aus dem Wege geht. Keinesfalls aber läßt sich eine Philosophie, die Gottes Weisheit nicht annehmen will, mit der „natürlichen Vernunft“ gleichsetzen; denn die unverbildete Natur stimmt in der Anerkennung Gottes gerade mit dem Christentum überein. In einer kleinen apologetischen Abhandlung über „das Zeugnis der Seele“, der liebenswürdigsten Schrift, die Tertullian geschrieben hat, sucht er diesen Gedanken des näheren zu illustrieren. Aus den „Selbstverständlichkeiten“ des gesunden Menschenverstandes, bis hin zu den unwillkürlichen Ausrufen und Redensarten, läßt sich, meint er, ohne weiteres zeigen, daß die „Seele“ in Wahrheit nur einen Gott kennt, daß sie sein Gericht fürchtet und daß sie bei ihm vor der Gewalt der Dämonen Schutz suchen möchte. Sie gibt dem Glauben damit ein wirksameres Zeugnis, als es alle gelehrte Apologetik vermag. Aber wohlgemerkt: es handelt sich nur um die Seele, die noch „schlicht und roh, ungebildet und einfältig“ ist. Eine Seele, die bereits geschult und gebildet, die akademischen Weisheiten Attikas „aufstößt“, ist keine Christin mehr, und mit ihr ist dann auch nichts Vernünftiges mehr anzufangen (test. an. 1, 6 f.).
Es ist zum Verständnis solcher Anschauungen nützlich, daran zu erinnern, daß Tertullian ein Abendländer war. Im lateinischen Abendland hatte die Philosophie niemals die öffentlich anerkannte Stellung und unabhängige Wirksamkeit gefunden wie in der griechischen Welt. Hier konnte sie in der Tat viel leichter als tote Schulweisheit und bloße Rhetorik, als leere Halbbildung und dekoratives Geschwätz erscheinen. Aber will man den ganzen Zorn Tertullians richtig verstehen, so darf man dabei nicht stehenbleiben. Man muß die eigentlichen, theologischen Gegner ins Auge fassen, an die er unwillkürlich denkt, sobald von der nichtsnutzigen Hohlheit der Philosophie die Rede ist. Das sind die Irrlehrer, die aufgeblasenen Schulhäupter und Phantasten einer „gebildeten“, vermeintlich höheren Weisheit und Erkenntnis, die selbst Christen verführt und allen Glauben verdirbt. Die Philosophen sind die „Erzväter der Ketzer“ (anim. 3, 1); erst damit wird die letzte Scheußlichkeit des philosophischen Unwesens endgültig offenbar.
Schon dem Umfang nach macht die Bekämpfung der Irrlehre den größten Teil von Tertullians Hinterlassenschaft aus. Es sind zugleich Schriften, in denen sein Ernst und seine sachliche Beteiligung bei aller polemischen Unruhe und Übertreibung am klarsten hervortritt. Der heutige Leser stößt sich freilich leicht an der Maßlosigkeit dieser Polemik. Tertullian bemüht sich nicht darum, seine Gegner von ihren eigenen Voraussetzungen her zu verstehen und ihren jeweiligen „Anliegen“ gerecht zu werden; er will sie bloßstellen und übergießt sie immer wieder mit seinem ätzenden Hohn. Aber er selbst hätte in dieser Feststellung schwerlich einen Vorwurf gesehen. Gerade darum will er ja die Ketzer mit allen verfügbaren Waffen schlagen und vernichten, weil es ihm wirklich um die Sache, um die Wahrheit und den Bestand des christlichen Glaubens geht. Die Frage, auf die es ankommt, kann unter diesen Umständen nur die sein, ob die Karikatur der Ketzer, um die es sich zweifellos handelt, als solche „richtig“ ist, d. h. ob sie die wesentliche Schwäche der gegnerischen Position enthüllt und trifft und dadurch auch tiefere, grundsätzliche Bedeutung gewinnt. Diese Frage läßt sich bejahen. Tertullian ist kein Verleumder, kein gemeiner Pamphletist, der sich beliebige Vorwürfe aus den Fingern saugt, sondern hat die wesentlichen, gemeinsamen Elemente der gegnerischen Position begriffen und unter großen Gesichtspunkten dargestellt und bekämpft – längst ehe die moderne Wissenschaft die zahllosen Gruppen und Richtungen der damaligen Ketzerei unter der einheitlichen Bezeichnung „Gnosis“ zusammenfaßte. Was ist für Tertullian die Gnosis? Sie ist der auflösende Synkretismus, wie ihn die natürliche Geistigkeit des Menschen liebt, die spiritualistisch-idealistische Selbstüber-Schätzung, die die feste Grenze verwischt, welche die Kreatur von der Gottheit scheidet; und sie ist darin zugleich die „nihilistische“ Feindschaft gegen den Gott der Wirklichkeit, der die Welt geschaffen und sich konkret im Fleische offenbart hat.
Voran steht, wie bei den griechischen Vorgängern, die starke Betonung der kirchlichen und dogmatischen Unbeständigkeit, des ständigen Schwankens und Fließens gnostischer Gemeinschaften und ihrer Spekulation. Die Ketzer verlassen sich eben auf ihre eigenen Einfälle und nicht auf Gottes Wort. Dieser Grundzug der unermüdlichen Neugier und Eitelkeit, die curiositas, begründet die innere Verwandtschaft und Verbundenheit mit der Philosophie. Nicht umsonst hat schon Paulus die Christen vorausschauend vor der Philosophie gewarnt (Kol. 2,8). Sie sollen nach Salomos Lehre „mit einfältigem Herzen den Herrn suchen“ (Weish. 1,1), nicht aber ein neues „stoisches, platonisches oder dialektisches Christentum“ erfinden (praescr. 7,11). Die Phantastereien, die dabei herauskommen, sind dann schlimmer als alle Philosophie. Es kann einem geradezu weh tun zu sehen, wie ein Plato jetzt herhalten muß, jedes Süppchen der häretischen Küche mit seinen Gedanken zu „würzen“ (de an. 23,5). Auch Seneca gehört mit dem, was er vernünftig sagt, nicht auf ihre Seite, vielmehr, wie so oft, „zu uns“ (de an. 20,1). – Kein Wort des Neuen Testaments führen die Irrlehrer so gerne im Munde wie die Weisung Jesu, man solle „suchen, um zu finden“ (de praescr. 8,2). Aber sie selbst berufen sich darauf nur, um ihre „endlosen Fabeln und Genealogien (1. Tim. 1,4), unfruchtbaren Fragen und krebsartig fortschleichenden Reden“ auszubreiten und arglose Hörer damit zu verwirren (praescr. 7,7). Die Ketzer wollen nicht hören und begreifen, daß es sinnvoller Weise nur dort ein Suchen gibt, wo man die Wahrheit noch nicht kennt, und daß wir bei Christus und bei seinem Evangelium darum ans Ende alles Suchens, nämlich ans Ziel gelangt sind. Der wahre Glaube ist immer einfältig (adv. Marc. V 20): Tertullian empört die spekulierende und problematisierende Grundhaltung der Ketzerei, die das Eine, was not ist, nicht halten kann. „Jeder christliche Handwerker“ weiß genau, worum es geht und worauf es jetzt für ihn ankommt; „er findet Gott und zeigt ihn an und besiegelt alle theoretischen Fragen nach Gott dann auch praktisch mit der Tat“ (apol. 46,9). Aber Christus hatte sich offenbar schwer geirrt, als er „lieber einfache Fischer als Sophisten zur Verkündigung aussandte“ (anim 3,3).
Der Ketzer weiß nicht, was glauben heißt. Er setzt seinen Stolz darein zu erkennen, er will wissen, statt sich von Gott lehren zu lassen, und folgt lieber menschlichen Lehrern, als sich dort zu bescheiden, wo Gott nicht mehr reden will, sondern schweigt. Dabei meint er immer schon zu wissen, wer Gott ist, was Gott tut, kann und darf und was Gott demnach angemessen ist und was nicht. Darum begreift er auch nicht, was das heißt, daß Gottes Sohn Mensch geworden ist. Tertullian trifft den entscheidenden Punkt der damaligen Diskussion: der gnostische Spiritualismus leugnet die Inkarnation. Sie erscheint ihm überflüssig und Gottes unwürdig. Der Gnostiker kann nur einen scheinbaren („doketischen“) Eingang Jesu in das Fleisch zugestehen; denn er kennt nur den erdachten, unwirklichen, nichts wendenden und nichts rettenden „Gott der Philosophen“ – der Ausdruck stammt von Tertullian (adv. Marc. II 27,6) –, der in Weltferne und Transzendenz verharrt. Ihm ist die häßliche, erniedrigte, ruhmlose Gestalt des Heilands ein Ärgernis, er hält diese Form der Offenbarung und Nähe Gottes für eine Beleidigung göttlicher Majestät. Er begreift nicht, daß Gott auf anderen Wegen nicht wirklich zu uns gelangt wäre und daß seine Würde anderer Art ist als der menschliche Ruhm. „Nichts ist Gottes so würdig wie des Menschen Heil“ (adv. Marc. II 27,1). Die Menschwerdung und nicht minder die Kreuzigung Christi, die den doketisierenden Theologen zur Verlegenheit werden, sind das eigentliche Geheimnis unserer Rettung. Für sie – und ausdrücklich nicht für die allgemeine Verkündigung Gottes und seiner Gebote – beruft sich Tertullian darum mit vollem Recht auf die paulinischen Sätze von Gottes „Torheit“, die die menschliche „Weisheit“ zu schanden macht. Seine berühmte Behauptung des „Credo, quia absurdum est“ wird meist nicht wörtlich zitiert und vor allem nicht in dem Zusammenhang verstanden, den er im Auge hat: „Gottes Sohn ist gekreuzigt – das ist nicht beschämend, weil es eine Schmach ist; und Gottes Sohn ist gestorben – das ist glaubwürdig, weil es eine Torheit ist; und er ist begraben und auferstanden – das ist gewiß, weil es unmöglich ist“ (carn. Chr. 5,4). Die scharfen Paradoxien sind mit Fleiß so provozierend formuliert: so kennen und so wollen die Christen ihren Gott – und dieser Gott läßt sie auch nicht im Stich, gerade dann nicht, wenn sie ihn in scheinbar hoffnungsloser Lage bekennen dürfen und äußerlich unter Martern zugrunde gehen.
Religion – das ist für Tertullian das Leben in der Wirklichkeit. Für den Ketzer ist sie dagegen ein Bereich des selbstgefälligen Tiefsinns und der erbaulichen Träumerei. Damit kann der Glaube nichts anfangen. Wer Christus im Leben wie im Sterben nachfolgen soll, der verlangt nach einem wirklichen, geschichtlich begegnenden, gestorbenen und in Ewigkeit lebenden Gott. Die Leibhaftigkeit, die volle Realität des „Fleisches“ Christi ist die Garantie der Wirklichkeit und Ernsthaftigkeit unserer Erlösung, so wie unsere Körperlichkeit zugleich die Unausweichlichkeit unserer persönlichen Verantwortung in dieser Welt bestimmt. Wer die Wirklichkeit des Fleisches Christi leugnet und wer sich selbst nicht fleischlich, sondern in der Unabhängigkeit einer überweltlichen Geistigkeit zu begreifen wünscht, wird ganz von selbst dazu gebracht, im konkreten Ernstfall der Anfechtung und Versuchung mit der Welt zu paktieren – mit der Weisheit, mit der Sittenlosigkeit und mit den Göttern und Dämonen dieser Welt. Die Martyriumsscheu so vieler Sekten ist die Probe aufs Exempel. Tertullian verfaßt eine eigene Schrift, „Das Gegengift gegen den Skorpionenstich“, in der er den mancherlei Ausreden begegnet, die das Blutzeugnis zugunsten eines jenseitigen oder innerlichen Zeugnisses im Geiste zu entwerten suchen. Für ihn ist jeder Gnostiker ein potentieller Verleugner, ein laxer Drückeberger und hochnäsiger Verächter des kirchlichen Gebots. Das ist gewiß eine Übertreibung und eine unerlaubte Verallgemeinerung. Aber die Geschichte der Gnosis zeigt, daß Tertullian mit dem, was er behauptet, trotzdem nicht einfach unrecht gehabt hat: fast all ihre Gemeinschaften sind mit der Zeit in einem unbestimmten Synkretismus zugrunde gegangen, wie er der Unbestimmtheit und Unbegrenztheit ihres fleisch- und geschichtslosen Offenbarungsbegriffes entsprach.
Für die katholische Kirche ist die Offenbarung auch äußerlich klar und verpflichtend gegeben: sie lebt von dem Einen, Bestimmten und Gewissen, das Christus angeordnet hat und die Heilige Schrift enthält. Sie besitzt das zweischneidige Schwert des Gotteswortes in Gesetz und Evangelium, die göttliche Weisheit, „den Feind des Teufels, unsere Rüstung gegen die geistlichen Feinde, alle Bosheit und fleischliche Begier, das Schwert, das um des Namens Gottes willen uns auch von denen abschneiden kann, die uns die liebsten sind“ (adv. Marc. III 14,3). Wer die Wahrheit nicht verstehen will, mit dem soll man auch nicht disputieren. Die Kirche kennt Gottes Wort und braucht sich mit den Markioniten, Valentinianern und sonstigen Gnostikern, die es verdrehen, nicht über seinen Sinn zu streiten. Diesen Gedanken hat Tertullian in einer eigentümlichen Schrift, der „Prozesseinrede gegen die Häretiker“, in eine streng juristische Form zu bringen gesucht. Sie ist für die spätere Entwicklung des Katholizismus höchst folgenreich geworden. Die katholische Kirche, heißt es hier, hat ihre Lehre wie die Heilige Schrift unmittelbar von den Aposteln empfangen – zu einem Zeitpunkt, wo all die heutigen Ketzereien noch gar nicht entstanden waren. Sie hat die ursprüngliche Wahrheit treu bewahrt und kann dies gegen spätere Abweichungen auch beweisen; denn sie steht ja noch heute mit den alten, apostolischen Gründungen in Kleinasien, Griechenland usw. oder, für das Abendland, mit Rom in ungestörter Gemeinschaft. Und woher sollte die Übereinstimmung der Rechtgläubigen in aller Welt überhaupt kommen, wenn sie nicht ursprünglich gegeben war? Hiergegen verfängt auch nicht die beliebte gnostische Verdächtigung der Apostel, als hätte ihnen Christus nicht alles anvertraut oder als hätten sie seine Lehre mißverstanden oder gefälscht. Sie konnten doch nicht alle auf die gleiche Weise die Wahrheit verwirren. „Was bei so vielen Gemeinden immer als ein- und dasselbe erkennbar ist, kann nicht irrig, es muß überliefert sein“ (praescr. 28,3). Es genügt also, wenn man der kirchlichen Lehre treu bleibt und die Bibel so versteht, wie es dem Bekenntnis entspricht. (Bei Tertullian taucht das Apostolicum zum ersten Mal in diesem normativen Sinne auf, als eine die Gemeinden verpflichtende „Glaubensregel“). Die Ketzer dagegen haben auf dem Boden der Kirche nichts zu suchen und berufen sich zu Unrecht auf die Schrift. „Wer seid ihr, seit wann und von wo kommt ihr eigentlich her? Was treibt ihr in meinem Eigentum, ohne zu mir zu gehören? Wer gibt dir, Markion, eigentlich das Recht, meinen Wald zu fällen? Wie kommst du dazu, Valentin, meine Quellen abzuleiten? Woher dein Anspruch, Apelles, meine Marken zu verrücken? ... Mein ist der Besitz; ich besitze ihn von jeher, besitze ihn vor euch und habe sichere Beweistitel von den Eigentümern selbst, denen das Objekt gehört hat. Ich bin der Erbe der Apostel“ (praescr. 37,3 ff.).
Das ist ein echt tertullianisches Vorgehen: es wird nach allen Seiten hin, so viel nur irgend möglich ist, bewiesen. Tertullian beansprucht zunächst einmal jedes Recht für sich allein und streitet den Gegnern nicht weniger als alles ab. Aber wir hätten es nicht mit Tertullian zu tun, wenn er sich mit einer solchen äußersten, formalen Sicherung begnügt hätte. So schließt er schon diese „summarische“ Prozeßeinrede mit der Versicherung ab, er werde, so Gott will, auf die ketzerischen Irrlehren auch noch im besondern zurückkommen, und dieses Versprechen hat er im Lauf seines Lebens tatkräftig eingelöst. Vor allem wäre hier das fünfteilige Riesenwerk „gegen Markion“ zu nennen. Hier hat Tertullian all seine Kräfte und Fähigkeiten zusammengenommen; denn in Markion hatte er seinen gefährlichsten Gegner gefunden. Es ist bewunderungswürdig, wie er die schärfste Logik und Dialektik, alle Künste der Rhetorik, der Ironie, die echte, erbitterte Leidenschaft und die feinste Sorgfalt und erschöpfende Gründlichkeit in der Sache in diesem polemischen Meisterwerk miteinander zu verbinden weiß. Markion ist für Tertullian der Erzketzer. In der Tat hatte dieser schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts eine eigene Kirche gegründet, die jetzt überall verbreitet war. Markion war Tertullian darin seiner Art nach verwandt, daß er gleichfalls immer die radikalsten Lösungen und die strengsten Positionen für die besten und für die eigentlich christlichen hielt. Er mißachtete dabei, wie die Katholiken, alle schweifende Ungebundenheit und Phantastik der gewöhnlichen Gnostiker und wollte auch seinerseits nichts als ein treuer Jünger Jesu und Schüler seines größten Apostels, Paulus, sein. Aber Markion und die Markioniten leugneten jeden Zusammenhang der christlichen Botschaft mit der früheren jüdischen Offenbarung des Alten Testaments, hinter der ein anderer, enger und feindseliger Gott stehen sollte, eben der moralische, „gerechte“ Gott dieser Welt, mit dem das echte Evangelium darum seinem Wesen nach gar nichts zu tun haben kann. Unter diesem Leitgedanken hatte Markion seine eigene Bibel geschaffen, die nur aus entsprechend verstümmelten Texten des Lukasevangeliums und der paulinischen Briefe bestand. Dagegen beweist jetzt Tertullian mit einer Klarheit, die jedem modernen Theologen Ehre machen würde, die Unhaltbarkeit dieser Redaktion; er erklärt sich gleichzeitig seiner Art gemäß sofort auch bereit zu zeigen, daß sogar das verfälschte markionitische Testament noch immer Markion widerlege und für die christliche Wahrheit zeuge, und er begründet die eigene Position und das Bekenntnis zur Einheit Gottes auch auf systematischem Wege durch den Nachweis, daß Gerechtigkeit und Güte, daß die souveräne Überweltlichkeit des Schöpfers und seine barmherzige Hinwendung zur Welt innerhalb des christlichen Gottesgedankens ihrem Wesen nach nicht zu scheiden seien.
Wir gehen auf die antignostischen Schriften Tertullians nicht im einzelnen ein. Ihre Fragestellung ist uns insofern fremd geworden, als das gnostische Denken das Problem der Wirklichkeit und der Offenbarung Gottes sozusagen von der entgegengesetzten Seite angreift und auflöst, als wir es gewohnt sind. Die Gnostiker insgesamt leugnen nicht die Transzendenz und Wirklichkeit des göttlichen Geistes, sondern Wirklichkeit und Sinn der materiellen, irdischen Welt; sie bezweifeln nicht die Notwendigkeit einer Erlösung, sondern den göttlichen Ursprung der Schöpfung und leugnen dementsprechend auch nicht die göttliche, sondern gerade die menschliche Seite des Erlösers, seine körperliche Natur und sein Fleisch. Auch auf diesem Wege ergibt sich zuletzt ein gewisser „Nihilismus“ als sittliche Konsequenz, und wir begreifen es wohl, daß die Gnosis keinen erbitterteren Gegner finden konnte als gerade Tertullian. Tertullian ist alles nur Geistig-Theoretische, Poetisch-Ästhetische, praktisch und moralisch nicht unmittelbar Faßbare schon als solches ein Greuel, weil er als Denker, wie wir sahen, Materialist und als Christ vor allem ein Mann des Gesetzes, des göttlichen Gebotes und des bedingungslosen Gehorsams ist. Was er verteidigt, ist die katholische Kirche und die christliche Glaubensforderung in ihrer unerbittlichen Realität; aber – man begreift es wohl, daß der schroffe Rigorismus einer solchen Persönlichkeit, gerade in ihrer geistigen Überlegenheit, auch für die eigenen Glaubensgenossen nicht immer bequem und leicht zu ertragen war. Vor allem in den praktischen Fragen der Gemeindedisziplin und der alltäglichen Sittlichkeit mußte es mit der Zeit zu Reibungen kommen.
Wir lernten Tertullians schwierigen Standpunkt schon kennen, wo es um das Verhältnis der Christen zur Welt und ihren Sünden ging. „Es verleugnet jeder, der sich bei irgendeinem Anlaß nicht offen zeigt und für einen Heiden halten läßt“ (idol. 22,4), und jeder, der in irgendeiner Form vom heidnischen Kultus und heidnischer Sittenlosigkeit einen Gewinn zieht. Man fragt sich, welchen Beruf ein ärmerer Christ eigentlich noch ergreifen kann, ohne daß Tertullian den Vorwurf einer indirekten Beihilfe zum Götzendienst erhübe, der aller Laster Anfang ist. Er wettert in der gleichen Weise gegen alle heidnischen Vergnügungen, die städtischen Wettkämpfe, Zirkusveranstaltungen und das Theater, das nicht nur, wie er mit archäologischer Gelehrsamkeit nachweist, den Götzen zu Ehren begründet wurde, sondern auch heute noch eine Brutstätte aller Unsittlichkeit und Ausschweifungen geblieben ist. Ebenso soll ein Christ auf allen Luxus verzichten, auf Schminke, Putz und kostbare Geräte. Hätte Gott an bunten Kleidern Gefallen – warum hat er dann nicht purpurne und himmelblaue Schafe geschaffen? Die christlichen Theaterfreunde scheinen in ihrem Widerstand besonders hartnäckig gewesen zu sein. Sie versuchten es sogar mit biblischen Begründungen: wo steht denn geschrieben, daß Gott die Spiele verurteilt, die er doch duldet und stattfinden läßt? Hat nicht auch David vor der Bundeslade getanzt, und ist Elias nicht im feurigen Wagen gen Himmel gefahren? Aber mit solchen Zweck-Exegesen ist Tertullian nicht beizukommen. Er zerpflückt sie mit grausamem Hohn und läßt zuletzt nur ein Schauspiel gelten, das für alle irdischen Entbehrungen entschädigen wird, das Schauspiel des jüngsten Gerichts! „Das wird eine Vorstellung von noch ganz anderem Ausmaß geben! Da werden wir staunen, da werden wir lachen! Welch ein Spaß, welch ein Vergnügen, wenn ich die Menge der Könige sehe, von denen es hieß, sie seien im Himmel aufgenommen, wie sie zusammen mit Jupiter und den angeblichen Zeugen dieser Vorgänge im Abgrund der Finsternis seufzen müssen! – Wie aber auch die Statthalter, die den Namen des Herrn verfolgt haben, in gräßlicheren Flammen zergehen, als die waren, mit denen sie fröhlich gegen die Christen gewütet haben! Ja, wer noch? Auch jene weisen Philosophen, die zu erzählen wußten, Gott kümmere sich um nichts in der Welt, es gäbe bestimmt keine Seele oder sie kehre jedenfalls niemals in ihren Körper zurück, sie werden da im Angesicht ihrer Schüler, die mit ihnen brennen, hübsch rot werden! ... Da müßt ihr erst die großen Tragöden hören – ihr Organ klingt noch weit schöner, wenn sie ihr eigenes Elend bejammern! Da müßt ihr die Mimen beobachten – das Feuer macht sie noch ganz anders gelenkig! Da muß man sich die Wagenlenker ansehen – sie sind im Flammenrad vom Scheitel bis zur Sohle rot geworden!“ Und dann erscheint der verhöhnte, geprügelte, bespuckte, mit Galle und Essig getränkte Herr in seiner Herrlichkeit, inmitten der Engel und auferstandenen Heiligen, vor den falschen Juden und sonstigen Verfolgern! Solch ein Spiel richtet kein Prätor, kein Konsul und kein Priester auf Erden aus, und in gewisser Weise haben wir es doch schon heute im Geiste vor Augen – noch ehe schließlich das, „was kein Auge gesehn und kein Ohr gehört hat“ (I. Kor. 2,9), im ewigen Gottesreich seinen Anfang nimmt. „Ich denke, das wird doch noch etwas erfreulicher sein als Zirkus und Bühne!“ (spect. 30,3 ff.).
So etwas schreibt nur Tertullian. Kein Grieche, aber auch kein mittelalterlicher Christ hat etwas derartig bis zum Sadismus Wildes, Grausig-Grandioses je wieder zu Papier gebracht. Tertullian ist durch nichts zu erschüttern. Auch die wirtschaftlichen Sorgen derer, die er mit seinen rigorosen Forderungen um ihren Lebensunterhalt zu bringen droht, weist er kurzerhand ab: „Was sagst du da? ‚Ich komme ins Elend!‘ Aber der Herr preist doch die Armen selig ... Die Jünger, die er berief, erklärten niemals: ‚Ich habe aber nichts zum Leben.‘ Der Glaube fürchtet den Hunger nicht; er weiß, daß er den Hungertod um Gottes willen genauso verachten muß wie jede andere Todesart“ (idol. 12,2.4). Solche schneidenden Antworten bringen die Hörer wohl zum Schweigen; aber ihr dumpfer Widerstand läßt sich damit doch nicht überwinden. Tertullian fühlt das selbst. Er beklagt sich ironisch-bitter über das gewohnte, „ihm eigentümliche“ Schicksal, mit seinen Schriften keinen Erfolg zu haben. Und doch verficht er nichts, wozu nicht die Wahrheit selber ermahnt, gegen deren Zeugnis keine Verschiedenheit der Zeiten, keine Menschen-Autorität und keine Landesgewohnheit etwas bedeuten