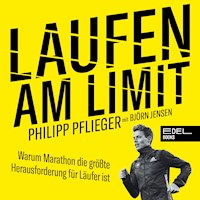
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - Ein Verlag der Edel Germany GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Philipp Pflieger war bei Olympia 2016 der schnellste deutsche Marathonläufer. Ein Jahr später sorgte er für Schlagzeilen, als er beim Berlin-Marathon seine Kräfte überschätzte und das Rennen orientierungslos abbrechen musste. Daraus hat er viel gelernt, nicht nur über die Königsdisziplin des Laufens, sondern auch über sich selbst. Sein nächstes Ziel: Olympia 2020 in Tokio. In seinem Buch nimmt Pflieger uns mit hinter die Kulissen des professionellen Marathonlaufens. Er schreibt über die Faszination des Laufens, lässt uns Siege und Niederlagen miterleben, und gibt Tipps, was Amateure von den Profis lernen können. Er spricht über Motivation und mentale Vorbereitung, die richtige Taktik und Verpflegung, aber auch offen und ehrlich über Leistungsdruck, Doping und die Herausforderungen als deutscher Profi in einer traditionell von afrikanischen Läufern dominierten Sportart. Ein hochspannendes, leidenschaftliches Buch von einem Spitzenathleten über die faszinierende Welt des Marathonlaufs, der inzwischen so viele Läufer in seinen Bann zieht.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
EINLEITUNGDas Rennen meines Lebens
TEIL 1 STARTPHASE
KILOMETER 1Aufwachsen
KILOMETER 2Erste Lauferfahrungen
KILOMETER 3Vorbilder
KILOMETER 4Erster Rückschlag
KILOMETER 5In den Leistungssport
#VERPFLEGUNG 1Mentale Vorbereitung
TEIL 2 TEMPO FINDEN
KILOMETER 6Trainer
KILOMETER 7Zurechtfinden im Team
KILOMETER 8Leistungsdruck
KILOMETER 9Das duale System
KILOMETER 10Regensburg
#VERPFLEGUNG 2Die Schuhe
TEIL 3 DRANBLEIBEN
KILOMETER 11Innovatives Gesamtpaket
KILOMETER 12In den Marathon
KILOMETER 13Motivation bei Erfolg – und bei Misserfolg
KILOMETER 14Training vs. Marathon-Vorbereitung
KILOMETER 15Trainingslager
#VERPFLEGUNG 3Die Bekleidung
TEIL 4 VON GROßEM TRÄUMEN
KILOMETER 16Der Geist von Olympia
KILOMETER 17Olympia aus Fan-Sicht
KILOMETER 18Der Weg nach Rio
KILOMETER 19Rio – das Erlebnis
KILOMETER 20Die Lehren aus Rio
#VERPFLEGUNG 4Ernährung
TEIL 5 TEMPO VERSCHÄRFEN
KILOMETER 21Ärger mit dem Verband
KILOMETER 22Die Hatz nach einer Norm
KILOMETER 23Marathon weltweit
KILOMETER 24Sport und Wirtschaft
KILOMETER 25Leistungssportreform
#VERPFLEGUNG 5Anfängerfehler
TEIL 6 AUF DEN KÖRPER HÖREN
KILOMETER 26Gesundheit
KILOMETER 27Ernährung
KILOMETER 28Emotionen und Sex
KILOMETER 29Doping
KILOMETER 30Suchtgefahren
#VERPFLEGUNG 6Stretchingtipps
TEIL 7 MANN MIT DEM HAMMER
KILOMETER 31Härteste Niederlage
KILOMETER 32Physischer Umgang mit Rückschlägen
KILOMETER 33Psychischer Umgang mit Rückschlägen
KILOMETER 34Familie und Freunde
KILOMETER 35Aufbau zum Comeback
#VERPFLEGUNG 7Die größten Läufer und Läuferinnen
TEIL 8 DURCHZIEHEN
KILOMETER 36Selbstvermarktung
KILOMETER 37Agentur
KILOMETER 38Social Media
KILOMETER 39Sponsoren
KILOMETER 40Zukunft
#VERPFLEGUNG 8Die fünf besten Laufstrecken
TEIL 9 ENDSPURT
DIE LETZTEN 2,195 KILOMETERLeistungslimit
DANKSAGUNG
EINLEITUNG
DAS RENNEN MEINES LEBENS
Die Nacht sollte der Freund des Athleten sein, der Körper regeneriert im Schlaf am besten. Doch diese Nacht ist ein Alptraum. Ich liege wach unter meiner Decke und schaffe es einfach nicht, das Gedankenkarussell zu stoppen. Immer wieder schaue ich auf mein Handy. Wie viel Uhr ist es? Wann hat dieses Warten endlich ein Ende? Frustriert sinke ich ins Kissen, weil die Ewigkeit nur eine halbe Stunde dauerte. Im Bett neben mir, in diesem Doppelzimmer in einem Berliner Hotel, liegt Jonas Fischer, mein langjähriger Teamgefährte und Freund. Er schläft. Er weiß, was mir am nächsten Tag bevorsteht. Er weiß nicht, dass ich deshalb kein Auge zukriege. Aber was würde es auch helfen? Besser, er schläft, dann ist immerhin einer von uns beiden fit. Schließlich geht es um alles.
Das ist, was mich von schönen Träumen abhält. Diese Endgültigkeit. Ich kann sehr konsequent sein. Und in den Tagen vor diesem Rennen am 27. September 2015 habe ich entschieden, dass ich meine Läuferkarriere beenden werde, für die ich fast 20 Jahre lang alles gegeben habe, sollte es nicht funktionieren. Sollte ich beim anstehenden Marathon scheitern und die Zeit, die ich mir vorstelle, nicht schaffen. Dann ist ein für alle Mal Schluss mit dem Laufen als Profi, noch hier, in Berlin.
Mit 20 dachte ich, Marathon sei etwas für Läufer, die zu langsam für die Bahn sind. Meine Strecke waren damals die 5000 Meter. Im Laufe der Jahre änderte sich das jedoch und ich stellte fest: Marathon ist die Königsdisziplin des Laufens. Denn die Marathondistanz vereint zwei Anforderungen: Ausdauervermögen, gepaart mit Tempohärte in einem Belastungszeitraum von etwas mehr als zwei Stunden.
2014 nahmen mein Trainer Kurt Ring und ich mein Marathon-Debüt in Angriff. Ich meldete mich für den Frankfurt-Marathon an, der traditionell am letzten Oktober-Wochenende stattfindet. Ab Ende Juli begann ich mit der Vorbereitung. Kurt war skeptisch. Er sah, dass ich nicht in der nötigen Form war. Doch mein Ansporn – man kann auch sagen: mein falscher Ehrgeiz – war größer. Ich wollte mir und meinem Umfeld beweisen, dass ich es schaffte. Dazu musste ich, so dachte ich, einfach nur mehr Umfänge trainieren als vor einem Zehner oder einem Halbmarathon. Um andere entscheidende Dinge bei einem Marathon wie Ernährung und Flüssigkeitszufuhr machte ich mir keine Gedanken.
Ich rannte sozusagen in mein Verderben und bekam prompt die Quittung. Ich lief in einer Gruppe mit Julian Flügel, damals bereits ein arrivierter Marathon-Läufer. Bis Kilometer 30 blieb ich an ihm dran, dann aber verlor ich den Kontakt, und alles verschwand im Nebel. Ich ignorierte sämtliche Warnsignale des Körpers. Schwindel, ein Kribbeln in den Händen? Einfach weiterlaufen! Ich erinnere mich gerade noch, wie ich bei Kilometer 35 nahe der Messe an unserem Teamhotel vorbeirannte. Zwei Kilometer weiter lag ich auf der Straße, nichts ging mehr. Kreislaufkollaps, Zusammenbruch, Filmriss. Passanten, erzählte man mir später, führten mich in den Sanitäterbereich. Eine neue Definition von Scheitern.
Ich brauchte gut zwei Monate, bis ich wieder Laufschuhe anziehen konnte. Mein sportlicher Lebenstraum seit Kindertagen war die Teilnahme an den Olympischen Spielen. In dieser Phase fehlte mir jegliche Vision dafür. Ein neuer Marathon-Versuch war damals so weit weg für mich wie Donald Trump vom Friedensnobelpreis. Ich war in dieser Zeit unausstehlich, haderte mit mir und zweifelte an allem.
Es war Felix Plinke, mein langjähriger Teamgefährte der mich wieder ans Laufen brachte. Ohne mein Wissen buchte er zusammen mit meinem Trainer für Januar einen Flug ins Trainingslager nach Portugal. Und dort reifte der Plan, im September 2015 in Berlin die Olympianorm für Rio 2016 anzugreifen. Der Verband setzte sie auf 2:12:15 Stunden an. Eine Zeit, die für mich zu jenem Zeitpunkt kaum erreichbar schien.
Wir nutzten das Frühjahr, um zuerst meine Halbmarathon-Zeit zu verbessern und meine Tempohärte zu trainieren. Was das Wichtigste war: Ich trainierte jetzt mit einer ganz anderen Einstellung und nahm den Marathon endlich so ernst, wie es notwendig ist. Es klingt komisch, aber statt drei sehr intensiver Einheiten pro Woche machte ich nur noch zwei und hatte zwei ganze Tage Regeneration dazwischen. In der Folge verringerte sich das Verletzungsrisiko und erhöhte sich mein Leistungsoutput.
Was ich unter „sehr intensiver Einheit“ verstehe? Darauf werde ich später gesondert noch eingehen. Aber auch wenn es die perfekte Marathon-Vorbereitung nicht gibt, weil man immer etwas findet, das man beim nächsten Mal anders machen würde, die Umstände jeweils andere sind: Ich fühlte mich perfekt vorbereitet, als es in Richtung Berlin ging.
Warum ich mir diesen riesigen Druck auferlegte, als ich mir sagte, ich würde aufhören, sollte es in Berlin schiefgehen, kann ich im Rückblick nicht so genau sagen. Mein Gefühl war: Du hast alles an Energie hineingesteckt, mehr geht nicht. Aber auch in ökonomischer Hinsicht war es eine schwierige Zeit. Ich hatte zwar ein paar kleinere Sponsorenverträge, am Jahresende blieb aber nicht mehr als die schwarze Null – wenn es gut lief. Dieses Gesamtpaket wog schwer. Vielleicht brauchte ich diesen Druck aber auch, um mich zu pushen. Leistungssportler sind ja oftmals Extremisten, suchen diesen besonderen Kick, dieses Entweder–Oder, Hopp oder Topp. Tod oder Gladiolen, wie es der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal formuliert hat.
In den grauen Morgenstunden, die kein Ende nehmen, denke ich daran, was ich aufs Spiel setze. Was mache ich mit meinem Leben, wenn der Sport nicht mehr ist? Ich habe keinen Plan B. Nur einen Bachelor in Politik-, Medienwissenschaft und Geschichte. Ganz okay, aber die Miete zahlt er dir nicht. Was also, wenn es schief geht? Um 4.30 Uhr wälze ich mich endlich aus dem Bett. Vor einem Wettkampf, der im Marathon klassisch am Morgen beginnt, steht der Athlet grundsätzlich früh auf. Der Kreislauf muss in Gang gebracht werden. Für mich ist es eine Erlösung.
Mit Jonas laufe ich durch das noch dunkle Berlin Richtung Tiergarten. Die Morgenluft tut gut. Zum Frühstück würge ich zwei Semmeln herunter. Ich habe keinen Appetit, leichte Übelkeit schnürt mir die Kehle zu. Aber Jonas, der an diesem Tag die Verpflegung mit dem Fahrrad an den dafür vorgesehenen Stationen für mich bereithalten wird, zwingt mich zum Essen, zur Energiezufuhr. Ich würde am liebsten ihn fressen, aber ich weiß, ich sollte ihm dankbar sein.
Nach dem Frühstück gehen wir nochmal aufs Zimmer, bis der Shuttlebus uns vom Hotel in den Startbereich bringt. Wettkampfequipment kontrollieren, zusammenpacken. Die Fahrt ist wie der Weg zum Schafott: Was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Neben dem abgesperrten Elitebereich, wo die Spitzenläufer ihre Sachen deponieren, hat die ARD ihren Übertragungspunkt aufgebaut. Ralf Scholt, der Moderator, und die Lauflegende Dieter Baumann, der als Experte fungiert, beobachten die ankommenden Athleten. In der Übertragung werden sie sagen, der Pflieger habe ängstlich ausgesehen – angesichts meines psychischen Zustandes halte ich das bis heute für eine freundliche Untertreibung.
Es widerstrebt mir kolossal, das Warm-up zu beginnen, denn es führt zwangsläufig an die Startlinie. Doch dann kommt die Wende. Bald merke ich: Die Beine fühlen sich gut an. Und das Wetter ist top! Kühl, aber sonnig und vor allem windstill. So wie ich es mag. Zehn Sekunden Countdown bis zum Start, sie fühlen sich an wie eine Ewigkeit – als der Schuss fällt, bin ich bereit.
Wie ist es möglich, dass genau in dem Moment, wenn es beginnt, der Fokus auf dem Rennen liegt? An einem Tag mit so wenig Schlaf? Es ist ein Wunder, für das ich keine rationale Erklärung habe.
Nach der zweiten Verpflegungsstation oder zehn Kilometern bin ich voll im Rennen und komplett bei mir, befinde mich in dem sagenumwobenen Flow-Zustand. Nichts kann mich ablenken. Ich habe diesen Zustand nicht oft erreicht, doch an diesem Tag fühle ich mich als Herr der Lage, weiß, dass ich alles schaffen kann.
Der Knackpunkt kommt erneut nach 30 Kilometern. In unserer zwölfköpfigen Gruppe, die sich aus deutschen und internationalen Läufern zusammensetzt, sind drei Tempomacher, zwei Kenianer und Simon Stützel, ein guter Freund und Teamkollege von Julian Flügel, dem Mann, dem ich ein Jahr zuvor in Frankfurt nicht folgen konnte. Simon steigt bei der Halbmarathon-Distanz aus, die Kenianer bei 25 beziehungsweise 30 Kilometern. Ich habe mich aus der Defensive, aus der ich gestartet war, in die Mitte vorgekämpft. Als der letzte Hase aussteigt, passiert, was oft passiert, wenn die Tempomacher das Rennen verlassen und sich die Gruppe neu sortieren muss: Kilometer 31 ist zehn Sekunden langsamer als die Kilometerzeiten davor, was wir auf einer Uhr sehen, die auf dem vor uns fahrenden Führungsfahrzeug angebracht ist.
Plötzlich schießt ein Läufer aus der Gruppe an mir vorbei, ein weiterer folgt ihm. Es sind Willem van Schuerbeeck und Florent Caelen, zwei Belgier. Aus einem Reflex heraus nehme ich die Verfolgung auf. Schnell lassen wir die anderen neun hinter uns. Den 32. Kilometer laufen wir in 3:02 Minuten – ein Tempo, das einer Zielzeit von 2:08 Stunden entspricht. Das werde ich niemals durchhalten können. „Jetzt ist dein ganzer Rennplan hinüber“, schießt es mir durch den Kopf.
In Gruppen zu laufen, macht Sinn. Man teilt sich die Tempoarbeit und kann im Windschatten laufen. Jetzt bin ich die letzten elf Kilometer mit den beiden Belgiern unterwegs, deren Taktik sich mir nicht ansatzweise erschließt. Immer wieder verschärfen sie abwechselnd das Tempo. Wollen sie den anderen demoralisieren? Und warum bleibe ich dran? Aus purem Trotz? Ein solch langer Dreikampf in der Endphase eines Marathons ist nicht gerade alltäglich. Aber der Rest der Gruppe macht keinerlei Anstalten aufzuschließen, und so bleibt mir keine Wahl: Wenn ich eine starke Zeit laufen will, muss ich dranbleiben. Adrenalin schießt mir ins Blut.
Als das Brandenburger Tor in Sicht kommt, überflutet mich ein Glücksgefühl. Ich ziehe das Tempo noch einmal an, in der Überzeugung, dass hinter dem Berliner Wahrzeichen der Zieldurchlauf sei. Tatsächlich liegt er 400 Meter weiter … Mit fast 42 Kilometern in den Beinen können 400 Meter eine Tortur sein. Mein ganzer Körper brennt. Aber es geht alles gut. 150 Meter vorm Ziel ist klar, ich laufe eine 2:12. Sollte das die Zeit gewesen sein, die ich nie mehr im Leben verbessern werde, dann ist das okay. Für mich war es ein perfektes Rennen.
Bei 2:12:50 Stunden bleibt die Uhr für mich stehen. Eine Sekunde vor mir läuft Willem als 15., eine Sekunde hinter mir Florent als 17. ins Ziel. Ich habe die Norm für Olympia um 35 Sekunden verpasst. Aber es ist eine gute Zeit, und ich weiß: Ich werde weitermachen mit dem Laufen!
Kurz danach kommt der Schmerz. 42,195 Kilometer bin ich über die Straßen Berlins gelaufen, in dem Moment, in dem ich aufhöre, sticht es in meinem rechten Fuß. Das Sprunggelenk ist nicht einverstanden mit den Strapazen. Ein Ödem kündigt sich an, das mich in den nächsten Wochen plagen wird. Im Sanitäterzelt ziehe ich meine schwarzen Laufschuhe aus. Meine Socken sind vorne tiefrot, sie triefen vor Blut. Der Stoff hat sich ins Fleisch meiner Zehen gebrannt. Während des Laufs habe ich davon nichts gemerkt. Neben den Schmerzen ist da aber noch ein Gefühl, das alles überstrahlt: tiefe Genugtuung.
Als Athlet hat man kaum Zeit, Erfolge zu genießen. Es stehen Interviews an, mit denen man nicht rechnet. Es gibt Siegerehrungen, Pressekonferenzen, jeder will irgendwas von einem. Erst nachmittags gegen 16 Uhr sitze ich mit meinen Eltern, Jonas und meinem Trainer in der Hotelbar und trinke zwei Bier. Geduscht habe ich da noch nicht, keine Zeit. Mit meiner Freundin Barbara telefoniere ich zwischen Tür und Angel. Sie hat das Rennen im Fernsehen verfolgt.
Abends gibt es eine After-Show-Party in einem Berliner Club. Jonas und ich geben mächtig Gas bis in die Morgenstunden. Verrückt, wozu der menschliche Körper imstande ist. 24 Stunden am Stück bin ich wach gewesen, habe einen Marathon in weniger als 2:13 Stunden geschafft und dann die Nacht durchgefeiert.
Die Quittung bekomme ich nach nur vier Stunden Schlaf, weil der Trainer nach Regensburg zurückwill. Meine Oberschenkel tun so dermaßen weh, dass ich beim Aufstehen direkt wieder ins Bett zurückfalle. Die paar Meter ins Bad sind die Hölle. Auf dem Weg zum Frühstücksraum treffe ich Eliud Kipchoge, den Marathon-Star aus Kenia, den Sieger des Rennens, und spreche ihn an: „Stairs or elevator?“ „Elevator“, ruft er, „elevator!“ Auch dem besten Marathon-Läufer der Welt tun nach einem Rennen die Beine weh. Finde ich sehr erleichternd.
Auf der After-Show-Party erfahre ich übrigens, was die beiden Belgier angetrieben hat, wie um ihr Leben zu rennen: Sie waren beide der Auffassung, dass nur der Bessere von ihnen zu Olympia nach Rio fahren dürfe, da es in ihrem Team noch einen anderen Läufer gab, dem die Norm locker zugetraut wurde, der allerdings nicht in Berlin am Start war. Die Ironie des Ganzen: Ihr Landsmann verpasste die Norm und am Ende fuhren sie beide nach Brasilien. Ich traf sie bei den Olympischen Spielen in Rio wieder. Aber Berlin war das Rennen unseres Lebens, das uns irgendwie immer verbinden wird. Bis heute sage ich, dass es das wichtigste sportliche Ereignis meines Lebens war.
Warum Marathon bei aller Plackerei, aller Schmerzen und Entbehrungen eine so riesengroße Faszination ausübt, nicht nur auf mich, sondern auf so viele Millionen Menschen, weltweit? Warum ich überhaupt bei Olympia in Rio 2016 dabei war, wo ich doch in Berlin die Norm, wenn auch super knapp, verpasst hatte? Warum ich auch in Tokio 2020 wieder dabei sein will? Das sind einige der Fragen, denen ich in den nächsten 42,195 Kapiteln nachgehe.
TEIL 1
STARTPHASE
KILOMETER 1
AUFWACHSEN
Es gibt eine Reihe von Klischees und Vorurteilen, mit denen Leistungssportler konfrontiert werden. Zum Beispiel die Annahme, man müsse aus einer besonders leistungsorientierten oder extrem sportlichen Familie stammen. Auf mich trifft das nicht zu.
Meine Eltern Brigitte und Roland haben durchaus etwas für Sport übrig. Meine Mutter war in ihrer Jugend Leichtathletin, ihre Spezialdisziplin war der Hochsprung. Mein Vater war Sportschütze. Ein ziemlich guter wohl, wie mein eineinhalb Jahre jüngerer Bruder Roman und ich feststellten, als wir einmal auf dem Dachboden in einer Kiste alte Urkunden, Medaillen und Pokale fanden. Nach meiner Geburt hörte unser Vater von einem auf den anderen Tag mit dem Rauchen auf und begann mit dem Laufen. Seit 30 Jahren schnürt er die Laufschuhe und hat mittlerweile auch einige Marathons absolviert.
Meinen Eltern ging es nie um Hochleistung. Für sie war Sport ein Hobby, das Spaß machte. Und in diesem Sinn wurden Roman und ich erzogen.
Ich bin im Juli 1987 in Sindelfingen geboren, einer Kreisstadt mit 65.000 Einwohnern, 15 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hieß Lothar Späth, der Bundeskanzler Helmut Kohl. Meine Eltern lebten in der 7000-Einwohner-Gemeinde Ehningen in einem Eigenheim, das man als Mehrgenerationenhaus bezeichnen könnte: Meine Oma, die Mutter meines Vaters, wohnte in der oberen Etage. Mein Bruder und ich teilten uns zehn Jahre lang ein Kinderzimmer mit einem Doppelstockbett. Nachdem unsere Oma gestorben war, zogen wir in das obere Stockwerk. Da hatte dann jeder sein eigenes Zimmer, außerdem gab es ein Bad und Omas ehemaliges Wohnzimmer – mit Fernseher.
Was für eine Freiheit das bedeutete, lernten wir schnell zu schätzen. Manche Tage bekamen unsere Eltern uns außer zum Essen kaum zu Gesicht. Am Wochenende sahen wir bis in die Nacht fern, am liebsten die Musiksender MTV und VIVA, und redeten dabei über Gott und die Welt. Diese Zeit war wunderbar. Obwohl mein Bruder und ich sehr unterschiedliche Typen waren – und bis heute sind –, ist unser Verhältnis sehr innig. Er ist beruflich viel in der Welt unterwegs. Wir sind heute vielleicht nicht ganz so regelmäßig in Kontakt wie andere Geschwister, aber wir wissen beide, dass wir uns aufeinander verlassen können.
Als Kind war ich ziemlich schüchtern, ja geradezu ängstlich, was sich viele, die mich heute kennenlernen, kaum vorstellen können. Ich war der klassische Spätentwickler, klein und schmächtig. Mein Bruder hat deutlich lauter „Hier“ gerufen, als die Muskeln verteilt wurden. Sein Sport war Ringen, der perfekte Kontrast zu mir dürrem Läufer. Wir fanden es beide gut, dass wir nicht den gleichen Sport machten. Damit waren wir die Sache mit dem Vergleichen los, jeder konnte in seinem Bereich wachsen.
Roman gab das Ringen irgendwann auf und legte seinen Ehrgeiz in das berufliche Fortkommen, und wenn man sieht, wo er heute ist, war das sicher die richtige Entscheidung.
Unsere Eltern haben uns vor allem Freiheit und Vertrauen geschenkt. Unser Haus lag damals am Ortsrand von Ehningen. Als ich vor ein paar Jahren wieder einmal dort war – meine Eltern wohnen mittlerweile in Sindelfingen –, stellte ich fest, dass sich der Ort sehr verändert hat. Damals war es zum Wald nur ein kurzes Stück, und mein Bruder und ich verbrachten unsere Kindheit zum Großteil draußen. Wir waren auf dem Bolzplatz, streunten mit Freunden durchs Dorf und durch den Wald. Das änderte sich ein wenig, als wir unsere ersten Computer und eine Playstation bekamen, aber bis heute liebe ich es, draußen zu sein.
Weihnachten war das Fest, das ich wie viele Kinder am meisten liebte. Es ist mir bis heute wichtiger als mein Geburtstag, weil es eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr ist, bei denen die ganze Familie zusammenkommt. Es braucht diese festen Tage im Kalender, finde ich, gerade in unserer durchgetakteten Welt.
Wir sind wohl das, was man als gutbürgerliche Familie bezeichnen würde. Meine Mutter hat eine Banklehre gemacht, heute ist sie bei einer Hausverwaltung beschäftigt. Mein Vater hat eine Lehre in einem Eisenwarenhandel gemacht, ist danach zu IBM gewechselt. Sein Bereich wurde später an einen US-Telekommunikationskonzern transferiert. Dort hat er betriebsbedingt mit Anfang 50 seinen Job verloren. Mittlerweile hat er als Berater und Verkäufer im Stuttgarter Laufladen Heart and Sole (Herz und Sohle) seine Berufung gefunden. Das freut mich sehr, denn seit ich denken kann, ist er in der Laufszene unterwegs. Aber diese Phase, in der er arbeitslos war und ich parallel zum Leistungssport studierte, hat mich geprägt.
Geld war nie ein Thema bei uns. Wir waren weder reich noch gab es jemals irgendwelche Nöte. Meinen Eltern war aber wichtig, dass wir bestimmte Dinge selbst finanzierten, wenn wir der Meinung waren, sie unbedingt haben zu wollen.
Allerdings hatte ich als Kind, und da kommt vielleicht der Schwabe in mir zum Vorschein, eine fast schon obsessive Neigung zum Sparen. Zum Weltspartag brachte ich mein gesammeltes Kleingeld zur Bank. Das Gefühl, eine Reserve für später anzusammeln, beruhigte mich irgendwie – auch wenn ich keinerlei Vorstellung davon hatte, was das genau bedeutete. Als wir von unseren Großeltern als Jugendliche einen für unsere Verhältnisse stattlichen Betrag geschenkt bekamen, wäre mir nie eingefallen, das Geld anzutasten. Das habe ich erst viel später getan, um mir meinen Traum von der Olympiateilnahme zu erfüllen. Ich hätte mir so gewünscht, dass meine Großeltern das noch erleben.
Als mein Vater seinen Job verlor, setzte das in mir bis dahin unbekannte Emotionen frei. Seitdem ist da ein innerer Antrieb, dem Geldverdienen eine gewisse Bedeutung zuzuschreiben. Dass Geld nicht wichtig sei, können vermutlich diejenigen Menschen leicht sagen, die genug davon haben. Wer wenig hat, der spürt schnell, wie unverzichtbar es eben doch ist. Vielleicht auch deshalb lege ich seit einigen Jahren einen Fokus darauf, nicht nur mit dem Sport über die Runden zu kommen, sondern auch in anderen Bereichen wirtschaftlich Fuß zu fassen. Mein Leitmotiv ist, nicht darauf zu warten, dass das Glück mich findet, sondern dass ich mein Schicksal selbst in die Hand nehme. Wer den Sprung ins kalte Wasser nie wagt, wird nie schwimmen lernen. Meine Eltern haben mich oft zu diesem ersten Schritt ermutigt.
Beim Essen habe ich meiner Mutter allerdings das Leben schwergemacht. Jahrelang waren Spätzle mit brauner Soße so ziemlich das Einzige, wovon ich mich ernährte. Natürlich ist das nicht so geblieben. Die Ernährung – darauf gehe ich in einem späteren Kapitel ein – ist für einen Leistungssportler ein wichtiger Erfolgsbaustein. Heute esse ich alles, und mit Erleichterung kann ich sagen, dass ich auch alles vertrage und nicht auf die im Leistungssport so moderne gluten- und/oder laktosefreie Kost angewiesen bin. Mein Leibgericht sind immer noch Spätzle, am liebsten mit Linsen. Da kommt wieder der Schwabe in mir durch.
Leider war es so, dass ich mich für die Schule und die meisten Dinge, die mir dort beigebracht werden sollten, nicht ganz so ausgeprägt interessierte. Eine Vier auf dem Zeugnis war für mich genau das, was sie bedeutet: ausreichend. Meine Priorität lag auf dem Sport und dem Training.
Am Stiftsgymnasium in Sindelfingen machte ich mein Abitur. Da diese Schule eine sogenannte Partnerschule des Leistungssports ist, hatte ich mir erhofft, für Kaderlehrgänge vom Unterricht freigestellt zu werden. Mein bester Kumpel und Vereinskamerad beim VFl Sindelfingen, Bastian Franz, ging auch dorthin. Wir hatten eine super Abi-Zeit, den Unterricht und meine Abschlussnote mal außen vorgelassen. Ich wählte den naturwissenschaftlichen Zweig, aber außer Biologie interessierte mich davon eigentlich nichts. Mir fiel das Lernen nie so leicht wie meinem Bruder, der ein Schulbuch nur anzuschauen brauchte, um zu wissen, was drinstand. Ich musste mir alles erarbeiten, aber weil ich Profisportler werden wollte, sah ich dazu wenig Veranlassung.
Warum ich mein Abitur nicht in Sport gemacht habe? Klingt vielleicht komisch: Weil ich keine Sportskanone war. Ich konnte laufen, keine Frage. Aber Ballsportarten waren nicht unbedingt meins, beim Schwimmen wäre ich gnadenlos untergegangen, und Bodenturnen lehnte ich ab. Natürlich gibt es Athleten, die alle Sportarten draufhaben. Zu denen zählte ich nicht.
Mein Glück war, dass ich in der Oberstufe einen Sportlehrer hatte, der früher selbst Leistungssportler gewesen war. Herr Takac hatte in der serbischen Nationalmannschaft Basketball und Volleyball gespielt, er erzählte großartige Geschichten aus dieser Zeit. Er konnte den Spirit, den Basti und ich hatten, nachvollziehen, deshalb nahm er es hin, wenn wir ab und zu fehlten. Dazu kam – und auch darüber erzähle ich später mehr –, dass ich unter heftigen Wachstumsproblemen litt. Bevor ich mir mein Abitur dadurch noch mehr versaute, dass ich wegen einer Verletzung nicht zur Sportprüfung hätte antreten können, entschied ich mich eben für den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das Resultat war ein Abiturschnitt von 3,1. Dank des damals gewährten Nachteilsausgleichs für Spitzensportler wurde diese Note zwar auf 2,9 nach unten korrigiert, Grund zum Stolzsein hatte ich aber höchstens deshalb, weil ich es überhaupt geschafft hatte.
Als Spätentwickler kam ich erst während der Oberstufe mit den Dingen in Berührung, die die coolsten Typen meines Jahrganges natürlich schon längst hinter sich hatten. Mädchen fand ich lange Zeit eher nicht so spannend, meine erste Beziehung hatte ich mit 16. Alkohol und Partys kamen mit 17 oder 18 Jahren dazu. Aber nicht an jedem Wochenende. Mein erster Gedanke war immer: Wann ist das nächste Training, wann der nächste Wettkampf? Für den Sport erst so hart trainieren, um das mit einem durchsoffenen Wochenende wieder zunichtezumachen? Bestimmt nicht!
KILOMETER 2
ERSTE LAUFERFAHRUNGEN
Laufen, als Sport, hat sich durch meinen Vater in mein Bewusstsein geschlichen. Fast jeden Tag habe ich ihn als Kind nach der Arbeit die Laufschuhe anziehen sehen. Anfangs schaffte er als ehemaliger Raucher kaum den Kilometer von unserem Haus in Ehningen bis zum Waldrand. Mittlerweile hat er eine ganze Reihe an Marathons gefinisht, sogar unter drei Stunden. Seine Bestzeit liegt bei 2:51 Stunden. Er hat an vielen Wettkämpfen teilgenommen, auch im Ausland, und viele Jahre den „Naturpark Schönbuchlauf“ mitorganisiert, ein bekanntes Event in unserer Region.
Mein Bruder Roman und ich waren oft bei seinen Wettkämpfen dabei, verteilten Getränke und halfen beim Auf- und Abbau. Bereits als Kind gehörte Laufen für mich wie selbstverständlich zum Leben dazu. Als wir einmal, ich war fünf Jahre alt, am Bodensee waren und in einem Gasthof zum Essen saßen, wurde mir langweilig. Ich quengelte und wollte alleine in die Ferienwohnung zurücklaufen. Eine Strecke von ungefähr zwei Kilometern. Meine Eltern nahmen das natürlich nicht ernst und schickten meinen Bruder und mich raus auf den Spielplatz. Ich rannte ohne zu zögern los, sie fanden mich später spielend auf dem Bauernhof wieder. Ich verstand damals gar nicht, warum sich meine Eltern anschließend so darüber aufregten.
Nach dieser Geschichte nahm mich mein Vater regelmäßig mit auf seine Läufe, zunächst bis zum Waldrand, dann immer weiter. Er wählte ständig andere Strecken aus. Damit legte er die Grundlagen, von denen ich bis heute zehre. Laufen muss für mich abwechslungsreich sein und draußen stattfinden. Natürlich absolviert man als Leistungssportler auch Einheiten auf der Bahn oder, bei ganz fiesem Wetter, auch mal auf dem Laufband. Aber für mich ist beim Laufen eigentlich das Wichtigste, die frische Luft zu spüren.
Das Wetter war und ist mir bis heute völlig egal. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, pflegte mein Vater zu sagen, und auch wenn der Spruch abgedroschen klingt, ist er doch wahr. Sich zu überwinden und den Schritt vor die Tür zu machen, ist die größte Hürde. Nach spätestens einem Kilometer ist einem sowieso warm, und alles ist gut. Die Umgebung hat für mich mindestens den gleichen Stellenwert wie das reine Laufen. Ich frage mich manchmal, ob ich denselben Weg eingeschlagen hätte, wenn ich in der Stadt aufgewachsen wäre. Naturnahe Laufstrecken direkt vor der Haustür haben meine Leidenschaft für diesen Sport mit Sicherheit befördert.
Der Antrieb, besser zu werden, zielgerichteter zu trainieren, entwickelte sich relativ schnell. Meine Karriere im Vereinssport begann jedoch zunächst wie bei den meisten Jungs: mit Fußball. Mit sieben Jahren wurde ich Mitglied im TSV Ehningen – bis meine Talentfreiheit am Ball zu offensichtlich wurde. Ich konnte ausdauernd laufen, was ich auf dem Platz auch tat. Aber ich konnte leider nichts mit dem Ball anfangen. Der Trainer gab mir sehr bald den Rat, es doch lieber mit Leichtathletik zu versuchen.
So wechselte ich nach nur einem Jahr zum TSV Dagersheim in die Leichtathletik-Abteilung, die über einen sehr engagierten, jungen Trainer verfügte. Björn Holst ist dort bis heute tätig. Er sorgte für meine leichtathletische Grundausbildung. Wäre es nach mir gegangen, wäre ich nur gelaufen, aber ich musste auch die Wurfdisziplinen und Hochsprung trainieren, was ich hasste. Im Rückblick war das eine sehr wichtige Zeit für mich. Das Laufen kristallisierte sich allmählich als meine Disziplin heraus. Es hat mir von Beginn an den meisten Spaß gemacht. Ich fühlte mich dabei so, als würde ich schweben.
Dass ich kein sportlicher Überflieger war, sollte sich einmal mehr zeigen, als ich zwei Jahre später an einem Sichtungsprogramm beim VfL Sindelfingen teilnehmen wollte. Der VfL war der wichtigste Verein in unserer Region. 1977 wurde in Sindelfingen der Glaspalast gebaut, ein hochmodernes Trainingszentrum mit 200-Meter-Laufbahn. Beim VfL hielt die Sprinterin und Hürdenläuferin Birgit Hamann (geborene Wolf), die 1996 in Atlanta über 100 Meter Hürden an den Olympischen Spielen teilnahm, Sichtungslehrgänge ab. Gemeinsam mit meinem Grundschulfreund Andreas nahm ich an einem solchen Lehrgang teil. Wir wurden auf unsere motorischen und athletischen Fähigkeiten getestet – und ich versagte auf ganzer Linie. Im Gegensatz zu Andreas, der eine Einladung erhielt, zum VfL zu wechseln. Da er das nur in Begleitung seines besten Freundes machen wollte, kam ich mit viel Glück doch noch zum VfL Sindelfingen, obwohl es eine ganze Menge talentierterer Kinder gab. Heute, 22 Jahre später, ist von den damaligen Athleten außer mir keiner mehr im Leistungssport. Denn außer Talent ist der Umgang mit Widrigkeiten offenbar ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg in die Spitze.
Für den VfL Sindelfingen bestritt ich erste 1000-Meter-Wettkämpfe auf Kreis- und Bezirksebene. Damals gab es Teamwettbewerbe, bei denen man als Verein gegen andere Vereine in allen Leichtathletik-Disziplinen antrat. Alle mussten besetzt werden, es konnten aber Athleten auch mehrfach starten. Die 1000-Meter-Läufe waren traditionell bei fast allen megaunbeliebt, deshalb hatte ich, der diese Distanz liebte, ein gutes Standing im Team. Manchmal musste ich auch in der Staffel mitsprinten. Aber nur auf der Langstrecke war ich richtig gut und konnte Punkte fürs Team sammeln.
An den Tag, an dem ich meine erste Urkunde erhielt, erinnere ich mich genau. Es war im Sommer 1996, ich war noch nicht ganz neun Jahre alt. Bei einem Lauf-Cup in unserer Region nahm auch mein Vater teil. Manche boten zusätzlich Kinderläufe an, und bei einem solchen erhielt ich meine erste Auszeichnung. Ich hatte es als Dritter aufs Podium geschafft. Obwohl nach 400 Metern meine Lunge und die Beine gebrannt hatten, wollte ich dieses Gefühl wieder erleben. Der Schmerz war das eine. Aber zu spüren, dass man das, was man liebt, auch gut kann, war ein riesiger Ansporn. Von diesem Tag an habe ich zielgerichtet trainiert und versucht, immer besser zu werden.
Als 13-Jähriger stand ich dann zum ersten Mal bei einem Sichtungslehrgang für den Landeskader Württembergs an der Schwelle zum Leistungssport.
KILOMETER 3
VORBILDER
Genauso ungeklärt wie die Frage, ob die Henne zuerst da war oder das Ei, ist für mich das Rätsel, wie ein Mensch seinen Sport findet. Sucht er ihn sich selbst aus? Oder kommt der passende Sport zum Menschen? Ich glaube, dass vieles über Vorbilder passiert. Wäre mein Vater nicht passionierter Läufer, dann wäre ich möglicherweise nicht der, der ich heute bin. Oft sind es aber auch Freunde, manchmal Lehrer, die einen prägen oder den entscheidenden Anstoß geben. Oder es sind Sportler, die man im Fernsehen oder sogar live sieht und die einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass man alles tut, um ihnen nachzueifern.
Ein solches Erweckungserlebnis war für mich der überraschende Sieg von Jan Fitschen über 10.000 Meter bei der Leichtathletik-EM 2006 in Göteborg. 1500 Meter vor dem Ziel drohte er den Kontakt zu den beiden Spaniern José Manuel Martinez und Juan Carlos de la Ossa zu verlieren, doch immer wieder lief er die Lücke zu, blieb dran und rannte die beiden im Endspurt in Grund und Boden. Unglaublich! Diese mentale Härte fand ich sehr beeindruckend, sie hat viele junge Athleten wie mich inspiriert, der gesamten deutschen Laufszene einen Boost gegeben und steht exemplarisch für das, was der Sport für die Charakterbildung bedeutet. Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und Biss sind Eigenschaften, die man im Leben braucht, um sich zu behaupten.
Grundsätzlich habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu sogenannten Idolen, und ich erkläre auch, warum. Zunächst einmal halte ich es für schwierig, sich von anderen Sportlern etwas abzuschauen, um es auf sich zu übertragen. Man kann sich natürlich vornehmen, der beste Spurter zu werden, der die Rennen auf der Zielgeraden entscheidet, so wie Jan Fitschen. Aber wenn einem die Anlagen dafür nicht gegeben sind, kann man sich das nicht antrainieren. Sich an Vorbildern abzuarbeiten, die unerreichbar sind, ist frustrierend.
In meiner Jugend gab es – abgesehen von meinem Vater und meinen Trainern, auf die ich in einem eigenen Kapitel eingehen möchte – zwei Leitfiguren, die meine Laufleidenschaft geprägt haben. Die eine war Haile Gebrselassie, der Wunderläufer aus Äthiopien. Der Mann hat insgesamt 26 Weltrekorde aufgestellt, darunter hielt er von 2007 bis 2011 die schnellste je gelaufene Marathon-Zeit der Welt. Er war in den 1990er-Jahren über die 10.000 Meter nicht zu schlagen, er war Olympiasieger in Atlanta 1996 und Sydney 2000. Bei einem Sportfest in der Stuttgarter Schleyer-Halle habe ich ihn einmal live laufen sehen, da war ich 13 oder 14 Jahre alt und von seinem eleganten Laufstil schwer beeindruckt. Live sieht Laufen nochmal anders aus als im Fernsehen, weil man das Tempo besser einschätzen kann und die Atmosphäre aufsaugt. Und Haile Gebrselassie war ein Phänomen.
Aber da war auch eine Distanz. Äthiopien, das war für mich ganz weit weg, und deshalb konnte Haile für mich kein Vorbild sein, dem ich nacheifern wollte. Ich wusste, dass ich niemals auch nur annähernd an ihn heranreichen würde. Auch seine Lebensgeschichte und sein Werdegang waren für mich nicht mal im Ansatz mit dem in Deckung zu bringen, was für meine Karriere wichtig werden könnte. Deshalb blieb er mir emotional eher fremd.
Die zweite Leitfigur war Dieter Baumann, ein Mann aus meiner Heimat, von der Schwäbischen Alb. Ich schaute zu ihm auf, er war der einzige Mensch, von dem ich sogar ein signiertes Poster in meinem Zimmer hängen hatte. Kein Popstar, Schauspieler oder Fußballer hat das geschafft, nur der Mann, der 1992 in Barcelona Olympiagold über seine Spezialstrecke 5000 Meter holte. Damals war ich zwar erst fünf Jahre alt und hatte das Ereignis am Fernseher nicht miterlebt. Aber als ich mit dem Laufen anfing, da war er allgegenwärtig. Das erste Mal, dass wir uns trafen, war bei einer Landesmeisterschaft: Er führte eine Siegerehrung durch und schüttelte mir die Hand! Nach meinem Wechsel nach Regensburg lernten wir uns kennen. Heute kommentiert er als TV-Experte u.a. den Berlin-Marathon, bei dem ich mitlaufe.
Aber, und das erklärt die Ambivalenz, die mich beim Thema Vorbilder umtreibt: Da gab es ja noch diesen Dopingfall, der als Zahnpastaaffäre bekannt geworden ist. Im Herbst 1999 wurde Dieter Baumann positiv auf das verbotene anabole Steroid Nandrolon getestet. Er, der sich stets als engagierter Vorkämpfer gegen den Missbrauch verbotener Substanzen präsentiert hatte, sollte nun selbst Täter gewesen sein. Seine Erklärung, die Zahnpasta sei manipuliert worden, wurde in der ganzen Welt diskutiert. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) sprach ihn im Sommer 2000 von den Vorwürfen frei, nachdem er in Nachtests Haarproben ohne Befund abgegeben hatte. Der Weltverband jedoch stellte sich gegen den DLV und sperrte Dieter Baumann bis Januar 2002.
Für mich war das damals ein Schock. Und der Moment, der mich ins Grübeln brachte. Das erste Mal war für mich ein Schatten auf den Leistungssport gefallen. Ich zweifelte und fragte mich, was an den Vorwürfen dran sein könnte. Ich habe viele Geschichten gehört, die mich bis heute bestärken, an seine Unschuld zu glauben. Und als ich im Sommer 2002 bei der Leichtathletik-EM in München die Siegerehrung des 10.000-Meter-Rennens live erlebte, war zu spüren, dass die meisten Fans diese Meinung teilten. Baumann war im ersten EM-Rennen nach seiner Sperre Zweiter geworden. Als er das Podium betrat, erhoben sich die Zuschauer von ihren Sitzen und feierten ihn frenetisch. Das war ein berührender Moment, den ich ihm sehr gegönnt habe.
Über die Jahre haben mich die vielen Dopingfälle in allen möglichen Sportarten zu dem Schluss kommen lassen, dass der Hochleistungssport wirklich leider nicht als die Hochglanzwelt betrachtet werden darf, als die er gern verkauft wird. Deshalb bin ich mit den Begriffen Idol oder Vorbild vorsichtig. Ich weiß andererseits, dass gerade Kinder durch Stars oftmals den ersten Impuls erhalten, den Schritt in ihren Sport zu gehen, und das ist enorm wichtig.
Angesichts meiner kritischen Einstellung fällt es mir nicht leicht, mit der Tatsache umzugehen, dass ich mittlerweile von einigen Menschen selbst als Vorbild betrachtet werde. Es zeigt sich in Gesprächen oder Reaktionen in den sozialen Medien, und ich gebe zu, dass diese Rolle für mich eine Mischung aus Belastung und Ansporn darstellt. Ich bin zum Beispiel in meiner Trainingsgruppe einer von wenigen, die das Laufen noch mit über 30 Jahren auf hohem Niveau betreiben. Viele sind in der Altersgruppe 20 bis 25, in der es die meisten Drop-outs gibt, also Entscheidungen, den Sport zugunsten von Beruf oder Familienleben aufzugeben.
Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu begreifen, dass ich mir diese Vorbildrolle nicht aussuchen kann. Also habe ich versucht, einen Weg zu finden, damit so verantwortungsvoll wie möglich umzugehen. Für mich bedeutet das, auf Augenhöhe Ratschläge zu geben. Ich sehe mich selbst beileibe nicht als Sportstar. Und ich stehe auch nicht morgens auf und denke: „Heute bin ich mal wieder Vorbild.“
Es passiert eher selten, dass ich in der Öffentlichkeit erkannt und um ein Autogramm oder Selfie gebeten werde. Aber wenn es passiert, tue ich das gern. Wen es interessiert, der kann über die sozialen Medien an meiner Karriere teilhaben. Das Internet birgt Gefahren, die mir sehr wohl bewusst sind, ich stand selbst schon im Shitstorm. Ich versuche es zu nutzen, um denen, die mit mir verbunden sind, etwas zu bieten. Und wenn ich dann Nachrichten von fremden Menschen erhalte, für die meine Karriere eine Inspiration ist, lässt mich das jedes Mal innehalten.
Als ich beim Berlin-Marathon 2017 auf dem Weg, meine Bestzeit zu brechen, einen Kreislaufkollaps erlitt, der live im Fernsehen übertragen wurde, waren im Nachgang 97 Prozent aller Nachrichten an mich positiv. Die meisten haben aus meinem Scheitern Motivation gezogen, weil sie gesehen haben, dass auch ein Leistungssportler nur ein Mensch ist. Vorbilder müssen keine Lichtgestalten sein, denen unter ihren Händen alles zu Gold wird. Aber sie müssen wieder aufstehen, neu angreifen und vielleicht sogar stärker zurückkommen. Ich habe das mehrmals durchlebt. Das erste Mal, als ich ein Teenager war – und mein Laufsport fast beendet war, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte.
KILOMETER 4
ERSTER RÜCKSCHLAG
Morbus Osgood-Schlatter. Klingt harmlos, könnte ein norwegischer Biathlet sein oder ein britischer Aktionskünstler. Ist aber laut Medizinlexikon eine „schmerzhafte Reizung des Patellasehnenansatzes am vorderen Schienbein“ – und das hätte mich um ein Haar (und mehrere Haarrisse) um den Verstand und meine Sportlerkarriere gebracht.
Als ich, der Spätentwickler, mit dem Laufen begann, waren an der Startlinie alle stets einen Kopf größer als ich. Mit 13 stand ich vor der Aufnahme in den Landeskader Württembergs, und anhand einer Messung meiner Handwurzelknochen wurde berechnet, dass ich 1,75 Meter groß werden würde, plus/minus fünf Zentimeter in beide Richtungen. Dass ich heute 1,88 Meter groß bin, sagt einiges über die Seriosität solcher Untersuchungen. Aber das wussten wir damals noch nicht.
Ich war 14, als die krassen Wachstumsschübe einsetzten. Es gab mehrere Phasen, in denen ich innerhalb weniger Monate zehn Zentimeter wuchs. Und in all diesen Phasen hatte ich extreme Knieschmerzen in den sogenannten Wachstumsfugen unterhalb der Kniescheibe, wo die Patellasehne ansetzt. Es begann mit moderaten Schmerzen unter Laufbelastung, die wir anfangs als Folge übermäßigen Trainings abtaten, weil sie abklangen, sobald ich mich schonte. Wenn ich dann wieder loslegen wollte, kehrten die Schmerzen zurück. Und zwar brutal. Am Ende war es bei jedem Schritt so schlimm, als würde jemand ein Messer in meine Knie bohren.
Anfangs versuchte ich, das Übel mit Salben, Verbänden, Globuli und Ruhe in den Griff zu bekommen. Schmerzmittel nehmen, um trainieren zu können, war für mich und meinen damaligen Trainer Harald Olbrich zum Glück keine Alternative. Schmerzmittel bekämpfen nie die Wurzel des Schmerzes, sondern nur die Symptome. Relativ schnell wurde leider klar, dass Hausmittel nicht halfen. Und so begann eine Odyssee durch die Arztpraxen unserer Region. Meine Eltern waren unglaublich geduldig mit mir, sie fuhren mich vom Heilpraktiker zum Orthopäden, wir versuchten es mit Einlagen und sonderangefertigten Schuhen. Aber es blieb dabei: Wenn ich wuchs, und ich wuchs viel, war an Laufen nicht zu denken.





























