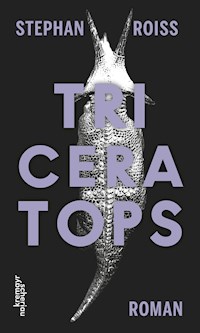Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Leon lebt wie im Rausch, Rausch, sucht Entgrenzung in der Fremde und probt den Aufstand daheim. Bis er von weither zu spät zurückkommt, als seine Mutter stirbt. Selbstvorwürfe quälen ihn, Erinnerungen suchen ihn heim, verbittert zieht er sich zurück. Selbst Vio und Milena, die beiden ungleichen Freundinnen, können daran nichts ändern, und auch nicht, dass ihre gemeinsame Punkband vor einem Durchbruch steht. Als Leon erfährt, dass er Krebs hat, folgt er einer Einladung nach Venedig, wo ihn ein alter Freund in die Kunst der Meditation einführt. Doch die Reise, auf die Leon sich begibt, endet nicht dort, sondern geht weiter, quer durch Italien, bevor er schließlich auf der Vulkaninsel Stromboli landet. Unverhofft findet er sich in einer Welt wieder, in der die Liebe schamlos ist, die Gitarren wieder fiepen und dröhnen und eine Versöhnung mit dem Leben möglich scheint.Lauter ist voller Wut und Hoffnung. Lauter feiert das Leben in Versenkung und Ekstase. Lauter ist der Ruf nach mehr, immer noch mehr, und endlich nach Stille.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAUTER
© 2024 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.
Umschlagbild: Bubble_Wrap 2 © Andy Grimshaw
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-306-7
STEPHAN ROISS
Lauter
Roman
per Monita
INHALT
NULL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
NULL
Ich sah das leichte Blau des Himmels und das schwere Blau der See, aufgeknöpfte Hemden und hautenge Röcke, balancierte auf dem Malecón zwischen gischtumspülten Felsen und einer vierspurigen Straße, während hoch über mir ein Pelikan in der Luft zu stehen schien, hörte das dumpfe Tuten eines Frachters, das die ganze Bucht erfüllte – und für einen Moment verstummten die kläffenden Hunde.
So lange hatte ich über den Begriff der Seele gelacht, bis in meiner Hand die Hand meiner toten Mutter lag, noch nicht kalt, doch schon zu kühl. Ich strich mit meinem Daumen über ein Netz aus feinen Falten, über das Relief der Venen, die Fingerknöchel, vergilbte Nägel. Die Heizung klackte. Irgendwo knisterte ein Radio. Ich saß an einem weißen Bett, übernächtigt und verschwitzt, drückte diese reglose Hand und bat jemanden um Verzeihung, der nicht mehr da war.
Mein Vater stand am Fenster, mit dem Rücken zu mir. Ich hoffte, dass er weinte, doch ich glaubte es nicht. Nach seinem Anruf hatte ich meine Reise sofort abgebrochen, den Fahrer eines ausgebuchten Busses bestochen, damit er mich im Gang kauern ließ, um so schnell wie möglich von der Schweinebucht zurück nach Havanna zu gelangen, war in Madrid in eine andere Maschine umgestiegen, nach der Landung zum Zug gerannt, ohne auf meinen Koffer zu warten, und hätten nicht an diesem Tag tausende Menschen in der Innenstadt protestiert und das Taxi zu einem Umweg gezwungen, wäre ich vermutlich rechtzeitig gekommen.
Mit sonnengeröteten Schultern stand ich auf dem Platz der Revolution, der riesig war und schattenlos und menschenleer, schloss die Augen und summte eine Melodie in das Diktiergerät. Westlich des Prado zerstampfte man mit Mörser und Schale Malanga für die Säuglinge, knatterte auf blank polierten Mopeds durch schmutzige Straßen, verkaufte den Touristen Eintrittskarten für ein Salsa-Festival, das niemals stattfinden würde. Ein Song von Sepultura lockte mich in eine Bar, ich trank Daiquiri nach Daiquiri auf der Dachterrasse, nichts ahnend vom Durchfall am nächsten Tag, sah den Kleinen Wagen steil gekippt und das W der Kassiopeia als M.
Ich hätte daran denken können, wer mich gelehrt hatte, diese Sternbilder zu sehen. Wer mir gezeigt hatte, wo links ist und wo rechts. Wer mir beigebracht hatte, meinen Namen zu schreiben, die Uhr zu lesen, eine Terz zu treffen. Wer mir mein erstes Instrument geschenkt hatte: ein Glockenspiel mit Klangstäben in den Farben des Regenbogens. Wer mir nach dem Adventkranzsingen demonstriert hatte, dass man mit dem Finger durch die Flamme fahren kann, ohne Schaden zu nehmen. Wer mir geholfen hatte, jedem Stofftier ein Löwenzahnblatt als Krawatte an die Brust zu heften. Wer mir Ronja Räubertochter vorgelesen hatte, bis Wilddruden in den Zimmerecken hockten. Auf der anderen Seite des Atlantiks hatte ich selten an meine Mutter gedacht.
Umschwirrt von Bienen stieg ich hinab in eine Höhle und entdeckte im Schein der Taschenlampe ein Pferdeskelett, ein unterirdisches Rinnsal und Blumen, die kein Sonnenlicht zu brauchen schienen. Ich tagträumte von Ogriden, ebenso schwachsinnigen wie boshaften Kreaturen, die in dieser Dunkelheit hausten, keine Lieder kannten. Als ich wieder ins Freie kletterte, sah ich drei Männer mit ausgefransten Strohhüten ein Ochsengespann antreiben. Sie schrien heisere Befehle und schlugen mit der flachen Hand gegen die Flanken weißer Rinder, die mühten sich über ein Zuckerrohrfeld.
Für mich war der Findling im Pfarrgarten ein Ei gewesen, so alt wie die Welt, und irgendwann würde ein Drache daraus schlüpfen. In meiner Vorstellung brauchte es zwei kräftige Feen, um eine Tafelkreide hochzuheben. Gäbe es keinen Regen, dachte ich, hätten die Fische das Meer längst ausgetrunken. Meine Mutter trocknete mir die Tränen, die ich über die Nüchternheit der Welt vergoss.
Ich sah Steinbrocken aus ziegelroten Äckern ragen und eine Mülldeponie, die kein Ende nehmen wollte. Neben der Fahrbahn brannte das Gras. Der Buslenker wich einer herrenlosen Schafherde aus und den Kratern im Asphalt. Ich fotografierte die fettigen Flecken auf dem Fenster neben mir, Hinterlassenschaften von Reisenden, die ihre Köpfe an das Glas gelehnt hatten, um zu schlafen oder sich mit offenen Augen in die vorbeirauschenden Bambuswälder zu träumen. An der Innenseite der Frontscheibe klebten durchsichtige Saugnäpfe, daran hingen drei verschiedene Wunderbäume und ein Wimpel mit der kubanischen Flagge und eine Miniatur von Ganesha und ein Medaillon mit dem Bildnis der Gottesmutter und purpurrote Bänder mit chinesischen Schriftzeichen. Von den glimmenden Wiesenhängen stiegen Rauchschwaden auf. Über der Mülldeponie kreisten Geier und Krähen.
Der Stern, der mich zum Jesuskind leiten hätte sollen, erlosch. Meine Freunde und ich liefen den Glühwürmchen nach. Wir gerieten zu tief in den Wald und kamen zu spät nach Hause, spielten mit Messer, Gabel, Schere, Feuer, pressten unsere Ohren gegen die Bahnschienen, fanden ein Loch im Zaun des Sägewerks. Die Zeit in der Kirchenbank nutzte ich für rhythmische Übungen, klopfte mit den Fingerspitzen im Sieben-Achtel-Takt gegen meine Kniescheiben, während der Pfarrer hinter dem Altar die Schauhostie zerbrach. Mutter ermahnte mich zu mehr Aufmerksamkeit in der Messe und rügte Vater immer wieder wegen seiner Völlerei, die sich zunehmend in Beschwerden niederschlug. Er wurde von Sodbrennen geplagt, seine Gelenke schmerzten, beim Treppensteigen fehlte ihm die Luft. Eines Tages setzte er sich an den Frühstückstisch, schnaubte belustigt und meinte, er müsse die ganze Nacht auf seinem Arm geschlafen haben, so taub fühle er sich an.
Morgens weckten mich die singenden Händler, die auf Lastenrädern durch die Straßen fuhren und dabei lauthals ihre Waren anpriesen, jeder in seiner eigenen Melodie. Ich trank starken Kaffee auf brüchigen Balkonen, stieg hoch in den Glockenturm, wanderte zur Radiostation am Cerro de la Vigía. Auf den Dächern der Stadt standen bauchige Wasserspeicher, türmten sich Eichhörnchengehege und Terrarien, griffen Bäume ineinander und bildeten schattige Lauben, verwoben sich Kabel und Drähte zu einem chaotischen Gespinst. Während der nächtlichen Stromausfälle lauschte ich dem Donner und den jammernden Katzen, dem Klicken, wenn meine Gastgeberin durch den Perlenvorhang trat.
Als mich Vater zum Umzugswagen trug, plärrte ich so fürchterlich, dass die Nachbarin aus dem Haus gerannt kam. Ich verstand die Welt nicht mehr. Mutter wollte sie mir schönreden. Sie erklärte mir, welche Möglichkeiten uns das Leben in der Stadt bieten würde. Doch von meinem neuen Zimmer aus konnte ich kaum mehr sehen als eine graue Mauer und eine grell erleuchtete Tankstelle, die Leute grüßten nicht, und der Park war kein Wald. Ich wollte weder in einen anderen Fußballverein noch aufs Gymnasium, sondern der linke Flügelflitzer mit der Nummer siebzehn bleiben und mit meinen Freunden in die Hauptschule gehen. Vater versuchte mich mit Geschenken aufzuheitern. Seine dumme Modelleisenbahn konnte er behalten.
Das Blätterdach flimmerte, der Kühlschrank sirrte, ein Eichhörnchen huschte über das Geländer der Veranda. Zwei Ventilatoren halfen die Hitze zu bewältigen und scheuchten die Insekten auf. Ich trank Mineralwasser und Guavensaft, notierte hin und wieder einen Reim, eine Wendung, einen klangvollen Satz, sammelte Material für den Text eines neuen Liedes. Zwei Tische weiter bemühte sich ein Österreicher um eine Kubanerin. Sein Englisch war so tollpatschig, dass ich mehrmals versucht war, ihm das passende Vokabel einzusagen. Sie war eloquent und höflich, stellte gelegentlich eine simple Frage und aß schwarze Bohnen und gelben Reis, während er eine Antwort stammelte. Auf der anderen Straßenseite warteten Menschen in einer langen Schlange neben der Bäckerei, fächelten einander Luft zu, mit Papptellern und bloßen Händen, zeigten beim Lachen weiße Zähne. Die beiden Wachposten vor dem benachbarten Regierungsgebäude trugen Tarnanzüge, schwere Stiefel, goldene Uhren, und schienen bemüht zu sein, gleichermaßen grimmig und lässig dreinzuschauen. It was a pleasure speaking with you, sagte die Frau und schlürfte ihren Mojito aus: Thanks for paying the bill. Die Antwort meines Landsmannes lautete: Please, please, please, lucky you, lucky me, und wurde mir zum Auftaktvers der letzten Strophe.
Vater fluchte über die Borniertheit der Kommission, das feige Kollegium und die generelle Misere der Wissenschaft, als er bei der Vergabe des Lehrstuhls erneut übergangen worden war. Er verließ die Universität, noch bevor sein Vertrag als Assistent ausgelaufen war. Immer öfter entzog er sich Mutters Umarmungen, immer seltener aß er mit uns gemeinsam. Ich stocherte im Gemüsereis, während über die Kellertreppe das Surren der Modelleisenbahn heraufdrang. Allmählich versteiften seine Hände, versagten seine Nieren. Er schwieg erbarmungslos, und Mutter versteinerte in Posen des Stolzes und der Stärke. Sie schloss sich im Badezimmer ein und drehte alle drei Hähne auf, da sie glaubte, im Rauschen des Wassers würde ihr Schluchzen untergehen.
Nach dem Regenguss quoll Dampf aus den Kanalgittern. Auf dem Prado wurden nasse Planen von den Stellwänden gezogen. Zum Vorschein kamen knallbunte Lackgemälde und melancholische Drucke, Flamingos auf selbstgeschöpftem Papier, Stadtansichten und Tanzszenen, Porträts von Fidel Castro und Celia Cruz, abstrahierte Krokodile unter Königspalmen. Zwischen zwei Ständen saß ein Schuhputzer. Hatte er sein Werk getan, glänzten die Schuhe seiner Kunden wie die Chevrolets, die petrolfarben, pink, blitzblau, minzgrün und rot vor den mondänen Hotels parkten. Immerfort kichernd bahnten sich Mädchen auf Rollschuhen ihre Wege durch die Menge der Marktbesucher. Ich schlenderte von Tisch zu Tisch, beugte mich über hölzerne Seepferdchen und Hundewelpen aus Fleisch und Blut. Eine Frau mit Vampirzähnen erläuterte mir die Santeria-Symbole, die sie in ihre Skulpturen einarbeitete. Ich erstand eine Handpuppe mit dem Konterfei von Hemingway.
Als wir ein letztes Mal zu dritt spazieren gingen, streute der Winter Schneeflocken wie Kokosraspeln auf unsere dunklen Hauben. Jedes böse Wort war bereits gefallen und kein gutes mehr übrig. Vater, der jahrelang davon geträumt hatte, die Philosophie des Renitenten Rationalismus zu begründen, verlor offenbar den Verstand. Er zog mit seiner neureichen Geliebten in ein verschlafenes Voralpendorf, behandelte seine Gicht mit Globuli und lektorierte Bücher über das keltische Baumhoroskop. Wie groß unser Haus mit einem Mal erschien und wie teuer es war. Mutter überwies jede Zahlung meines Vaters umgehend zurück und fand bald im Bahnhofsviertel eine Mansardenwohnung für uns.
Ich legte drei Scheine auf den Kassentisch, wohl das Zehnfache dessen, was der Barbier von einem Einheimischen verlangt hätte, und spazierte mit kurz geschorenen Seiten und scharf konturiertem Bart über die Plaza Santa Ana. Hinter der Kirchenruine standen Flammenbäume mit breiten Kronen, aus denen herab kunstvoll gefertigte Käfige hingen. Kanarienvögel, Finken, Tocororos hüpften darin hin und her, auf und ab, rastlos zwitschernd, während die Männer, die sich für die Besitzer der Tiere hielten, schweigend auf den Parkbänken saßen, Zigarren pafften. Ich nahm das Diktiergerät zur Hand und spielte die Melodie ab, die ich in Havanna aufgenommen hatte. Die Abfolge der Töne wirkte jetzt so einfach und zwingend, dass ich nicht länger glauben konnte, ich sei ihr Urheber. Doch mir wollte auch nicht einfallen, woher sie mir womöglich bekannt war.
Gero und ich fanden endlich einen Schlagzeuger und gründeten God in Trouble. Wir stiegen in die Umkleidekabinen des Stadions ein, färbten einander dort die Haare: strohblond, giftgrün, feuerrot. Nach dem ersten Konzert im Jugendzentrum fühlten wir uns wie Rockstars. Meine Noten wurden schlechter, die Lehrer erklärten mir Gleichungssysteme, den Parasympathikus, die Relativitätstheorie, ich ihnen den Krieg. Mich lockten große, entfesselte Gesten, verzerrte Riffs, unendliche Nächte. Mutter rief mich zurück an die karierten Hefte. Bald befand ich, dass ich von Mutters Ratschlägen lebenslang übel zugerichtet worden war, und warf ihr vor, was ich meinem Vater jedes zweite Wochenende leichtfertig verzieh.
Ich pfiff die Melodie vor mich hin, ohne aus ihr schlau zu werden, passierte verfallene Villen und Obststände, stacheldrahtumrankte Eisenportale und mit Zwiebelketten behangene Verschläge, schlug die Angebote der Prostituierten und der Taxifahrer aus, wanderte eine gute Stunde bis nach La Boca ans Meer. Ein Lastwagen donnerte über die staubige Piste, brachte die Maiskolben ins Wanken und ließ ein dürftig montiertes Blechschild am Straßenrand klappern. Während ich am Strand meine Wandergitarre stimmte, setzte sich ein kleines Mädchen neben mich in den Sand, lutschte an einem Avocadokern und blickte wortlos auf die grauen Wellen. Die meisten Einheimischen gingen mit T-Shirts ins Wasser. Sonnenschutzmittel waren schwer zu bekommen.
Ich begann zu stehlen: daheim Münzen aus dem gläsernen Krug, in den Läden Plektren und Eishockey-Pucks, Woolfs Wellen, Wittgensteins Tractatus, schwarze Schweißbänder. Während die Nachbarn längst piepsende Induktionsherde besaßen, verblüffte unser Gasofen nach wie vor mit blauen Flammenkränzen. Als Mutter den dritten Tag in Folge die Schottische Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy auflegte, stürmte ich aus dem Haus, betrank mich im Machine und sah zum ersten Mal Anton, den Frontmann von Stiletto Mantikor: Er rotzte auf die Bühne, marterte den Bass, marterte seine Stimme, spritzte Bier ins Publikum. In den frühen Morgenstunden riss ich das Wohnzimmerfenster auf und übergab mich in die Blumenkiste, auf Mutters Hyazinthen. Ich biss mir auf die Unterlippe, wenn ich mich schuldig fühlte. Mutter biss sich auf die Unterlippe, wenn sie sich schuldig fühlte. Wir überbrüllten das schlechte Gewissen und zerschlugen im Zorn Porzellan: Okarinas, Aschenbecher, Heiligenfiguren.
Das Fell der Sanduhrtrommel war rissig, der Kontrabass mit Plastiksaiten bezogen, die Tres eine umgebaute Westerngitarre. Jaulend fiel ein struppiger Hund in den Chorus ein, woraufhin der Sängerin vor lauter Lachen ihre Claves entglitten. Schon beim dritten Lied tanzten alle Menschen auf der Terrasse des Lokals, außer mir und einem Greis, der friedlich schlummernd sein Barcelona-Trikot bespeichelte. Ich musste auf einen Stuhl steigen, um sehen zu können, wie die Finger des Tres-Spielers über das Griffbrett rasten. Er spielte barfuß und hatte fast die ganze Zeit über die Augen geschlossen. Nach dem Konzert fragte ich ihn nach seinem Namen und ob er mir Unterricht geben wolle. Er klatschte in die Hände, richtete sich auf, klopfte mir auf die Schulter. Corsario. Si, por supuesto.
Mutter stellte auf ihrem Notenständer nur noch Kochbücher ab, absolvierte keine Vorsingen mehr, verdingte sich nun Vollzeit in der Reinigungsfirma. Wie stark ihre Unterarme waren vom Auswringen der Putzlappen. Wie wenig Kraft sie noch aufbrachte für alles andere. Ihr Tadel trieb mich jeden Tag aufs Neue in die Enge. Ich schrieb Mutter einen Abschiedsbrief, den ich ihr nie gab, stopfte zwei Reisetaschen voll und schlief bei Gero auf der Couch, bis in der besetzten Sporthalle ein Zimmer frei wurde, weil Anna vom Dach des Turmhotels gesprungen war.
Verwitterte Cherubime knieten zu beiden Seiten des Portals, und ein Rudel heller Hunde streifte durch den Friedhof, der so wirr und uneben angelegt war, dass ich oft nicht ausmachen konnte, ob eine Steinplatte Teil des Weges war oder zu einem Grab gehörte. Ein fingerdünner Kolibri flatterte vor einem Strauch, stand mal da und mal dort mit flirrenden Flügeln in der Luft, tauchte seinen Schnabel in mangofarbene Blütenkelche. Vor der Kapelle tunkte ein alter Mann das Mundstück seiner Zigarre in Honig und bekreuzigte sich, bevor er zur Streichholzschachtel griff.
Ich lernte, über den Begriff der Seele zu lachen: in den Backstage-Bereichen versiffter Venues, auf den 8. März- und 1. Mai-Demos, im Max-Stirner-Lesekreis. Milena schulte mich als Musikredakteur beim Freien Radio ein und ging in Mutterkarenz. Eine Woche vor dem Geburtstermin nahm sie mich mit in Tommys Tätowierstube, wo Vio sich gerade Fuchur auf den Unterarm stechen ließ: den aus dem Buch, wie sie betonte, nicht den aus dem Film. Weil Gero nicht einsah, weshalb ich Bitches und Bourbon nicht mehr spielen wollte, kam es zum Zerwürfnis. Ich verließ God in Trouble, und Graógramán formierte sich. Ich trug meine Kämpfe nun alleine aus, sorgte für mich selbst, unbeirrbar in meinem Glauben, Mutter nicht länger zu brauchen.
An einer mit Glasscherben bewehrten Mauer lehnte ein Mechaniker in tiefblauem Overall und schälte eine Papaya mit einem rostigen Buschmesser. Obwohl sie allesamt einen großen Bogen um ihn machten, zischte er den vorbeikommenden Touristen beharrlich seinen Wechselkurs zu: hundert Pesos für einen Euro. Eine Kutsche fuhr die Straße hoch, gezogen von einem Pferd, dem man eine Glocke um den Bauch gebunden hatte. Hinterdrein liefen Kinder in ockerfarbenen Schuluniformen und imitierten mit hellen Stimmen das Bimmeln und zungenschnalzend das Klacken der Hufe. Vor uns auf der Bordsteinkante lag ein Gecko in der Vormittagssonne, schwarzäugig und bleich. Corsario drückte seine Zigarette in einer Kokosnussschale aus, und wir setzten uns wieder auf die beiden Hocker in der Mitte des Tanzsaals, dessen Wände mit blinden Spiegeln verkleidet waren. Geduldig versuchte Corsario meiner an Präzision gewohnten Schlaghand das Gleitenlassen beizubringen. Stop playing salsa like rock. Play salsa.
Mutter rang immer öfter um die Wörter für die banalsten Gegenstände, an schlechten Tagen hieß alles nur noch Dings. Sie wollte mir ihr altes Diktiergerät schenken, obwohl sie das am Tag zuvor bereits getan hatte. In ihrer Küche roch es nach angebrannter Milch. Die Welt meiner Mutter wurde kleiner und kleiner, bis sie schließlich auf der Schwelle der Wohnungstür endete. Manchmal erschrak sie vor mir, weil sie mich nicht erkannte. Wenn ich ihr ein Lied aus ihrer Kindheit vorsummte, kam sie wieder zur Ruhe. Ihre Erinnerungen wurden trüb, ihre Singstimme blieb bis zuletzt klar.
Ich saß mit drei Männern in einem schattigen Arkadengang um ein Spielbrett, das statt auf einem Tisch auf unseren Oberschenkeln lag. Hijo de Puta!, fauchte Corsario und ließ eine Handvoll Dominosteine auf das Brett niederprasseln, woraufhin die anderen beiden schallend auflachten. Sofort wurde eine neue Runde eröffnet. Mir ging alles viel zu schnell, ich konnte den Gesprächen kaum folgen, verlor fast jedes Mal, war glückselig, schenkte uns allen Rum nach, siebenjährig, bernsteinfarben. Am Vorabend hatte der Wind mein Buch aufgeblättert, ich war seiner Empfehlung gefolgt und hatte das Gedicht auf Seite 68f gelesen: und das Tier war eine Hymne.
Ich besuchte Mutter im Pflegeheim, mit der Gitarre auf dem Rücken und Hyazinthen in der Hand. Als ich herausfand, dass sie in den Wochen nach meinem Auszug gar nicht mit dem Chor durch die Benelux-Länder getourt, sondern in einem Sanatorium gelegen war, nahm ich sie zum ersten Mal seit Jahren wieder in den Arm – und wollte sie nicht mehr loslassen. Hörigkeit schlug in Hass um, und der traf meinen Vater mit voller Wucht. Ich verspottete seine Wendung ins Esoterische. Er spuckte fünf Minuten lang Gift und sprach danach monatelang kein Wort mit mir. Anton fragte mich, ob ich in sein Bauernhäuschen ziehen wolle, denn er gehe auf unbestimmte Zeit in den Süden.
In sengender Hitze passierte ich das Baseballfeld der Héroes de Playa Girón und das Revolutionsmuseum, in dessen Vorgarten zwei Panzer standen, querte die Straße, um im Schatten der Wechselstube zu rasten. Dort saß bereits jemand. Alessias Beine waren übersät von roten Punkten. Sie konnte nicht sagen, ob sie von Bettwanzen, Sandflöhen oder Moskitos zerstochen worden war. Sie schilderte mir ihr Leben in Palermo und zeigte mir auf ihrem Mobiltelefon Fotos ihrer Malereien. Bald reichte mein Italienisch nicht mehr aus. Ich besorgte uns zwei Dosen niederländischen Importbiers und erzählte die drei englischen Witze, die ich kannte.
Ein Pfleger vermutete, dass Mutter kürzlich hingefallen sein musste, da auf ihrem Hinterkopf ein kleines Hämatom zu sehen war, versicherte mir aber, dass es ihr gutginge. Sie klage nicht über Schmerzen, sei neurologisch unauffällig und unverändert mobil. Mutter fragte ihr Spiegelbild, wo sich denn der Ausgang aus diesem Irrenhaus befinde. Die Hörgeräte pfiffen. Süßstoffpillen lösten sich im Milchkaffee auf. Eisentabletten schwärzten den Stuhl. In der Hauskapelle betete man für einen raschen Tod und das ewige Leben.
Die Küstenstraße war bedeckt mit Pferdeäpfeln und den Kadavern überfahrener Krabben, die ihre befruchteten Eier ins Meer hatten bringen wollen. Der Pfad zum Strand war gesäumt von blutroten Hibiskusblüten. Männer mit Macheten in den Gürteln erklommen die geschuppten Stämme der Palmen, die verneigten sich vor dem Ozean. Im Schutz der Mangrovenwurzeln, die sich dicht am Ufer zu einem Unterwasserwald verwuchsen, gewöhnten sich Jungfische an das Leben. Alessia und ich schwebten über Korallen, deren Formen uns an Gehirne, Luftfächer, vielarmige Kerzenständer, wild zerzaustes Haar erinnerten. Unter dem Vordach einer Strandhütte zogen wir einander die schwarzen Stacheln der Seeigel aus den Sohlen. Die Muster, die die Tauchmasken auf unserer Haut hinterließen, trugen wir wie Abzeichen. Lange gab es nichts als das Knarzen unserer Hängematte und das Brechen der Wellen. Als Alessia mein Gesicht in ihre Hände nahm, klirrten die Ringe an ihren Armen. Auf dem Heimweg wichen Krabben mit erhobenen Scheren vor uns zurück.
Ich beschwichtigte Mutter, mir sei auch manchmal schwindlig. Ich versprach, ihr eine Karte aus der Karibik zu schreiben. Sie bedankte sich, redete mich dabei mit dem Namen ihres Bruders an, streichelte meine Wange und sagte, dass sich das Leben nicht lohne, aber dass es gut sei und schön.
In meinem Kulturbeutel wimmelte es von Feuerameisen. Ich zog mein Shirt nicht in der Mitte des Zimmers aus, weil der wuchtige Deckenventilator so tief hing, dass meine hochgereckten Arme zwischen die rasend rotierenden Flügel geraten wären. Im Hinterhof von Alessias Apartment zirpten die Zikaden, und ein doppelstämmiger Limonenbaum streckte seine Äste über die Zäune, bot seine Früchte auch den Nachbarn an. Wir griffen im orangen Dämmerlicht nach dem Körper des anderen, vermaßen ihn erst mit unseren Fingerkuppen, bald mit vollen Händen, zählten Küsse und Bisse, wogen sein Gewicht unter dem Moskitonetz liegend, fanden seinen Takt und verloren uns darin, lösten uns auf mit zitternden Pupillen. Wir hörten dem Dorf beim Erwachen zu, dem sanft anschwellenden und stetig dichter werdenden Chor, dem Quaken und Zwitschern, dem Gebell, den klappernden Fenstern, den ersten Stimmen, Hufschlag, Motorenkrach. Mein Telefon vibrierte, und der Schrei eines Hahnes, der vor dem Fenster durch einen Hain aus weiß blühenden Bäumen schritt, rief eine Ahnung in mir wach.
Mutter war tot. Ihre Finger hatten nicht gezuckt. Was ich gespürt hatte, war eine Feuerameise, die über meinen Daumen krabbelte. Ich musste sie eingeschleppt haben. Mein Blick fand keinen Halt, traf statt auf den Blick meiner Mutter bloß auf ein Paar halb zugefallener, lichtloser Augen, irrte über das Weiß der Bettdecke und verlor sich in der flimmernden Dunkelheit, die hinter geschlossenen Lidern herrscht. Der Wind wurde laut. Vater hatte das Fenster gekippt, schnäuzte sich, trat an mich heran und sagte, er gehe an die frische Luft. Ich sah nicht auf zu ihm, aber fasste mit meiner Linken nach seiner gichtsteifen Hand und drückte sie, während meine Rechte noch immer die Hand meiner Mutter hielt. Für einen Moment und zum allerletzten Mal bildete mein Körper eine Brücke zwischen meinen Eltern. Bevor die Tür hinter Vater zufiel, hörte ich eine Krankenschwester fragen, ob sie den Leichnam nun herrichten sollten.
Sie würden den Leichnam herrichten: ihn waschen, kämmen, in Leintücher wickeln, den Unterkiefer mit einer dünnen Nylonschnur anbinden, damit der Mund nicht aufklaffte, ihm eine Blume auf die Brust legen, ihn zwei Stunden später in die Pathologie hinunterbringen, kühlen, ihm das Kleid anziehen, das Vater für das schönste im Kasten gehalten hatte, und ihn abends in die Obhut des Bestatters übergeben.
Ich strich über Mutters Haar, über die Narbe, die von der Gürtelschnalle des Dorflehrers herrührte, über ihre Altersflecken, über die Wange, wieder und wieder über ein Netz aus feinen Falten. Mein Summen verschwamm mit den Geräuschen des Windes und der Straße.
EINS
Fantômas, Refused, Mary Lou Lord: Wahllos zog ich Schallplatten aus Antons Sammlung. Inmitten eines Stücks von Tschaikowski für Orchester und Klavier blieb die Nadel hängen. Ein Knacken und fünf leise Töne. Ein Knacken und fünf leise Töne. B-Moll. So oft hörte ich diese Sequenz, bis ich mir einbildete, feine Unterschiede zwischen den Wiederholungen ausmachen zu können. Ein Knacken und fünf leise Töne.
Ich wurde mir zum Rätsel. Dass ich in Kuba gewesen war, bezeugten meine gebräunte Haut, die Handpuppe, Muscheln und Münzen. Aber wie war es möglich, dass der Mann, der letzte Woche noch durch leuchtende Fischschwärme getaucht war, und dieses weltverlorene Gespenst, das in Bademantel und Stricksocken durch ein düsteres Haus schlich, ein und dieselbe Person waren? Bis zum Begräbnis hatte ich Haltung bewahrt, organisiert, was organisiert werden musste, den Zusammenbruch aufgeschoben und meinen Zorn im Zaum gehalten, doch kaum war die letzte Hand geschüttelt und die letzte Beileidsbekundung in der Kapelle verhallt, verlor ich die Fassung, sagte Vater, der mir anbot, mich nach Hause zu fahren, er solle aus meinem Leben verschwinden, und sank dann in mich zusammen.
Ich verbrachte die Tage in abgedunkelten Räumen. Die Sonne sah ich, wenn ich am Dachbodenfenster rauchte. Ich rauchte, um mich meines Atems zu versichern, und unter dem Eindruck, es sei ohnehin Irrsinn, etwas zu tun, egal was. Warum bläst der Wind noch? Und warum hält der Kirschbaum ihm noch stand?
Läutete es an der Tür, öffnete ich nicht, obwohl der Kaminrauch jedem verraten musste, dass ich zu Hause war. Ich stocherte in der Asche, stapelte Reisig auf Zeitungspapier und Scheit auf Scheit, rollte mich vor dem Kachelofen ein. Der November war mild, mein Frösteln blieb mir unerklärlich.
Das Telefon lag ausgeschaltet zwischen einzelnen Socken am Boden des Kleiderschranks. Bevor ich es dorthin gelegt hatte, waren mir nur drei Anrufe unaufschiebbar erschienen: Ich hatte bei der Radiostation meinen Urlaub verlängert und meine beiden Bandkolleginnen um Verständnis gebeten: Graógramán