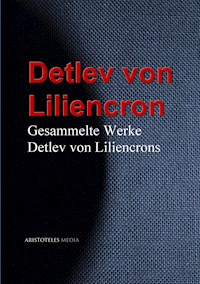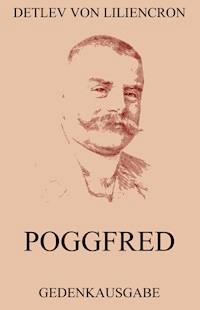Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein autobiografischer Roman des 1909 verstorbenen deutschen Lyrikers. Liliencron war einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. Sein Werk ist dabei äußerst vielgestaltig und lässt sich nur schwer einer bestimmten Literaturepoche zuordnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leben und Lüge
Detlev von Liliencron
Inhalt:
Detlev von Liliencron – Biografie und Bibliografie
Leben und Lüge
Erster Teil
Wo kam er her?
Die ersten Kinderjahre
Schüler und Schulen
Zweiter Teil
Ein Schifflein sah ich fahren,
Kapitän und Leutenant
Dritter Teil
In Tangbüttel
Im Süden
Vierter Teil
Nach vielen Jahren
Wiebke Blunck
Ein wenig aus der Dichterei
Ein Gespräch
Der letzte Tag
Leben und Lüge, D. von Liliencron
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849630768
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Detlev von Liliencron – Biografie und Bibliografie
Dichter und Novellist, geb. 3. Juni 1844 in Kiel, verstorben am 22. Juli 1909 in Alt-Rahlstedt. Trat in das preußische Heer ein, beteiligte sich an den Feldzügen von 1866 und 1870, nahm seinen Abschied als Hauptmann und lebt jetzt in Alt-Rahlstedt bei Hamburg. Mit den soldatisch kräftigen und koloristisch fesselnden Gedichten »Adjutantenritte und andre Gedichte« (Leipz. 1883, 3. Aufl. 1898) trat er als starkes Talent von ind individuellem Gepräge in die Literatur ein. Es folgten der Roman »Breide Hummelsbüttel« (Leipz. 1887), die Novellensammlung »Eine Sommerschlacht« (das. 1886), die Dramen: »Knut der Herr« (das. 1885, 2. Aufl. 1905), »Der Trifels und Palermo« (das. 1886, 2. Aufl. 1905), »Arbeit adelt« (das. 1886), die Trauerspiele: »Die Merowinger« (das. 1888, 2. Aufl. 1905) und »Pokahuntas« (Berl. 1905), die Erzählungen: »Unter flatternden Fahnen« (Leipz. 1888), »Der Mäcen« (das. 1889, 2 Bde.), »Krieg und Frieden« (das. 1891), »Kriegsnovellen« (das. 1893), sowie »Gedichte« (das. 1889), »Der Haidegänger und andre Gedichte« (das. 1890), »Neue Gedichte« (das. 1893, 2. vermehrte Aufl. u. d. T.: »Nebel und Sonne«, Berl. 1900; 4. Aufl. 1904) und die weitern lyrischen Sammlungen. »Kampf und Spiele« (Berl. 1897), »Kämpfe und Ziele« (das. 1897), »Bunte Beute« (das. 1903, 5. Aufl. 1905) und »Ausgewählte Gedichte« (das. 1901). In all diesen Gedichten offenbart L. eine oft hinreißende Frische, malerische Anschaulichkeit und ein hervorragendes Formtalent, so daß er unter den Lyrikern der Gegenwart mit in erster Linie steht. Die gleichen Vorzüge verrät sein subjektives »kunterbuntes« Epos »Poggfred« (Berl. 1896, 5. Aufl. 1905). Liliencrons »Sämtliche Werke« erschienen zuletzt in Berlin 1904–05 in 14 Bänden; 1904 erfuhr der Dichter zahlreiche Auszeichnungen an seinem 60. Geburtstag. Vgl. O. J. Bierbaum, Freiherr Detlev v. L. (Leipz. 1892); F. Oppenheimer, Detlev v. L. (Berl. 1898); F. Böckel, D. v. L. im Urteile zeitgenössischer Dichter (das. 1904).
Leben und Lüge
Erster Teil
Wo kam er her?
Die winzige Grenzfestung, als solche im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts eingegangen, lag im Westen Deutschlands. Sie war so klein, daß man von einem Tor durchs gegenüberliegende sehen konnte. Sie hatte davon vier, genau nach der Windrose. In der Mitte sonnte sich der große viereckige Markt- und Alarmplatz. Um diesen herum lagen die einzigen Häuser des Städtchens.
Weshalb eigentlich hier die Feste gebaut war, konnte niemand ergründen. Weder war ein Flußübergang, noch ein Felsenpaß zu verteidigen. Weder bot sie Platz für geräumige Speicher, für Vorräte, für bereitliegende Waffen, für Kriegsbedarf, noch konnte sie aus Raummangel geschlagenen und zerstreuten Truppen als Zufluchtsort und Schlupfwinkel dienen.
Die Gegend legte sich meilenweit platt um die Wälle. Alle feindlichen Heere waren auch von jeher lachend und höhnend um sie herumgezogen, hatten sie nicht einmal einer Beschießung, gar einer Belagerung für wert und würdig gehalten.
Sie war nach Vaubans »erster Manier« angelegt. Ja, es ging die Sage, aber eben nur die Sage, daß Vauban selbst den Bau geleitet habe. Eins aber hatte die kleine Feste: ein niedrig streifendes Schußfeld im besten Sinne des Wortes.
Zum Standort gehörten der Kommandant, der Platzmajor, ein Infanterie-Regiment und zwei Batterieen. Ferner waren vorhanden: Proviantbeamte, der Kriegsgerichtsrat, ein Baurat, der Pfarrer, der Artillerie-Offizier vom Platz und der Ingenieur-Offizier vom Platz, der Arzt und einige Wallmeister.
Die Häuser und »ärarischen« Gebäude der Festung, die den Markt- und Alarmplatz umstanden, waren die Kommandantur, die Kasernen, die Vorratsräume, ein turmloses Kirchlein, die Wohnungen für Offiziere und Beamte und einige wenige Privathäuser.
Aber hinter ihnen, oft ganz versteckt zwischen und in den Werken, träumten schöne, stille, einsame, uralte Gärten. Freilich, wäre die Festung nur ein einziges Mal belagert gewesen, sie hätte, da dann alles umgehauen werden mußte, nicht ihre Riesenbäume gehabt, die in diesen Gärten den größten Schmuck ausmachten. Ein besichtigender General hatte mal ausgesprochen, daß solche einsame, alte, gänzlich versteckt liegende Gärten die traumhafteste Poesie, die Poesie an sich wären. Der größte, einsamste und versteckteste Garten gehörte zur Kommandantur.
So schlief denn das Örtchen und hatte geschlafen die Jahrhunderte hindurch, abseits von aller Welt.
###
Der Kommandant um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hieß Oberst von Vorbrüggen. Die Familie Vorbrüggen stammte aus Südfrankreich, aus der Provence. Der Glanzpunkt dieses Geschlechtes war Raimon devant le Pons (Pont), der Troubadour. Später war es nach Holland gekommen, wahrscheinlich mit den Grafen Nassau-Orange, und von hier aus, zu Zeiten des Großen Kurfürsten, in die Mark Brandenburg. Vielleicht durch verwandtschaftliche Beziehungen der Hohenzollern zu den Oraniern. Ein Zweig wanderte in demselben Jahrhundert in Dänemark ein. Dieser Zweig wurde im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts in den dänischen Grafenstand erhoben.
Eigentlich hätten sich die von Vorbrüggen in richtiger Übersetzung ihres Namens »vor der Brücke« nennen müssen. Aber wie es immer gekommen sein mochte: sie nannten sich von Vorbrüggen. Aus dem »vor der« war ein »von« geworden. In Brandenburg verbanden sie sich durch zahlreiche Heiraten mit dem Adel des Landes.
Waren sie früher reich und begütert gewesen, haperte es jetzt bedenklich mit dem Vermögen der letzten preußischen Vorbrüggen. Diese waren der Oberst mit seinen zwei Söhnen.
In Dänemark stand die Familie nur auf zwei Augen. Der letzte, Graf Enewold, war nicht vermählt. Er saß, außergewöhnlich reich, auf seinem Schloß Tangbüttel in Holstein. Alle, die ihn kannten, hielten ihn für einen sehr klugen Menschen, mit dem es nicht bequem war umzugehen. Das mochte aber so gekommen sein: Er hatte sich sein Leben hindurch seine volle Freiheit bewahrt; ließ sich, wie sein Kammerdiener zu sagen pflegte, von keinem an die Nasenspitze fassen. Und so einer ist nicht »bequem«. Zuweilen tat der jetzt achtundzwanzigjährige Enewold Kammerherrndienste in Kopenhagen.
Der Name seines Gutes Tangbüttel heißt Tannenort und hat nichts zu tun mit Tang (Seetang) und ähnlichem.
###
Der Kommandant, Oberst Friedrich Wilhelm von Vorbrüggen, hatte, einunddreißig Jahre alt, achtzehnhundertundneunzehn die siebzehnjährige Tochter eines pommerschen Predigers geheiratet.
Schon bei Jena hatte er als Junker, siebzehn Jahre alt, mitgekämpft; am dreißigsten Dezember achtzehnhundertundzwölf war er die entscheidenden Stunden bei York in Tauroggen gewesen. Bei Dennewitz verwundet, machte er doch schon Leipzig wieder mit, wo ihm das Eiserne Kreuz verliehen wurde. Für Waterloo erhielt er das Eiserne Kreuz erster Klasse.
Am Tage von Waterloo wurde auf Schloß Tangbüttel in Holstein, in der Nähe von Hamburg, Graf Enewold von Vorbrüggen geboren.
In der langen Friedenszeit später war der brave Offizier langsam, wie man es scherzhaft nennt: in der Ochsentour, weiter aufgerückt.
Achtzehnhundertzwanzig und achtzehnhunderteinundzwanzig wurden ihm Söhne geschenkt.
Der Oberst lebte in glücklicher Ehe mit seiner Pastorentochter. Das von beiden Familien zusammengebrachte Geld hatte eben gereicht, um das Vermögen, das zur Heirat notwendig verlangt werden mußte, aufzubringen. Da hieß es: sparsam sein. War der Oberst von Natur zur Sparsamkeit veranlagt, so stand ihm darin seine Frau bei als treue, kluge Lebensgefährtin. Sie stammte aus einem der häufig vorkommenden evangelischen Prediger-Häuser, wo Friede, Sitte und Herzensfröhlichkeit drei schöne, liebe Blumen sind im Familienkranz.
Der Kampf mit dem Leben, eben: durch den Geldmangel, war allerdings hart und bitter für beide. Aber sie kämpften ihn durch: gradeausgehend, umsichtig, glaubensfroh und vertrauend auf Gott und seine Güte. Nie war es nötig gewesen, Schulden zu machen, nie hatten sie fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen brauchen.
Die beiden Söhne, im Kadettenkorps erzogen, standen als junge Offiziere in demselben Regiment. Die Zulage, die ihnen von den Eltern gegeben werden konnte, war nur gering. Aber sie kamen damit durch: beide hatten das Geld- und Spartalent von Vater und Mutter geerbt. Beide waren tüchtige, nüchterne junge Männer, die ihren Eltern große Freude machten. Da kam ein sehr trauriges Ereignis dazwischen: beide starben, kaum Offiziere geworden, in einem Jahr, kurz aufeinander: der eine fiel im Duell und der andere wurde aus Versehen auf dem Schießstand erschossen.
Der Schmerz der Eltern war grenzenlos. Aber ihr tiefes und inniges Gottvertrauen brachte sie über die ersten schweren Jahre hinweg. Vater und Mutter lebten, als der Oberst Kommandant der kleinen Grenzfestung geworden war, ihr altes genügsames Leben weiter. Da trat im Herbst des Jahres achtzehnhundertdreiundvierzig das langerwartete und langersehnte Ereignis ein: Der Oberst wurde General.
###
Es war an einem wunderschönen, stillen, klarkalten Januartag, als die Offiziere und Beamten der Festung ihrem Kommandanten, dem neuen General, ein Liebesmahl gaben. Die breiten knallroten Hosenstreifen sollten »begossen« werden.
In den Vorzimmern des Kasinos erwarteten der Oberst des Infanterie-Regiments, der Platzmajor und die übrigen Herren den zu feiernden General. Der Oberst, eine vierschrötige Gestalt, hatte mehr die Furcht als die Liebe seiner Untergebenen. Er kannte nichts als den Dienst. Von diesem Standpunkt aus sah er sein und jedes Leben, die ganze Welt an. Er hieß bei seinen Offizieren aus nicht erklärlichen Gründen der Blockgendarm. Von ganz anderer Art war der Platzmajor, Rittmeister Kaulfuhs. Er hatte das Unglück gehabt, bei einem Rennen zu stürzen und das linke Bein zu brechen. Infolge schlechter Heilung blieb dies Bein zu kurz, so daß er stark hinken mußte. Im Dienst bei der Truppe nicht mehr verwendbar, hatte man dem brauchbaren, liebenswürdigen Offizier die angenehme Stellung eines Platzmajors gegeben. Sein Gemüt mischte sich aus Sanftmut und einer gewissen immerwährenden schwermütigen Stimmung, die er mit strenger Gewissenhaftigkeit und merkwürdigerweise mit großer Vorliebe für die Mathematik zu vereinigen wußte. Er hatte nur ein Steckenpferd: Die Sternkunde. Hierin leistete er so ungewöhnliches, daß er mit der Zeit Mitarbeiter und Mitglied einiger, darunter selbst ausländischer Fachgesellschaften geworden war. Ein früherer Pulverturm mit flachem Dach diente ihm für seine Beobachtungen.
Die Tafel im Kasino war in Hufeisenform gestellt. In der Mitte saßen der General, rechts und links von ihm der Regimentskommandeur und Rittmeister Kaulfuhs. Diesen saßen die Stabsoffiziere gegenüber; und dann folgten die andern.
Der General brachte nach guter alter Sitte den ersten Trinkspruch Seiner Majestät dem König. Dann beglückwünschte mit kurzen, dienstlichen Worten der Oberst den General. Damit war, nach dem Dank des Kommandanten, für heute, zu aller Freude, die Reihe der Reden zu Ende. Bald begann die Fröhlichkeit. Mit den aufgestellten brennenden Kerzen, mit den Zigarren kam eine lustige Bewegung an den Tisch.
Es war spät geworden, als der General endlich nach Hause zu gehen beschloß, und siehe da, er hatte sich einen kleinen Spitz getrunken; zum erstenmal in seinem langen Leben. Ja, zum erstenmal in seinem Leben. Denn von jeher hatte er, wie in allem, auf strenges Maß gehalten im Trinken.
Als er mit seiner Begleitung an die scharfe Luft kam, wuchs der kleine Spitz zu einem größeren, so daß er sich in den Arm des breitschultrigen Obersten hing. Links von ihm humpelte der Platzmajor, sich kräftig auf seinen dünnen eisernen Stock stützend.
Wie wohl, wie leicht, wie heiter, wie begeistert fühlte sich der General, als er durch die frische, sternenüberglitzerte Winternacht ging. Plötzlich blieb er stehen und wies mit der ausgestreckten Linken auf den gestirnten Himmel und sagte: »Der da, der rote Stern, das ist der Stern meines Lebens von Kindheit an gewesen. Ich erinnere mich genau, wie meine Mutter ihn mir zum erstenmal zeigte. Leider verliere ich ihn immer im Sommer. Seinen Namen kenne ich nicht. Daß es nicht der Mars ist, weiß ich. Sehen Sie ihn, meine Herren? Haben Sie ihn gefunden?«
Der Oberst legte die Hand an den Helm wie bei einer dienstlichen Frage und antwortete: »Sehr wohl, Herr General.«
»Aber wozu haben wir denn unsern Weltengucker bei uns? Lieber Kaulfuß, nun mal her mit Ihrer Gelehrsamkeit! Wie heißt der rote Stern?«
Der Rittmeister fing sofort an endlos zu erklären:
»Der Stern heißt der Aldebaran, mit dem Ton auf der vorletzten Silbe. Es ist ein arabisches Wort und heißt wahrscheinlich: der eindringlich Redende. Andre nennen ihn den Folgenden. Er ist für unsre Breiten kein Zirkumpolarstern, das heißt er bleibt nicht immer über unserm Horizont. Bezeichnet man mit p, wie üblich, die geographische Breite eines Ortes, so sind für diesen Ort alle diejenigen Sterne zirkumpolar, gehen nie unter, deren Deklination größer als 90° – p ist. Deklination nennt man die Abweichung vom Äquator, ist also an der Himmelskugel das Analogon zur geographischen Breite auf der Erde.«
Nach einer kleinen Verschnaufung fuhr der Rittmeister fort: »Der Aldebaran ist der größte Stern unter den Hyaden. Im Norden kann er in unsrer Gegend niemals stehen, wohl aber in der nördlichen Himmelshälfte, also kurze Zeit nach seinem Aufgang im Ostnordost und vor seinem Untergang im Westnordwest. Ob eine eigne Literatur über den Aldebaran besteht, weiß ich nicht. Von einer Monographie über ihn habe ich bisher noch nie etwas gelesen. Aber Beobachtungen über seine Eigenbewegungen, über Ermittelung seiner Parallaxe, über Farbe und Veränderlichkeit, endlich besonders über die spektralanalytischen Ergebnisse finden sich in großer Zahl zerstreut in der Fachliteratur.«
Der Platzmajor hatte beendet. Der sonst so nüchterne, auch jetzt von seinem Räuschchen wieder ernüchterte General schaute wie verklärt auf seinen Stern. Ja, er breitete sogar die Arme aus und rief: »Mein Stern, mein lieber Stern, du geheimnisvoller Begleiter meines Lebens!« Der Oberst sah finster vor sich hin; er fand im stillen das Gebahren des Generals und das »langweilige Geschwätze« des Rittmeisters lächerlich und unpassend, zum mindesten höchst »undienstlich«.
Vor der Kommandantur verabschiedete sich der General dankend von den beiden Herren. Dann stieg er die Stufen hinauf. Im ganzen Hause war es ruhig; alles lag im Schlafe. Aber oben öffnete sich eine Tür und Frau von Vorbrüggen empfing ihren Mann. Aufzusitzen und zu warten war sie bisher nicht gewohnt gewesen. Ängstlich fragte sie ihn, ob ihm etwas begegnet sei; sie habe schon ins Kasino schicken wollen. Statt aller Antwort küßte der General sie so ungestüm, daß sie »Fritz, aber Fritz« rief.
Er warf seinen Helm im Bogenwurf auf den Tisch, daß er auf der andern Seite hinunterkollerte.
Nun zog er die Generalin, riß sie förmlich ans Fenster, öffnete es mit kräftigem Ruck und schrie beinah, sie fest und fester an sich ziehend: »Siehst du unsern Stern da, Klärchen, unsern roten Stern, den wir immer im Sommer nicht finden können? Siehst du ihn? Er ist ja stets unser Glücksstern gewesen. Wie oft haben wir ihn begrüßt als unsern lieben Freund und Vertrauten. Und jetzt weiß ich auch, daß er Aldebaran heißt.«
Er schwieg einen Augenblick wie betroffen; beide schwiegen einen Augenblick: sie dachten an ihre verstorbenen, ihnen so jäh entrissenen Söhne.
Nun erzählte er weiter und weiter: wie glücklich sie als Mann und Frau gelebt hätten; daß sie sein guter Engel, sein Ein und Alles sei und bleiben werde.
Eng an einander gelehnt, standen die beiden herzensguten Menschen am offenen Fenster und feierten ihren schönen roten Stern.
###
In einer Septembernacht desselben Jahres wurde dem General ein Knabe geboren, zum Erstaunen der Welt, zum Gekicher der Leutnants, die, wie nun mal Gottseidank die lustigen Leutnants sind, allerlei Berechnungen anstellten; und fast zur Beschämung der alternden Eltern.
Maßlose Verwunderung, sogar Entsetzen brachte es hervor, daß der Junge tiefschwarze Augen hatte, daß er mit tiefschwarzen Härchen zur Welt gekommen war. Weder Vater, noch Mutter konnten sich keines einzigen Falles in ihren Familien erinnern, daß von blauen Augen und blonden Haaren abgewichen sei. Unerhört. Von einer Vererbung wußten diese treuen Menschen nichts, konnten es auch nicht wissen und ahnen. Von der sogenannten »Vererbungstheorie« hörte man erst in spätern Jahren: daß in der Reihenfolge eines Geschlechts plötzlich eine körperliche, eine seelische Eigenschaft und Ähnlichkeit wieder hervortritt, die viele Jahre, vielleicht Jahrhunderte geschlummert hat. Sonst hätten sie wohl erwogen, daß sich der »Glanzpunkt« des Vorbrüggenschen Hauses, der Troubadour Raimon devant le Pons wieder bei ihrem neugeborenen Söhnchen in Erscheinung gesetzt habe. Nach der Überlieferung soll dieser Raimon, »goldene Bänder in nachtschwarzem Haar«, um die Wette gesungen und besonders in der Kanzone geglänzt haben und in der Dansa und Balada mit Bernhard von Ventadour.
Aber noch etwas viel schrecklicheres hatte sich bei der Geburt ereignet. Doch dies hatte nur die Hebamme gesehen. Und diese treffliche Frau erzählte es bis an ihren seligen Tod unendlich oft Gevattern und Nicht-Gevattern: Das Fenster war bei der Niederkunft nicht verhangen gewesen. Die stürmische, regnerische Nacht hing mit Wolken und Dunkelheit vorm Himmel. Nur ab und zu war, wie in zerreißendem Schleier, ein Stern durchgeblitzt, um sofort wieder verdeckt zu werden. Als nun die Wehmutter das Knäblein zuerst in die Arme nahm, es hochhob, hatte es, o unnatürlicher Graus! die Augen durchs Fenster geschickt und die dünnen Ärmchen ausgebreitet nach dem rötlichen Stern, der, länger als die andern, für Minuten allein am Himmel stand. Dabei waren die Augen des Kindes so weit geworden, es hatte sie so sehr aufgerissen, daß sie wie Wahnsinnsaugen ausgesehen hätten. Ja wie Wahnsinnsaugen, erklärte die Hebamme immer wieder. Sie log hinzu, daß er dem roten Stern Kußhändchen gesandt habe. Und wo sie ganz sicher war, Glauben zu finden, erzählte sie noch: der Knabe hätte ganz laut und deutlich, wie ein erwachsener Mensch, gesagt: Weshalb ließet ihr mich von euch? Ich komme wieder.
Dann war das Kind wie alle Kinder: es trank, schlief, schrie, wurde getrocknet, wurde gebadet, trank, schlief, schrie. Und nach sechs, acht Wochen lächelte es zum erstenmal die Mutter an; wie alle Kinder das tun in dieser Zeit.
Bald sollte der Knabe getauft werden, er sollte die ehrlichen Namen Friedrich Wilhelm erhalten; wie sein Vater hieß. Aber Frau von Vorbrüggen hatte einen Plan gefaßt und diesen Plan in die Tat umgesetzt.
###
Es war erklärlich, daß die Ehegatten, ohne sich es gegenseitig zu gestehen, dieselben Gedanken hatten: Nun sind wir eben mit dem Leben so weit fertig geworden, daß wir mit Ruhe dem Grabe entgegensehen können, und jetzt fängt alles noch mal an durch den neu erschienenen kleinen Schreihals. Im innersten aber hatte der Vatter die Freude, daß sein Name nicht mit ihm, wenn auch nur in Deutschland, ausstürbe.
Die Eltern gestanden es sich, wie sie überhaupt einer vorm andern nie ein Geheimnis lange verbergen konnten. Eines Tages, bald nach der Geburt, sagte der General etwas trübselig zu seiner Frau: »Da haben wirs denn, nun müssen wir noch einmal von vorn anfangen, berechnen, wieder sparen, wo wir eben uns ein wenig erlauben durften. Es muß doch Geld zurückgelegt und auf Zinsen gegeben werden, daß der Junge was hat, wenn wir vor seinem Eintritt ins Leben sterben sollten. Wenn er ins Heer tritt, muß er Zulage haben. Nun, hat uns Gott und unser roter Stern bis hierher geholfen, er wird auch weiter helfen. Wir wollen auf ihn bauen, wie wirs immer getan haben.«
Der General küßte seiner Frau die Stirn und sagte ganz heiter: »Also wieder recht sparsam sein.«
Die Generalin errötete leicht und flüsterte: »Ja.« Sie hatte dabei einen ganz andern Gedanken. Den aber verriet sie ihrem Manne diesmal nicht.
Frau von Vorbrüggen war der entfernte Verwandte in Holstein eingefallen. Vorbrüggens hatten ihn nie gesehen, fast nie von ihm gehört; nur das wußten sie, daß er unendlich reich und daß er unverheiratet sei. Auch Enewold Vorbrüggen in Holstein hatte sich nie um seine Namensvettern in Preußen gekümmert. Seit über zwei Jahrhunderte waren die beiden Zweige des Geschlechts auseinandergekommen.
An diesen Vetter dachte Frau von Vorbrüggen. Einige Tage überlegte sie, dann schrieb sie einen langen, ausführlichen Brief nach Holstein. Sie erzählte darin treuherzig vom Familienzuwachs; und erzählte klar, wahr und klug, wie die Geldverhältnisse lagen. Schließlich bat sie den entfernten Vetter, Pate zu sein. Sie bat ihn, falls Enewold die Patenstelle annehmen wolle, ihrem Söhnchen seine Vornamen zu geben. Des Vetters Vornamen, das wußte sie nicht (sie kannte nur seinen Rufnamen Enewold), hießen Raimon, Devantlepons (in einem Wort), Enewold, Kai (Cajus).
Nach sechs Tagen kam die Antwort. Sie öffnete den Brief mit großer Bewegung. Zuerst konnte sie die Schrift nicht lesen, denn sie sah aus, als wenn viele Ulanenlanzen wüst durcheinander geworfen wären. Allmählich aber ordnete sie diesen Ulanenlanzenhaufen und entzifferte das Schreiben. Als sie mit dem Lesen geendet hatte, tropften ihr die Tränen, und nach ihrer frommen Weise faltete sie die Hände, legte die Stirn darauf und sagte laut, mit einfacher, inniger Stimme: »Das hast Du getan, mein Gott; ich danke Dir.«
Dann aber eilte sie zum General, umarmte ihn, und konnte nur immer schluchzen: »Lies, Lies!«
Der General konnte auch nicht gleich den Ulanenlanzenhaufen entwirren. Da las sie ihm den Brief vor:
Gnädigste Frau Cousine.
Ihre Zuschrift hat mir große Freude gemacht. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Vertrauen. Nun bitte, hören Sie meine Antwort:
Die Leute sagen, und es wird auch wohl so sein, daß ich reich sei.
Ich stehe ganz allein auf der Welt.
Mein Geld und meine Liegenschaften würden, falls ich nicht eheliche Nachkommenschaft bekäme, an Verwandte meiner verstorbenen Mutter fallen. Die aber sind selbst sehr reich und brauchen deshalb mein Geld und Gut nicht. Nur zwei alte Oheime aus der Familie meiner Mutter, die beiden Prinzen Swienkuhlen, die bei mir wohnen, sind arm. Weil sie mir zwei sehr liebe Menschen sind, habe ich ihnen in meinem Letzten Willen, den ich schon vor Jahren gerichtlich habe beglaubigen lassen, eine größere Summe ausgesetzt, die aber auch wieder nach ihrem Ableben an den Haupterben zurückfällt. Außer dem Pflichtteil für meine anderen Blutsverwandten und außer einigen Stiftungen für Wohltätigkeitszwecke und für meine Dienerschaft, vermache ich mein ganzes Vermögen, meine Schlösser und Güter und Stadthäuser Ihrem Sohne. Und zwar schon gerichtlich in diesen Tagen, sowie ich die beglaubigte Abschrift eines Taufzeugnisses in Händen habe. Meine etwaige Verheiratung würde allerdings diese Erbschaft ändern. Doch auch in diesem Falle bedenke ich Ihren Sohn mit einem ausreichenden Vermögen. Zwanzigtausend Species erlaube ich mir, mit warmer Hand, Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl, meinem lieben Vetter, schon in dieser Woche für Ihren Sohn zu senden. Nach Ihrem ausführlichen Bericht darf ich annehmen, daß Sie und Ihr Herr Gemahl diese kleine, mir aus innerstem Herzen kommende Schenkung nicht verweigern werden. Wie dies Geld angelegt wird, überlasse ich ganz den Eltern.
Sie haben den Wunsch ausgesprochen, mein Patenkind möge meine Vornamen haben. Ich bitte darum. Meine Vornamen sind Raimon, Devantlepons, Enewold, Kai. Gerne sähe ich es, wenn mein kleiner Vetter auf den Rufnamen Kai getauft würde, weil ich diesen Namen besonders liebe. Ich habe noch zwei Bitten, die ich aber unter keinen Umständen als Bedingungen gelten lassen möchte: Den Knaben das Gymnasium bis zur Abgangsprüfung besuchen zu lassen. Ferner würden mir die Eltern einen großen Gefallen tun, wenn ich ab und zu mein Patchen, vielleicht in den Schulferien, bei mir sehen dürfte. Doch darüber wollen wir uns nicht schon jetzt in Näheres einlassen: das wird sich mit der Zeit finden und verabreden lassen.
Wegen der Einzelheiten der Erbschaft usw. schreibe ich Ihnen bald, nachdem ich Ihre und Ihres Herrn Gemahls Einwilligung erhalten habe.
Es bleibt mir für mein liebes Patenkind zum Schluß nur das Wort, das so fröhlich und lebensfrisch klingt:
Vivat, floreat, crescat!
Ihr
treuergebener Vetter
Enewold Graf Vorbrüggen.
Zuerst wußte der General nicht recht, was er dazu sagen sollte. Ihm kamen einzelne Bedenken in sein strammes preußisches Ehrenherz. Vor allem mochte er die Namen Raimon Devantlepons Enewold Kai nicht. In seinem Hause hatten seit Jahrhunderten nur die alten guten deutschen Vornamen der brandenburgischen Kurfürsten, der preußischen Könige und Prinzen gewechselt: Friedrich, Wilhelm, August, Karl, Heinrich und wie sie sonst heißen mögen. Der Name Kai war ihm sehr zuwider. Aber seine Frau hatte nun mal an allem schuld. So ließ ers denn laufen, wie es gekommen war.
Auch ihn überwältigte eine große Rührung. Er küßte seine Frau und sagte immer wieder: »O du Kluge, du Kluge!«
Die Eltern redeten und beredeten noch bis in die späte Nacht hinein. Am andern Tage ging das Dank-und Annahmeschreiben, vom General verfaßt, nach Holstein ab. Sie hatten beschlossen, die zwanzigtausend Species dem Kleinen als ungeteilte Summe zu hinterlassen.
Kurz vor der Taufe kam es noch mal zu einem kurzen Briefwechsel zwischen dem General und dem holsteinischen Vetter. Der Kommandant bat: Raimon Devantlepons in Raimund verwandeln zu dürfen. Aber hier blieb Graf Enewold fest. Er erinnerte daran, daß seit langem alle Vorbrüggen in Dänemark und Holstein mit ihren Vornamen, wenn auch nicht stets als Rufname, Raimon Devantlepons geheißen hätten zum Gedächtnis an den berühmten Troubadour Raimon devant le Pons (Pont). Er zählte auch die Schlachten auf, wo sie, die alle mit Vornamen Raimon genannt waren, gekämpft hatten: Bei Akka und Buvines, bei Courtrai (wo sieben Devant le Pons gefallen seien und ihre goldnen Sporen verloren hätten), bei Crécy, Azincourt, bei Marignano und Pavia.
So blieb es denn dabei, daß der kleinste Vorbrüggen Raimon, Devantlepons, Enewold, Kai getauft werden sollte, mit dem Rufnamen Kai.
Doch kurz vor der heiligen Handlung trat noch ein kleines Hindernis ein. Grade in diesen Tagen gingen Gerüchte, daß die westlichen preußischen Armeekorps kriegsbereit gemacht werden sollten, wegen »drohender Wolken« in andern Ländern. Da schrieb denn der Vater ein letztes Mal an Enewold, ob er ihm nicht erlauben wolle, noch einen Vornamen hinzuzufügen, und zwar den Namen Kriegsbereit. Enewold lachte und hatte nichts dagegen einzuwenden. So waren denn endgültig des schwarzäugigen und schwarzhaarigen Säuglings Namen festgestellt: Raimon, Devantlepons, Enewold, Kai, Kriegsbereit. Damit hatte das alte, stolze, ehrenvolle Generalsherz doch noch einen kleinen Sieg erfochten.
Auch noch eine andre Schrulle hatte sich der General ersonnen: Er hatte mit Bestimmtheit befohlen, daß sein Sohn in einer Kasemattenluke getauft werden solle. Sein Gedankengang bis zu dieser Absonderlichkeit mochte dadurch seinen Weg genommen haben, daß er sich vorstellte, sein Sohn werde dann besser an sein Vaterland Preußen, an die Armee gebunden bleiben, für den Fall, daß er später ins Ausland ginge. Das »Ausland« nannte er Dänemark und Schleswig-Holstein. Es würde ihm später immer erzählt werden, daß er in einer königlich preußischen Kasemattenluke auf einem königlich preußischen Geschütz getauft worden sei; und das würde ihm eine ewige Verbindung mit seinem alten Vater- und Geburtslande Preußen sein. Kurz und gut, die Taufe sollte in einer Kasemattenluke vollzogen werden.
Zu diesem Zwecke wurde ein großes niedriges Gewölbe in einer bombensichern Schanze bestimmt. Ein uraltes Riesengeschütz, das schon die Zeiten der ersten preußischen Könige erlebt haben mochte, wurde ausersehen. Um sein Zündloch stand der Spruch: »Du leckest dir nit das Maul mehr, wenn ich dich geküßt habe«. Das Ungetüm wurde aus der Luke etwas zurückgezogen.
Dann war die heilige Handlung. Der General setzte, wörtlich zu nehmen, sein Söhnchen auf die Mündung, die Windeln und das Kleidchen festhaltend. Ein anwesender Leutnant flüsterte seinem Nachbarn den schon damals bekannten Vers zu: »Wenn der Vater mit dem Sohne auf dem Zündloch der Kanone ...«
Der Garnisonpfarrer taufte den Säugling: Raimon, Devantlepons, Enewold, Kai, Kriegsbereit, mit dem Rufnamen Kai.
Die ersten Kinderjahre
Kai Vorbrüggen, der Säugling, hatte das erste Jahr hinter sich, das Mörderjahr, wie es wegen der großen Kindersterblichkeit genannt wird. Es hatte ihm nichts gefehlt. Er schrie, trank, schlief, wurde getrocknet, wurde gebadet, wie alle andern. Das Schreien ist ja die einzige Waffe, die den Würmchen zu Gebot steht. Das sollten wir ein wenig bedenken. Zuweilen runzelte er die Stirn, runzelte sie, daß sie aussah wie die Rinde von jungen Eichbäumen. Dann dachte der kleine Kerl wohl darüber nach, wie schön es wohl früher gewesen war, als er noch auf dem Aldebaran gewohnt hatte. Aber alle Kinderchen in dem Alter machen die krausen Stirnen.
Nur seine ebenholzschwarzen Augen: die waren das einzig außergewöhnliche, das er vor allen voraus hatte. Hatte ihn wer noch nicht gesehen, und plötzlich zeigte ihn die Mutter oder die Amme, so erschrak der, dem er zu Gesicht kam, bebte womöglich ein paar Schritte zurück. Der General, mit seinem ehrlichen preußischen Friedrich-Wilhelm-Gesicht, konnte sich garnicht recht darein finden. Auch er erschrak fast immer wieder, wenn er die Augen seines Sohnes sah; es war ihm unheimlich, es war ihm gradezu unpatriotisch, wie einer solche rabenschwarzen Augen haben konnte im preußischen Vaterlande. Er konnte auch deshalb eine leichte Abneigung gegen seinen Jungen nicht überwinden, so sehr er sich auch dagegen sträubte. Die Amme und andere Frauen, die ihn sahen, redeten noch immer das greulichste Geschwätz. Der rote Stern spielte die Hauptrolle darin. Diese seine tiefschwarzen Augen haben ihm immer, bis an seinen Tod, allerlei »Umstände« gebracht. Auch in seinen spätern Jahren, bis ins Alter hinein, überraschte er die Menschen, die ihn erstmals sahen, namentlich wenn er sich schnell umdrehte, dermaßen, daß sie zuerst ganz verblüfft zurückprallten. Das gab oft zu ergötzlichen Lagen Veranlassung; zuweilen auch störte es ihn gradezu. Bei den Weibern aber haben später diese Augen viel Verwirrung angestiftet.
In seinem zweiten Lebensjahr trat eine merkwürdige Veränderung in der Farbe seines Körperchens ein. In drei, vier Tagen wurde aus der weißen Haut eine elfenbeinfarbene Haut, so wie Elfenbein aussieht, das lange gelegen oder gestanden hat, ohne der Sonne ausgesetzt gewesen zu sein. Der Hausarzt und die hinzugezogenen andern Ärzte wußten keine Erklärung. Jeder dachte an eine Leber- oder Milzkrankheit, die sie wohl kaum in so zartem Alter je beobachtet hatten. Aber es tat dem Kaichen nichts. Er blieb ebenso gesund wie im ersten Jahr. Nach wenigen Monaten verschwand diese Elfenbeinfarbe wieder, und das weiße, europäische Körperchen war von neuem da. Während seiner »gelben Periode« aber hatte die Farbe jenen Mischrassen geähnelt, wie sie in Nordafrika zu finden sind.
Vater und Mutter, die ganz ratlos gewesen waren, fanden sich wieder zurecht und dankten Gott, daß alles wie früher geworden war.
Die Amme und die Bonne Kais waren in Lothringen geboren und sprachen nur französisch. Auch sein erster Lehrer, Herr Ney, sprach nur französisch. Herr Ney behauptete, daß er verwandt sei mit der Familie des berühmten Marschalls Ney, der in Saarlouis geboren war, in der Nähe der Festung, wo er jetzt den kleinen Kai unterrichtete. So kam es, daß Kai französisch und deutsch gleichmäßig lernte. Beide Sprachen sind ihm gleich geläufig geblieben bis an sein Grab.
Den ersten Menschen, den Kai kennen lernte, außer seinen Eltern und der Dienerschaft, war der alte Wallmeister Heinrich Steffens aus Treuenbrietzen. Der kam täglich zum General mit allerlei Meldungen und Berichten. Auch Heinrich Steffens trat ganz verwirrt zurück, als ihm der kleine Kai zum erstenmal entgegensprang.
Der alte Wallmeister war gleichalterig mit dem General, hatte wie er die Befreiungskriege mit gefochten und landete endlich als tüchtiger, umsichtiger, brauchbarer Soldat in der kleinen Festung als Wallmeister, wo man ihn wegen seiner Pflichttreue und Kenntnis bis heute gelassen hatte. Der General hielt große Stücke auf ihn und konnte eigentlich ohne ihn kaum fertig werden. Dazu kam, daß sie sich beide als Veteranen immer wieder erzählen mußten von der großen Zeit, die sie gemeinschaftlich mit Gott für König und Vaterland gestritten hatten.
Zuerst lief Kai weg, wenn er den etwas brummigen Wallmeister erblickte. Der General und der Wallmeister trugen dieselben Bärte, Bindfadenbärte genannt, weil der Backenbart nur bis zu einer Linie zwischen Lippe und dem untersten Ohrpunkt getragen werden durfte. Diese Linie »richtete« man tatsächlich »aus« mit einem Bindfaden. Der General hatte freundliche Augen, während der Wallmeister starke buschige Brauen über seinen strengen Augen zusammenzog, trotz seiner unendlichen Seelengüte.
Doch bald schloß Kai mit dem alten Herrn Freundschaft. Nun blieben sie auch die besten Freunde. Kai konnte die Minute kaum erwarten, wenn Heinrich Steffens in die Tür trat. Dann lief der Junge ihm entgegen, und der grauhaarige, griesgrämig dreinschauende Soldat nahm ihn in seine Arme. Eine immer größere Liebe wuchs zwischen den beiden. Der Alte nahm das Söhnchen seines Generals oft mit auf seine Gänge in den stillen Wällen und Festungsgräben. Da Steffens ein großer Vogelfreund und Naturliebhaber war, so konnte er seinem Begleiter allerlei erklären in Baum und Strauch, in den leeren oder wasservollen Gräben, und nicht zuletzt in den zweihundertjährigen, versteckten, einsamen Festungsgärten; besonders im großen Garten der Kommandantur. Dieser geheimnisvolle, wie verzauberte Garten schloß sich dem sich gut entwickelnden, bald fünfjährigen Knaben auf wie ein Paradies.
Inzwischen war das Jahr achtundvierzig mit seinen Erschütterungen vorübergebraust. Zweimal waren in diesem Jahre Befehle von Berlin wegen der Ausrüstung des Platzes und wegen ähnlicher Kriegs- und Belagerungsvorbereitungen gekommen. Denn es schien nicht unwahrscheinlich, daß die kleine Festung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte durch die inneren oder äußeren Wirren, lag sie auch noch so abseits von der Welt. Vielleicht hätten andere, leicht erregte Kommandanten die Befehle so aufgefaßt, daß sie das Fällen der Bäume in den Werken und außerhalb der Werke sofort angeordnet hätten. General von Vorbrüggen ließ aber eines Tages sämtliche Bürger zusammenkommen und eröffnete ihnen, daß er das Abholzen nur im letzten Augenblick befehlen wolle, wenn sich die männlichen Einwohner dazu entschließen könnten: dies, wenn die äußerste Gefahr heranrücke, binnen sechs Stunden selbst zu tun. Der Vorschlag wurde mit Jubel aufgenommen. Für jeden Baum stellten sich die und die und die Männer zur Verfügung. Alle hielten ihre Äxte bereit. Dreimal wurde die Sache blind durchgemacht. Weil aber die äußerste Gefahr nicht eintrat, wurden die Gärten und Bäume gerettet.
Später setzte die Bürgerschaft dafür ihrem damaligen Kommandanten, lange nach seinem Tode, ein Denkmal. Ein reicher Bäckermeister gab hierzu nicht nur das meiste Geld, sondern schuf dies Denkmal mit eigner Hand. Er hatte sich von jeher als Bildhauer gefühlt. Leider mißlang es und steht jetzt in den Anlagen zum Gespött und Gelächter. Denn es sieht mehr einem Riesenfrosch, der auf einem breiten Nachtstuhl sitzt, ähnlich, als dem verstorbenen General von Vorbrüggen. Einerlei, dies »Denkmal« blieb als ein Zeichen des Dankes und der Liebe für den Kommandanten in unruhiger Zeit.
###
Kai, nun fünfjährig, wuchs prächtig und »normal« heran. Von Krankheiten wurde er nicht geplagt. Nur die Bräune, wie man damals die Diphterie nannte, mußte er mehrfach überstehen. Einmal schien es mit ihm zu Ende gehen zu wollen. Aber als er schon die Augen verdrehte, gab ihm der gute Doctor eine solche Ohrfeige, daß er mordsmäßig zu schreien anfing. Der Hals war frei.
Glückselige Kinderzeit! Wie die unschuldigen Augen uns ansehen. Nichts noch wissen sie von den Greueln und den furchtbaren Gefahren des Lebens. Glückselige Kinderzeit!
Kai nutzte sie, wie die andern Kleinen, gründlich aus. Seine Eltern waren vernünftig genug, ihn, soweit ihnen dies erzieherisch erlaubt schien, gewähren zu lassen. Er spielte mit allen Kindern des Städtchens, ohne daß die Eltern Rücksicht auf Stand und Bildung nahmen: Räuber und Soldat, Peitschenknallen und Reifentreiben, Marmelwerfen und »Schießgewehr«, und wie all der fröhliche Zeitvertreib heißt. Besonders aber hatte er sich dem süßen Töchterchen eines wohlhabenden Nachbars angeschlossen: Er und Mine Meinssen blieben unzertrennlich, als wollten sie niemals voneinander lassen, wenn sie auch, nach Art jener ersten Freundschaften, zuweilen in einen tüchtigen Wortwechsel gerieten. Aber bald ging alles wieder im vorigen Geleise. Sie rutschten, ein Hauptvergnügen, die Treppengeländer hinunter; nur durfte das keiner sehen, sonst gabs arge Schelte. Sie öffneten, was streng verboten war, die Einfriedigungen für Enten und Hühner und liefen dann mit bösem Gewissen davon. Sie fuhren Sand und ihre Puppen in ihren Wägelchen und gruben tiefe Löcher, meistens an Stellen, wo es nicht grade angebracht war. Dann wieder besahen sie Bilderbücher und versuchten sie mit großer Emsigkeit zu zerreißen. Oder sie richteten sich einen Laden ein und verkauften ihre Waren. Oder sie versteckten sich auf dem Boden der Kommandantur, eines großen schönen Empirehauses. Und was dergleichen unbewölkter Unfug mehr ist. Von überall her hörte man ihr Lachen und Lärmen, ihren Übermut. Und wenns auch mal dem General zu viel wurde, dann dachte er schnell an seine eigne frohe Kindheit, und ließ sie weiter toben und tollen.
Ein großes Vergnügen für Kai war es, auf dem Hausgerät herum zu klettern. Dann schalten und warnten die Eltern: »Du brichst dir noch die Beine.« Dadurch aber wurde er noch mehr ermuntert, stieg einmal auf einen großen Schrank und schrie: »Nu brech ich mich die Beine, nu brech ich mich die Beine!«
Immer blieb der alte Wallmeister Heinrich Steffens der Hauptfreund Kais. Als er sechs Jahre zählte, lehrte ihn der Wallmeister Schwimmen auf der Militärschwimmanstalt. Es war ein Vergnügen für den General, als er bemerkte, mit welchem Mut Kai ins Wasser ging. Es dauerte auch nicht lange, da konnte er schwimmen, tauchen, auf dem Rücken liegen, allerlei Kunststücke im Wasser machen: wahrlich, ein kleiner Hydriot.
Im nächsten Winter lernte er beim Wallmeister Schlittschuhlaufen. Auch hier zeigte er großen Wagemut. So oft er auch fiel, und wenn er auch (wie es einmal geschah) einen Stern ins Eis schlug mit dem Hinterkopf, gleich war er wieder oben und lief weiter. Da dieser Winter lang andauerte mit seinem harten Frost, so lernte er auch noch das Holländern. Alle Menschen sahen dem gewandten, kühnen Jungen mit heller Freude zu, wie er vor ihnen seine schlanken, zierlichen Bewegungen ausführte, mit einer Anmut, die man kaum bei einem sechs, siebenjährigen Knaben erwarten konnte.
Mit sechs Jahren wurde er schulpflichtig. Die Eltern taten ihn in die Klippschule des Städtchens. Hier saß er mit den Söhnen und Töchtern der Offiziere und Bürger zusammen. Dieser Schule stand Herr Ney vor, der Verwandte des berühmten Marschalls. Sonderbar, daß die Regierung diesen Herrn Ney als Vorsteher in seiner Schule ließ: eben, weil er kaum ein Wort deutsch sprechen konnte. Doch die Bewohner hatten den Minister gebeten, ihn in seiner Stellung zu belassen, weil er ein tüchtiger Lehrer und zugleich ein wahrer Vaterlandsfreund sei. Hauptsächlich war es ihnen wohl darauf angekommen, daß ihre Kinder auf diese Weise gleichsam spielend französisch lernten. Waren doch auch die andern Lehrer und Lehrerinnen durchaus deutsch gebildet, konnten kaum französisch radebrechen, obgleich noch viel französisch in der Bevölkerung dieses Land- und Grenzstriches gesprochen wurde.
Der Minister hatte den Bitten der Bürger, die auch der Kommandant unterstützte, gewillfahrt.
Merkwürdig genug. Wohl die einzige Schule im preußischen Staate, deren Vorsteher und erster Lehrer nur soviel deutsch wußte, daß er sich einigermaßen verständigen konnte.
Kai mußte schon nach vier Wochen aus der Schule genommen werden, weil sein Gehirnchen noch nicht reif genug war, um folgen zu können. Er wurde auf ein ganzes Jahr zurückgestellt. Seine körperlichen Kräfte waren den geistigen vorausgeeilt. Den Eltern war es recht; Kai konnte sich noch ein ganzes Jahr austoben nach Herzenslust.
Nun schloß sich Kai noch einmal ganz seinem Freunde Steffens an. Der alte, einsame, unverehelichte Wallmeister, der keine Verwandten besaß, umfing ihn mit aller Liebe, deren er fähig war.
Doch da ereignete sich etwas, was schon seit einiger Zeit erwartet worden war: Der General bekam den Blauen Brief. Mit einem Handschreiben seines Königs, mit dem Generalleutnant und mit dem Stern zum Roten Adler-Orden zweiter Klasse. Nun war er Exzellenz.