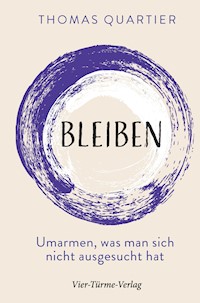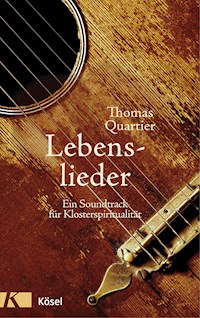
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
„Gleichgewicht zwischen Herz und Stimme“
Musik und Spiritualität gehören zusammen wie Körper und Seele. Beide bringen den Leser näher zum Kern des Lebens, zu Gefühlen und Bildern. Das Urbild des Mönchtums ist auch ein solcher Klangraum und dem künstlerischen Schaffen vielleicht verwandter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. In früheren Epochen war es Gang und Gäbe, dass Mönche und Nonnen kulturell Wertvolles im Dialog mit der Welt hervorbrachten. Warum sollte das heute nicht mehr so sein? Thomas Quartier will über seine Gottessuche im Kloster berichten, nachdem er vorher jahrelang als Straßenmusiker sein Geld verdiente und dort den Sinn des Lebens sah. Dies möchte er nicht als spirituellen Ratgeber, sondern als eine Art Experiment, den Soundtrack der Gottessuche in seiner spezifischen Lebensform aufzuspüren: die Psalmen, die Regel Benedikts und Texte und Persönlichkeiten seiner Jugend. Aus der Keimzelle seines Klosters versucht er, eine radikale Lebensform zu erkunden, die die Welt verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Musik und Spiritualität gehören zusammen wie Körper und Seele. Das Urbild des Mönchtums ist auch ein solcher Klangraum und dem künstlerischen Schaffen vielleicht verwandter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. In früheren Epochen war es Gang und Gäbe, dass Mönche und Nonnen kulturell Wertvolles im Dialog mit der Welt hervorbrachten. Warum sollte das heute nicht mehr so sein? Thomas Quartier will über seine Gottessuche im Kloster berichten, nachdem er sich vorher als Straßenmusiker etwas hinzuverdiente und dort den Sinn des Lebens sah.
Dies möchte er nicht als spirituellen Ratgeber, sondern als eine Art Experiment, den Soundtrack der Gottessuche in seiner spezifischen Lebensform aufzuspüren: die Psalmen, die Regel Benedikts und Texte und Persönlichkeiten seiner Jugend. Aus der Keimzelle seines Klosters versucht er, eine radikale Lebensform zu erkunden, die die Welt verändert.
Thomas Quartier osb, geboren 1972, ist Benediktinermönch der Abtei St. Willibrord in Doetinchem (NL). Er doziert Monastische Studien an der Katholischen Universität Leuven (BE) und Liturgie- und Ritualwissenschaft an der Radboud Universität Nijmegen (NL). Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Titus Brandsma Instituts in Nijmegen und Gastprofessor an der Benedik-tinischen Universität Sant Anselmo in Rom.
Thomas Quartier osb
Lebens-
lieder
Ein Soundtrack
für Klosterspiritualität
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Weiss Werkstatt, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-25030-0V001
Für Robert,
Gefährte der
Lieder und Wege
Inhalt
Intro: »Mit Harfe und Leier«
Idole: »Ich bin der Herr, euer Gott«
Lieder: »Griffel des flinken Schreibers«
Performance: »Der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden«
Kämpfer: »Alle suchen dich«
Ewigkeit: »Abraham und seinen Nachkommen auf ewig«
Himmel: »Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen«
Identität: »Das alles ist Windhauch«
Realität: »Die Liebe ist langmütig«
Coverversionen: »Neuer Wein in alte Schläuche«
Anmerkungen
Intro: »Mit Harfe und Leier«
Das Buch der Psalmen, Liederbuch der Bibel, endet mit einer beeindruckenden Liste von Musikinstrumenten, mit denen man Gottes Lob singen kann. Der Mensch legt sein gesamtes musikalisches Gefühl und Können in jenes eine Lied, das er für Gott singt, das zu seinem Lebenslied wird. Mich fasziniert am Mönchtum vor allem, dass der Klang jenes Lebensliedes alles durchdringt. Mönche singen in allen Lebenslagen mit allen Registern ihrer Person für Gott. Sie nehmen den Aufruf des Psalmisten wörtlich:
Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns,
lobt ihn mit Harfe und Leier!
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte!
Lobt ihn mit tönenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln! (Ps 150,2-5).
An den Liedern meiner Kindheit war von dieser Art von Mönch in mir noch nichts zu merken. Oder doch? Jedenfalls war ich mir dessen nicht bewusst. Das erste Musikinstrument, das ich spielte, war die allseits bekannte, handelsübliche Mundharmonika. Sie kommt nicht in der Auflistung im Psalm vor und ist auch nicht gerade das, was man später im Kloster erwarten würde. Auch wenn man das Lob Gottes in allen Tönen singen kann, so kann ich beim besten Willen nicht sagen, meine kindlichen Bemühungen als solches erfahren zu haben.
Schon früh bekam ich eine Spielzeugharmonika von meiner Großmutter geschenkt. Ich spielte bekannte Kinderlieder, mehr schlecht als recht. Aber immer mit großer Leidenschaft und Inbrunst, wie meine Mutter mir glaubhaft versichert. Auch wenn ihr der Geräuschpegel sicher manchmal auf die Nerven gegangen ist, was sie heute nicht mehr zugeben will. Später wurde die Mundharmonika für mich zum Melodieträger meiner musikalischen Pubertät. Ich spielte sie auf einem Ständer um meinen Nacken, dazu Westerngitarre. Dazwischen sang ich alle möglichen Lieder: Protestsongs, Arbeiterlieder, Volkslieder.
Allesamt waren sie Versuche, meinem Verlangen nach einer besseren Welt, einem sinnvollen Leben und ein klein wenig Erfüllung Ausdruck zu verleihen. Genauer wusste ich zu jener Zeit noch nicht, wonach es mich eigentlich verlangte. Es war noch nicht mehr als ein Vorspiel. Aber der Klang meiner Mundharmonika wurde im Laufe der Jahre immer leidenschaftlicher. Die geselligen Kinderweisen spielte ich schon lange nicht mehr. Der Blues weckte in mir Sehnsucht, keine Gemütlichkeit. Meine Lieder erwachten zum Leben.
Bluesharp
In dieser Phase hat das Spiel auf dem Blasinstrument eine wichtige musikalische Vorliebe in mir hervorgerufen: Ich begeisterte mich für Singersongwriter und alles, was in den Bereichen Pop und Rock irgendwie damit zusammenhing. Ich bewunderte Liedermacher im In- und Ausland, die den wehmütigen und zugleich verheißungsvollen Klang der Mundharmonika in ihr Werk integrierten. Um mich dabei von jeglicher Volkstümelei abzusetzen, sprach ich inzwischen von einer »Bluesharp«. Das klang doch schon viel mehr nach großer weiter Welt, nach Fernweh, Freiheit und Kreativität. Ich war Autodidakt und verbrachte Stunden blasend und saugend auf meinem Zimmer, krampfhaft ein »Bending« versuchend. Für die Nicht-Kenner: es handelt sich dabei um eine Technik, wie man einen Ton »biegen« kann, das heißt bluesig ein wenig höher oder tiefer spielt. Das gab dem Ganzen einen gewissen Touch, den unverwechselbaren Klang, wie man ihn von Cowboys und Landstreichern kannte.
Der Singersongwriter-Sound, den ich in jener Zeit hörte, war spontan und »basic«. Es ging weniger um filigrane Harmoniegefüge, als vielmehr um die Idee, die Story, das Gefühl. In einem Buch zum Erlernen des Blues las ich: »Früher oder später wirst du an einen Punkt kommen, an dem du zwar improvisiert spielen kannst, dir aber eine gewisse persönliche Note in deinem Spiel fehlt. Diese stellt sich dann ein, wenn manchmal etwas Unerwartetes passiert, und vor allem, wenn man für einen kurzen Moment von der Bluesskala abweicht«.1 Es ist kein Zufall, dass mich die Mundharmonika schon früh auf diesen musikalischen Weg geführt hat, denn er entspricht meiner musikalischen und auch persönlichen Neigung: ich improvisiere für mein Leben gern, in allen Lebenslagen.
Das heißt nicht, dass ich nicht auch etwas gelernt hätte. Man kann nur von der Bluesskala abweichen, wenn man sie zuvor beherrscht, und das ist am Anfang gar nicht so einfach. Momente der Freiheit setzen Struktur voraus, nicht nur im Blues. So bin ich heute froh, dass ich am Klavier eine Art musikalische Grundausbildung erhalten habe, auch wenn mein Klavierunterricht mich langweilte. Die Etüden von Carl Czerny kamen mir öde und sinnlos vor. Lieber spielte ich auch an den Tasten nach Gehör, und zwar ganz unterschiedliche Weisen. Das gefiel meinem Klavierlehrer, dem braven Organisten meiner Heimatpfarrei und einem herzensguten Mann, gar nicht. Er sagte mir, die Etüden seien wichtiger, ebenso wie die endlosen Tonleitern, hoch, runter und dann gegeneinander. Mir leuchtete das zwar irgendwie ein, und ich tat, was nötig war, um die wöchentliche Klavierstunde so unbeschadet wie möglich zu überstehen. Denn ich wollte nichts lieber als Klavierspielen. Doch kaum war er nach einem Gläschen mit meinem Vater wieder weg, spielte ich, was mir in den Sinn kam und auf der Seele brannte: Blues in C.
Ich war wohl eher der Träumer als der penible Techniker. Ich schnappte mir meine Bluesharp, kombinierte sie mit dem Klavier und meiner Westerngitarre, und träumte von einer besseren Welt. Meistens war es recht flach, was ich so spielte. Es stellte sich nichts Unerwartetes ein, wie man es sich bei einer echten Improvisation erhoffte. Dafür fehlte mir noch das Gespür und die Gelassenheit. Vieles von meiner persönlichen Note in jener Zeit war mehr gewollt als gekonnt. Aber ich habe es mit Begeisterung gemacht, fühlte mich individuell und extravagant.
Gregorianik
Von einem Mönch würde man eigentlich eher das Gegenteil erwarten, nämlich dass er sich mit Disziplin und Genauigkeit in das Repertoire des Mönchschors fügt. Eine musikalische Mönchsarbeit kommt an Etüden und Tonleitern nicht vorbei. Der Musikant sollte eigentlich ganz und gar darin aufgehen, keinesfalls auf unerwartete Momente spekulieren. Wenn man als Einzelner im Chor eines Klosters herauszuhören ist, ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Es geht um den Chor, nicht um die persönliche Stimme oder Stimmung. Musikalisch schien ich im Kloster also im völlig falschen Film gelandet zu sein.
Auch wenn vielleicht langgezogene Mundharmonikasoli das Vorspiel in meiner Kindheit und Jugend bildeten, so musste doch etwas anderes an ihre Stelle treten, was meinem musikalischen und vor allem spirituellen Verlangen mehr Struktur gab. Die Bluesskala schien mir völlig ungeeignet, denn schon der Klang »gebogener« Töne erweckte eine Sehnsucht in mir, die ich nicht mit ins Kloster nehmen wollte. Schon in den Jahren vor meinem Eintritt in unsere Abtei ließ ich die Bluesharp darum im Etui verstauben. Ich spielte sie nicht mehr und hörte auch nicht mehr die Folk-Platten jener Helden meiner Jugend, die sie so meisterlich einzusetzen vermochten. Ich fand, dass ich nur noch jene Gesänge hören durfte, die für mich der Ausdruck des Mönchtums par excellence waren: Gregorianische Choräle, jenes geheimnisvolle Repertoire, dessen erste handschriftliche Bezeugungen auf das zehnte und elfte Jahrhundert zurückgehen.
Ich tat mein Bestes, die verschiedenen Modi – für Nicht-Kenner: eine Art Kirchentonarten – zu lernen und mich mit der Quadratnotation vertraut zu machen, in der die Melodien festgehalten waren. Nicht dass ich ein Meister darin geworden wäre. Aber langsam entwickelte ich einen Blick für das ungewohnte Notenbild und ein Gespür für die zunächst eigentümlich klingenden Wendungen. Das Fremde wurde mir langsam vertraut, aber es blieb mysteriös. Es klang spirituell, bis ich irgendwann merkte, dass auch die Gregorianik nicht vollständig in Skalen einzufangen war. Im Gegenteil, eigentlich ging es darum, dass historische und spirituelle Praxis zusammengehören.
Dafür braucht man eine eigene Stimme, nicht einfach nur ein mathematisches Wissen und handwerkliches Geschick. Der Gregorianik-Experte Stefan Klöckner beschreibt die Bewegung, die man machen muss, um wirklich singen zu können, folgendermaßen: »In der Verinnerlichung der Gesänge liegen sowohl die Wurzel ihres Entstehens als auch die Verdichtung ihrer spirituellen Tiefe begründet. Alle Debatten um ›alt‹ und ›modern‹, um ›traditionell‹ und ›aktuell‹ werden vor dem Hintergrund dieses Ansatzes obsolet«.2
Es ist also ein Trugschluss, dass Musik darum schon monastisch wäre, weil sie alt ist. Auch neue Musik kann sehr spirituell sein. Wichtig ist, dass man verinnerlicht, was der Klang und der Text, der gesungen oder musikalisch umgesetzt wird, gemeinsam bedeuten. Dann wird die Grenze von Zeit und Ewigkeit überschritten. Die Freiheit, die man durch die spirituellen Klänge erlangt, kommt nicht durch eine bestimmte Melodie zustande, sondern erst durch den Klang im eigenen Innern.
Erst nach und nach lernte ich, dass die ursprüngliche Art, Gregorianik zu notieren, gar nicht Noten waren, sondern die sogenannten »Neumen«: Zeichen, die angeben, mit welcher Dynamik man eine bekannte Melodie singen sollte. Anscheinend war die Praxis des Singens der Ausgangspunkt, nicht die Skala. Eine Praxis, die scheinbar schon seit tausend Jahren das Innere der Menschen berührte. Ob es im Mittelalter wohl »unerwartete Momente der Improvisation« und »eine persönliche Note« gegeben hatte? Ich war mir sicher: Die Register, mit denen man Gottes Lob singt, sind wertlos, wenn man nicht die richtigen, die eigenen zieht!
Resonanz
Als ich ins Kloster eintrat, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass in der Musik etwas von meiner Gottessuche resonieren könnte. Der Klang der Mönche zog mich magisch an, und das machte mich zum fanatischen Schüler des geistlichen Gesangs. Ich tat nichts anderes mehr als Bücher über Choral zu verschlingen und CDs zu hören. Es war, so glaubte ich, ein Weg der Verinnerlichung, denn der klösterliche Gesang richtet sich auf eigentümliche Weise nach innen.
Man merkt es in jedem Gottesdienst: wo man normalerweise gewöhnt ist, jede Zeile eines Liedes bis zum Ende aus voller Brust auszusingen, wird das beim Psalmensingen schnell negativ auffallen. Man endet einen Vers mit einem Decrescendo (wird also leiser), und eben nicht mit einem vollen Ton. Damit lenkt man den Strom des Textes und der Melodie quasi Zeile für Zeile nach innen. Das ist ungewohnt und erfordert am Anfang Übung. Oft merkt man selber nämlich gar nicht, wenn man doch viel zu laut singt. Aber auch »Widderhorn und tönen Zimbeln« dürfen den eigentlichen Lobgesang nicht übertönen.
Der Mönch, der einen darauf hinweist, dass man sich ein wenig zurücknehmen müsse, trifft einen wunden Punkt. Denn er sagt damit eigentlich, dass man seinen inneren Resonanzraum noch nicht betreten hat, und das hört niemand gerne, auch wenn es stimmt. Übung macht eben den Meister. Noch wichtiger als die richtige Gesangstechnik und das Wissen über die musikalischen Hintergründe ist jedoch die Frage, was eine spirituelle Resonanz eigentlich ist. Denn langsam aber sicher kann man auch zum musikalischen »Fachidioten« werden, der überhaupt nicht mehr nach innen, sondern nur noch auf die Technik gerichtet ist. Mir ging es zum Beispiel beim Studium meines »Graduale Novum« so, der zu jener Zeit neuen Notenausgabe, in der die Gesänge anhand von Handschriften noch näher als in den bisher bekannten Versionen an das historische Original herankamen. Faszinierend und sehr wichtig. Aber ich fixierte mich zu sehr auf die »Semiotik«, die Wissenschaft, die alten Handschriften zu interpretieren.
Der Begriff »Resonanz« des Soziologen Hartmut Rosa hat mir dabei geholfen, Musik wieder als probates Mittel für die Verinnerlichung und damit für das Gotteslob zu verstehen, nicht nur als Technik. Er schreibt: »Nichts anderes scheint eine vergleichbare psychisch wirksame Qualität zur alltäglichen Vermittlung und Heilung subjektiver Weltverhältnisse zu besitzen. Musik scheint so etwas wie das universelle Bindemittel für das spätmoderne Weltverhältnis geworden zu sein.« Wie ich mich zur Welt verhalte, bestimmt also, ob ich offen für Spiritualität bin oder eben nicht. Musik kann mir helfen, mich zu öffnen, aber nur wenn ich ihr offen begegne. Das geht sogar so weit, dass meine Musik mitbestimmt, wer ich bin: »Kein anderes Medium hat eine auch nur annähernd so hohe Bedeutung für die Herausbildung und Stabilisierung von (spät)modernen Identitäten.«3
Als Mönch musste ich mir also tatsächlich Gedanken darüber machen, welche Musik zu meiner Lebensform passt und welche nicht, also auch welches Register ich ziehen und welches Instrument ich spielen konnte. Die Gesänge, die ich hörte, studierte, einübte und sang, waren Resonanzen meines Daseins. Die Bluesharp war es nicht, so dachte ich zumindest. Es ging nun mal nicht alles, schon gar nicht, wenn ich spirituelle Erfahrungen in der Musik suchte. In der Resonanztheorie kann die Wirklichkeit nämlich auch tatsächlich »antworten«, wenn man sich richtig zu ihr verhält. Rosa benutzt dafür das Wort Gott: »Religion kann dann verstanden werden als die in Liedern und Erzählungen erfahrbar gemachte Idee, dass Gott im Grunde die Vorstellung einer antwortenden Welt ist.«4
Bloß nicht vom Weg des Mönchsgesangs abbringen lassen, dachte ich mir. Er schien mir quasi wissenschaftlich legitimiert. Weg mit dem Lärm! Nur leider spricht Rosa in diesem Zitat über Popmusik und nicht über Gregorianik, die er ansonsten durchaus häufig zitiert. Und ob »Trommel und Reigentanz« im Psalm wohl so geräuscharm waren? Wie so oft beißt die Katze sich selber in den spirituellen Schwanz: man meint, den richtigen Klang gefunden zu haben, und je mehr man davon überzeugt ist, umso weniger passt er.
Aber im Ernst, eine spirituelle Resonanz durch Pop? Sicher ist nicht alles, was in den Hitparaden ist, geeignet, um uns für die Antworten auf weltbewegende Fragen empfänglich zu machen. Aber prinzipiell können ganz verschiedene Repertoires und Interpretationsweisen zu Resonanzen unserer Spiritualität werden. Da wir als moderne Menschen auch nicht mehr »an einem Stück« sozialisiert werden, wäre es sogar sehr merkwürdig, wenn es nur einen einzigen Musikstil in unserem Leben gäbe. Bei mittelalterlichen Mönchen mag das der Fall gewesen sein, vielleicht auch bei jenen, die vor einigen Jahrzehnten mit achtzehn ins Kloster eintraten und noch wenig von der Welt gehört und gesehen hatten. Bei mir war die Sache jedenfalls komplizierter. Ich hatte schon eine bewegte musikalische Biografie, als ich eintrat – fühlte mich selber als »Song-and-Dance-Man«. Das zu verleugnen und meine Mundharmonika endgültig an den Nagel zu hängen, hätte bedeutet, eine Resonanzachse abzuschneiden, die zu meiner Identität gehörte, ob ich wollte oder nicht. Dass ich es doch versuchte, war naiv und fanatisch zugleich.
Wiederentdecken
Lieder können uns so stark prägen, dass wir sie unser ganzes Leben lang nicht mehr verlieren. Sie bleiben Resonanzräume unseres Verlangens, so sehr wir uns auch entwickelt haben. Sie resonieren in unserem Körper, wenn wir sie hören oder singen, und manchmal ist es egal, wieviel Zeit seit dem letzten Mal vergangen ist. Um es kurz zu machen: mir ging es mit der Mundharmonika so. Ich habe mich im Kloster eine ganze Zeit lang geziert, wollte nichts mehr vom Klang des sehnsuchtsvollen Folkblues wissen. So war denn auch meine letzte Bluesharp beim endgültigen Umzug in die Abtei verlorengegangen, war irgendwo liegengeblieben oder schlummerte noch in einem Umzugskarton, den ich wohl erst nach Jahren wieder öffnen würde.
Es geschah bei einem Folkkonzert, zu dem ich mit einem Freund ging. Eigentlich war schon klar, dass das mir selber auferlegte Embargo gefallen war, als ich mich darüber freute, die Eintrittskarte geschenkt zu bekommen. Aber selber spielen? Das war doch noch etwas anderes. Wie der Zufall so wollte, konnte man an einem Stand im Foyer Bluesharps kaufen. Viel zu teuer natürlich, man hätte sie im Internet für die Hälfte bestellen können. Dennoch schlich ich ein ums andere Mal um den Stand herum. Mein Freund sagte: »Ich kaufe dir eine Harmonika, denn das gehört doch zu deiner Identität.«
Sollte er recht haben? Sollte in meiner modernen Mönchsidentität, meiner langsamen Gottessuche, auch Platz für eine Harmonika sein, die irgendwie mit dem Gotteslob verbunden war? Wie gut er mich verstanden hatte! Ich gab mir einen Ruck und freute mich von Herzen auch über dieses Geschenk, das ich verstohlen mit nach Hause in die Abtei nahm. Seitdem spiele ich wieder Mundharmonika – und habe es von Anfang an als Befreiung erfahren. Gott sei Dank, das Vorspiel war vorbei, jetzt begann das echte Spiel!
Wenn man von einem »Revival« spricht, sind meistens Sounds aus einer fernen Vergangenheit gemeint, die heute erneut in Mode gekommen sind. Die Gregorianik erlebt gerade ein solches Revival. Eigentlich hatte man den lateinischen Choral in den Gottesdiensten seit den sechziger Jahren abgeschafft. Moderne Lieder traten an seine Stelle. Im letzten Jahrzehnt hören wir jedoch auf CDs, von Chören und auch in manchen Gottesdiensten auf einmal wieder Hymnen und Antifonen, die lange vergessen zu sein schienen. Wie ist dieser »Erfolg« zu erklären? Interessanterweise sind es oft nicht diejenigen, die mit den lateinischen Messen aufgewachsen sind, die sich heute dafür begeistern. Offensichtlich verbinden sie mit ihrem spirituellen Verlangen etwas Altes, Historisches, das in diesem Repertoire zum Ausdruck kommt.
Die Frage ist, ob es dabei nicht zuweilen um ein Verlangen nach einer Spiritualität geht, die es so vielleicht nie gegeben hat. Der amerikanische Ritualwissenschaftler Ronald Grimes spricht von »Fantastereien«, die wir zum Klingen bringen und die uns manchmal davon abhalten können, uns unseren tatsächlichen Lebensumständen zu stellen. Seiner Meinung nach braucht es »Kreativität«, die »permanent Ausdrucksformen wieder-entdeckt«. Wer kreativ ist, flüchtet sich nicht in eine Fantasie, sondern verbindet Altes mit Neuem. Die Entdecker haben also nicht den naiven Anspruch, etwas ganz Neues zu schaffen, aber eben auch nicht, das Alte schlicht zu kopieren: »Sowohl traditionelle als auch neuerfundene Ausdrucksformen können uns bis ins Mark treffen und uns helfen, die Stromschnellen unseres Lebens zu meistern.«5 Was hier über Rituale gesagt wird, gilt auch für Lieder. Sie sind der Soundtrack der Rituale, mit denen wir unserem Verlangen nach Sinn Ausdruck verleihen.
Mein Revival hatte lange Zeit darin bestanden, mich in die Fantasterei eines klösterlichen »Monosounds« zu flüchten. Es konnte nur eine, aus vergangenen Jahrhunderten stammende musikalische Ausdrucksform für meine Suche geben. Je mehr ich aber die Fantasie losließ und mich wirklich um einen persönlichen Zugang zur Gregorianik bemühte, umso mehr kam es mir komisch vor, dass ich andere Musikformen und Lieder, die sich tief in mir befanden, verdrängt hatte. Ich musste sie wieder spielen, singen und hören. Irgendwann erwachte der Begriff »Lebenslieder« tatsächlich zum Leben. Selbst wenn wir wollen, können wir diese Lieder nie ganz verleugnen. Wer hat keine Songs, die mit der Pubertät verbunden sind, dem ersten Kuss, dem ersten Bier oder einer Reise?
Was auf allgemein menschlichem Niveau gilt, ist meist auch auf spirituellem Niveau wahr. Ich wollte das Wagnis eingehen, meine Lebenslieder, die ich auf dem weltlichen Instrument Bluesharp entdeckt hatte, aus klösterlicher Perspektive wiederzuentdecken. Was bedeuten Folksongs für meine Suche nach Gott – als Singersongwriter? Das ist eine Art umgekehrte Bewegung. Ist es auch eine Rolle rückwärts? Das wäre es, wenn ich auf einmal das Folkrepertoire mit Nostalgie gepflegt hätte – und es gibt sicher viele Menschen, die das tun. Wenn man aber wirklich nach Gott sucht, hilft Nostalgie nicht weiter. Dann braucht man Klänge, die den inneren Resonanzraum öffnen, zum Lobpreis Gottes. Für mich ist das sowohl der gregorianische Choral als auch die Mundharmonika mit all ihren Songs, die für mich zu Lebensliedern geworden sind.
Einklang
In meinem Innern resonieren sehr unterschiedliche Klänge. Manche findet man in alten Schriften zur Klosterspiritualität sicher nicht, andere durchaus. Ich glaube inzwischen, dass es nicht so sehr auf das musikalische Medium ankommt, sondern auf die Haltung. Dass es Resonanzräume für die Gottessuche geben muss, ist ein Grundprinzip der benediktinischen Spiritualität, in der ich heute lebe. Für mich war es einer der Gründe in diesen Orden einzutreten, dass Benediktiner ein liturgisches Leben führen: sie singen einen beträchtlichen Teil des Tages, und auch wenn sie nicht singen, leben sie in einem Stil, den man als »musisch« bezeichnen kann.
In der Regel des heiligen Benedikt aus dem sechsten Jahrhundert lesen wir über diese Lebensliturgie: »Beachten wir also, wie wir vor dem Angesicht Gottes und seiner Engel stehen müssen, und stehen wir so beim Psalmensingen, dass Herz und Stimme im Einklang sind« (RB 19,6-7). Der Einklang, der hier gemeint ist, betrifft Körper und Geist. Die Stimme (vox) ist die Seite unserer Identität, die körperlich zum Ausdruck bringen kann, was innerlich, in unserem Geist (mens), vorhanden ist. Das kann unser Verlangen sein, gerade wenn wir uns der Wirklichkeit so öffnen, dass unsere Stimme wirklich resoniert und »Gott« uns antwortet. Primär für unsere Erfahrung ist nämlich die Stimme. Den »Einklang«, den Benedikt auf das Psalmensingen bezieht, vermute ich auch beim Spiel auf der Mundharmonika. Es geht darum, dass wir Lebenslieder singen oder spielen, die uns in Einklang mit Gott und Welt bringen. Warum also nicht mit einem umgekehrten Revival?
Zuvor gibt Benedikt uns seine ganz eigene Erklärung einer Resonanz: »Überall ist Gott gegenwärtig, so glauben wir, und die Augen des Herrn schauen an jedem Ort auf Gute und Böse« (RB 19,1). Wir leben immer in der Wirklichkeit, und die Welt hat auch dann einen tiefen Sinn, wenn wir es gar nicht merken. »Gott« ist dieser Sinn der Wirklichkeit. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir diesen Sinn zum Klingen bringen, im Lobpreis »mit Harfe und Leier«. Denn dann kann ein wenig von unserem Verlangen und unserer Sehnsucht zu Hoffnung und Vertrauen werden. Benedikt verwendet dafür freilich andere Worte: »Das wollen wir ohne Zweifel besonders dann glauben, wenn wir Gottesdienst feiern« (RB 19,2). Lebenslieder zu hören und zu singen, auf der Bluesharp zu spielen, manchmal mit persönlicher Note und unerwarteten Wendungen, ist für mich eine Form von Gotteslob. Kein Widerspruch zu meiner Gottessuche, sondern Vehikel; kein Störsender im Klosterleben, sondern Intensivierung.
Das heißt freilich nicht, dass ich heute den ganzen Tag zwischen den Gottesdiensten im Kloster Mundharmonika spielen würde. Dann würden meine Mitbrüder in den hellhörigen Zellen mich sicher schnell davon abhalten. Auch in unserer Liturgie ist weder für die Mundharmonika noch für das Folkrepertoire Platz, anders als in mancher Pfarrkirche. Dennoch bleibt genug Raum, um die Brücke zu meinen eigenen musikalischen Wurzeln zu schlagen. Denn kein einziges Lebenslied findet immer und überall einen Klangraum, auch gregorianische Sequenzen nicht. Das ist aber auch nicht nötig. Wenn wir Benedikt ernst nehmen und das ganze Leben Liturgie ist, dann sind alle unsere Lebenslieder auf ihre ganz eigene Art und Weise liturgische Klänge, Resonanzräume der antwortenden Welt, die wir »Gott« nennen. Es lohnt sich, nach ihnen zu suchen »damit Gott in allem verherrlicht werde« (RB 57,9).
Idole: »Ich bin der Herr, euer Gott«
Alles, was uns heilig ist, kann uns schnell zu Fanatikern machen. Es ist für Menschen gut und richtig, Leuchtfeuer für ihren Lebensweg zu haben. Das beginnt schon in jungen Jahren, wenn man nach Orientierung sucht, kann aber immer wieder nötig sein. In Krisen, Schwächen oder auch überschwänglichen Lebensphasen brauchen wir Anhaltspunkte. Gerade dann ist es aber sehr verlockend, diese zu verabsolutieren. Menschen werden zu »Abgöttern«, meistens mit einem großen Sicherheitsabstand, damit sie sich nicht so schnell vom Sockel stürzen und uns nicht enttäuschen.
Im heutigen Medienzeitalter werden uns mehr als genug »Produkte« angeboten, die als Abgötter dienen können. Ich habe aber als Mönch gemerkt, dass auch im Kloster jede Menge »Abgötter« zum Greifen nahe sind. Eine bestimmte Lebensform, ein Mitbruder, die Tradition: all das kann uns davon abhalten, uns wirklich auf Gottessuche zu begeben. Schon im biblischen Zeitalter war das so. Daher lesen wir in den Weisungen, die Mose empfangen hat:
Ich bin der Herr, euer Gott.
Ihr sollt euch nicht anderen Göttern zuwenden
und euch nicht Götterbilder aus Metall gießen.
Ich bin der Herr, euer Gott (Lev 18,3-4).
Wer hatte in seiner Jugend nicht solche »Abgötter«, deren Konterfeis nicht »aus Metall gegossen« waren, sondern im Schlafzimmer als Poster oder Starschnitt einen prominenteren Platz einnahmen als das Weihwasserbecken, das schon über dem Kinderbettchen hing, und das Bronzekreuz, das man zur Erstkommunion bekommen hatte? Bei mir war es jedenfalls so. Das begann schon als Kind mit meiner Begeisterung für die Stars der ZDF-Hitparade. In der Pubertät sammelte ich »Bravo«-Poster von allen möglichen Stars und Sternchen, Sängerinnen und Sängern. Aber wirkliche Vorbilder wurden sie für mich nicht. Vielleicht waren sie zu glatt, vielleicht zu kurzlebig oder zu inhaltslos. Wirklich Charakter hatte keiner derjenigen, über die ich mit roten Ohren las. Ich hörte ihre Lieder und las die Storys, gemeinsam mit Klassenkameraden.
Gefiel mir der Popsound der Achtziger? Schwer zu sagen, denn in der Popkultur geht es immer um das Gesamtgefüge von Sänger und Lied. Wir hören nur noch selten Lieder, die sich unabhängig davon, wer sie singt, durchsetzen. Unsere Stars singen unsere Hymnen, und niemand anders, und das fördert nicht unbedingt ihre Qualität. Als Zwölfjähriger nahm ich Lieder aus dem Radio auf, wie man das damals mit einem Kassettenrekorder machte. Wenn die angehimmelten Interpreten von der Bildfläche verschwunden waren, hörte ich sie mir nie wieder an. Es waren vielleicht doch »Abgötter«, die mich blind dafür machten, ob mir die Musik wirklich gefiel, und schon erst recht, für welche Inhalte sie stand.
Idole
Schließen echte Sinnsuche und Idole sich aus? Diese Frage wird aus geistlicher Sicht oftmals mit einem klaren Ja beantwortet. Man verschließt sich der eigenen wahren Identität, wenn man sich zu sehr auf eine Scheinwelt richtet; wenn man seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf Bilder von anderen Menschen projiziert, die kaum der Realität entsprechen. Ganz zu schweigen von der Offenheit für den letztendlichen Horizont des Lebens, das Ziel der geistlichen Suche: Gott. Man kann keinen eigenen Charakter entwickeln, wenn man andere Personen vergöttert. Diese Gefahr ist besonders groß, wenn es um öffentliche Personen wie Popstars geht.
Als Mönch plagen mich auch heute immer wieder Zweifel an meinem Interesse an berühmten Sängern, das mir geblieben ist, auch wenn ich heute nicht mehr die »Bravo« dafür zu konsultieren brauche. Darf man sich als »Gottessucher«, wie der heilige Benedikt Mönche ausdrücklich nennt (RB 58,7), an einem Personenkult beteiligen, der zuweilen um Musiker veranstaltet wird, die uns ihre Lieder zum Besten geben? Das widerspricht scheinbar dem mönchischen Ideal, denn ich kann kaum Gottes Lob singen, wenn ich in Wahrheit Abgöttern huldige. Kein Mensch ist es wert, angebetet zu werden, schon gar nicht, wen man heutzutage im Showgeschäft so alles präsentiert bekommt. Wer dabei mitmacht, unterstützt einen Egotrip. So weit so gut: Kein Charakter durch Idole!
So berechtigt ich diese Fragen und Bedenken auch finde, so wenig kann ich auch heute von mir selber behaupten, von bestimmten Sängern und Sängerinnen und ihren Liedern nicht beeinflusst zu werden. Meine Identifikation, die manchmal Zustimmung, manchmal auch Reibung bedeutet, hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin, ob ich will oder nicht. Neben meinen Musikinstrumenten habe ich auch Vorlieben bei meinem Klostereintritt hinter mir zurückgelassen, als die Spiritualität den größten Raum einnahm und zu meiner Lebensform wurde. Fansein passte nicht zu meinem neuen Leben. Aber ich begann, die Helden meiner Jugend zu vermissen, als ich nach Vorbildern suchte, die mir beim Finden meiner Lebensform als Mönch behilflich sein könnten.
Können wahre Idole nicht doch zur Bildung unseres Charakters beitragen, ohne »Abgötter« zu werden? Sind sie nicht Modelle, an denen wir uns für unser Verhalten, auch in späteren Lebensphasen, orientieren? Niemand wird bestreiten, dass es im Laufe unseres Lebens Vorbilder gibt. Nur welche die guten und welche die schlechten sind, daran scheiden sich die Geister, auch auf dem geistlichen Weg. Ich begann, mich darauf zu besinnen, wer meine wichtigsten Einflüsse waren und warum. Ich kramte in alten Bücher- und Plattenkisten. Und ich entdeckte zu meiner Überraschung nicht nur meine Idole, sondern mit ihnen ein Stück von mir selber, von Menschen, die mir wichtig sind, ja: ein wenig Offenheit für Gott.
Ein Idol ist im wörtlichen Sinne ein »Abbild«. Im allgemeinen Sprachgebrauch kann der Begriff eine durchaus positive Bedeutung haben: jemand ist ein Idol, wenn ihm große Bewunderung entgegengebracht wird. Der Grund dafür kann sein, dass er etwas Besonderes geleistet hat. Musik ist dafür ein naheliegender Bereich, da sie ein öffentliches, für jedermann sicht- und hörbares Feld darstellt, das medial vermarktet wird und dadurch leicht zugänglich ist. Genau das macht viele aber auch misstrauisch. Es scheint ungerechtfertigt, Menschen zu bewundern, deren Leistung uns vielleicht nur durch eine gezielte Kampagne so außergewöhnlich erscheint. Längst nicht alle Idole können auch singen. Die Idol-Politik großer Medienkonzerne ist manipulativ bis zum geht nicht mehr.
Das »Abbild« wird leer. Es bildet nichts mehr ab, ist wörtlich ein »Abgott«, dem jegliche innere Wertigkeit fehlt. Mir ging es zweifelsohne bei manchen der Popstars so, die ich aus der »Bravo« kannte. Mein Bravo richtete sich auf eine Fassade, die keinen Hintergrund hatte. Sie forderte die gesamte Aufmerksamkeit, die mein Jugendzimmer hergab. Aber wirklich geformt hat sie mich nicht. Ich wurde durch den Popkult weder offen für eine Musik, die mir etwas bedeutet hätte, noch für menschliche Werte, ganz zu schweigen von meiner spirituellen Suche. Die Klänge, die aus der bescheidenen Anlage in meinem Zimmer tönten, hatten keinen Charakter.
Modelle
Ich habe mich in jenen jungen Jahren nie wirklich damit beschäftigt, wie sich meine Backfisch-Idole zu meiner Kirchlichkeit verhielten. Ehrlich gesagt fand ich auch nicht, dass sie mir dabei im Weg gestanden hätten zu beten. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Wenn man inhaltslose Idole hat, können sie einen höchstens abstumpfen, verstopfen, aber nicht dazu verführen, einer anderen Religion anzugehören. Dafür fehlt ihnen einfach der Charakter. Denn sowohl was irdische Errungenschaften als auch was himmlische Attribute betrifft, verwiesen sie auf nichts bis wenig. Freilich gab es auch Unterschiede: singende Idole, die gerade jungen Leuten ideologische Verblendung unter dem Deckmantel persönlicher Ausstrahlung und Authentizität unterjubeln. Dann war und ist Vorsicht geboten! Aber in aller Regel habe ich Popkultur eher als inhaltslos, weniger als inhaltlich verblendet erfahren. Mich hat jedenfalls gerade die Inhaltslosigkeit schon als Heranwachsender massiv gestört. Ich sehnte mich insgeheim nach Musikern, die durch ihre Persönlichkeit authentische Lieder sangen, die mich wirklich berührten und mir in meiner eigenen Lebenssituation weiterhalfen. Lange Zeit habe ich sie nicht gefunden.
Was ich wirklich suchte, waren wohl Modelle, an denen ich mich orientieren konnte, nicht nur in meiner direkten Umgebung, sondern eben auch in der großen weiten Musikwelt. Aus der Psychologie ist bekannt, dass wir lebenslang anhand von Modellen lernen. Sie können durchaus ein buntes, zuweilen auch dissonantes Ganzes bilden. Wer wir sind, welchen Charakter wir entwickeln, hängt von den Menschen ab, an denen wir uns orientieren. Das geschieht jedoch nie blind, quasi eins zu eins. Unsere Entwicklung setzt ein, wenn wir uns vom kindlichen Verhalten lösen, bei dem wir moralische Werte, die unsere Bezugspersonen ausstrahlen, wahrnehmen und aus dem Gedächtnis einfach übernehmen. Wir gehen dann zu einem selbstständigen »dialogischen« Charakter über. In der Konfrontation mit anderen entdecken wir Grundsätze, denen wir in unserem eigenen Leben Raum geben.
Wenn man als Kind den gängigen Konventionen seiner direkten Umgebung nicht entspricht, ist es nicht verwunderlich, dass man dafür auch auf öffentliche Personen stößt, wie in meinem Fall zum Beispiel Sänger. Problematisch wird das Lernen am Modell nur, »wenn wir das ideale Selbst als ein abgerundetes, fertiges Selbst auffassen«, wie der niederländische Theologe Hans van der Ven sagt. Modelle helfen uns, wenn wir nach einem »mehrdimensionalen Selbst suchen, das auf verschiedene Situationen, Positionen und Rollen verteilt ist«. Kein Idol darf uns dann so verblenden, dass es eine schlüssige Lösung unserer eigenen Probleme verkörpern würde. Aber es kann uns »Geschichten« anreichen, die wir »auf unsere eigene Situation beziehen können«.6 Ich verschlang solche Geschichten, wo immer sie mir in die Finger kamen.
Charakter
Und ich hörte viel Musik. Ich suchte nach Sängern, die in ihren Liedern Geschichten erzählten, die mir etwas von ihrem Charakter offenbarten. Die eigentliche Errungenschaft meiner wahren Idole sollte ihr Charakter sein! Wie hörte es sich an, wenn jemand seine ganze Persönlichkeit in seinen Liedern auslebte, die andere Menschen in ihrem tiefsten Innern berührten? Ich war mir damals noch kaum darüber im Klaren, was »Charakter« eigentlich bedeutet. Ging es bei einem Sänger, der Charakter hat, um eine Art souveränen Troubadour, der eine schlüssige Botschaft in Klänge übersetzte? Das wäre naiv und im Sinne eines Idols sogar problematisch. Das Risiko, einem ideologischen »Abgott« hinterherzurennen, wäre riesengroß. Ich dachte, dass man die richtigen Slogans bei den großen Helden vergangener Jahrzehnte würde finden können.
Ich hörte von echten Typen, die seit den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts den Aufstand geprobt hatten. Sie erschienen mir wie eine Art »Heilige«. Aber auch das war natürlich ein Trugschluss. Wenn ich an einem solchen »fertigen« Charakterideal festgehalten hätte, wäre die Enttäuschung früher oder später groß gewesen. Denn wer ist schon ein »vollkommener« Charakter, der auch noch die passenden Verse zum Besten gibt? Bei aller Modellfunktion, die öffentliche Personen für uns haben können, stellt der Charakter doch eine lebenslange Aufgabe für jeden einzelnen dar. Im Verlauf der Zeit ist er dynamisch, er kann sich stets verändern, und er ist immer unvollkommen. Warum sollte es bei jenen Idolen, von denen ich mir Tiefgang erhoffte, anders sein?
Die Situationen, in denen wir Menschen begegnen, bestimmen ganz entscheidend, welche Charaktereigenschaften wir bei ihnen wahrnehmen und wie unser eigener Charakter sich entwickelt. Wir modellieren sie auf unsere eigene Art und Weise. Bei öffentlichen Persönlichkeiten ist das nicht anders. Wenn unsere Idole in jungen Jahren flach sind, werden unsere möglichen charakteristischen Züge wenig mit ihnen zu tun haben. Vielleicht entwickeln wir selber auch weniger charakteristische Eigenschaften. Die Inszenierung von Idolen birgt immer das Risiko, dass die Arena, in der wir ihnen begegnen, nicht wirklich geeignet ist, jene Seiten wahrzunehmen, die für uns zu Geschichten für eigene Lebenssituationen werden können.
»Geschichtenerzählen« gehört aber wesentlich zur Konstruktion unseres Charakters. Für die eigene Entwicklung darf man es nicht verpassen. Das bedeutet freilich nicht, dass man einfach nur so eine Geschichte erfinden könnte. Im Gegenteil, man »schreibt seine eigene Biografie in einem größeren Zusammenhang von Geschichten«, so van der Ven.7 Die Geschichten unserer Idole laden uns ein, auch unsere eigene Geschichte zum Klingen zu bringen, wenn sie jedenfalls charakteristisch genug sind. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Wenn ich versuche, mir einige der Sternchen vor Augen zu führen, die wir auf Teenagerfeten hörten, bin ich heute ganz froh, dass ihre Storys für mich keine charakteristischen Erzählungen geworden sind. Meine Gottessuche orientierte sich an anderen Vorbildern, oft ohne dass ich es wusste.
Scheitern
Ich hoffte als Junge vom Land insgeheim wohl darauf, Vorbilder zu entdecken, um mich in ihnen wiederzuerkennen, mich an ihnen zu reiben und mir einen Weg weisen zu lassen, der die Spießigkeit und Erwartungen meiner Umgebung sprengte. Nur wo sollte ich sie finden, wenn ich höchstens zum Einkaufen in die nächste Kleinstadt ging, wo auch das Gymnasium war, das ich besuchte? Es geschah eher zufällig. Als Zwölfjähriger kaufte ich mir ein Buch über John Lennon! Nicht dass er mich zuvor übermäßig interessiert hätte. Ich wusste, er war – gemeinsam mit Paul McCartney – Sänger der legendären Beatles gewesen und 1980 erschossen worden. Ich war nicht mit den Liedern der Beatles aufgewachsen, die Gruppe trennte sich 1970, zwei Jahre vor meiner Geburt.
Unser Englischlehrer brachte ein Tonbandgerät mit in den Unterricht, auf dem er uns einige Lieder vorspielte, die allesamt von junger Liebe, Liebeskummer und Spaß an der Freude handelten. Er war ein fanatischer Fan, und die Texte waren für ihn willkommenes Unterrichtsmaterial. Wir sangen mehr schlecht als recht mit. Als ich beim Buchladen der Kleinstadt auf dem Wühltisch das Buch über Lennon, reduziert seinerzeit auf 2,99 DM, fand, kaufte ich es von meinem Taschengeld. Mich faszinierte der Gedanke, das Leben eines Menschen kennenzulernen, dessen musikalische Klänge für mich bis dahin noch nichts Charakteristisches hatten, aber vor dem ich doch einen gewissen Respekt hatte, wenn mein Lehrer schon so beeindruckt von ihm war.
Es handelte sich bei dem Buch um einen Erfahrungsbericht der Geliebten Lennons, mit der er von 1973 bis 1974 zusammengelebt hatte.8