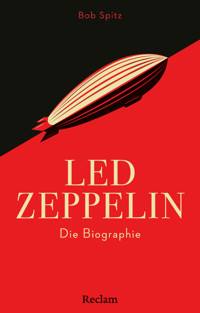
39,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 39,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die ultimative Biografie über die legendäre Rockband Led Zeppelin – schonungslos ehrlich und fesselnd erzählt. Mit über 300 Millionen verkauften Alben prägte Led Zeppelin Jahrzehnte der Rockgeschichte wie keine andere Band. Von ihrem ersten Album an zeigten die vier Musiker, dass sie etwas Besonderes sind: eine Kollision aus großartigen künstlerischen Fähigkeiten und brutaler Kraft, englischer Folk Music und erdigem amerikanischem Blues. Hits wie »Stairway to Heaven«, »Whole Lotta Love« und »Kashmir« machten sie zu Ikonen des Hard Rock und Heavy Metal. Doch hinter den Kulissen tobten oft die Dämonen - Drogen, Gewalt und Kontroversen begleiteten den kometenhaften Aufstieg der Band. Bob Spitz wirft in dieser Biografie ein schonungsloses Licht auf die Szene hinter dem Mythos Led Zeppelin. Durch intensive Recherche und Interviews mit Zeitzeugen enthüllt er die Wahrheit über Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones und John Bonham – und trennt dabei geschickt zwischen Legende und Realität. Ein Must-Read für jeden Fan, der schon immer wissen wollte, was sich hinter Songs wie »Achilles Last Stand«, »All My Love« und »Black Dog« verbirgt. »Das Buch ist gespickt mit musikalischen Anspielungen, die Spitz so eindringlich beschreibt, wie man Musik nur beschreiben kann.« Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bob Spitz
Led Zeppelin
Die Biographie
Reclam
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
Led Zeppelin. The Biography
Penguin Press, New York 2021
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962337
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverillustration: © Gutentag-Hamburg
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962337-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011465-0
www.reclam.de
Inhalt
Widmung
Zitate
Prolog
Kapitel 1: Ein klarer Fall von Blues
Kapitel 2: Kommen wir ins Geschäft
Kapitel 3: Die Neuerfindung des Rades
Kapitel 4: Front
Kapitel 5: Das Black Country
Kapitel 6: Lass mir meinen Raum
Kapitel 7: Durch die Schallmauer
Kapitel 8: Die neue Normalität
Kapitel 9: In die ferne Vergangenheit
Kapitel 10: Flehend und beschwörend
Kapitel 11: Nur Jungs, die Spaß haben
Kapitel 12: Ihr eigenes Gesetz
Kapitel 13: Das Mondo-Bizzaro-Land
Kapitel 14: Led Zeppelin waren anderweitig beschäftigt
Kapitel 15: Zu nahe an der Sonne fliegen
Kapitel 16: Zuhause fort von zu Hause
Kapitel 17: Das Jahr des gefährlichen Lebens
Kapitel 18: Das andere Ende vom Spektrum
Kapitel 19: Ihr eigenes privates Sodom und Gomorrha
Kapitel 20: Eine Übergangsperiode
Kapitel 21: Schwanengesang
Kapitel 22: Coda
Anmerkungen
Anmerkungen des Übersetzers
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Danksagungen
Register
Zu Autor und Übersetzer
Für Scott Moyers
So wird es nicht weitergehen mit dem Rock ’n’ Roll. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Es reicht nicht mehr, wenn eine Band uns nur Gier, Prahlerei und lärmende Unaufrichtigkeit zu bieten hat und das dann Entertainment nennt. Es mag ein paar irregeleitete Seelen geben, die zurzeit bereit sind, so etwas zu kaufen, aber es hat keine Zukunft.
Jon Landau: »Led Zeppelin – Nothing was delivered«,
The Boston Phoenix, 9. September 1970
Fick die Sechziger, wir werden das neue Jahrzehnt entwerfen!
Jimmy Page
Prolog
Sonntag, 26. Januar 1969
Sie hatten schon die ganze Woche lang diese Band gespielt. Beide Seiten des Albums in voller Länge. Das FM-Radio, das freie Ausdruckskanalsystem des Underground, war ein Gottesgeschenk. Er hatte WNEW-FM gehört, New Yorks führendes Alternativradio, als es losging: »Dazed and Confused«, »Communication Breakdown«, »You Shook Me«, sogar »Babe, I’m Gonna Leave You«, eine Nummer von Joan Baez, unter Starkstrom gesetzt und auf Touren gebracht. Scott Muni, der Nachmittags-DJ des Senders, war außer sich vor Begeisterung. Er schabte förmlich die Rillen aus dieser Platte. Alison Steele, die Nachteule von NEW, spielte sie wie in einer Wiederholungsschleife.1
Led Zeppelin.
Schon der Name allein hatte unmittelbare sinnliche Power. Klar, er war unpassend. Ein Bleizeppelin war nun wirklich der letzte üble Scherz, aber ihr »Led« zu buchstabieren, zeigte, dass sie Mumm hatten. Es verriet dir alles, was du über diese Band wissen musstest – sie war dynamisch, respektlos, subversiv, extrem – geschaffen um zu rocken, nicht als Speichellecker für die Massentauglichkeit der Top 40. Led Zeppelin würden nicht dein Händchen halten oder den T-Bird deines Daddys für eine Spritztour nehmen. Sie gingen zur Sache. Das war ernsthafter, heftiger Stoff.
Er liebte, was er gehört hatte. Nun kam es darauf an, sie auch zu sehen.
Wie der Zufall es wollte, schleppte sein Freund Henry Smith an diesem Wochenende Led Zeppelins Anlage in einen Club in Boston. Wenn er zu dem Auftritt kommen würde, hatte Smith ihm versprochen, ihn in die Show zu schleusen. Aber wie? Er war praktisch pleite. Sie hatten im Apartment seiner Eltern in Yonkers campiert, wo seine Band Chain Reaction sich durchzuschlagen versuchte. Wenn er nach Boston wollte, ging das nur per Anhalter.
Der Verkehr am Sonntagnachmittag auf der I-95 war spärlich. Das Wetter war nicht hilfreich. Ein Tiefdruckgebiet war von Oklahoma aus ostwärts gekrochen und ließ die Temperaturen entlang der Atlantikküste unter den Gefrierpunkt fallen. Der Himmel sah finster aus. Der Wetterbericht sagte einen Sturm aus Nordosten voraus, der Boston später in der Nacht oder am folgenden Morgen erreichen würde. Mit ein bisschen Glück könnte er sich bis zu dem Konzert durchschlagen.
Eine Mitfahrt … dann noch eine in der Abfolge von Autos, die die Interstate füllten wie ein nahtloses Band von Stamford über Bridgeport und New Haven und Providence und weiter. Die Lieder in seinem Kopf trugen ihn über Dutzende von Meilen hinweg. Dieser Tage konntest du gar nicht einatmen, ohne einen Killer-Song zu inhalieren. »Jumpin’ Jack Flash«, »Dock Of The Bay«, »All Along the Watchtower«, »White Room«, »Hey Jude«, »I Heard It Through the Grapevine«, »Hurdy Gurdy Man«, »Fire« … man konnte sich den ganzen Tag an diesen Leckerbissen gütlich tun, Hunger ausgeschlossen. Aber Led Zeppelin hatten ihn emotional aus dem Gleichgewicht gebracht. Ihre Songs hatten ihn ganz tief drinnen getroffen. Sie hatten etwas Dunkles, Bedrohliches, etwas fremdartig reizvoll Provokatives in ihrem Wesen. Sie überrollten ihn, ließen seine Phantasie ausbrechen.
Kein Wunder, dass ihre Explosion durch Jimmy Page ausgelöst worden war. Er wusste alles über Page, ein Gitarrenvirtuose in der Tradition von Clapton, Stills und Jimmys kratzbürstigem Alter Ego Jeff Beck, mit dem Page eine kurze, aber stürmische gemeinsame Zeit bei den Yardbirds verbracht hatte, als diese bedeutende Band erste Auflösungserscheinungen zeigte. Page war bereits von einem sagendurchwobenen Nimbus umgeben. Er hatte ungenannterweise Licks zu Unmengen von Hits beigesteuert, nicht zuletzt bei Sessions mit The Who, The Kinks und Them. Aber Led Zeppelin hatten Page in eine andere Dimension geführt, in einen Landstrich des Rock ’n’ Roll, der schwer zu beschreiben war. Manchmal war es geerdet und bluesig, manchmal frei improvisiert, manchmal eine Mischform, die sie Heavy Metal nannten, und all das gewürzt mit genug Folk, Funk und Rockabilly-Elementen, um sämtliche Grenzen zu verwischen. Da gab es eine Menge zu verarbeiten für einen angehenden Rock ’n’ Roller. Page und seine Band live zu erleben würde helfen, die Dinge klarer zu sehen.
Die Boston Tea Party im Januar 1969 – wo alles sich für immer änderte
Als er bei dem Gig ankam, war es bereits dunkel. Es war ein Club namens Tea Party in einem umgebauten unitarischen Gemeindehaus samt Synagoge, das auf halber Höhe einer verlassenen Straße stand.2 Eine halluzinatorische Düsternis hatte sich über das South End von Boston gesenkt und nahm die East Berkeley Street in eine trostlose Umarmung. Das war nicht das Boston wohlhabender Brahmanen, kultiviert und Teil der feinen Gesellschaft. »Es war eine raue Gegend, ein Ort wo du nachts nicht herumhängen wolltest«3, so Don Law, der den Laden führte. Es gab keine Anzeichen von Leben in den Wohnblocks der Umgebung, abgesehen von einer Bodega nebenan, deren Licht einen wächsernen Schimmer auf den löchrigen Bürgersteig warf. In den Silhouetten, die sie warfen, konnte er Umrisse von Köpfen erkennen, die Schultern gegen die Kälte zusammengezogen, eine Schlange, die sich die Straße entlang und um die Ecke zog. Es müssen – tja, wie viele? – mehrere hundert Leute gewesen sein, die aufgereiht darauf warteten, hineinzukommen. Mehr noch.
Woher zur Hölle kamen die alle?
Led Zeppelin waren keineswegs schon ein allgemein bekannter Begriff. Bis vor kurzem waren sie noch unter dem Namen The New Yardbirds aufgetreten. Ihr Debütalbum war erst vor zwei Wochen erschienen. Sicher hatte er erwartet, hier ein paar Freaks und Hartgesottene zu treffen, aber dieser Andrang war absolut erstaunlich. Offensichtlich hatten die Buschtrommeln funktioniert. Und das nicht zum ersten Mal. »Wir hatten hier völlig unbekannte britische Acts, die am Donnerstag anfingen«, erinnert sich Don Law, »und bereits am Samstag standen sie Schlange die ganze Straße runter.« Er hatte es mit Jethro Tull, Humble Pie und Ten Years After erlebt, die alle in den vergangenen Monaten in diesem Club gespielt hatten. Das Radio half dabei enorm. Bostons FM-Rocksender WBCN steckte noch in den Kinderschuhen. Die meisten Sendungen wurden direkt aus einem Vorraum der Tea Party ausgestrahlt, die Moderatoren waren ein bunter Haufen von Ex-College-Jugendlichen aus der Kommunikationsabteilung von Tufts und Emerson. Die Bands kamen von der Bühne und gaben direkt Interviews. Radio-Airplay eines guten Albums war die beste Waffe, um einem neuen Act zum Durchbruch zu verhelfen. Der Beweis sammelte sich in Massen auf dem Bürgersteig – wie hier im Fall von Led Zeppelin.
In die Tea Party hineinzugelangen, um ihren letzten Auftritt zu sehen, würde nicht ganz einfach sein. Die Schlange wirkte einschüchternd; der Anhalter fürchtete, er sei zu spät angekommen. Zum Glück hatte Henry Smith nahe der Tür nach ihm Ausschau gehalten, und die beiden Männer schlüpften hinein, ehe das Management oder die Feuerwehr sie daran hindern konnten.
Etwas Besonderes lag in der Luft. Der Raum pulsierte vor gespannter Erwartung. Die Menge war erregt. Sie waren bereit.
Die Tea Party war nicht unbedingt der geeignetste Ort, um eine Band wie diese auftreten zu lassen. Es war schwer, den Charakter eines Hauses der Anbetung loszuwerden. Die Bühne war eine frühere Kanzel mit dem über dem Altar eingemeißelten legendären Sinnspruch »Preiset den Herrn«, die Tanzfläche sah nach dem Entfernen der Kirchenbänke pockennarbig aus, und ein mächtiges Buntglasfenster präsentierte den Davidstern. Wenn schon die Musik, die aus dem PA-System dröhnte, nicht direkt liturgisch zu nennen war, so war die psychedelische Lightshow, die ineinanderfließende Formen und Muster vom Balkon herunterstrahlte, ausgesprochen weltlich. Kein Gottesdienst hatte je eine Gemeinde wie diese zusammengebracht, die den Saal fast bersten ließ. 700 Besucher waren die zulässige Höchstgrenze für den Club, aber diese Zahl war längst überschritten. Die Menge stand Kopf an Kopf.
Drei gute Abende hatte die Band tapfer zum Aufwärmen hinter sich gebracht. Die Shows am Donnerstag, Freitag und Samstag waren so verlaufen, wie sie gehofft hatten, sie hatten wuchtige Sets abgeliefert, die, wie ein Kritiker bemerkte, »ihrem Ruf als Gruppe mit außergewöhnlich viel Power und Drive gerecht wurden«4. Hauptsächlich spielten Led Zeppelin die Highlights ihrer ersten Platte, und ab und zu wurden Nummern der Yardbirds oder von Chuck Berry eingestreut. Lange, ausschweifende Solos enthielten improvisierte Fragmente von R&B- oder Bluesklassikern. War das »Mockingbird«, eingetaucht in »I Can’t Quit You Baby«? Ein paar Takte von »Duke Of Earl«? Das bekannte Riff aus »Cat’s Squirrel«? Besonders Jimmys Gitarrenspiel war flüssig und opulent. Er fühlte sich heimisch in der Tea Party, weil er nur neun Monate zuvor noch mit den Yardbirds hier aufgetreten war.5 Ein paar Monate später, im Juni 1968, waren Page und sein Manager Peter Grant hier erschienen, um sich die neueste Besetzung einer anderen Band von Grant anzusehen, die Jeff Beck Group, zu der Ronnie Wood und Rod Stewart gehörten.
Don Law hat in Erinnerung behalten, wie Grant hereinkam, bevor Becks Auftritt begann. Er hütete ein Weißmuster wie seinen Augapfel. »Das ist eine neue Band namens The New Yardbirds«, meinte er. Die drei Männer ließen sich in einem schäbigen kleinen Büro hinter der Bühne nieder. Als Law die Testpressung hörte, während sich Page und Grant vielsagende Blicke zuwarfen, wusste er sofort, dass er diese Band buchen musste, bevor sie ihm irgendein windiger Konkurrent wegschnappte. Und Grant überredete ihn zu einem Vier-Abende-Engagement.
Er hoffte, dass diese Sonntagabendshow am 26. Januar für einigen Gesprächsstoff in Boston sorgen würde.
Law verbrachte ein paar Minuten backstage eine Stunde vor Showtime.6 Er unterhielt sich mit Page, einer zierlichen, nahezu geisterhaften Gestalt, die Rockstar-Feuer ausstrahlte. Law hatte bei Page einen Stein im Brett, was an seinem Vater lag, der ebenfalls Don Law hieß. Der hatte in Texas Mitte der 1930er Jahre die einzigen bekannten Aufnahmen – ganze 29 Songs – der Blueslegende Robert Johnson produziert. Page war genauso dem Einfluss von Johnsons Musik verfallen wie seine Freunde Eric Clapton und Jeff Beck, und er fragte Law aus, ja verhörte ihn geradezu, auf der Suche nach irgendwelchen unentdeckten Schmankerln über Johnson, die ihm tiefere Einblicke in diese Musik gewähren würden. Belauscht wurde ihre Unterhaltung von Robert Plant, Zeppelins raubkatzenhaftem Sänger und selbst ein großer Johnson-Fan. »Als ich anfing zu singen, habe ich bei Robert Johnson besonders auf die Liaison zwischen Stimme und Gitarre geachtet«, so Plant Jahre später. »Es war so symbiotisch miteinander verbunden. Als ob die Gitarrensaiten seine Stimmbänder wären.«7
Plant war ein Blueskenner, der die entlegensten Chicago-Anthologien nach Stücken durchforstet hatte, um sie sich anzueignen, seit er 14 Jahre alt war. Muddy Waters, Skip James, Son House, Snooks Eaglin – sie alle gehörten zu Plants Erziehung. Erst diesen Donnerstagnachmittag hatte ein junger Fan, der den Roadies half, eine Bandkopie von »King of the Delta Blues Singers Vol. 1« dabeigehabt, auf der ein paar von Johnsons Balladen waren.8 Plant betrachtete Johnson als den Musiker, »dem wir alle mehr oder weniger unsere ganze Existenz verdanken«9. Er bemühte sich, so viel wie möglich von der Unterhaltung zwischen Law und Page mitzubekommen, aber der Lärm ringsum war zu groß, und so gab sich Plant damit zufrieden, seinen heißen Tee zu schlürfen, um seine Stimmbänder zu pflegen, während seine Bandkollegen, Bassist John Paul Jones und Drummer John Bonham, sich im Raum verteilten, jeder mit einem Pint Watney’s Red Barrel, zusammen mit einem BCN-Discjockey namens J. J. Jackson.
Es gab einen deutlich spürbaren Abstand, ja sogar eine gewisse Fremdheit zwischen den Bandmitgliedern, die größere Intimität verhinderte. Sie waren immer noch in der Findungsphase, lernten einander noch kennen, entwickelten noch ihre Kameradschaft. Erst seit wenig mehr als vier Monaten bildeten sie eine Einheit, zusammengestellt von Jimmy Page, ähnlich wie ein Koch Gewürze für ein Gericht gesammelt hätte. Page und John Paul Jones kannten sich bereits als gefragte Sessionmusiker aus der Londoner Studioszene, Robert Plant und John Bonham waren Kameraden aus den Midlands. Obwohl es niemand zugab, hing ein Hauch von Nord-Süd-Unterschied in der Luft.
Ihre Shows hatten hohe Wellen geschlagen, seit sie gegen Ende 1968 in den Staaten gelandet waren. Ihre Debüts in Los Angeles und San Francisco ließen nur den Schluss zu, dass hier ein neuer Stern aufging. Die Kritiker waren außer sich und bezeichneten sie als Phänomene, die »miteinander jammten, als hätten sie schon jahrelang zusammengespielt«10 und »in einem Atemzug mit The Who, den Rolling Stones und den späten Cream«11 genannt werden müssten. Der Schreiber aus Toronto meinte, »verschiedene Kritiker, mich eingeschlossen, halten Led Zeppelin für die nächste sogenannte Supergroup«12. Jimmy Page spürte, dass sie abhoben. »Nach dem Auftritt in San Francisco machte es einfach BANG«13, sagte er.
Allerdings waren die Säle, in denen Zeppelin spielten, oft schlecht ausgestattet, die Lautsprechersysteme stammten aus der Steinzeit, und die Arrangements klangen dementsprechend so überzeugend wie Highschool-Konzertabende. In Detroit, vor einem Publikum lokaler Berühmtheiten wie den MC5 und den Amboy Dukes, schrieb ein Kritiker in der allerersten Ausgabe von Cream: »Jedes Gruppenmitglied spielte was anderes, überhaupt nichts Gemeinsames … sie machten gleichzeitig völlig verschiedene Dinge.«14 Es war peinlich, aber verzeihlich. Anfangsschwierigkeiten waren für neue Bands normal. Led Zeppelin waren da keine Ausnahme. »Wir wurden jeden Tag besser und fanden uns nach und nach beim Spielen«15, erklärte Jimmy Page kurze Zeit später. Die Band kämpfte und arbeitete an sich auf dem Weg zu einer perfekten Show.
Eine Menge hing vom Publikum ab. Eine Band lebt von der Energie in der Halle, und die Tea Party brodelte.
Als Discjockey Charlie Daniels die Bühne betrat und das Licht ausging, bekam der Anhalter eine Gänsehaut durch den Jubel, der in dem alten Gebetshaus losbrach. Er stand an der Rückwand des Saals neben der Tür. Ehrfürchtiges Staunen erfüllte ihn. Er hoffte, dass die Band so gut war wie der Hype, der sie umgab.
Am hinteren Ende der Halle flog eine Tür auf, und die vier Musiker marschierten theatralisch durch die Menge – »wie Könige, wie heldenhafte Eroberer, die die Massen teilen«16 – in Richtung Bühne.
»Hier sind sie«, brüllte Daniels und trieb die Stimmung zum Siedepunkt. »Aus England – ein warmes Bostoner Willkommen für LEDDDDDD ZEPPELIN!«
Ein Klang wie eine Sirene schnitt durch die Dunkelheit, bevor ein Scheinwerfer anging und Robert Plant erfasste, verrenkt wie ein Gummimensch über dem Mikrophon, seine Hand um eine Mundharmonika gelegt. Seine bluesige Klage wurde von einer kraftvollen Gitarrenlinie aus Jimmy Pages Les Paul nachgeahmt, und sie stürzten sich in »The Train Kept a-Rollin’«, einen alten Yardbirds-Standard, allerdings wie mit Aufputschmitteln und mit einer Lautstärke, die Taubheit herbeiführen konnte. Die Version, rollend und gekonnt vorgetragen, war dazu geeignet, die Aufmerksamkeit der Menge zu gewinnen.
Dann schrie eine Stimme wie ein verwundetes Tier auf: »I … I … I can’t quit you baby. Woooman, I’m gonna put you down a little while.«
Das war die Stimme von jemand, der Erfahrung mit Verzweiflung und gebrochenem Herzen und ein Gefängnis im Süden von innen gesehen hatte. Aber seltsamerweise kam sie aus dem Mund von einem mageren 20-jährigen Weißen mit Haaren, die jedes Gretchen neidisch gemacht hätten. Plant hatte das Motiv Generationen von unsterblichen schwarzen Minnesängern entwendet, aber es war mehr als kulturelle Aneignung. Es war echt empfunden. Da war etwas Raues in seiner Darbietung, das sich mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit richtete, angefeuert durch eine Art, die Instrumente zu behandeln, die das Bluesidiom auf den Kopf stellte. Die Spielweise passte weniger zu einem Jukebox-Laden als zu einer Garage. Sie war laut und aggressiv. Page verstand im Solo-Break seine Gitarren-Saiten als Starthilfekabel, drehte völlig durch und spielte, als ob Buddy Guy verrückt geworden wäre. Seine Finger flogen die Gitarrenbünde hinauf und hinunter, als ob sie zu heiß wären, um länger auf ihnen zu verweilen. Der Bass, den John Paul Jones (von seinen Freunden »Jonesy« genannt) bis zum Anschlag seines Verstärkers aufgerissen hatte, sandte Schockwellen durch die Menge. Ein Zuschauer sagte: »Die Vibrationen trafen deinen Brustkorb mit physischer Gewalt.«17 Und der Drummer John Bonham spielte sein Schlagzeug nicht – er attackierte es, als wäre es »ein Güterzug auf der Flucht«18. Die Schläge auf die Snare knallten so wie Gewehrfeuer, unter das der Saal genommen wurde.
Als Led Zeppelin ein paar Songs später auf »Communication Breakdown« stürzten, befand sich die Masse in einem aufgepeitschten Trance-Zustand. Ruckende Köpfe, zuckende Hände, Körper hemmungslos dem Rhythmus verfallen – die Tea Party erinnerte an eine Stammesorgie. »Man konnte fühlen, wie das gesamte Gebäude sich bewegte und bebte«19, erinnert sich ein Promotionmann von Atlantic Records im Rückblick an diesen Abend.
Die Band war locker, der Kontakt zum Publikum hatte sie richtig in Fahrt gebracht, und die gut eingeübten Arrangements hatten sich zu freien Jams voller Improvisationen entwickelt.
Rhythmen und Tempi änderten sich abrupt: »Dazed and Confused« glitt über zu »Shapes of Things«, und Jimmy Page, einen Hippie-Merlin imitierend, holte einen Geigenbogen hervor, sägte mit ihm über die Saiten seiner Gitarre und erzeugte »dabei einen Sound und Rückkoppelungen, so radikal, wie man sie seit Jimi [Hendrix] nicht mehr gehört hatte«20. Eine muskulöse Nummer, genannt »Pat’s Delight«, enthielt ein ausgefeiltes fünfminütiges Schlagzeugsolo, wobei Bonham, aus gutem Grund »Bonzo« genannt, seine Sticks wegwarf und die Felle und Becken mit den bloßen Händen bearbeitete, angetrieben von anfeuerndem Geheul. Die Band unterbrach ihre letzte Nummer »How Many More Times« immer wieder, um Teile von »Smokestack Lightning«, »Beck’s Bolero«, »For Your Love«, »The Duke of Earl« und »Over Under Sideways Down« einzustreuen. »Wenn du da nicht hüpfen, tanzen und grinsen magst, nachdem du das gehört hast, musst du tot sein«21, staunte der fassungslose Kritiker des Boston Phoenix.
Ein Mann und sein Bogen in der Hitze von »White Summer«
Am Ende des einstündigen Sets herrschte absolutes Chaos. Led Zeppelin, ausgepowert und beglückt, verbeugten sich mehrmals und verschwanden backstage, während die Menge in unbändige Ekstase ausbrach. Die Band feierte es mit einer Runde durstlöschendem Watney’s. Die Menge schrie im Chor nach Zugaben, lauter von Minute zu Minute. Es war klar, sie mussten wieder raus und weiterspielen. Nur – was? Sie hatten ihr Repertoire erschöpft. Nach einigem Zögern wurde entschieden, den gleichen Set noch einmal zu spielen.22 Was sonst hätten sie tun sollen? So etwas hatte man noch nicht erlebt. Diesmal dehnten sie die Solos aus, besonders Pages Gitarrenstück »White Summer«, das mit dem Geigenbogen in unerhört neue Klangwelten vorstieß. Und Plant hatte die Nerven, »Babe, I’m Gonna Leave You« von Joan Baez bis zum letzten Tropfen auszuwringen, und das in ihrer Heimatstadt, die sie auf denselben Sockel wie die heilige Muttergottes stellte. Die Band gab alles, was sie hatte. Sie sahen aus, als hätten sie ein Dampfbad hinter sich.23 Page und Bonham trugen nur noch ihre durchnässten Hemden, und Plants buntgemustertes T-Shirt klebte an seiner Brust.
Als sie fertig waren – ein zweites Mal –, wurde die Reaktion beängstigend. Der Applaus ging in Stampfen und Zertrümmern über. »Da schlugen Jugendliche ihre Schädel gegen den Bühnenrand«24, erinnerte sich ein fassungsloser John Paul Jones. Der Anhalter weinte. Er weinte! »Zeppelin war so verflucht heavy, meine Gefühle überwältigten mich, ich konnte nicht anders«25, meinte er.
»Ihr müsst noch mal raus«, beschwor Don Law die Band, nachdem sie backstage kollabiert war.
Er machte wohl einen Witz. Auf gar keinen Fall würden sie diesen Set noch einmal spielen. Es war schon ein Wunder, dass sie damit durchgekommen waren, es zweimal zu spielen, wenige hätten das Durchhaltevermögen gehabt, es auch nur so zu spielen, wie sie es getan hatten. Das war’s, das war die Show. Im Übrigen wurden sie ein paar Abende später in New York erwartet für ihr Debüt im legendären Fillmore East. Sie mussten mit dem haushalten, was noch im Tank war.
Nach fünf Minuten nicht nachlassenden Tumults sahen sie ein, dass es aussichtslos war. Sie mussten die Menge besänftigen, und sei es nur, um sie zu beschwichtigen. Ansonsten hätten sie den Laden auseinandergenommen. »Wir hatten keine andere Chance, als ganz schnell Ideen auszutauschen«, so John Paul Jones. »Wir riefen uns Songs ins Gedächtnis, die wir alle oder einige von uns ganz oder teilweise kannten, um zu sehen, was passiert.«26
Eine Stunde später hatten Led Zeppelin einen ganzen Set von Coversongs ausgewrungen, die sie aus den Zeiten ihrer diversen Bands als Jugendliche kannten. Sie verpassten den alten Kamellen Flügel, je nachdem, wer gerade von ihnen ein Gefühl für ein bestimmtes Stück entwickelte. Sie kämpften sich durch eine funkelnde Version von »Long Tall Sally«, zwei Titel von Eddie Cochran, »Somethin’ Else« und »C’mon Everybody«, die Jimmy Page mit Red E. Lewis and the Redcaps gespielt hatte, zwei Favoriten von den Beatles, »I Saw Her Standing There« und »Please Please Me«, und ein Chuck-Berry-Medley aus »Roll Over Beethoven« und »Johnny B. Goode«, das jedem die Gelegenheit zu einem Solo bot.
Backstage war oft nicht so glamourös, doch G schoss den Vogel mit seiner modischen Markenzeichen-Waschbären-Mütze ab.
Als sie in die Garderobe stolperten, zog sie Peter Grant, Zeppelins Manager und ein Gigant von einem Mann, in eine grizzlybärenartige Gruppenumarmung und hob sie mehrere Zentimeter in die Luft.27 Der üblicherweise finster blickende Grant »weinte, kann man sich das vorstellen«28, so Jones. Sein Mund war unnatürlich zu einer gerührten Grimasse verzogen, die die Briten »a nanker« nennen. Jimmy Page fühlte es. Er meinte später, dass dies der Moment gewesen sei – der Moment, in dem er wusste, dass »wir es tatsächlich schaffen würden«29. John Paul Jones betrachtet diese Nacht in der Tea Party als »den entscheidenden Gig von Led Zeppelin«30 – jetzt waren sie endgültig fokussiert. Nach einigen Monaten der Anlaufschwierigkeiten, des gegenseitigen Kennenlernens, Materialauswählens, Soundverfeinerns, Auftretens in erbärmlichen kleinen Sälen und unter widerlichen Umständen für wenig mehr als ein Taschengeld, nach Monaten der Unsicherheit, gekennzeichnet von Sorgen und Selbstzweifeln, hatten sie sich nun aus einem lahmen Schwarm neuer Yardbirds in Led Zeppelin verwandelt, eine Rock-’n’-Roll-Spitzentruppe.
Kein Zweifel: Led Zeppelin hatten sich in Boston Heldenstatus erspielt. Selbst ein normalerweise missmutiger Kritiker musste zugeben: »An vier aufeinanderfolgenden Abenden pusteten sie eine aus den Nähten platzende Tea Party ganz klar in den Charles River.«31
Keiner begriff das besser als der Anhalter. Er stolperte in die Nacht hinaus. Die Musik war kompakter und schärfer und härter als alles, was er je zuvor gehört hatte, gnadenlos in einer Lautstärke gespielt, die das Zentralnervensystem aufbohrte. Mann, war das laut! Nie zuvor hatte er in so einem kleinen Raum sechs große Rickenbacker Transonic-Verstärker bin zum Anschlag aufgerissen gehört. Der Lärm hatte das Publikum zur Raserei gepeitscht. Und der Sänger Robert Plant war eine Offenbarung. Sein Vortrag hob den Blues auf eine neue Ebene und gab ihm etwas Dunkleres und Dreckigeres als, sagen wir, Mick Jaggers clowneske Theatralik. Der Anhalter spielte in seiner Band als Frontmann eine ähnliche Rolle, und Plants Magnetismus, seine Ausstrahlung brachte ihn auf Ideen. Er musste sein Image verfeinern. Für den Anfang schon mal: seinen Namen ändern. Steven Tallarico brachte es nicht wirklich für einen Rockgott. »Steven Tyler« hatte mehr Biss. Er konnte es kaum erwarten, zu seinen Bandkollegen in Sunapee, New Hampshire zurückzukehren, wo seine Eltern eine Scheune hatten. Er wollte das, was er gesehen und gehört hatte, seinem Gitarristen Joe Perry mitteilen. Sie könnten etwas aus »Train Kept a-Rollin’« machen, auf ihre eigene Art, etwas rauer.
Was immer sie entscheiden würden, sie mussten Vollgas geben, denn Led Zeppelin hatten die Regeln des Spiels neu definiert. Sie hatten etwas Fundamentales mit dem Rock ’n’ Roll gemacht. Sie hatten seinen eindeutigen dynamischen Beat genommen und komprimiert, auseinandergenommen, wahnwitzige Verzerrungen hinzugefügt und ihn in eine kühne neue Richtung geschossen. Der Anhalter spürte es. Hard Rock, Heavy Metal, Progressive – sollten die Fans es doch nennen, wie sie wollten. Die Musik war im Begriff, wesentlich komplizierter zu werden.
Kapitel 1
Ein klarer Fall von Blues
1
Am Anfang war der Blues. Lange vor dem Jazz, dem Swing und sehr lange vor dem Rock ’n’ Roll gab der Blues der afroamerikanischen Lebenswirklichkeit in einer brutalen Realität eine Stimme. Ob du dich auf den Weg zur Kreuzung machtest, um den Herrn um Gnade zu bitten, ob du dich auf die mitternächtliche Liebespirsch machtest als der Mann, der alle Hintertüren kennt, ob du deine Lampe sauber und am Brennen hieltest – ganz egal, worum es ging, Bruder, du littest an einem klaren Fall von Blues. Du hattest den Blues, wenn du eine Frau mit dem verdorbensten Gesicht der ganzen Stadt hattest, wenn du um Wasser bittest und deine Süße gibt dir Benzin, wenn du dich auf den Tod zu fixt. Wenn dein Mojo auf Betriebstemperatur war, konnte ein guter zwölftaktiger Blues jede Sorte von Wehwehchen kurieren (außer natürlich den Summertime Blues), und in den frühen 1960ern entdeckte eine Generation von britischen Nachkriegsteenagern, dass er eine Medizin gegen die Langeweile war, die bleiern auf ihrem Leben lastete.
Wenn die 1950er Jahre auch nur irgendeinen Hinweis gaben, würden sie es nicht leicht haben. Als Teil der allgemeinen Öffentlichkeit hatten es die britischen Teenager mehr als nötig, den Blues zu singen. Sie waren eine praktisch nicht vorhandene Größe, klassenlos in einer Gesellschaft, die eine Oberschicht aus blasierten Sirs und Lords feierte. Teens hatten kein verfügbares Einkommen, keinerlei Einfluss und kaum eine Zukunft, auf die man sich hätte freuen können. In den meisten Fällen endeten sie in einem perspektivlosen Sackgassenjob, angestellt als Ladenverkäufer oder festgelegt auf die Rolle eines Niedriglohnschreibers in einem leblosen Verwaltungsbüro. Trost und Entspannung brachten nur die in einem örtlichen Pub verbrachten Abende, sturzbetrunken die vermoderten Gassenhauer aus der Zeit des Ersten Weltkriegs mitgrölend bis zur finalen Selbstbetäubung: »Ma, He’s Makin’ Eyes At Me«, »Daddy Wouldn’t Buy Me a Bow Wow«, »Knees Up Mother Brown«, »K-K-Katy Show Me the Way to Go Home«. Gott, was für eine Mausefalle! Sie brauchten andere Lieder.
Die Musik, mit der sie gefüttert worden waren, war ein unterirdischer Brei aus miefigen Music-Hall-Überresten, Orchesterstücken und banalem Hitparadenschmalz, von der BBC mit hoffnungsloser Gleichgültigkeit gespielt. Die einschläfernden Beeb-Sendungen Two Way Family Favourites und Housewive’s Choice – die einzigen Radiosendungen, wo populäre Musik zu hören war – warfen den Teens hin und wieder einen Knochen hin, indem ein oder zwei Titel vom seichten Crooner Tommy Steele oder vom skiffelnden Lonnie Donnegan gespielt wurden, und ein Klassiker von Hank Williams oder Roy Acuff, falls der DJ außerordentlich gnädig gestimmt war. Die Clubszene war auch nicht viel hipper. Hauptsächlich zog sie junge Leute an, die sich zu einer Musikform namens »trad« – also traditioneller Jazz – bewegten, die eigentlich aufgewärmter Dixieland war, gespielt von mittelalten weißen Männern, von denen einige Melonen trugen.
Cyril »Squirrel« Davis und Alexis Korner im Ealing Jazz Club 1952. Hinter ihnen ein jugendlicher Charlie Watts am Schlagzeug.
Die Swingin’ Sixties waren noch Jahre entfernt, als Chris Barber, ein Meister des traditionellen Jazz, 1960 die letzte halbe Stunde der Auftrittszeit seiner Band im Londoner Marquee Club einem ungewöhnlichen Paar von Bluesmännern überließ. Alexis Korner und Cyril »Squirrel« Davies waren weder schwarz noch besonders dem Weltschmerz verfallen, aber ihre räudige Spielart von elektrifiziertem Blues entzündete ein junges unruhiges Publikum, das entschlossen war zu explodieren. Sie waren gelangweilt von dem Gemümmel des Old School Jazz und dem klebrigen Pop von Cliff Richard und Adam Faith. Ab 1962 führten Korner, ein mittelmäßiger Gitarrist mit ausgezeichnetem Geschmack, und Davies, eine Verbrechervisage aus Buckinghamshire, der die dreckigste Chicago-Style-Mundharmonika blasen konnte, eine Gruppe an, die sie Blues Incorporated nannten, und eröffneten einen Club in einem Westlondoner Keller direkt gegenüber der U-Bahn-Station Ealing Broadway, um die Band dort der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Musik, die sie spielten, verdankte ihre DNA einem Konzert in der St. Pancras Town Hall am 20. Oktober 1958, wo Muddy Waters sein Londoner Debüt gegeben hatte. Das englische Publikum war gewöhnt an regelmäßige Bluestouren amerikanischer Folk-Blues-Künstler wie Big Bill Broonzy, Lonnie Johnson und Josh White, die sich alle auf akustischen Gitarren begleiteten. Bei dieser Show aber besaß Muddy die Unverschämtheit, seine Telecaster an einen Verstärker anzuschließen. Was für ein Sakrileg! Das Publikum war schockiert über seine nadelstichigen Sololinien. Zum ersten Mal hörten sie elektrischen Blues, und für viele klang es »hart, unhöflich … oft sehr laut«1. Tatsächlich buhten Leute, genau wie die Briten Bob Dylan ausbuhen sollten, als er 1966 »elektrisch wurde«. Als Muddy den Lautstärkeregler für »Honey Bee«, »Long Distance Call«, »I Can’t Be Satisfied« und »Louisiana Blues« ruchlos aufriss, schlug er ein völlig neues Kapitel mit seiner urbanen Version des Blues auf. Es beendete das verbindliche Trad-Jazz-Blues-Gemisch und, wie ein Historiker bemerkte, »hallte wider durch die Annalen des Rock für die nächsten 50 Jahre«2.
Kein Zweifel – vier Jahre später erschütterte dieses Beben immer noch die Wände des Ealing Club. Die Samstagabende dort wurden zu Ereignissen, die Leben veränderten.
Die schweißige, schlecht riechende Kaschemme, »manchmal knöcheltief im Schweiß stehend«3, platzte fast vor Kids, die an den Rändern lebten, die neugierig waren, die nirgendwo anders hineinpassten. Der Blues war ihr Glaubensbekenntnis geworden und Blues Incorporated ihre schrägen Propheten. Am Abend des 17. März 1962, als der Club vor ausverkauftem Haus öffnete4, bestand die Formation aus einer spontanen Besetzung, zu der Drummer Charlie Watts und Pianist Ian Stewart gehörten. Ab und zu wurden Amateure aus der Menge herausgepickt und eingeladen mitzumachen. An diesem Abend erblickte Alexis Korner einen schmalen, bleichen Bottleneck-Slide-Gitarristen, den er als Elmo Lewis kannte, und rief ihn hinauf auf die Bühne. Lewis war per Anhalter aus dem 90 Meilen entfernten Cheltenham gekommen, nur um eine Chance zu ergattern, mit Blues Incorporated auf der Bühne zu sein, und nun schlug er sich bewundernswert durch das Fade-Out-Solo von Elmore James’ Erkennungsmelodie »Dust My Broom«. Danach entdeckte Elmo Lewis einen Freund, der mit zwei schlaksigen Teenagern hinten im Club zusammenstand, und schloss sich ihnen für ein Schwätzchen an.
»Natürlich wusste ich, dass Lewis in Wahrheit Brian Jones hieß«, erinnert sich sein Freund David Williams, »und ich stellte ihn Mick und Keith vor, die beide von seiner Darbietung beeindruckt waren.«5
Diese Jungs waren hingerissen vom Blues – vielleicht trifft es besessen noch besser. Es war keine leichte Sache, gleichgesinnte Seelen in einem Vakuum zu finden. Eine kolossale Menge an musikalischer Fachsimpelei wurde an diesem Abend ausgetauscht. Das Nehmen und Geben in dieser Nacht ging ungefähr so vor sich:
»Wen hörst du so?«
»Ich hab da diese Scheibe von Memphis Slim gehört, ›Steppin’ Out‹, mit einem phantastischen Gitarrensolo drauf.«
»Wer spielt da Gitarre?«
»Das ist Matthew Murphy.«
»Jeeezus, Matthew Murphy?!«6
Die neue Musikszene entwickelte sich sehr schnell, Blues Incorporated war ihr instabiler Kern. Ihre Schüler gingen ihre eigenen Wege und formten ähnlich instabile Gruppen. Nicht lange nachdem der 19-jährige Mick Jagger mit der Band aufgetreten war (»nur Lippen und Ohren … er sah aus wie die Puppe eines Bauchredners«7), machte er sich mit dem Drummer Charlie Watts auf und davon. Watts wurde ersetzt durch Peter »Ginger« Baker, und Jack Bruce stieg am Bass ein. In den folgenden Monaten tauchten John Baldry, Eric Burdon und Rod Stewart auf, um ihr Glück am Mikrophon des Ealing Club zu versuchen, genau wie ein vor Lampenfieber versteinerter Eric Clapton, der eine glaubwürdige Version von »Roll Over Beethoven« herausbellte, während er hölzern unbeholfen auf den Fußboden starrte. Man wusste nie, wer dabei sein würde. Ein besonderer Abend präsentierte Paul Pond, den Kumpel von Brian Jones, der den Blues im vornehmsten Oxbridge-Akzent sang, Jahre bevor er als Paul Jones, Sänger bei Manfred Mann, wiederauftauchen sollte. Der Club war ein Hexenkessel, der vor Talenten überkochte.
Die Samstagabende im Ealing Club zogen die Bluesnächte am Donnerstag im Marquee nach sich, ein ehrwürdiges Jazzmekka in der Oxford Street in einem Keller unter dem Academy Cinema, das die Neuankömmlinge eher unwillig begrüßte. Anfang Dezember 1962 zog die Bluesnacht mehr als 1000 Enthusiasten an, die nach und nach das verknöcherte Erscheinungsbild des Marquee ankratzten. Die Donnerstagabende inspirierten die Montagabende, und das Marquee als solches setzte den Flamingo, den 100 Club, Studio 51, Eel Pie Island, den Red Lion in Sutton, den Crawdaddy Club in Richmond, das Railway Hotel in Harrow und den Ricky-Tick in Windsor in Gang – als der Blues explodierte und die Szene Wurzeln fasste.
Langspielplatten mit obskurem Material waren die angesehenste Form von Währung. Es war zu dieser Zeit nahezu unmöglich, in London ein Bluesalbum zu kaufen. Vielleicht stolperte man über ein Secondhand-Exemplar in dem staubigen Kelleranhängsel von Dobell’s Jazz Shop. Wenn du der Glückliche warst, eine seltene Kostbarkeit ausfindig gemacht zu haben – sagen wir, Howlin’ Wolfs Chess-Meisterwerk von 1959 »Moanin’ In The Moonlight« mit seiner glühend heißen Version von »Smokestack Lightning«, oder irgendeine der Duke-Records-Importe von Junior Parker, Otis Rush oder Bobby »Blue« Bland« –, dann warst du der Mann der Stunde. Und was für eine Verbindung das zu anderen schuf! »Wenn irgendjemand eine Platte hatte, hatte sie jeder«, erinnert sich Dave Williams. Das Album wurde herumgereicht, untersucht, auseinandergenommen, interpretiert, bis ins Kleinste durchleuchtet und analysiert, bis die allerletzte Nuance aus seinen Rillen herausgekratzt war.
Genau das geschah, als Mick, Keith und Brian eine 12-Inch-Compilation-LP namens Bluesville Chicago in die Hände bekamen, die fünf der authentischsten Künstler von Vee-Jay Records vorstellte. Es könnte Mick gewesen sein, der sie bei Dobell’s in der Charing Cross Road fand. Er belagerte diesen Laden an Freitagnachmittagen in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden an der London School of Economics nur eine Ecke weiter. Wie auch immer: Das Album war eine Goldmine, was das Material betraf, unverfälschter Blues, wie ihn niemand in England spielen konnte. Mit solchen Songs konnte man sogar eine Band gründen, und genau das beschlossen die drei Jungs Jagger, Keith Richards und Brian Jones. Es gab ihnen eine solide Grundlage, mit der sie arbeiten konnten, und sie übten unverzüglich zwei Songs von Eddie Taylor ein – »Bad Boy« und »Ride Em On Down« – sowie »I Wish You Would«, »I Ain’t Got You« und »Don’t Stay Out All Night« von Billy Boy Arnold.
Anfangs nannten sie sich The Rollin’ Stones, nur ein Trio, noch Monate entfernt von einem rechtmäßigen Bassisten und Drummer. Ihr erster Auftritt, in Wahrheit nur ein Herumjammen, war im Hinterzimmer von The Grapes, einem Pub am unteren Ende der Sutton High Street. 15 Leute kamen, von denen nur drei Eintritt bezahlten, und sie brachten ihre fünf Songs, ergänzt durch »Too Much Monkey Business«, eine Chuck-Berry-Nummer. Ungeeignet, größere Auftritte zu absolvieren, traten sie regelmäßig mit Alexis Korners Band auf und spielten rudimentäre Versionen von B-Seiten von Chuck Berry und Bo Diddley.
Mehr als irgendjemand sonst verkörperten The Rollin’ Stones den neuen Sound des Blues. Keine junge Band hatte je zuvor so etwas gespielt. Sie nahmen den Chicago-Stil und verpassten ihm eine ungehobelte britische Wendung. Irgendwie legten sowohl Micks punkiges Genöle als auch die dreckigen Gitarrenlicks die anzüglichen sexuellen Anspielungen bloß, die in den Texten verborgen waren. So wie sie den Blues spielten, gab es keinen Zweifel daran, was es bedeutete, »unter die Motorhaube zu schauen und nach dem Vergaser zu sehen«. »Was immer es war, es war abgedreht, laut und jenseits von allem, was man so kannte«, so Jim McCarty, später der Drummer der Yardbirds, der einen der ersten Auftritte der Stones in Richmond mitbekam, einer Vorstadt im Südwesten von London. »Es war ein aufwühlender Sound, unfassbar originell.« McCarty kam es vor, »als sähe man eine Band vom Mars«8.
Selbst mit einer schmalen Besetzung machten die Stones klar, dass sie nicht aufzuhalten waren. Sie arbeiteten besessen daran, den Blues zu gentrifizieren und den Sound so neu zu deuten, dass er einem jüngeren, wilderen, weißeren Publikum gefallen würde. Und sie waren nicht allein. Cyril Davies’ R&B All Stars, angeführt vom Sänger Long John Baldry mit Rod Stewart an der Mundharmonika, übernahmen die Donnerstagabende im Marquee, und John Mayalls Blues Syndicate dehnte die Szene auf solche Läden wie Klooks Kreek, Eel Pie Island und das Fishermen’s Arms aus. Für eine Generation britischer Teenager, die darauf geeicht war, ihre Spur zu hinterlassen, war der Blues Lebensgefühl und Geisteszustand geworden.
Im September 1962 schlug ein Blitz in die Community ein, als die Rede davon war, dass die Götter sich versammeln würden … ausgerechnet in Manchester. Wenn die Gerüchte zutrafen, hatten sich authentische Blueskünstler – nicht Teenager-Möchtegerns, sondern Hohepriester des Mississippi Delta und der South Side von Chicago – darauf geeinigt, einen Abend am 21. Oktober, einem Sonntag, gemeinsam in der Free Trade Hall aufzutreten. Die Nachricht verbreitete sich »wie verdammtes Höllenfeuer«, die Namen wurden ehrfürchtig geflüstert. John Lee Hooker, Sonny Terry & Brownie McGhee, T-Bone Walker, Memphis Slim, Willie Dixon. Zusammen, leibhaftig, unter einem Dach. Das American Folk Blues Festival. Wie einer der Stammgäste des Ealing Club es ausdrückte: »Das war der heiße Scheiß!«9
In der Tat. Eine Karawane von Schülern aus London wurde mit der Präzision einer RAF-Offensive organisiert. Ein Lieferwagen wurde gemietet, und ein Fahrer, Graham Ackers – der einzige Junge mit einem Führerschein – wurde für den fünfstündigen Trip nach Norden angeheuert. Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards wurden in London aufgesammelt und zusammen mit vier anderen wie Sardinen in den fensterlosen Laderaum gepfercht, wo es nicht mehr als Seitenbänke anstelle von Sitzen gab. Wie dem auch war: Musik entschädigte alle für die widrigen Reiseumstände. Graham Ackers hatte Bandkopien von Swing Low mitgebracht, einer französischen Neuerscheinung von den Staple Singers, deren letzter Song auf Seite zwei mit dem Refrain »This may be the last time, may be the last time, I don’t know« endete. Ein anderer Mitfahrer namens Mick Sales hatte das brandneue Album Howlin’ Wolf dabei mit einem Schaukelstuhl auf dem Cover. Für einen Teil der Reise war es Gegenstand intensiver Diskussionen. (Später, als es ihnen gelang, einen Plattenspieler aufzutreiben, hörten die Jungs zum ersten Mal »Little Red Rooster«.) Der Einzige, der in dieser Delegation fehlte, war der 19-jährige Jimmy Page, ein Wissbegieriger an den Außenrändern dieses Zirkels, der an diesem Abend einen Auftritt hatte, er spielte mit Neil Christian & the Crusaders. Er nahm den Zug und kam am späten Sonntagnachmittag in Manchester an.
Es war eine lange, unangenehme Fahrt auf der M1 durch die Provinz und für alle Mitfahrenden ihr erster Trip auf einer Autobahn. Nicht an alles Notwendige hatten sie gedacht. Als sie am Samstag im Morgengrauen in Manchester ankamen, wussten sie nicht, wo sie bleiben sollten. Die Glücklicheren kamen in einer Studentenbude unter, Brian Jones fand Unterschlupf beim CVJM, Mick und Keith aber, abgebrannt bis auf den letzten Penny, schliefen einfach in dem nicht wärmegedämmten Auto. Der Sonntagmorgen war neblig und kalt. Da die erste Show nicht vor 18 Uhr abends begann, hatten sie eine Menge Zeit totzuschlagen, sie streiften durch die Straßen der Stadt und lungerten in einem chinesischen Restaurant herum, über einem einzigen Gericht versammelt. Ihre Gespräche, die sich über Stunden und Stunden hinzogen, waren Fachsimpelei mit Tunnelblick.
»Ob Hooker wohl so klingt wie seine Platte?«
»Werden sie unsere Lieblingslieder spielen?«
Mick fragte sich, ob die Mundharmonika verstärkt werden würde. »Glaubt ihr, Shaky Jake Harris bläst direkt ins Mikro?«
Gegen fünf Uhr, müde und leergeredet, trafen sie sich mit Jimmy Page unter einer Arkade der Free Trade Hall, einem palazzoartigen Bauwerk im italienischen Stil in der Stadtmitte. Mick, Keith und Brian wurden den anderen vorgestellt, und man verstand sich auf Anhieb bestens. Jimmy war bereits auf der Sonnenseite. Mit nur 19 Jahren hatte er sich einen beachtlichen Ruf als umwerfender Gitarrist erworben, er hatte mit Blues Incorporated im Marquee gespielt und war schon Mitglied zweier bekannter Cover-Bands gewesen, Red E. Lewis & the Red Caps und Neil Christian & the Crusaders. Mick, Keith und Brian waren begierig, von ihm zu profitieren, auch wenn er nicht Teil ihrer Welt war. Sie waren gleichgesinnte Freigeister, der Musik verfallen und auf der Suche nach einem Leben, das die Regeln der Konvention brach.
Jimmy war Brian Jones nicht völlig fremd, er sah in ihm so etwas wie ein Blues-Wunderkind. Er hatte ihn bereits im Ealing Club bei einem seiner Soloauftritte beobachtet. »Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Elmore-James-Zeug«, erinnert sich Jimmy. »Plötzlich machte es klick. Es lag an der Abstimmung. Brian hatte es raus.« Er hatte sich darauf gefreut, Brian zu treffen, auch wenn das nicht die Hauptsache war. »Ich kam mit, weil ich unbedingt John Lee Hooker sehen wollte.«10
Die amerikanischen Blueskünstler spielten an diesem Abend zwei Konzerte, und die Jungs hatten Tickets für beide – billige Sitze auf den billigen Plätzen für die erste Show, aber ganz nahe dran für die zweite. Zwischen den Aufführungen trafen sie sich an der Bar. Abgesehen von Page, der sich aufgrund gut bezahlter Gigs eine Menge leisten konnte, reichte es für die meisten nur für ein halbes Bitter. Anderseits war die Konversation unbezahlbar.
Sie waren fasziniert von dem beeindruckenden Memphis Slim, mehr noch von seiner geschniegelten Erscheinung als von seinem üppig ausgeschmückten Vortrag. Der Mann wusste wirklich, wie man einen Anzug trägt. Er war geschmeidig und feingliedrig, und mit seinem gegelten High-Gloss-Haar sah er aus wie der Inbegriff von Chic mit seiner weißen Pepé Le Pew-Strähne mitten auf der Stirn. Slim hatte Honky-Tonks und Tanzschuppen in Arkansas mit einem Set von Jump-Blues-Perlen gerockt, der »Every Day I Have the Blues«, »Steppin’ Out« und »Rockin’ the Blues« enthielt, aber er brachte sie in einer Art und Weise, die sich mehr auf Charme als auf die übliche Spielart des Blues verließ. Wie auch immer: Die jungen Musiker verfolgten verzaubert seinen Set. Von Slims Kontrabassspieler konnten sie überhaupt nicht genug bekommen, einem Mann von beachtlichen Ausmaßen und hünenhafter Größe, der sein Instrument wie ein Kinderspielzeug handhabte: der legendäre Willie Dixon.
Der einzigartige Willie Dixon
Mehr als jeder andere hatte Dixon den Sound des Chicago Blues geformt. Als einer der unersetzlichen Eckpfeiler von Chess Records hatte er die frühesten Aufnahmen von Otis Rush und Buddy Guy arrangiert und produziert und mit Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson, Jimmy Witherspoon, Muddy Waters, Chuck Berry und Bo Diddley gearbeitet – dem gesamten Pantheon. Doch hatte er als Songwriter den größten Einfluss. Das Dixon-Songbook war die Bibel des Blues: »Hoochie Coochie Man«, »I Just Want To Make Love To You«, »Little Red Rooster«, »Spoonful«, »You Can’t Judge a Book By the Cover« und – möglicherweise besonders beeindruckend für den jungen Jimmy Page – »You Need Love«, dessen Text mit »You’ve got yearnin’ and baby I got burnin’« beginnt.
Dixon schlug den Bass so, wie er seine Gegner im Ring auf seinem Weg zu den Illinois-Golden-Gloves-Schwergewichtsmeisterschaften 1937 behandelt haben dürfte.11 Er war die Maschine, das Ruder und der Anker hinter Memphis Slim, und er begleitete auch die anderen Künstler bei ihren Darbietungen.
Mick Jagger und Brian Jones waren besonders gefesselt von Shaky Jake Harris, der »mit seiner Mundharmonika, so laut er konnte, direkt in das Mikrophon blies«12. So etwas sahen sie zum ersten Mal. Sie hatten gehört, dass das die Technik von Little Walter war, aber nun sahen sie es in echt, und sie waren umgehauen von dem explosiven Sound, der dabei herauskam. Sie machten sich in Gedanken Notizen für die anstehenden Gigs. Shaky Jake würde bei den Stones seine Spuren hinterlassen, doch der Triumph des Abends gehörte T-Bone Walker und John Lee Hooker.
Keiner der Jungs hatte je derartig extravagante Showmanship gesehen. Natürlich kannten sie Chuck Berrys Entengang über die Leinwand in Rock, Rock, Rock! und Jazz On a Summer’s Day, aber auf die krasse Theatralik von T-Bone Walker waren sie nicht vorbereitet. Er stürmte über die Bühne wie ein Gladiator und schwang seine Gitarre wie ein Schwert in einem römischen Kolosseum. Ein Zuschauer erinnerte sich, wie er »die Gitarre zwischen seine Beine fallen ließ und sie dann hinter seinem Kopf zu einem Solo hochriss«13. Oder er lag flach an der Bühnenkante, starrte das Publikum an, und seine Finger verschmolzen mit dem Griffbrett wie durch Osmose. Genauso wie Shaky Jake bei den jungen Stones gelandet war, sollte Jimmy Page niemals den verwegenen Walker vergessen.
Im Vergleich dazu war John Lee Hooker eine Zimmerpflanze, das Modell der Zurückhaltung, aber mindestens so beeindruckend. Sein treibendes Boogiegitarrenspiel war so eigenartig, er mixte Tempos und Betonungen, als wären sie Cocktails, lieber geschüttelt als gerührt. Dies war das echte Ding, der dunkle Delta Blues, für den Jimmy Page hergekommen war. »Boogie Chillun« und »I’m in the Mood« hallten spirituell durch den Saal. Während Hookers kurzem Set erinnert sich Dave Williams, die Männer neben sich beobachtet zu haben, Jimmy Page links von ihm, Keith Richards rechts. »Ihre Unterkiefer waren auf ihren Knien. Sie waren gebannt. Sie haben während des Sets kaum geatmet.«14
Nach einem grandiosen Finale konnten die Jungs nicht mehr an sich halten. Sie stürmten die Bühne, während ihre Idole bei den Bodenlichtern verweilten, ziemlich überwältigt von der unerwarteten Stampede. Mit einem Gesichtsausdruck wie ein Frettchen fuchtelte Mick Jagger nervös mit seinem Programm vor seinem Lieblingskünstler herum – »Bitte, Mister Hooker, kann ich ein Autogramm haben?« –, und Hooker, schockiert von so viel Aufmerksamkeit, kritzelte eine Unterschrift auf das Cover. Währenddessen hatte Brian Jones Shaky Jake belagert und eine Trophäe erbeutet – die Harmonika des Musikers. Am anderen Ende der Schlange der Danksagenden war es Jimmy Page und Keith Richards gelungen, die Hände ihrer Idole zu schütteln, aber sie blieben stumm, überwältigt.
Erst als sie sich wieder im Lieferwagen für die Heimfahrt versammelten, wich die emotionale Spannung. Die Jungen jubelten ekstatisch. Der Blues war für sie lebendig geworden. In den letzten paar Monaten hatten sie sich als Blueskünstler gebärdet, indem sie so spielten, wie sie dachten, dass der Blues klingen sollte. Hier war er nun, das Original, zum Lernen und Aufsaugen. Es war in ihren Köpfen. Sie waren besoffen davon.
Als der Wagen Manchester verließ, war es spät, kurz vor Mitternacht. Nach einigem Hin und Her stimmten sie für eine Nachtfahrt zurück nach London. Mick musste um zehn am nächsten Morgen in seiner Klasse sein. Keith musste sich um seinen Job als Postbote kümmern, und Jimmy war für einen vollen Tag von Aufnahmesessions gebucht, die seine frühe Anwesenheit erforderten. Sie hatten gerade noch genug Benzin, um es zu schaffen, aber sie wären auch vermutlich allein mit ihrem Adrenalin zurückgekommen.
»Wir schwebten hoch über den Wolken«, erinnert sich Dave Williams. Brian Jones erhöhte das Energielevel, indem er Shaky Jakes Harmonika herausholte und ein stimmungsvolles Bluesmotiv blies. Der ganze Wagen – sogar Jimmy Page, nicht gerade der größte Sänger der Welt – brach in ein Lied aus.
Bright lights, big city
Gone to my baby’s head …
Jetzt war es offiziell: Großbritannien war vernarrt in den Blues. Bis zum Frühjahr 1963 hatten sich die Rolling Stones (nicht mehr einfach nur »Rollin’«) durch Hinzufügung des Bassisten Bill Wyman, Ian Stewart am Klavier und Drummer Charlie Watts die Naturgewalt des erdigen R&B nutzbar gemacht. Sie plünderten die Grooves von Jimmy Reed at Carnegie Hall, Howlin’ Wolfs Schaukelstuhl-Album und jede Chuck-Berry-Platte, die es gab, und sie reicherten diese Songs mit einem Rock-’n’-Roll-Backbeat an, der praktisch den Blues neu erfand. Mit einem robusten Set gemischter Songs schlugen die Stones in einen behelfsmäßig ausgestatteten Club hinter dem Station Hotel in Richmond auf. Das war nicht nur ein Auftritt, sondern ein längeres Engagement – und mit Fans. »Es war eine Sache der Atmosphäre«, berichtete ein örtlicher Promoter. »Man schien dort in einer eigenen Welt zu sein, wenn die Stones eine Musik spielten, die den ganzen Laden elektrisierte.«15
Aber es war Jimmy Page, der über den Blues hinausdachte. Im Sommer 1966 war er der Kopf der Yardbirds und drehte an den Stellschrauben des britischen Elektrik-Blues-Idioms.
Der Blues dieser Gruppe wurde immer fortschrittlicher, weniger strukturiert, schärfer, rauer, und ihre Auftritte immer unvorhersehbarer. Aber das reichte Jimmy noch nicht. Der Blues hatte die Fundamente gelegt für einen musikalischen Aufbruch, der nach Innovation, Technologie und Lautstärke lechzte, nach unglaublicher Lautstärke. Page hatte eine glasklare Vorstellung vom Blues; für ihn diente er als ein Sprungbrett hin zu etwas Größerem, Dynamischerem. Und er wusste ganz genau, wo er hinwollte.
2
Jimmy Pages Blues hatte nicht den Anspruch, der Erbe vom Mississippi oder von Chicago zu sein. Er stammte aus den Tiefen des Surrey Delta, eine Gegend, die auf keiner Landkarte verzeichnet war.
Es ist kaum zu glauben, dass die Heilige Dreieinigkeit der britischen Gitarrengötter – Page, Jeff Beck und Eric Clapton – allesamt aus einer vornehmen, bewaldeten Gegend im Südosten von England stammten, die man eher mit Millionären als mit dem Blues in Verbindung brachte. Der Landstrich, gelegen an Nebenarmen und Zuflüssen der Themse, war Teil des prosperierenden Speckgürtels Londons. Jimmys Eltern – James, ein Personalmanager in einer Plastikmantelstofffabrik, und Patricia, eine Zahnarzthelferin – zogen 1952 dorthin nach Epsom, als ihr einziges Kind acht Jahre alt war.
Epsom war eine alte Marktstadt, klassisch mit einem Platz als Mittelpunkt, flankiert von typischen Bauwerken aus der Ära Georgs VI.: eine Bank, eine Kirche, eine Stadthalle. Sein bekanntestes Gebäude war ein 70 Fuß hoher Uhrenturm aus roten Ziegeln. Er dominierte die Skyline und diente als Treffpunkt zum Abhängen für die örtlichen Teenager – in Ermangelung eines geeigneteren Ortes. Solange man zurückdenken konnte, war Epsom ländlich und verschlafen gewesen. Eingebettet in den Schoß nicht zersiedelter Hügel und Ebenen konnte man es mit Ewell, Guilford, Ashtead, Horsham oder jeder anderen nahe gelegenen Ortschaft verwechseln. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Epsom wachgeküsst, als ein reiches Vorkommen von Mineralquellen die stille Stadt zu einem begehrten Kurort machte, wegen seines Heilwassers gern frequentiert von der Oberschicht. Die Herstellung von Epsom-Salz – ergiebige, dem Wasser entnommene Vorräte von Magnesiumsulfat – verstärkte noch den Ruf der Stadt als vornehmes »Spa«, versüßt durch fünf psychiatrische Kliniken, die gegen Ende des Jahrhunderts erbaut wurden. Und zweimal im Jahr verdoppelte sich mindestens die Einwohnerschaft wegen zweier klassischer englischer Pferderennen auf den Epsom Downs.
Die Pages bewohnten eine übliche »Zwei oben, zwei unten«-Haushälfte in der Miles Road, einer Ansiedlung identischer, unauffälliger Häuser, typisch für das Nachkriegsengland. Das waren sehr bescheidene Wohnstätten, oft ohne eingebaute Toiletten, und viele Gebäude, so auch Jimmys, grenzten hinten an die Eisenbahnlinie nach London. Es gab schon auch vornehme Anwesen in Epsom, aber die Miles Road befand sich eindeutig auf der falschen Seite der Gleise. »Es war eine unscheinbare Straße«, erinnert sich ein Nachbar der Pages. »Es gab kaum Autos, weil sich keiner eines leisten konnte, und nichts in den Vorgärten, woran man irgendein Haus vom andern hätte unterscheiden können.«1 Wie auch immer: Der hintere Garten, üblicherweise zweimal so groß wie die Hausfläche, war äußerst wertvoll, wurde doch jeder Quadratmeter in diesen mageren Jahren für den Anbau von Gemüse genutzt.
Zum Glück gab es keinen Mangel an Spielkameraden. Der Babyboom der Kriegszeit war in nahezu jedem Haus in der Miles Road angekommen. Jeden Tag konnte Jimmy einen Tennisball durch die Straße kicken oder mit seinem direkten Nachbarn Jeff Reese rollschuhfahren, mit Dave Housego, Pete Neal oder Dave Williams, sie alle lebten im gleichen Block. Viele Jungen aus der Nachbarschaft in Jimmys Alter waren Söhne amerikanischer Soldaten, die in England stationiert waren, so dass in der Schule des Öfteren Baseball anstelle von Cricket gespielt wurde.
Außerdem brachten die Amerikaner ihre unvergleichliche Musik mit. Sie besaßen Schallplatten – meistens Country and Western und Rockabilly sowie ein Sammelsurium von Chess, Checker, Sun und seltenen Veröffentlichungen, die eine Brücke vom Rhythm and Blues zum Rock ’n’ Roll schlugen, der noch in den Kinderschuhen steckte. Da die Amerikaner oft umzogen, landeten viele dieser Platten in Secondhand-Läden, vermengt mit Ausschussware aus den Musicboxen – und gerieten so in die mehr als dankbaren Hände britischer Kids. Jimmys Freund Dave Williams tat sich als Retter dieser aussortierten Kostbarkeiten hervor, indem er unermüdlich Mülleimer durchforstete und jede Platte am Leben erhielt, deren Sängernamen interessant klang – amerikanisch. Darunter befanden sich die längst vergessenen Pioniere der Schallplattengeschichte wie Texas Tyler, Jackie Lee Cochran, Wade Hall, Jessie Hill und Ronnie Self. »So viele waren schlicht und einfach Mist«, so Williams, »aber hin und wieder stieß ich auf eine vom Johnny Burnette Trio oder von Carl Perkins, und dann rannte ich sofort rüber zu Jimmy, um meine Entdeckung zu teilen.«2
Jimmy fand die Musik unwiderstehlich. »Er liebte es, Platten im Radio zu hören«3, erinnerte sich seine Mutter. Wie die meisten britischen Familien hatten die Pages einen Radioschrank aus Mahagoni im Wohnzimmer, und Jimmy bearbeitete seine Bakelit-Drehknöpfe mit der Kompetenz eines Safeknackers. Wenn der Himmel und die Wetterlage gnädig waren, konnte Radio Luxemburg eingestellt werden, die einzige Radiowellenverbindung zum Rock ’n’ Roll im Vereinigten Königreich. Der statisch aufgeladene Empfang klang wie gefiltert durch einen Windkanal, aber er war ein Hinweis auf die Revolution, die sich am Horizont zusammenbraute. »Du musstest dich ans Radio klemmen und ausländische Stationen hören, um überhaupt gute Rockplatten hören zu können«4, so Jimmy. Er verpasste keine Sendung. In wolkenlosen Nächten, das Ohr an den Lautsprecher gepresst, konnte er Fragmente von Fats Domino oder Buddy Holly oder LaVern Baker oder den Everly Brothers oder von Elvis erwischen. Außerdem stieß er auf die 15-minütigen Beiträge von DJ Alan Freed auf dem American Forces Network – ein Potpourri aus R&B, Rockabilly, Pop und dem wilden Zeug, das man mit üblen Jungs wie Gene Vincent und Eddie Cochran verband.
Bis zum Alter von 12 Jahren beschränkten sich Jimmys sämtliche musikalischen Erfahrungen darauf, im Chor der St. Barnabas Anglican Church zu singen. »Er machte sich an alle Klaviere heran, die irgendwo bei Leuten standen, die wir besuchten«, fiel seiner Mutter dazu ein. Ansonsten hatten die Pages keine Beziehung zu Musikinstrumenten. Gut, es gab da eine Western-Gitarre, die sie im Haus vorgefunden hatten. Sie war nichts weiter als ein vernachlässigtes Ziermöbel in einer Ecke des Wohnzimmers, das niemand bisher weggeworfen hatte. Es war immerhin eine Gitarre … mit Stahlsaiten … spielbereit … mehr oder weniger. Sie zu entdecken fühlte sich für Jimmy an »wie ein Wink des Himmels«5. Seine leidenschaftliche Neugier auf sie wurde angeheizt durch zwei Songs, die er im Radio gehört hatte. Der erste war das Rockabilly-Meisterstück »Baby, Let’s Play House« von Elvis Presley. Von seinem hemmungslosen, stotternden Anfang »Whoa, baby, baby, baby, baby, baby / Baby, baby, baby, b-b-b-b-b-b-baby, baby, baby« war Jimmy überwältigt. »Ich hörte die akustische Gitarre, den geschlagenen Bass und die elektrische Gitarre – drei Instrumente und eine Stimme, und sie erzeugten so viel Energie, ich musste einfach ein Teil davon sein.«6 Es war unmöglich, davon nicht gepackt zu werden. »Ich wollte das spielen. Ich wollte wissen, worum es dabei ging.«7
Fast genauso verführerisch, wenn auch auf eine völlig andere Art, war »Rock Island Line«, Lonnie Donegans überhitzte Verballhornung des Klassikers von Leadbelly, die Mitte der 1950er Jahre bei den britischen Teenagern einen wahren Musikfimmel auslöste. Das Ganze nannte sich Skiffle – ein schwarzer Slangausdruck für Musik8, die bei Wohnungspartys gespielt wurde, ein Mix aus amerikanischen Folk- und Bluesstandards im Cornball-Stil altmodischer Jug Bands. Im Wesentlichen ermöglichte Skiffle Kindern aus der Arbeiterklasse, sich in Hinterhofcombos zusammenzutun und ganz einfache hausgemachte Instrumente zu benutzen – ein Waschbrett für die Perkussion, ein Seil an einer alten Teekiste als Bass, ein Kamm umwickelt mit Butterbrotpapier als Blasinstrument, und alles zusammengehalten von einer Ukulele oder einer Gitarre. Skiffle einen Fimmel zu nennen wäre eine ziemliche Untertreibung. Zwischen 30 000 und 50 000 Skifflegruppen schossen in Großbritannien aus dem Boden9, eine davon angeführt vom zwölfjährigen Jimmy Page.
Die alte akustische Gitarre kam ihm da gerade recht. Er überredete einen älteren Schulkameraden, Rod Wyatt, ihm dabei zu helfen, das störrische Instrument zu stimmen und ihm zu zeigen, wie man ein paar Grundakkorde schrammelt. Er konnte sogar eine Version von »Rock Island Line« heraushauen, und das beeindruckte Jimmy ohne Ende. Das kettete ihn mehr oder weniger an der Gitarre fest, bis er den verdammten Song beherrschte. »Von Anfang an waren Jimmy und die Gitarre an der Hüfte miteinander verwachsen«, meinte Dave Williams, der regelmäßig vorbeischaute, um die Fortschritte seines Freundes zu überprüfen. »Als er erst einmal diese Akkorde intus hatte, brachte er sich praktisch selbst das Spielen bei.«10
Umgehend besorgte sich Jimmy ein Exemplar der Gitarrenschule » Play in a Day von Bert Weedon. Für zukünftige britische Rockvirtuosen wie George Harrison, Dave Davies, Keith Richards, Pete Townshend und Eric Clapton war es die Bibel. Aber Spielenkönnen in einem Tag dauerte für Jimmy Page eine gefühlte Ewigkeit. »Ich war viel zu ungeduldig«11, gab er zu. Außerdem waren die Anweisungen viel zu einfach gefasst. Sie bildeten die vertrackten Fingersätze, die er auf Schallplatten hörte, einfach nicht ab. Es war leichter für ihn, nach Gehör zu spielen. »Du hörtest dir das Solo an, nahmst den Tonarm hoch und ließest ihn wieder runter, um es noch mal zu hören.«12 Auf diese Art gelang es ihm, ganz allein die Arrangements herauszufinden.
Das Problem war nur, dass seine Gitarre nichts taugte.13 Sie war nicht mehr als ein Spielzeug. Die Saiten standen zentimeterweit von den Bünden ab und waren stumpf und ohne Klang. Er war über diese Gitarre hinausgewachsen eigentlich seit dem Augenblick, als er sie zum ersten Mal in die Hand genommen hatte. Was er wollte – wovon er träumte –, »war so ein Ding, wie man es auf den Covers von Gene Vincent and the Blue Caps und Buddy Holly sah«, meinte er. »So eine Gitarre zu bekommen war, wie von einem Cadillac zu träumen.«14 Eine bessere Gitarre war eine teure Anschaffung für eine Familie aus der Arbeiterklasse. Sein Vater war gar nicht abgeneigt, aber er stellte Bedingungen. »Okay«, sagte er, »aber du machst dafür die Zeitungsrunde.«15 Jimmy gehorchte und übernahm die sonntägliche Auslieferungsrunde in Epsom, ging von Haus zu Haus und schulterte eine Last von Zeitungen, angefüllt mit Wochenendbeilagen, die eine Tonne wogen.
»Ich machte die Zeitungsrunde und kriegte eine Hofner Senator«16, erinnerte er sich. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch keine Lösung. Die Senator war eine solide Ahornlaminat-Gitarre mit einem f-Loch, die dazu neigte, bei jedwedem Anschlag zu vibrieren. Jimmy konnte einfach keinen vernünftigen Sound aus ihr herausbekommen. »Nachdem ich mehr und mehr Zeitungsrunden gedreht hatte, bekam ich einen elektrischen Tonabnehmer für sie«, sagte er. Aber wie sollte er sie verstärken? Und siehe da: Das Radiogrammophon seiner Eltern hatte einen Eingang auf der Rückseite. »Als der Sound aus den Lautsprechern kam, konnte ich es nicht fassen.«17 Auch wenn er nicht gerade die Wucht von Mach 1 hatte, erfüllte er zunächst einmal seinen Zweck für Jimmy. Was er jedoch wirklich brauchte, war eine elektrische Gitarre.
Vorerst jedoch reichte die Feuerkraft der Senator für ihn, um eine Band zusammenzuwürfeln. Dave Housego





























