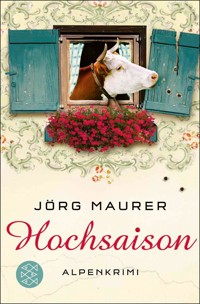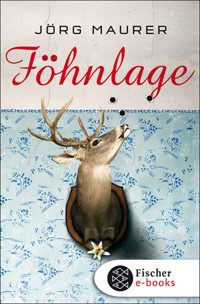16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den Abenteuern eines vergesslichen Mannes Daniel Koch ist sportlich, freundlich und fühlt sich topfit. Dass er manchmal Sachen vergisst, kümmert ihn nicht, das passiert ja jedem mal. Dann aber sagt ihm seine Ärztin, dass er Alzheimer hat und der Verlauf der Erkrankung nicht aufzuhalten sei. Und tatsächlich, Daniel driftet sehr rasch immer mehr aus der Realität ab. Doch in dem Maße, in dem die ihm vertraute Welt verschwindet, tut sich eine neue auf: eine Welt mit verblüffenden, schrägen, komischen Geschichten. Und Jörg Maurers vergesslicher Held stürzt von einem Abenteuer ins nächste...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jörg Maurer
Leergut
Roman
Über dieses Buch
Daniel Koch ist eine sportliche Erscheinung in mittleren Jahren. Er lebt allein, treibt viel Sport und fühlt sich topfit. Dann fällt ihm auf, dass er ein wenig vergesslich wird. Sein Schlüsselerlebnis: An einer Verkehrsampel weiß er plötzlich nicht mehr, was die Farben Rot und Grün bedeuten. Er geht in die neurologische Praxis von Sarah Gossberg. Sie diagnostiziert Alzheimer im Anfangsstadium und rät ihm, sich ein Notizheft zu besorgen, darin Alltagserlebnisse und Geschichten festzuhalten. Koch wundert sich selbst, wie ruhig er die Diagnose aufnimmt. Er folgt ihrem Rat, setzt sich in ein Café und bittet spontan den Kellner, ihm ein Erlebnis zu erzählen. Koch wird zum Sammler von Geschichten. Während die Krankheit ihren Lauf nimmt, entdeckt er eine ihm bisher unbekannte Welt voller erstaunlicher, spannender, komischer Geschichten, die er immer weiter verfolgen möchte …
Weitere Romane von Jörg Maurer:
›Föhnlage‹, ›Hochsaison‹, ›Niedertracht‹, ›Oberwasser‹, ›Unterholz‹, ›Felsenfest‹, ›Der Tod greift nicht daneben‹, ›Schwindelfrei ist nur der Tod‹, ›Im Grab schaust du nach oben‹, ›Stille Nacht allerseits‹, ›Am Abgrund lässt man gern den Vortritt‹, ›Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt‹, ›Am Tatort bleibt man ungern liegen‹, ›Den letzten Gang serviert der Tod‹, ›Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel‹, ›Shorty‹ und ›Kommissar Jennerwein darf nicht sterben‹
Die Webseite des Autors: www.joergmaurer.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Maurer liebt es, seine Leserinnen und Leser zu überraschen. Er führt sie auf anspielungsreiche Entdeckungsreisen und verstößt dabei genussvoll gegen die üblichen erzählerischen Regeln. In seinen Romanen machen hintergründiger Witz und unerwartete Wendungen die Musik zur Spannungshandlung.
All dies hat Jörg Maurer auch schon auf der Bühne unter Beweis gestellt. Als Kabarettist feierte er mit seinen musikalisch-parodistischen Programmen große Erfolge und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine inzwischen fünfzehn Jennerwein-Romane sind allesamt Bestseller. Sein Roman »Shorty« war ebenfalls erfolgreich.
Jörg Maurer lebt zwischen Buchdeckeln, auf Kinositzen und in Theaterrängen, überwiegend in Süddeutschland.
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Newsletteranmeldung
Dieser Roman basiert auf einer wahren Begebenheit.
Gewidmet ist er meinem guten Freund C., dem ich hier den Namen Daniel Koch gegeben habe. Er war zuerst mit der Namenswahl nicht einverstanden, hat aber schließlich dann doch wegen mangelnder passender Alternativen (Sütterlin, Kocharek, Kocinski, von Taubenburgh, de Hoon, Kußmaul, Meier, Müller, Schmidt …) zugestimmt.
1
Daniel Koch hatte gerade die endgültigen Untersuchungsergebnisse erfahren. Er schloss die Tür der neurologischen Praxis hinter sich und stieg die frisch gewischte und noch feuchte Steintreppe hinunter. Daniel Koch nahm nie den Lift. Doch jetzt musste er höllisch aufpassen, wohin er seinen Fuß setzte. Eine derart niederschmetternde Nachricht, und danach auch noch ausrutschen – das wäre dann doch eins zu viel gewesen. Daniel Koch wunderte sich darüber, dass er die Diagnose so gefasst aufgenommen hatte. Er war weder in Schockstarre verfallen, noch war alle Farbe aus seinem Gesicht gewichen, wie es immer hieß. Der Befund der schmallippigen Neurologin hatte zwar seine allerschlimmsten Befürchtungen übertroffen, aber Daniel Koch war keiner, den das zu Boden warf. Noch in der Praxis hatte er sich geschworen, den ungleichen Kampf mit diesem heimtückischen Gegner aufzunehmen. Rasch trat er auf die Straße und sah sich um. Trotz der morgendlichen Stunde war die Fußgängerzone schon reichlich belebt. Tatkräftige Menschen eilten ihren Zielen entgegen, allesamt gekämmt, geschminkt, frisch rasiert, guten Mutes und voller Zukunftspläne. Daniel Koch blickte hoch zur graublauen Herbstkuppel, an die der große Schaufensterdekorateur versuchsweise einige Wölkchen geklebt hatte. Es war eigenartig. Die Diagnose ließ ihn vollkommen kalt. Sie berührte ihn nicht. Es war eher so, dass er sich die Hiobsbotschaft der Neurologin mit wachsendem Interesse angehört hatte, als ob es sich nicht um ihn, sondern um einen Fremden handelte, mit dem ihn nichts weiter verband als ein siebenseitiger ärztlicher Wisch mit Unterschrift. Daniel Koch warf einen Blick auf seine Fingerspitzen. Alter Schwimmerbrauch. Am Startblock vor dem Sprung immer auf die Finger gucken, hatte sein Trainer oft gesagt. Du kannst am ganzen Körper zittern wie Espenlaub, aber in den Fingern muss die Ruhe stecken. Spring gar nicht erst rein, geh gar nicht erst an den Start, wenn deine Finger nicht absolut ruhig bleiben. Oder hatte das ein Schach-Coach im Fernsehen gesagt? Ein Olympiasieger im Gewichtheben? Vielleicht war es auch ein Tanzlehrer bei Let’s Dance gewesen. Egal, seine Finger zitterten momentan jedenfalls nicht. Nicht im Geringsten. Er war gewillt, den Parcours zu betreten. Sein Gegner war der feigste und verkommenste Foulspieler im Reich der Krankheiten und Handicaps. Aber Daniel Koch stand bereit.
Als er den Blick wieder hob, fiel ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein kleiner Schreibwarenladen auf, der Zeitschriften, Tabakerzeugnisse und Buntstifte feilbot: Gitti’s Lädchen.
»Einfach alles aufschreiben«, hatte die Neurologin gesagt. »Immer Block und Bleistift bereithalten. In Griffweite. Und schämen Sie sich nicht, auch etwas Peinliches zu Papier zu bringen. Niemand wird Sie auslachen. Führen Sie Tagebuch?«
»Nein, damit habe ich mich eigentlich noch nie abgegeben.«
»Stichpunkte genügen.«
Er hatte sich im geräumigen Arztzimmer der Neurologin umgesehen. Es war nüchtern gehalten: keine Bilder, keine Fotos, keine Urkunden über bestandene Prüfungen, auch keine Kinderzeichnungen, nicht einmal die üblichen postmodernen Kunstdrucke, mit denen Akademiker ihren erlesenen Geschmack zu unterstreichen versuchten. Die Mappe mit dem Befund lag vor ihm auf dem Schreibtisch. Die Neurologin Sarah Gossberg saß stocksteif in ihrem Drehstuhl. Ihre Frisur war aus Beton, ihre Augen stachen kalt in die Luft. Ihren Hals umschlang ein enormer Seidenschal in Anthrazit. Als ob der Hals ihre empfindlichste und verwundbarste Stelle wäre. Alles in allem schien sie aber eine gute Ärztin zu sein, Daniel Koch meinte das nach den monatelangen Untersuchungen beurteilen zu können. Er hatte Vertrauen zu ihr gewonnen. Sie redete nicht drumherum, sie kam ohne Umschweife zur Sache.
»Demenz ist eine gerade noch geglückte Bruchlandung in eine neue Welt«, hatte sie ihm erklärt.
»Und was bringt mir das Aufschreiben?«, hatte er gefragt.
»Es ist eine gute Methode, Struktur in Ihren Alltag zu bekommen. Ihr Tagesablauf wird ab jetzt immer mehr aus den Fugen geraten. Auf diese Weise können Sie ihn aber festhalten. Sammeln Sie Geschichten. Fremde Geschichten und Ihre eigenen Geschichten. Erfundene Geschichten und wahre Geschichten. Helle und dunkle, runde und eckige. Sie werden sie alle noch gut brauchen können, glauben Sie mir.«
Sarah Gossberg und ihr allgegenwärtiger, wuseliger Assistent Mario Braun hatten ihm noch viel Glück gewünscht und ihn verabschiedet.
Daniel Koch betrat den Schreibwarenladen und schob sich durch Bastelbedarf, Schneekugeln und anderen Plunder. Bei der jungen Frau hinter der Ladentheke (Sonnenstudio, meterlange Fingernägel, pfundschweres Ohrgehänge) musste es sich wohl um Gitti höchstpersönlich handeln. Als er näher trat, griff sie, ohne dass er auch nur ein Wort von sich gegeben hätte, hinter sich, nahm einen Schreibblock mit Spiralbindung von einem Stapel, strich ihn mit der Hand glatt und reichte ihn über die Ladentheke.
»Macht zwei achtzig.«
Dann ließ sie eine Kaugummiblase platzen und musterte ihn. Sie musterte ihn verschwörerisch, frech und misstrauisch zugleich, wie er fand. Daniel Koch kramte in seiner Geldbörse. Im Laden roch es nach hundertvierundvierzig Zigaretten- und Zigarrenaromen, die miteinander in heftigem Clinch lagen. Er überlegte, warum sie ihm den Block einfach so gab, ohne dass er danach gefragt hatte. Oder hatte er vergessen, dass er beim Hereinkommen schon danach verlangt hatte? Vielleicht war es einer jener Aussetzer, wie sie in letzter Zeit öfter vorgekommen waren, und die ihn schließlich dazu gebracht hatten, eine Arztpraxis aufzusuchen. Gitti schob das Wechselgeld über den Tisch, er strich es ein.
»Warum wussten Sie, dass ich einen Schreibblock brauche? Sind Sie Hellseherin?«
Sie lachte, dass ihre Ohrenklunker weihnachtlich schepperten.
»Nein, ganz und gar nicht. Alle, die von Sarah kommen, kaufen erst einmal einen Schreibblock.«
»Sarah? Sie sprechen von meiner Neurologin, Sarah Gossberg? Woher wissen Sie –«
»Man hat von hier einen guten Blick auf das gläserne Treppenhaus gegenüber. Ich habe Sie aus dem dritten Stock runterkommen sehen, dort liegt die Praxis von Sarah. Also nix hellsehen – hingucken! Mein Lebensmotto. Außerdem: Als Sie dann so ratlos auf der Straße standen, sind Sie mir vorgekommen wie einer, der gerade eine fette Alzheimer-Diagnose verpasst bekommen hat.«
Alz-hei-mer. Daniel Koch schloss kurz die Augen und versuchte dabei zu ergründen, wie er auf diese giftigen drei Silben reagierte. Doch der Klang des Namens und die herannahende Katastrophe, die sich dahinter verbarg, berührten ihn immer noch nicht. Er war eher überrascht und verwundert, so wie man bei einem Zaubertrick Verblüffung, aber keinerlei Schrecken empfindet. Daniel Koch lächelte. Es war sein erstes Lächeln heute.
»Frau Gossberg empfiehlt allen Patienten tatsächlich, einen Schreibblock mit sich herumzuschleppen?«
»Allen. Ohne Ausnahme. Sie schwört darauf. Es ist sozusagen ihr Markenzeichen.«
Daniel Koch fand Gitti nicht unsympathisch, trotzdem wurde ihm das Gespräch jetzt lästig, wenn nicht sogar unangenehm. Die Schreibwarenhändlerin hatte ihn, sicherlich ohne es zu wollen, aus der schützenden Anonymität gerissen. Das konnte er momentan gar nicht brauchen, er wollte selbst entscheiden, wem er seinen Gesundheitszustand anvertraute. Und eine völlig Fremde war sicher nicht die Richtige dafür. Daniel Koch hatte die Hand schon an der Klinke, doch Gitti war auf Kommunikation gebürstet.
»Ich kann mich nicht beklagen, wissen Sie. Seit Sarah ihre Praxis dort drüben aufgemacht hat, gehen Schreibblöcke wie Hölle. Eigentlich braucht ja heutzutage keiner mehr welche, digitale Welt und so. Aber wegen ihr habe ich einen Riesenberg gekauft. Hoffentlich erzählt jetzt nicht irgendein Psychopfosten im Fernsehen, dass Geschichten aufschreiben genau das Falsche bei Alzheimer ist. Dass man sich damit auch noch die letzten Nervenzellen wegschreibt. Und ich armes Würstchen bleibe dann auf dem Stapel sitzen.«
»Wie auch immer: Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte«, sagte Daniel Koch und öffnete die Tür.
»Warten Sie!«, rief sie ihm nach. »Ich habe noch etwas für Sie.«
Sie wedelte mit einem kreditkartengroßen Pappschild.
»Was ist das?«
»Ein sogenanntes Verständniskärtchen. Sie haben wahrscheinlich noch keines. Das werden Sie aber brauchen. Gibt es gratis dazu.«
Koch betrachtete die Karte:
Ich habe Demenz.
Haben Sie etwas Geduld.
Danke.
Präsentiert von: Gitti’s Lädchen.
Auf der Rückseite sollte man Name und Adresse eintragen.
»Zeigen Sie es her, wenn Ihnen danach ist«, sagte sie gönnerhaft. »An der Supermarktkasse, in der Straßenbahn, auf der Skipiste, in der Sauna, wo immer Sie wollen.«
»Danke, das werde ich tun. Aber jetzt: bis bald.«
»Einem meiner Kunden ist mal was Komisches passiert«, fuhr Gitti unbeirrt fort. »Er legt dieses Kärtchen in einem Restaurant auf den Tisch. Sein Gegenüber greift in die Tasche und holt genau das gleiche Kärtchen heraus. Haben die gelacht! Sie sind die verbleibende Zeit Freunde geblieben.«
Die verbleibende Zeit. Die Zeit bis zum Dahindämmern ohne Sinn und Zweck. Die Zeit bis zu einer leeren Hülle, die einmal ein Mensch war. Alzheimer. Es war nicht einfach ein Beinbruch. Es war ein irreparabler Schaden. Doch auch diese schrecklichen Aussichten berührten Daniel Koch immer noch nicht so, wie er das eigentlich erwartet und befürchtet hätte. Er schloss die Ladentür von außen. Gitti winkte ihm von der Theke aus zu. Seufzend drehte er sich um und mischte sich unter die zielstrebigen Passanten in der Fußgängerzone. Die Mappe mit den Untersuchungsergebnissen hielt er immer noch in der Hand, dazu den Collegeblock. Er hatte im Laden natürlich vergessen, einen Stift zu kaufen. Vergessen? Vergessen, ja vergessen. War das schon wieder so ein Anzeichen für eine erneute Lücke, die diese komischen Eiweißplaques gerissen hatten? Als sich Daniel Koch langsam durch die Menge schob, schlugen ihm von allen Seiten Gesprächsfetzen an die Ohren.
»Mensch, das Lied kenn ich doch«, sagte eine korpulente Dame im Vorbeigehen. »Aber meinst du, mir fällt ein, von wem das ist?«
»Es klingt nach Supertramp«, erwiderte ihre atemlose Begleiterin.
»Supertramp? Auf keinen Fall«, setzte die korpulente Dame nach. »Von Supertramp kenne ich alles. Mit Supertramp bin ich groß geworden.«
Die Luft an diesem Herbstmorgen war frisch, viele der Passanten hatten schon einen Schal umgeworfen, der Zeitungsverkäufer an der Ecke tappte von einem Fuß auf den anderen, um die Kälte zu verscheuchen. Daniel Koch ließ sich ohne rechtes Ziel durch die Fußgängerzone treiben. Als er einem Straßenreinigungsfahrzeug auswich und einen Schritt zur Seite trat, überkam ihn schon wieder einmal ganz kurz das Gefühl, dass ihn jemand am Arm fasste, ihn daran zog oder schob, ihn vielleicht sogar niederdrücken wollte. Unwillkürlich hatte er das Bedürfnis, den Arm wegzuziehen, aber er ließ es dann doch, zu irreal war das Gefühl gewesen. Hätte er der Neurologin von diesen manchmal auftretenden, ganz sicherlich eingebildeten Phantomberührungen erzählen sollen? Das nächste Mal vielleicht. Er hatte noch nicht gefrühstückt, so nahm er auf der Terrasse eines kleinen Cafés Platz. Er war schon einige Male hier gewesen, auch kannte er den Ober, der eigentlich viel zu alt für diesen Knochenjob war. Seine Kluft wirkte leicht abgeschabt, er hatte einen unrunden, schiefen Gang, das freundliche Lächeln war ihm so eingebrannt, dass er es wohl nie mehr aus dem Gesicht bekam. Dieser arme Mensch hatte etwas zutiefst Unterwürfiges, dachte Daniel Koch. Etwas, das über das bloße Servile hinausging. Hatte er den Beruf deswegen gewählt? Oder war es umgekehrt, und der Beruf hatte ihm das knechtische Aussehen verliehen? Daniel Koch lieh sich einen Schreibstift aus, bedankte sich herzlich dafür und schlug den Collegeblock auf. Womit sollte er beginnen? Irgendwas schreiben, hatte Sarah Gossberg gesagt. Einfach den Stift aufs Papier setzen, dann ginge alles wie von selbst. Von wegen! Die Spitze des Kugelschreibers zitterte nervös in der Luft, hinterließ dann einige schwer zu deutende Krakelspuren auf dem weißen Blatt. Vielleicht sollte er mit seinem allerersten Aussetzer beginnen, den die Neurologin als ›dissoziative Störung‹ bezeichnet hatte, wenn er sich recht erinnerte. Es war vor zwei Jahren gewesen, als er an einer Verkehrsampel plötzlich nicht mehr wusste, was die Farben Rot und Grün bedeuteten.
Er hatte mit dem Auto auf der linken Abbiegespur gestanden, und als er aufblickte, hatte er nur ungläubig auf die rätselhaften Farbkleckse gestarrt. Sein erster Impuls war, aus dem Auto zu springen und Hals über Kopf, mitten durch den dichten Verkehr, davonzulaufen. Erst aus dem Hupkonzert hinter ihm und der Tatsache, dass die Autos auf der Gegenfahrbahn nicht losfuhren, schloss er, dass jetzt die Linksabbieger freie Fahrt hatten. Zögerlich startete er, immer noch nicht recht begreifend, was da gerade mit ihm geschehen war. An die ersten leisen Vorzeichen einer Demenz dachte er damals natürlich nicht, das kam ihm schon deshalb nicht in den Sinn, weil er diese Erkrankung mit Leuten weit jenseits der Siebzig in Verbindung brachte. Davon war er noch unendlich weit entfernt. Zudem war er überzeugt davon, dass ein sportlicher, drahtiger Typ wie er ohnehin davor gefeit war. Dreimal in der Woche ging er ins Training, Handball, Tennis, Schwimmen, zusätzlich joggte oder stemmte oder strampelte er mindestens eine halbe Stunde pro Tag. Und dann: Ernährung top, Nichtraucher, kein Alkohol, genügend Schlaf, kein ungesunder Arbeitsplatz, viel frische Luft und, seit der Trennung von seiner Ex, kein Stress in der Beziehung. Nach ein paar Wochen hatte er die Episode an der Ampel fast schon wieder vergessen. Aber dann häuften sich die Vorkommnisse. Freunde und Arbeitskollegen, aber auch wildfremde Menschen machten ihn auf merkwürdige Verhaltensweisen und kleine Aussetzer aufmerksam. Das hast du mir jetzt schon dreimal erzählt! Du wirst doch noch wissen, wo die Kneipe ist, in die wir nach dem Sport immer gehen! Schließlich hatte er beschlossen, einen Arzt aufzusuchen. Erst da war ihm aufgefallen, dass er gar keinen richtigen Hausarzt hatte. Er hatte bisher noch keinen gebraucht, so ein gesundes Leben hatte er geführt.
Als er versuchte, diese Geschichte mit der Ampel aufzuschreiben, gelangen ihm nicht einmal Stichpunkte. Er scheiterte schon an der Überschrift: An der Ampel. Rot und grün. Mein erster Aussetzer.
»Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Der servile Ober war an seinem Tisch erschienen. Außer dass ich Alzheimer habe und mein Hirn in absehbarer Zeit Matsch sein wird, ist bei mir alles in allerbester Ordnung, dachte er. Er verzichtete jedoch darauf, den Satz laut auszusprechen, der Ober konnte ja nun wirklich nichts für seine fatale Lage. Stattdessen antwortete er:
»Ja, natürlich, alles in bester Ordnung.« Aus einer Laune heraus fügte er hinzu: »Wissen Sie vielleicht eine Geschichte?«
»Eine Geschichte? Was für eine Geschichte? War etwas nicht recht? Hat etwas mit dem Kaffee nicht gestimmt?«
»Doch, schon. Aber Ihnen fällt doch sicher irgendein Erlebnis aus Ihrem Beruf ein.«
Der Ober trat einen Schritt zurück. Ein schelmischer Ausdruck erhellte sein geknechtetes Gesicht.
»Ich könnte Ihnen tausend Dinge erzählen. Aber eine Anekdote gefällt mir besonders gut. Ach schade, ich sehe gerade: Es sind neue Gäste eingetroffen. Ich komme ein andermal darauf zurück.«
Der Ober entfernte sich wie ein Lakai am Hofe, rückwärts und mit einem demütigen Gesichtsausdruck. Nur ein Kratzfuß fehlte noch. Koch packte den Collegeblock weg, nahm sich das Gutachten von Frau Gossberg nochmals vor und überflog es. Erhöhtes Amyloid-Aufkommen … Seltene Variante von Morbus Alzheimer … Er blieb bei seinem allerersten Mini-Mental-Status-Test hängen, vor ein paar Monaten hatte er dabei noch ganz gut abgeschnitten, allerdings wurden die Ergebnisse der Uhrenzeichnungen dann von Mal zu Mal wackeliger, zum Schluss waren sie ausgesprochen unbefriedigend. Trotzdem verspürte er immer noch keine Angst, ihn überkam nur das starke Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden. Das hatte ihm die Gossberg ohnehin geraten. Er musste einer nahestehenden Person von dieser Diagnose erzählen. Im Geist ging er seine Bekannten, Kollegen und Freunde durch. In der Arbeit gab es ein paar Menschen, mit denen er lose, aber keine engeren Kontakte pflegte. Eine feste Beziehung hatte er zurzeit keine. Und Verwandte? Plötzlich fiel ihm jemand ein. Sein Bruder. Den könnte er anrufen. Daniel Koch war sich plötzlich sehr sicher, dass sein Bruder genau der richtige Gesprächspartner für diese dramatische Situation war. Oder vielleicht doch nicht? Man hatte immer den falschen Bruder, die falschen Eltern, die falsche Verwandtschaft für solche Extremgespräche. Trotzdem wählte er die Nummer, die er schon lange nicht mehr gewählt hatte. Es klingelte ewig. Keine Mailbox sprang an. Dann, plötzlich, ein Klacken und die bekannte und über Jahre nicht mehr gehörte Stimme.
»Hallo? Hallo? Wer spricht da?«
Schweigen auf beiden Seiten der Leitung. Daniel Koch war außerstande, irgendetwas zu sagen. Er suchte nach einer möglichst wenig peinlichen Eröffnung. Doch auch sein Bruder schwieg. Warum legte er nicht auf? Wusste er, wer dran war?
»Hallo!«, ertönte es nach einer Ewigkeit am anderen Ende der Leitung. »Wer ist da? Das bist doch nicht etwa du, Klopfer, oder? Jetzt sag was, oder ich leg auf.«
Nach einem missmutigen Gegrunze hörte Daniel ein Klacken. Ein Klacken vom anderen Ende der Welt. Einfach weggedrückt. Wie spät war es jetzt dort? Klopfer. So hatte ihn schon lange niemand mehr genannt. Welcher Teufel hatte ihn geritten, seinen Bruder anzurufen? Zu dem er den Kontakt eigentlich abgebrochen hatte. Zu Recht, wie er immer noch fand. Umständlich packte er seine Sachen zusammen und warf ein paar Münzen für den Kaffee auf den Tisch. Er musste jetzt unbedingt mit jemandem sprechen. Wer von seinen Bekannten war für so etwas geeignet? Ein Sportskamerad fiel ihm ein. Fred Bügel. Der hatte das, was man eine soziale Ader nannte. Er war hilfsbereit und freundlich, organisierte immer die Stammtische und Feste, kümmerte sich darum, dass die Startbögen bei den Stadtmarathons richtig ausgefüllt wurden. Fred Bügel arbeitete als Bankangestellter in einer kleinen Sparkassenfiliale. Daniel Koch hatte vor, genau dort hinzugehen. Als er die Terrasse verlassen wollte, wäre er fast mit dem Ober des Cafés Ambiente zusammengestoßen.
»Entschuldigen Sie, ich hatte viel zu tun«, sagte der Ober atemlos, und die Atemlosigkeit verstärkte den unterwürfigen Eindruck noch. »Ich wollte Ihnen doch noch meine Lieblingsanekdote erzählen.« Als Koch etwas verdutzt blickte, fügte er hinzu: »Mein Chef sieht es nicht so gern, wenn ich so lange mit Gästen quatsche. Und mein Chef ist streng. Ich kann mir hier keine weiteren Ausrutscher mehr leisten. Einmal noch so eine Sache, dann bin ich weg vom Fenster. Dabei brauche ich den Job.« Sein Ton war ein klein bisschen gehetzt, er befürchtete wohl, dass sein Chef ihn durchs Fenster beobachtete. Er zeigte mit dem Daumen nach hinten. »Dort, wo Sie gesessen haben, befand sich der Stammplatz eines Gastes, der sehr schwierig war. Was heißt schwierig: Er zeigte ein abscheuliches Verhalten. Ausgesprochen ungeduldig, immer von oben herab, arrogant, man konnte ihm wirklich nichts recht machen. Dabei stinkreich, stadtbekannter Fabrikant, Einzelgänger, ruppiger, unfreundlicher Ton. Tausend Umbestellungen, und natürlich kein Trinkgeld, ist klar. Eines Tages behauptete er, ich hätte ihn über eine halbe Stunde auf sein stilles Wasser warten lassen. Was nicht den Tatsachen entsprach. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Mein Herr, es ist gerade viel los bei uns, sagte ich. Er entgegnete, dass er meinen läppischen Job mit links machen würde, er würde bedienen, während er nebenbei noch ein paar wichtige Auslandstelefonate führte. So ging es hin und her. Aber dann kam ein überraschender Vorschlag von ihm: Er würde für einen Tag meinen Job übernehmen, ich solle seinen haben. Dann würde ich ja sehen. Für einen Tag? Gut, so machen wir das, sagte ich. Wir haben dann die Rollen getauscht, und ich kann mir heute gar nichts anderes mehr vorstellen, als Kellner zu sein.«
Es entstand eine sonderbar schwebende, blassblaue Pause. Nur ganz von Ferne hörte Daniel Koch das Knirschen von Skateboards auf dem Asphalt, eine verklingende Krankenwagensirene und an- und abschwellendes Kinderlachen. Er sah dem Ober verwundert ins Gesicht.
»Wie jetzt: Sie selbst waren der unangenehme Gast, der herrische Herr?«
Der Ober, der eigentlich keiner war, blinzelte.
»Ich bin es immer noch. Und ich habe viel gelernt, das kann ich Ihnen sagen.«
»Und die Firma? Ihre ehemalige Firma?«
»Läuft mit ihm besser denn je. Wir haben beide gelernt.«
Er nahm Haltung an. Hatte Daniel Koch übersehen, dass der Ober ihn immer schon ein wenig von oben herab, vielleicht sogar herrisch behandelt hatte? Der Ober verschwand nun wieder im Inneren des Cafés Ambiente. Er hinterließ eine große, leicht nach Bohnenkaffee riechende Leere auf der Terrasse.
2
»Darf ich dich mal alleine sprechen?«, sagte Daniel Koch zu Fred Bügel in der Lobby des Kreditinstituts.
In Anzug und Krawatte, als leibhaftigen Bankangestellten, hatte er Fred Bügel noch nie gesehen. Er kannte ihn von den gemeinsamen Stadtmarathonläufen, sie trafen sich auch wöchentlich beim Handballtraining. Fred war ähnlich sportbegeistert wie er selbst. Jetzt erschien er ihm ungewohnt seriös in seinem taubenblauen Businessfummel.
»Klar«, sagte Fred und wies ihm den Weg in den Keller, in einen fensterlosen Raum.
Fred schloss die Tür sorgfältig hinter sich, warf vorher sogar noch zwei kurze Blicke rechts und links auf den Kellergang, als ahnte er schon, dass das, was er gleich zu hören bekäme, auf gar keinen Fall für fremde Ohren bestimmt war. Sie setzten sich. Die Wand war in einer undefinierbaren Erdfarbe gestrichen, die Klimaanlage summte ihr ewiges Klagelied von der einzig wahren Wohlfühltemperatur bei 21° Celsius. Nachdem sie ein paar Höflichkeiten ausgetauscht hatten, blickte ihn Fred erwartungsvoll an. Die plötzlich eingetretene Stille ließ in Daniel Koch ein vages Gefühl der Unsicherheit aufsteigen. Vielleicht war es doch eine Schnapsidee gewesen, solch eine Unterhaltung im einzelzellenartigen Besprechungszimmer eines Geldinstituts zu führen. Hier liefen vermutlich ganz andere Debatten ab, engagierte Kapitalinvestitionsberatungen oder hitzige Steuervermeidungsstrategien. Fred beugte sich elastisch über den Tisch und senkte die Stimme.
»Was gibt’s denn, sag schon.«
Seine Augen blitzten auf. Daniel Koch hätte ihm jetzt alles Mögliche anvertrauen können, Familiäres, Politisches, Religiöses, Transzendentales – der Befund von Sarah Gossberg war in dieser buntscheckigen Palette jedoch nicht vertreten. Es kam Daniel Koch jetzt sogar ausgesprochen rücksichtslos vor, Fred mit solch einer erschreckenden Diagnose zu belasten. Fred verstärkte seinen erwartungsvollen Blick. Er zwinkerte aufmunternd. Koch sah sich nervös um. Es lag nicht nur an Fred. Es lag auch an der Umgebung. Diese Räumlichkeit passte ganz und gar nicht zu dem, was er zu sagen hatte.
»Können wir uns irgendwann mal woanders treffen?«, sagte Daniel Koch zögerlich. »Es geht um – etwas sehr Intimes.«
»Na klar, wo und wann du willst.«
Fred war offenbar nicht im Geringsten enttäuscht. Er kräuselte die Lippen, stützte sich am Tisch ab und rollte seinen Sessel ein Stück nach hinten. Doch Daniel Koch kam sofort der Gedanke, dass er diesem Menschen sein Geheimnis auch an einem anderen Ort nicht preisgeben könnte. Ganz und gar nicht. Fred war nicht der Richtige. Fred rollte wieder vor.
»Du kannst es mir auch hier sagen. Es hört niemand zu, wir sind in diesem Raum völlig ungestört. Und ich schwöre es: Kein Geheimnis verlässt diese vier Wände. Was immer es auch ist. Was meinst du, was ich hier unten im Keller schon alles gehört habe. Unglaubliche Dinge. Hässliche Dinge. Unappetitliche Dinge. Strafbare Dinge.«
»Ich will eine größere Summe Geld von meinem Konto abheben«, sagte Daniel Koch.
Es war ihm einfach so herausgerutscht. Er hatte es gar nicht sagen wollen. Aber etwas anderes war ihm nicht eingefallen, um aus dieser Nummer herauszukommen. Um nicht ganz dumm vor Fred dazustehen. Um vor allem Fred, den alten Sportskameraden, nicht ganz dumm aussehen zu lassen.
»Das habe ich mir schon gedacht, als du zur Tür hereingekommen bist«, sagte Fred mit einem wissenden Lächeln.
Schon war er über den Computer gebeugt, um das Konto von Daniel aufzurufen.
»Wie viel?«
»Alles, was auf dem Konto ist«, sagte Daniel Koch leise.
Fred zuckte nicht. Auch das hatte er sich wahrscheinlich schon gedacht. Und Daniel Koch konnte nicht mehr zurück.
»Eine Überweisung?«, fragte Fred.
Wenn er jetzt ja sagte, musste er einen Empfänger angeben. Das war blöd. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu entgegnen:
»Nein, ich brauche es auf die Hand.«
Daniel Koch hatte vor, einfach bei einer anderen Bank ein Konto zu eröffnen, um es dort wieder einzuzahlen. So viel Flüssiges brauchte er momentan wirklich nicht. Geld war augenblicklich sein geringstes Problem.
»Du hast Glück, dass du heute gekommen bist. Nur am Donnerstag haben wir so viel Bargeld im Haus.«
»Das trifft sich gut.«
»In kleinen Scheinen?«
»In Hundertern.«
»Ist mit deiner Familie alles in Ordnung?«, fragte Fred beiläufig, ohne Daniel Koch anzusehen.
»Ja, ja. Alles prima.«
»Und sonst auch?«
»Klar, logisch. Alles im Lot.«
Warum sagte er das? Warum war er jetzt nicht mit der Wahrheit herausgerückt? Stattdessen leierte er förmlich:
»Dann bedanke ich mich bei dir für die schnelle Abwicklung.«
»Gern geschehen. Wozu hat man Freunde! Du kannst dann gleich zur Kasse gehen. Wir sehen uns heute Abend beim Handballtraining.«
Sie verabschiedeten sich. Daniel Koch verließ die Bank. Jetzt wollte er nur noch nach Hause. Er steuerte die Bushaltestelle an. Er fuhr nicht mehr Auto. Seit dieser Ampelgeschichte hatte er nicht mehr am Steuer gesessen. Wieder wunderte er sich über seine Gelassenheit. Er hatte eine dramatische Krankheit und war so ruhig. Wie konnte das sein? Blieb das jetzt immer so, auch wenn sich die Krankheit weiterentwickelte? Er hatte die letzten Wochen und Monate mit ihr gelebt und kam doch offensichtlich gut zurecht. Alzheimer. Wie ging es weiter? Er würde nicht nur vergessen, wer er selbst war, er würde auch vergessen, dass er die Krankheit hatte. Er würde nicht mehr wissen, was die drei Silben Alz-hei-mer bedeuteten. Daniel Koch stellte sich vor, wie ein Buchstabe nach dem anderen in seinem Gedächtnis abbröckelte:
Alzheimer
Alzheime
Alzheim
Alzhei
Alzhe
Alzh
Alz
Al
A
Als sich der vollbesetzte Bus in die Kurve legte, kam ihm kurz der Gedanke, ob es nicht möglich war, dass mit dem Verschwinden der Buchstaben auch die Krankheit selbst verschwand. Dass die Krankheit nur da war, weil es ein Wort für sie gab. Dass das Wort selbst die Krankheit war. Er tat den Gedanken als viel zu kindisch ab. Ein Fehler.
3
Sarah Gossberg, Neurologin und Demenzforscherin, öffnete das Fenster ihrer Praxis und beugte sich weit hinaus. Unter ihr erstreckte sich die Fußgängerzone.
»Kennen Sie das Lied, das die Straßenmusikerin dort drüben spielt? Ich glaube, ich habe es heute schon einmal gehört. Mir kommt es bekannt vor, aber ich kann mich nicht auf den Titel besinnen.«
Mario Braun, ihr Assistent, ein junger, wuseliger Weißkittel Mitte zwanzig, trat neben sie, lauschte angestrengt hinaus und versuchte, etwas aus dem Klanggewirr herauszufiltern. Dann schüttelte er den Kopf.
»Ich kann den Text nicht verstehen. Sie befindet sich einfach zu weit weg.«
»Und die Melodie?«
»Musik ist nicht so meins. Ich habe nie ein Instrument gespielt.«
Sarah Gossberg wandte sich vom Fenster ab und sah ihren Assistenten prüfend an.
»Was halten Sie von dem Patienten Koch?«
»Nun, er ist kooperativ, er folgt Ihren Anweisungen, er hält uns Ärzte nicht für Idioten und Pfuscher, was will man heutzutage mehr. Er ist auch keiner, der uns mit im Internet zusammengeklaubtem Halbwissen niederschwätzt.« Mario Braun trat einen Schritt zurück und hob die Hände, wie um anzudeuten, dass er mit der letzten Einschätzung doch ein wenig zu weit gegangen sei. »Ihrer Diagnose stimme ich übrigens voll und ganz zu. Es scheint sich bei ihm um eine nicht allzu häufig auftretende Demenz-Variante zu handeln. Ein Aspekt ist mir allerdings unklar.« Er zögerte und schürzte die Lippen wie ein Kind, dem bewusst war, dass es gleich eine sehr dumme Frage stellen würde. »Warum raten Sie eigentlich allen Patienten, Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben? Gibt es wissenschaftliche Grundlagen für solch einen Therapieansatz?«
»Nein, die gibt es nicht«, antwortete sie in bestimmtem Ton. »Ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, dass es gerade in unserem Forschungsgebiet oftmals an gesicherten wissenschaftlichen Grundlagen mangelt. Das hat Tradition, es war schon zu Zeiten des alten Alois Alzheimer so. Seitdem sind wir noch nicht entscheidend weitergekommen. Deswegen sollten wir uns neuen Therapieansätzen nicht verschließen.«
»Sie glauben also an die Heilkraft einer zufällig aufgeschnappten Geschichte?«
»Glauben ist der falsche Ausdruck.«
»Dann müssen Sie mir das erklären.«
Das Fenster war immer noch einen Spaltbreit geöffnet, der Herbstwind blähte den weißen Vorhang wie einen Spinnaker auf, dessen Boot führerlos im Meer trieb, drei welke Laubblätter fielen auf den Holzboden.
»Sie wissen, dass unsere Patienten oft verwirrt sind, wenn man ihnen Fragen stellt. Wenn der Sohn den dementen Vater fragt, wo er denn jetzt um alles in der Welt hinwolle, bei Regen und Sturm, mitten in der Nacht, noch dazu im Schlafanzug und barfuß, dann lautet die Antwort des Vaters oft: Nach Hause!«
Die Neurologin hatte begonnen, auf- und abzuschreiten, als ob sie im Hörsaal dozierte. Mario Braun hörte ihr aufmerksam zu, die Augenbrauen hatte er jedoch skeptisch hochgezogen.
»Der Vater meint das natürlich nicht wörtlich, er meint damit so etwas wie einen sicheren Zufluchtsort, den er im eigenen Zuhause momentan nicht findet. Trotzdem belehrt ihn der Sohn meist, er sei doch hier zu Hause, was er denn draußen wolle, er hole sich dort noch den Tod. Und genau damit bringt der fürsorgliche Sohn den dementen Vater – natürlich unabsichtlich – in eine ausweglose, verzweifelte Situation. Ich aber rate dazu, dem Patienten eine Geschichte zu erzählen, die ihn einfängt, möglichst eine, die er kennt, um ihn dadurch von seinem schädlichen Vorhaben abzulenken.«
»Ich verstehe«, erwiderte Braun nachdenklich. »Die Geschichte selbst soll so etwas wie das Zuhause sein.«
»Ich habe den Eindruck, dass abgeschlossene Geschichten eine existenzielle Rolle in der Gedankenwelt eines Alzheimer-Patienten spielen.« Als sie immer noch Spuren von Skepsis in der Miene ihres Assistenten bemerkte, fügte sie hinzu: »Und nein, belegen kann ich das nicht. Jedenfalls nicht durch Studien. Es ist eine Vermutung. Ein Gefühl.«
Mario Braun wunderte sich insgeheim, dass eine derart kühle, wissenschaftlich orientierte Natur wie Sarah Gossberg überhaupt von vagen Vermutungen und unbestimmten Gefühlen sprach. Und sich wohl darüber hinaus auf diese verließ. Laut sagte er:
»Nun ja, eine Geschichte. Das kann ja zumindest nicht schaden.«
Die Neurologin überhörte den spöttischen Unterton.
»Ich habe dazu übrigens eine Testreihe begonnen. Patienten im Anfangsstadium bekommen Anekdoten, Märchen oder ähnliche Kurzerzählungen vorgetragen, mit der Bitte, sie sich gut einzuprägen. Wenn sie in einem fortgeschritteneren Stadium dann Unruhe, Angst oder Desorientierung zeigen, bestätigte sich oft, dass sie mit diesen Geschichten auf festen Boden zurückgeführt werden konnten, in einen Bereich, den sie kennen und in dem sie sich wohlfühlen.«
»Gleichsam eine Art Safe Room im Kopf.«
»Wenn Sie so wollen.«
Sarah Gossberg sah wieder hinunter auf die Straße. Die Musikerin hatte das Lied jetzt beendet, ein paar Leute klatschten, sie verbeugte sich, Kinder wurden vorgeschickt, um Münzen in den Zylinder zu werfen. Mario Braun zeigte auf die Menschenmenge.
»Was glauben Sie: Wie viele dieser Menschen dort unten werden in einer Demenz enden?«
»Ich denke, jeder Fünfte«, erwiderte Sarah Gossberg ohne zu zögern. »In zwanzig Jahren wird ein Fünftel dieser zielstrebigen und agilen Personen zumindest die ersten Anzeichen von Demenz aufweisen. Es sei denn, wir finden bis dahin ein Mittel dagegen.«
Mario Braun schob einen Aktenstapel beiseite und setzte sich auf die Kante des Schreibtisches.
»Meinen Sie, dass der Patient Koch für unsere Zwecke geeignet ist?«
»Ja, sicher doch. Er hat die Nachricht sehr gefasst aufgenommen, richtig diszipliniert. Auf mich wirkt er wie eine Kämpfernatur. Ich denke, dass er ein guter Kandidat für die Testreihe ist. Er arbeitet nicht gegen uns, er vertraut uns.«
»Sollen wir ihn gleich bei der nächsten Sitzung um seine Zustimmung bitten?«
»Das ist noch nicht nötig, Mario. Die Testergebnisse sind anonym, und es würde ihn nur verunsichern, wenn er am Anfang der Behandlung schon wüsste, dass er Forschungsobjekt ist. Lassen Sie uns drei, vier Sitzungen abwarten, ob er überhaupt geeignet ist.«
Mario Braun schüttelte zwar kurz verwundert den Kopf, zuckte dann aber gleichgültig die Schultern. Sie war der Chef. Sie trug die Verantwortung für die Langzeituntersuchung von Demenzkranken, an der sie beide arbeiteten. Er war ja nur der Assistent, der pausbäckige Junge, der lediglich seinen Arbeitseifer und seinen Ehrgeiz ins Feld führen konnte. Er war der unerfahrene Zauberlehrling mit ein paar einstudierten Taschenspielertricks, sie die alte, geheimnisvolle Hexenmeisterin aus einer anderen Zeit.
Mario Braun arbeitete erst seit ein paar Wochen mit ihr zusammen. Er hatte sich um eine Assistentenstelle beworben, weil ihn Demenzforschung außerordentlich interessierte. Unter anderem spielten dabei auch persönliche Gründe eine Rolle. Bei Mario Braun lag es in der Familie. Schon mehrere Verwandte von ihm lebten deswegen in Heimen, in vollkommener Abhängigkeit von menschlicher und maschineller Betreuung. Sie befanden sich allesamt in der Endphase der Krankheit. Bei seinem Vater, einem ehemaligen Hochschulprofessor, war die Demenz am weitesten fortgeschritten. Es musste genetisch verankert sein, die Häufungen waren offensichtlich. Die allgemeinen Forschungen liefen weltweit auf Hochtouren, doch es gab immer noch keine Aussicht auf Heilung, Vorsorge oder wenigstens anhaltende Linderung. Je länger er mit Sarah Gossberg zusammenarbeitete, desto mehr verstärkte sich sein Eindruck, dass sie einem Lösungsansatz auf der Spur war. Dass sie einen Verdacht hatte, eine vage Arbeitshypothese, wie die Alzheimer-Krankheit funktionierte und wie sie das Großhirn und damit die menschliche Lebensqualität langsam außer Kraft setzte. Das hieß aber doch auch, dass sie eine Vermutung hatte, wie diese Krankheit zu heilen war! Sie rückte allerdings nicht damit heraus, vielleicht waren ihre Hypothesen noch zu unausgereift. Er hoffte, es irgendwann einmal zu erfahren. Doch sie zeigte sich seinen Nachfragen gegenüber sehr verschlossen. Er hatte im Netz nachgesehen: Sie hatte kaum wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, schrieb nicht für Fachzeitschriften, sprach selten auf Tagungen. Manchmal kam sie ihm sogar ein wenig unheimlich vor. Sie hatte etwas von einer herumstreifenden Wölfin, die Witterung aufgenommen hatte. Was hatte sie vor? In welche Richtung wollte sie forschen? Mario Braun durchzuckte auch jetzt wieder ein leiser Schauer. War sie einer sensationellen Entdeckung auf der Spur?
Die Gitarristin in dem bunten Poncho hatte inzwischen ihr nächstes Lied begonnen, ein paar Leute klatschten rhythmisch mit. Sarah Gossberg schloss das Fenster.
»Ich komme einfach nicht drauf.«
»Soll ich runtergehen und mich bei ihr erkundigen?«, fragte er lächelnd.
»Nein, so wichtig ist es auch wieder nicht. Es macht einen nur verrückt, wenn einem so eine Kleinigkeit wie ein Songtitel nicht einfällt.«
»Das ist ja genau unser Thema. Das Vergessen. Schon Odysseus und seine Gefährten quälten sich damit herum. Sie wissen schon: Und neun Tage trieb ich, von wütenden Stürmen geschleudert, über das fischdurchwimmelte Meer; am zehnten erreicht’ ich die Insel der Lotosesser …«
Sarah Gossberg lächelte dünn.
»Humanistische Bildung?«
»Selbstverständlich. Ich entstamme einer alten, weitverzweigten Ärztefamilie.« Er vollführte wieder diese unbestimmte, vage Handbewegung, die einem schnellen Orchestereinsatz des Dirigenten glich oder auch einer kleinen Andeutung, zu schweigen. Bildungstrunken fuhr er mit dem Homer-Zitat fort: »Wer dort bei den Lotophagen die Honigsüße der Lotosfrüchte gekostet, denkt nicht mehr an Heimkehr, vergisst seine Freunde …«
»Vielleicht müssen wir nur nach dem Wirkstoff in den Lotosfrüchten suchen, um auf das Geheimnis demenzieller Erkrankungen zu kommen«, unterbrach Sarah Gossberg.
»Es wäre viel geholfen, wenn wir schon einmal wüssten, wie das Vergessen genau funktioniert«, sagte Mario Braun. »Ich stelle mir das so vor, dass sich ein Teilchen nach dem anderen löst, so wie Lack absplittert«, fügte er eifrig hinzu.
Er zog einen Marker aus dem Kittel und schrieb an das Whiteboard:
Sarah Gossberg musterte das Tafelbild und wiegte zweifelnd den Kopf.
»Sie meinen, es werden Stücke aus der Erinnerung gerissen, so dass immer mehr leere Stellen übrig bleiben? Ich glaube eher, dass sich in die entstandenen Lücken andere Inhalte schieben, die für Außenstehende zunächst nicht erkennbar sind.«
Der Assistent sah sie verständnislos an.
»Im Gehirn gibt es keine Lücken«, fuhr sie fort. »Meiner Ansicht nach kann gar nichts vergessen werden, vor allem nicht vollständig. Wie in einem Computer nichts ganz gelöscht werden kann.«
»Es sei denn, man formatiert die Festplatte, schlägt mit einem Hammer mehrmals darauf, taucht sie in ein Säurebad und wirft sie in hohem Bogen in den Ätna. Und selbst dann –«
Sarah Gossberg schüttelte den Kopf.
»Ich bin davon überzeugt, dass sich neue Bedeutungen in die Lücken schieben, sobald sie entstanden sind. Man kann nicht an nichts denken.«
Sie nahm Mario Braun den Marker aus der Hand und schrieb an das Whiteboard:
Alzheimer
Aozheimer
Aozheiber
Aozhesber
Gozhesber
Gozhssber
Gohssberg
Gossberg
»Nur so als Beispiel«, sagte die Neurologin.