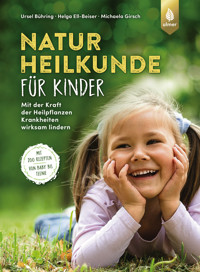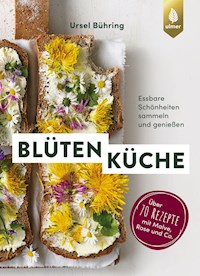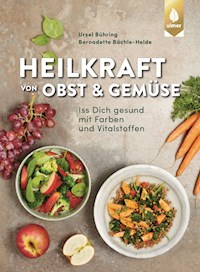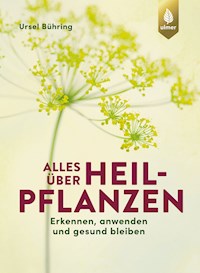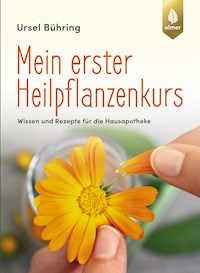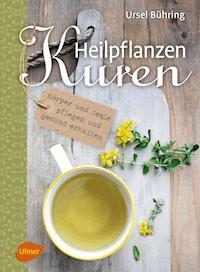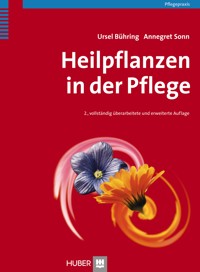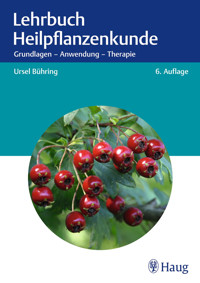
99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Phytotherapie verstehen und sicher anwenden
Sie möchten wissen, welcher Wirkstoff was bewirkt, und wie Sie Heilpflanzen bei verschiedenen Indikationen gezielt anwenden? Dann bietet Ihnen dieses Buch fundierte und lebendig gestaltete Fachkenntnisse rund um die Heilpflanzenkunde:
- alle relevanten Heilpflanzen mit Inhaltsstoffen, Wirkungen, Indikationen, Darreichungsformen und Nebenwirkungen
- Praxiswissen fürs Rezeptieren und Herstellen von Tinkturen, Salben und Ölen
- Behandlungsvorschläge und Therapieoptionen nach Indikationen sortiert
- Texte der Sachverständigen-Kommissionen (Kommission E, ESCOP, HMPC und WHO)
- Heilpflanzen-Verzeichnis mit Indikationen – für einen noch schnelleren Überblick
Neu in der 6. Auflage
- ca. 30 Mind-Maps zu den wichtigsten Pflanzen mit Indikationen
- aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und angepasste Rezepturen
- Vorstellung neuer Pflanzen (Eberraute, Griechischer Bergtee)
- Erkenntnisse aus der Pflanzenheilkunde zu Post-COVID
Ursel Bühring hat ihr geballtes Wissen anschaulich und praxisnah aufbereitet. Ideal, um das bestehende Wissen zu wiederholen und zu vertiefen, Neues zu lernen oder einfach nur zu schmökern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2058
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lehrbuch Heilpflanzenkunde
Grundlagen - Anwendung - Therapie
Ursel Bühring
6., überarbeitete und erweiterte Auflage
209 Abbildungen
Geleitwort
Das Heilpflanzenbuch von Ursel Bühring erscheint genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn trotz einer uralten Heilpflanzentradition (über 60000 Jahre!) und trotz modernster wissenschaftlicher Beweise der Wirksamkeit von Heilpflanzen wurde durch die neue Gesundheitsreform dieser Zweig der Medizin vernachlässigt mit der Folge, dass viele Arzneipflanzenzubereitungen nicht mehr erstattet werden. Was Sie als Therapeuten auch dadurch trifft, dass viele, selbst jahrelang in der Praxis bewährte Präparate vom Markt verschwinden. Andererseits führt dies dazu, dass aus Kostengründen viele Patienten eher zu den für sie günstigeren chemischen Mitteln greifen, trotz ihrer zum Teil erheblichen Nebenwirkungen.
Guter Rat ist gefragt. Und genau diesen bietet das vorliegende Buch an. Die Phytotherapie ist fester Bestandteil der naturheilkundlichen Praxis. Es könnte sein, dass, wie so oft im Leben, das Ärgerliche plötzlich ein ganz neues Gesicht bekommt – dass die Widersacher einer guten Angelegenheit – hier der Naturheilkunde –, ohne es zu wollen, ihr den größten Dienst erweisen. Denn nun treten diejenigen auf den Plan, denen die Heilpflanzenkunde wirklich am Herzen liegt.
Frau Bührings Buch ist nicht nur sehr lebendig geschrieben, sondern versetzt den Leser in die Lage, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Therapeuten wie Laien können sich in diesem so überschaubar angelegten Text problemlos zurechtfinden und entdecken schnell die gewünschten Angaben für ihre derzeitigen Beschwerden und die entsprechenden Heilpflanzen. Durch die brillante Art, zu schreiben und zu erklären, werden die Leser motiviert, neugierig zu bleiben und möglichst schnell Hilfe in diesem Buch zu finden.
Aber das Schönste von allem ist, dass wir angeregt werden, unseren eigenen Heilpflanzenvorrat für ein ganzes Jahr zu sammeln, zu trocknen und aufzubewahren. Ich wünsche dem Leser dieses wundervollen Buches gute Therapieerfolge, immer neue Entdeckerfreuden und eine von Jahr zu Jahr zunehmende Gesundheit und Fröhlichkeit durch das Leben in und mit der Natur.
Essen, im Sommer 2004
Dr. med. Veronica Carstens
Fachärztin für Innere Medizin und Homöopathie
Geleitwort
In dem Begriff „Phytotherapie“ ist nicht nur die Pflanze, sondern auch das Wort „Theos: Gott“ verborgen, das heißt: Wir vermögen, oft staunend, in der Natur ein höheres Prinzip zu erkennen. Die Phytotherapie befasst sich neben der Bewegungs-, Ernährungs- und der Hydrotherapie mit der Natur des Menschen, die auch im Mittelpunkt des Interesses von Naturheilkundlern und Naturwissenschaftlern steht. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich, insbesondere in Deutschland, eine wissenschaftliche Betrachtung dieser Medizin aus der Natur, welche als die „grüne Apotheke der Welt“ gilt. Genauso wichtig ist es allerdings, sich auch mit der Natur der Medizin zu beschäftigen – nicht in einem akademisch abgehobenen, theoretischen Lehrgebäude, sondern immer in der Anschauung und im Kontakt mit der Pflanze.
Hier hat die Freiburger Heilpflanzenschule mit ihrer Gründerin Ursel Bühring Vorbildliches geleistet, um die verschiedenen Erkenntnisstränge zusammenzuführen und, was eine Besonderheit der Schule darstellt, an der Pflanze erfahrbar zu machen. Frau Bühring versteht es, die rationale Phytotherapie im Rahmen der evidenzbasierten Medizin mit wichtigen Erkenntnissen aus der Erfahrungsheilkunde (Experience Based Medicine) zu vereinen. Dieser Anspruch spiegelt sich in ihrer umfangreichen Lehrtätigkeit wider sowie in diesem Buch, das ganz praxisnah aus ihrem Unterricht entstanden ist. Es beschreibt die wissenschaftlichen Grundlagen und das praktische Wissen so, dass das Lernen Freude macht.
Dieses „Praxis-Lehrbuch der modernen Heilpflanzenkunde“ bietet hervorragende Möglichkeiten, Lehrende und Lernende wieder mit der Natur der Pflanzen in Kontakt zu bringen und wirkliches Wissen und Verständnis zu erfahren, und ich wünsche ihm viele Leser, die davon profitieren dürfen.
München, im Sommer 2004
Dr. Erwin Häringer, M.D., Ph.D.
Geleitwort
Es ist mir eine Freude, ein Geleitwort für das Buch von Frau Ursel Bühring zu schreiben, denn es ist derzeit das beste Buch zum Thema, das ich kenne; das ausführlichste, umfangreichste, genaueste und praktikabelste. In den 40 Jahren meiner phytotherapeutisch ausgerichteten Praxis und den 15 Jahren Mitarbeit in der Kommission E habe ich rund um die Phytotherapie vieles gehört, gesehen und erlebt, und ich möchte mir durchaus ein Urteil erlauben. Lassen Sie mich das begründen:
Die zahlreiche phytotherapeutische Literatur scheint momentan in drei Kategorien zu zerfallen:
Zum einen ist da eine Reihe von wissenschaftlichen Fachbüchern, die zwar eine umfangreiche Datenlage vorweisen, in denen aber leider die tägliche Praxis häufig außen vorgelassen wird.
Dann gibt es die Flut von phytotherapeutischen Ratgebern und Arzneipflanzenbüchern auf dem Markt, nett, reich bebildert, teilweise aufwendig gestaltet, doch oft unkritisch und „schwerelos“. Aber was Gewicht hat, ist nun einmal schwer – oder?
Die esoterische Pflanzenliteratur ist gut gemeint, aber für die Praxis zum größten Teil unbrauchbar: Magisches und Okkultes, Wundermittel aus fernen Ländern, Altes und Obskures klingt zwar durchaus interessant, doch damit arbeiten kann man nicht und schon gar nicht ein Praxisschild über Jahrzehnte an der Haustüre halten.
Das vorliegende Buch geht über diese Kategorien hinaus. Als seriöse Empirikerin verbindet Frau Bühring Altes mit Neuem, bleibt dabei aber immer auf dem Boden der Tatsachen. Sie ist, wie es schon Paracelsus forderte, den Erfahrungsweg gegangen und berichtet nicht nur, was der sogenannten Wissenschaftlichkeit entgeht, sondern auch, was diese entbehrt. Über Jahre beobachte ich nun ihren Weg – und kenne nur ganz wenige, die sich so engagiert in dieses Gebiet hineinbegeben haben.
Diesem Werk ist ein gutes Schicksal zu wünschen!
München, im Sommer 2004
Josef Karl
Heilpraktiker, Phytotherapeut
Ehemaliges Mitglied der Kommission E
Vorwort zur 6. Auflage
Vor nunmehr 19 Jahren erschien die 1. Auflage dieses großen Lehrbuchs Heilpflanzenkunde. Nach der 2. Auflage 2008, 2011 der 3., 2014 der 4. Auflage und 2020 der 5. Auflage halten Sie nun also die 6. Auflage in Ihren Händen und profitieren davon, dass das Buch vielfachst in Gebrauch ist. Längst ist das „Praxis-Lehrbuch Heilpflanzenkunde“, wie es früher hieß, zum Standardwerk der Phytotherapie geworden und wird in vielen Institutionen als Grundlage und Lehrwerk für den Phytotherapieunterricht eingesetzt. In der Schweiz ist es seit 2015 als einziges Lehrwerk von der Expertenkommission für die Ausbildung zugelassen.
Da Wissenschaft und Medizin wie die Natur einem steten Wandel unterworfen sind, gab es viele Änderungen – und besonders viele Bereicherungen. Nachdem die 4. Auflage durch strukturelle Elemente für eine bessere Übersicht bestückt wurde, Erweiterungen im Therapieteil, neue Erkenntnisse und Studien und aktualisierte Präparate hinzukamen, zeichnete sich die 5. Auflage durch die Komplettierung der Texte der Sachverständigen-Kommissionen (neben der Kommission E die ESCOP, HMPC und WHO) in deutscher Sprache in jedem einzelnen Pflanzenporträt aus. Vor allem aber wurden der gesamte Therapieteil und sämtliche Pflanzenporträts aktualisiert, mit einer Fülle neuer Erkenntnisse und Studien und Aktuellstem aus Fachkongressen. Das Kapitel 41.19, Studien und Quellen, hat enorm zugelegt: Viel tut sich in 19 Jahren! Wie erfreulich, dass die Forschung nicht stehen bleibt und so auch neue Pflanzen in die Therapie mit aufgenommen werden – Sie finden sie im Buch! Die Welt rückt zusammen und Erkenntnisse werden besser zugänglich, das tut einem Lehrbuch besonders gut.
Und nun die 6. Auflage. Eigentlich wollte ich nicht viel verändern, aber - wie viel tut sich Jahr für Jahr an neuen Erkenntnissen auf. Mit jeder neuen Fortbildung, die ich regelmäßig besuche, mit jedem neuen Fachmagazin, mit jedem Austausch mit Gleichgesinnten: neues Wissen, neue Erfahrungen, Bestätigungen von Tradition und Moderne! Das drängt sich in die neue Auflage. Neu hinzugekommen sind Themen wie Darmmikrobiom und Covid-19, einige neu erforschte Arzneipflanzen und Rezepturen. Neu sind auch Mindmaps anstelle der Tabellenübersichten bei den Indikationen. Diese Mindmaps geben einen schnellen Überblick über die je Indikation benötigten Wirkrichtungen aus dem großen Spektrum der Pflanzeninhaltsstoffe, welche Heilpflanzen über diese verfügen und welche Drogen schließlich zu verwenden sind.
Heutzutage sind Gesundheitskompetenz und Selbstmedikation erneut gefragt. Das zeigt sich auch am Interesse am Thema Heilpflanzen, das nicht nachlässt, im Gegenteil. Und es scheint wichtiger denn je in Zeiten wie diesen, stetig am Ball zu bleiben, die eigene Gesundheitskompetenz zu fördern und Andere fachkundig und seriös beraten zu können.
Es geht nicht nur ums Verstehen, Beurteilen und Nutzen gesundheitsfördernder Maßnahmen, es geht auch ums gekonnte Differenzieren der Informationsflut von „Dr. Google“, TV-Infos, Apps & Co. Um Gesundheitskosten zu senken, hat der Gesetzgeber in Deutschland seit 1992 die Erstattungsfähigkeit durch die GKV budgetiert bzw. vielfachst gestrichen, darunter fast alle Phytotherapeutika. Auf der anderen Seite unterstützen Patientenleitlinien (www.patientenleitlinien.de, Kap. ▶ 2.5), entwickelt von einem Team von Ärzten und Gesundheitsfachleuten, mit gut verständlichen Informationen therapeutische Entscheidungen. Zudem gibt es seit 2004 das vom Arzt als Empfehlung ausgestellte Grüne Rezept für rezeptfreie pflanzliche und andere Heilmittel, das Sie bei vielen gesetzlichen Krankenkassen zur Voll- oder Teilerstattung als Satzungsleistung einreichen können. Es gibt also nichts Gutes, außer man tut es. Und nicht zuletzt wurde 2004 auch im Zuge der Gesundheitsreform das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (www.iqwig.de) gegründet, eine fachlich unabhängige wissenschaftliche private, gemeinnützige Stiftung, die der Öffentlichkeit unabhängige und evidenzbasierte medizinische Informationen zur Verfügung stellt. So eine Institution scheint notwendig zu sein aufgrund einer eher mangelhaften Gesundheitskompetenz eines Großteils der Bevölkerung.
2004 stellte ich dem Buch folgende Worte voran:
Heilen mit Pflanzen ist der ursprünglichste Weg zu heilen und er hat sich seit Jahrtausenden bewährt. Die Pflanzen – ihre Gestalt, ihr Duft, ihre Geschichte, die Art ihrer vielgestaltigen Botschaften und ihre lebensspendende (Heil-)Kraft – haben mich immer schon in ihren Bann gezogen. Bereits als Kind war es selbstverständlich für mich, Löwenzahn für einen Salat zu sammeln oder Spitzwegerich bei Wunden aufzutragen. Die Liebe zu Pflanzen hat mich durch Wiesen und Wälder geführt, meine Neugier genährt, mehr und mehr wissen zu wollen und alles anzufassen und auszuprobieren, um wirklich zu begreifen und zu verstehen. Ich habe erfahren, geschmeckt und probiert, habe ältere Menschen befragt (was man heute „Feldforschung“ nennt) – und dabei viel mehr in Erfahrung bringen können, als ich es je über Bücher vermocht hätte.
1982, zu Beginn meiner Heilpraktikerausbildung, hatte ich dann ein Schlüsselerlebnis, das eine Wende in mein Leben bringen sollte: Eine Freundin erzählte mir von ihrer Tochter Sophia. Diese war als Baby so schwer an einem Virus erkrankt, dass die Ärzte der Uniklinik sie schließlich aufgegeben hatten. Die Mutter nahm die Kleine (gegen ärztlichen Rat und auf eigene Verantwortung) mit nach Hause und zog sie mit der Pastinake auf, einer kohlenhydratreichen Wurzel, die das Kind als einzige Speise vertragen konnte. Heute ist Sophia eine gesunde junge Frau, Krankenschwester und inzwischen selbst Heilpraktikerin. Sie besuchte u.a. die Ausbildung an der Freiburger Heilpflanzenschule und integriert die Phytotherapie, die ihr selbst das Leben gerettet hatte, in ihre naturheilkundliche Praxis.
Diese Kraft der wilden Kräuter berührte mich so tief, dass ich spürte, dass es an der Zeit war, mein „Erfahrungswissen“ auf solide Beine zu stellen. So begann ich im Alter von 35 Jahren, mich intensiv weiterzubilden. Ich las und las und verschlang die Phytoliteratur, besuchte Seminare, Kongresse, Ausbildungen, verwarf so manches und überprüfte das Wissen auch auf seine Praxisrelevanz: Teemischungen z. B. mussten so schmecken, dass sie auch getrunken werden können (was beileibe nicht selbstverständlich ist!).
Schließlich gab ich erste Wildkräuterkurse und Heilpflanzenseminare, und bald kamen Krankenkassen und Kliniken auf mich zu. Mit der Zeit wuchsen meine Erfahrungen und mein Wissen und entwickelten sich, zusammen mit den Rückmeldungen und Erfahrungen der Patienten in der Praxis und in der Klinik, der Freunde, Bekannten und später der Kursteilnehmer, zu einem harmonischen Ganzen.
Als ich im Jahr 1996 die ersten Unterrichtsskripte für die Eröffnung der Freiburger Heilpflanzenschule erarbeitete, wusste ich noch nicht, welche Kreise dies ziehen würde. Statt des zaghaften Öffnens einer „Knospe“ durfte ich von Anfang an eine volle „Blüte“ erleben: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer strömten damals aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Italien und Österreich, es gab für alle Kurse von Beginn an Wartelisten. Dass meine Schule so eine positive Resonanz erfuhr, beglückt mich bis heute.
Pflanzen brauchen zum Gedeihen ein ordentliches, reichhaltiges Wurzelwerk. Die Wurzeln meiner Schule, die 1997 die erste ihrer Art in Deutschland war, liegen zum einen in meinem Unterrichtsskript, in dem ich den Lehrstoff „Phytotherapie“ völlig neu für einen lebendigen Unterricht aufbereitet habe. Es musste verständlich geschrieben, gut strukturiert und logisch aufgebaut sein und sich als kompetentes Begleitskript und Nachschlagewerk gleichermaßen bewähren. Dieses Skript ist von Ausbildung zu Ausbildung gewachsen, es wurde verändert und auf den neuesten Stand gebracht, manches wieder verworfen, vieles ist dazugekommen und bereichert worden durch Anregungen der Teilnehmer meiner Schule, denen ich hiermit als Erstes herzlich danken möchte. Heute ist daraus dieses Buch entstanden, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun in der Hand halten.
Der andere Teil des Wurzelwerks meiner Schule ist feiner, ähnlich den zarten nährenden Wurzelhärchen, ohne die kein Baum existieren könnte: Es ist die eingangs schon erwähnte Liebe zu den Pflanzen. Sie ist eine Stütze, ein Elixier und zugleich die „Seele“ meiner Schule (die ich mittlerweile an Nachfolger übergeben habe – heute gibt es über 100 solcher Institutionen in Deutschland). Sie erfüllt mich mit steter Energie, verleiht mir Flügel und schenkt mir die Kraft, diese so schnell gewachsene Institution mit Herz und Freude zu leiten. Diese Begeisterung möchte ich mit anderen teilen – und mitteilen, quasi durch die Sprache der (heilenden) Blumen.
Das Lehrbuch Heilpflanzenkunde wendet sich an alle interessierten Angehörigen aus Heil- und Pflegeberufen, an Medizinstudenten und Therapeuten und solche, die es werden wollen. Im naturheilkundlich orientierten Praxisalltag gehört die Phytotherapie von jeher zur bewährten Basis. Mit diesem Werk halten Sie ein Lehr- und Praxisbuch und ein Nachschlagewerk zugleich in der Hand, das Sie mit handfestem Wissen und vielen naturheilkundlichen Tipps begleitet. Und ganz nebenbei macht es Lust, zu lernen und das Gelernte umzusetzen. Wenn Sie wollen, können Sie das Heilen mit Pflanzen „Schritt für Schritt“ lernen, lebendig, praxisnah und mit Anleitungen zu eigenen Experimenten und zur Selbsterfahrung.
Das Wissen und die praktische eigene Erfahrung – die „Evidence Based Medicine“ und die „Experience Based Medicine“ – bergen gemeinsam einen so wertvollen Wissensschatz, dass dieser allen zugänglich sein sollte, die daran Interesse haben, Therapeuten wie „Laien“. Aus diesem Grund möchte ich genauso interessierte Laien ermutigen, sich in die faszinierende Welt der Heilpflanzen zu begeben, denn Selbstmedikation mit Heilpflanzen hat eine lange Tradition. Durch fachgerechte Heilpflanzenanwendungen könnten viele Menschen ihre Eigenverantwortlichkeit wiedererlangen und leichte Unpässlichkeiten zu Hause selbst „phytotherapieren“. Sie können mithilfe dieses Buches ihre Gesundheit „lust- und geschmackvoll“ erhalten und Befindlichkeitsstörungen im Vorfeld lindern, bevor (Labor-)Befunde eine Erkrankung aufzeigen. Aus diesem Grund habe ich das Buch so geschrieben, dass es auch für Laien verständlich ist und alle, die sich das Wissen verantwortungsbewusst erarbeitet haben, damit auch arbeiten können. Für ein ausführliches Hintergrundwissen gibt es ausreichend wissenschaftliche Literatur, die weitere Informationen liefern kann.
Die Umsetzung dieses Wissens ist allen zu empfehlen, und es möge Ihnen Freude bereiten. Die „Gründaumigen“ unter Ihnen können in die Praxis gehen: Heilsame aromatische Kräuter lassen sich im eigenen Garten oder auf dem Balkon relativ einfach anbauen und ernten, oder Sie erwerben sie in einer (biologisch arbeitenden) Heilpflanzengärtnerei oder sammeln sie, mit geschulten Augen natürlich, in „freier Wildbahn“, d.h. mitten in der Natur.
Eignen Sie sich das Wissen aus diesem Buch an, und lassen Sie sich auf Exkursionen, Kursen oder durch weitere Fachliteratur darin schulen, die Pflanzen wiederzuerkennen. Die Rückverbindung mit der Natur wird nicht nur für Ihren Körper eine Wohltat sein.
Auch für die 5. Auflage meines Lehrbuchs bestimmt die Liebe zu den Heilpflanzen mein Tun. Ich widme mich mit großer Freude dem Unterrichten auf Seminaren, Weiterbildungen, Kongressen. Mit zunehmendem Alter spüre ich Vorteile: Die ganze Erfahrung, das Wissen, das menschliche und das pädagogisch-didaktische Potenzial ist Teil von mir und schenkt beim Unterrichten eine Leichtigkeit, ja etwas Spielerisch-Persönliches, dass es eine Freude ist, ein ständig nährender Quell. Man „muss“ nicht mehr, man „darf“. Ich achte mehr auf mich, auf meine Lust am Tun und betreibe, was ich auch im Unterricht vertrete: Selbstpflege. Es sind eine Art Samen der Motivation, die sich verteilen. Je älter, desto freier der Unterricht, desto mehr „fließt es“, desto mehr bin ich Mittlerin zwischen Pflanzen und Menschen, desto mehr gibt es mir die Energie, die ich hineinlege, vielfach wieder zurück. Menschliche Begegnungen mit Pflanzen zu vereinen, machen das Leben für mich ganzheitlich – und glücklich. Wissen vermehrt sich, indem man es teilt, das ist wie bei der Liebe.
Und damit wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude beim Lesen, Lernen und Umsetzen.
Freiburg, im September 2023
Ursel Bühring
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für all die hilfreiche und engagierte Mitarbeit an meinem zentralen Lebenswerk:
Ganz am Anfang stehen der Dank an die Natur mit ihren herrlichen Pflanzengeschöpfen und all den interessierten Menschen, die sich in dieses spannende Thema vertiefen wollten, ja, die es manchmal zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Dank an die vielen, vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Schule und all meiner Seminare bis heute, denn sie waren der Grund, weshalb dieses Werk entstanden ist und sich so reichhaltig weiterentwickelt hat.
Ganz herzlich und besonders danke ich meiner geschätzten Kollegin und Freundin Michaela Girsch für den wertvollen und freudebereitenden inhaltlichen Austausch über die gesamten letzten 25 Jahre – so lange arbeiten wir schon zusammen! Und das gerne, und wie die Pflanzen in synergistischer Weise. Sie arbeitet mit diesem Lehrwerk in ihren Seminaren, hat genaueste Einsicht, hatte schon für die 5. Auflage die Grundtexte der stoffwechselbedingten Hauterkrankungen, der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung und das Kap. ▶ 30, „Ausleitung und Regeneration“, wo es nötig war überarbeitet und für die 6. Auflage die Frauenheilkunde: ein wunderbar fachlich-fruchtbarer und menschlich beflügelnder Austausch für dieses monströse Textwerk. Danke!
Weiterhin danke ich Christian Böser vom Karl F. Haug Verlag für die stete unterstützende, aufmerksame und menschlich so sympathische Begleitung, immer offen für Fragen, immer beratend zur Seite, immer mit mir zusammen nach der besten Lösung ringend: das tut richtig gut! Und genauso danke ich meiner Projektmanagerin Carolin Frotscher. Mit ihrer klaren frischen Art, ihrem offenen Ohr, ihrer Leichtigkeit im Erklären, ihrer Kenntnis auch in Sachen „technischer Support“ gelingt es uns gemeinsam, diesem großen Werk seinen „Segen“ zu geben. Und nicht zuletzt möchte ich auch dem Verlag danken, der viele Schritte in eine digitale Zukunft ging und mich behutsam mitnahm. Dank dem Einsatz moderner digitaler Lösungen habe ich den Entstehungsprozess eines Buches noch nie so reibungslos empfunden wie diesmal. Danke!
Über die Autorin
Ursel Bühring, Jahrgang 1950, ist Heilpraktikerin, Krankenschwester, Natur- und Umweltpädagogin und ausgewiesene Expertin in Phytotherapie. Ihre Arbeit ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit der Natur – ihre innere Triebfeder für die intensive Beschäftigung mit Heilpflanzen. Seit 40 Jahren ist sie als Dozentin für Pflanzenheilkunde an Institutionen im In- und Ausland tätig.
Abb. 0.1 Ursel Bühring, mitten unter ihren Pflanzenfreundinnen.
Seit gut 35 Jahren ist Frau Bühring als Autorin von Fachbüchern und Heilpflanzenartikeln im In- und Ausland bekannt, einige Werke davon im Selbstverlag (über www.ursel-buehring.de) erhältlich. Außerdem wirkt sie regelmäßig bei Radio- und Fernsehsendungen mit. Im August 2001 wurde Frau Bühring für ihr Engagement in der Pflanzenheilkunde der „Regiopreis für Gesundheit und Ernährung“ vom Kulturförderkreis der Wirtschaft verliehen.
Ihr Anliegen, das über Tausende von Jahren überlieferte Heilpflanzenwissen mit modernen Phytotherapie-Kenntnissen in ein Lehrprogramm zusammenzufassen, hat Frau Büring in die Tat umgesetzt. So konnte der wertvolle Schatz an Heilpflanzenkunde in strukturierter Form allen Interessierten zur Verfügung stehen – und fachkompetent angewendet und weitergegeben werden. Ihre Leidenschaft für die Heilpflanzen war die Basis der Gründung ihrer „Freiburger Heilpflanzenschule Ursel Bühring“. Es war Pionierarbeit, als sie im Jahre 1997 die erste Ausbildungsstätte dieser Art in Deutschland eröffnete mit dem Ziel, das traditionelle Wissen über Kräuterheilkunde aufzugreifen und mit den neuesten Erkenntnissen der Naturheilkunde und der wissenschaftlich anerkannten Phytotherapie zu verbinden. Die Schule entwickelte sich von Beginn an zu einer der bundesweit führenden Schulen für Phytotherapie und war bei Medizinern, Pädagogen, Biologen und an Heilpflanzen Interessierten gleichermaßen als berufsbegleitendes Lehrinstitut geschätzt. 2013 gab sie ihre Schule an Nachfolger weiter.
Frau Bühring vermittelt in ihren Seminaren an vielen Institutionen nach wie vor fachkompetentes Wissen „zum Anfassen und mit allen Sinnen begreifen“, damit Lernen auch Freude bereitet. „Lebendiges Lernen“ ist ihr Motto. „Schau hin, aber schau genau hin“ – diese differenzierte Betrachtungsweise prägt ihren Unterricht und das Schreiben gleichermaßen.
Für den Unterricht entwickelte sie ein eigenes praxisnahes Unterrichtskonzept (Curriculum) und völlig neues Lehrmaterial, das immer ausgefeilter wurde und – mit diesem Lehrbuch – schon seit Jahren vielen Weiterbildungsinstituten als Vorbild und als Grundlage für Phytotherapieunterricht dient.
Wie Pflanzen mit gutem Boden und Wuchsbedingungen sich gedeihlich entfalten, wachsen, Blüten und Früchte entwickeln und Samen, die ihrerseits neue Pflanzen hervor bringen, so sind auch aus Schule, Lehrbuch und Unterricht neue Früchte gediehen: Heilpflanzenschulen gibt es mittlerweile weit über 100 Institutionen allein in Deutschland, und aus dem Unterricht entstanden „Unterrichts-Bücher“: das Arbeitsheft Moderne Heilpflanzenkunde, die Lernkarten Heilpflanzenkunde und Heilpflanzen in der Kinderheilkunde. Praxis Heilpflanzenkunde ist das neueste Werk, verfasst zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Michaela Girsch.
Frau Bühring unterrichtet und schreibt weiter, unbelastet von Verwaltung und Besitz. Sie sieht es als Geschenk und Lebensglück an, das, was ihr am Herzen liegt und was sie glücklich macht, weiterführen zu dürfen: mit Menschen und Pflanzen arbeiten und sich Heilpflanzenkunde und Phytotherapie zu widmen.
Zur Arbeit mit diesem Buch
Liebe Leserinnen und Leser,
um Ihnen zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der Lektüre meines Buchs zu gewinnen, möchte ich Ihnen gerne die Struktur etwas erläutern.
Das Buch folgt einem klaren Aufbau: Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte der Pflanzenheilkunde bis heute und deren arzneimittelrechtlichen Regelungen (Monografien und Leitlinien) können Sie gleich „loslegen“:
In den Praxis-Grundlagen finden Sie aus der Vielfalt der praktischen Anwendungsmöglichkeiten die wichtigsten Zubereitungen aufgeführt mit praxisbewährten Rezepturen zum „Nachmachen“ für Ihre eigene Hausapotheke.
Anschließend werden die einzelnen Wirkstoffe dargestellt. Im Unterricht hat es sich bewährt, diesen theoretischen Lehrstoff mit einer Praxiseinheit zu beginnen. Das Erlernte bleibt danach besser im Gedächtnis, da es auch „erfahren“ wurde. Im Kapitel „Heilen mit Pflanzen“ finden sich oft nur Kurzbeschreibungen der Wirkstoffe, sodass Sie im Zweifelsfall immer hier in diesem Kapitel nachschlagen können.
Der Hauptteil des Buchs, das Heilen mit Pflanzen, orientiert sich am jahrelangen Unterrichten. Diese Kombination aus Hintergrundwissen, Theorie, Praxis und Bildern hat sich dort als sehr sinnvoll erwiesen und motiviert und unterstützt das Lernen.
Innerhalb des Textes sind relevante Pflanzen zugunsten schneller Auffindbarkeit in farbiger Schrift gesetzt.
Zu Beginn der einzelnen Indikationen finden Sie eine Zusammenfassung des Unterrichtsstoffs, gefolgt von Abbildungen der wichtigsten Heilpflanzen zu dem jeweiligen Indikationsgebiet. Dann eine Einführung ins Thema, naturheilkundliche Aspekte – und anschließend die einzusetzenden Heilpflanzen. Damit Sie bei der großen Themenfülle den guten Überblick bewahren, finden Sie zu Beginn jeden Kapitels eine Mindmap der wichtigsten Heilpflanzen bei der jeweiligen Indikation.
Innerhalb dieser Kapitel bieten Ihnen dabei Pflanzensteckbriefe („Porträts“) zu den einzelnen Arzneidrogen die wichtigsten Informationen über Geschichte, Botanik, Inhaltsstoffe, Anwendung etc. Um diese auf den ersten Blick zu finden, wurde jeweils ein Pflanzen-Icon dem Pflanzennamen vorangestellt; das sieht dann so aus:
Aufbau der Pflanzensteckbriefe
MariendistelSilybum marianum Silybi fructus (M).
Sie enthalten in dieser Reihenfolge
den deutschen Namen (z. B. „Mariendistel“)
den botanischen Namen (z. B. „Silybum marianum“)
die Drogenbezeichnung (z. B. „Silybi fructus“)
einen Hinweis auf die Erstellung einer Monografie (M) durch eine oder mehrere der Sachverständigen-Kommissionen (Kommission E, ESCOP, HMPC, WHO, siehe Kap. ▶ 2). Es folgen:
Inhaltsstoffe
Wirkungen
Indikationen: Darunter finden Sie Hinweise auf die Einsatzgebiete:
zuerst die „Indikationen Erfahrungsheilkunde“,
darunter die „Indikationen nach Monografien“, also die Monografien aller Sachverständigen-Kommissionen (siehe Kap. ▶ 2). Kursiv geschrieben sind die Indikationen der Kommission E.
Danach folgen die zusätzlichen (!) Indikationen der ESCOP und HMPC (weil sich deren Empfehlungen oft sehr ähneln bzw. sich wiederholen, habe ich der besseren Übersicht halber auf die genaue Wortwahl verzichtet und nur die jeweils zusätzlichen Indikationen eingepflegt). Da die Monografien der WHO keinen offiziellen rechtsverbindlichen Status haben, sind diese, wenn sie sehr abweichend sind zu den Indikationen der Kommission E, ESCOP und HMPC, gesondert gekennzeichnet angegeben: WHO: Indikation XY.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten. Dieser Absatz leitet Sie zu weiteren wichtigen Indikationsgebieten dieser Arzneidroge.
Darreichungsformen
Tagesdosis: Die angegebenen Dosierungen beziehen sich auf die getrockneten Pflanzenteile (Droge) und auf eine gute Wirkstoffqualität der Arzneidrogen.
Nebenwirkungen/Gegenanzeigen
Teezubereitung
Die ausführlichen Pflanzensteckbriefe befinden sich jeweils im Kapitel über die Hauptanwendung(en) dieser Pflanze (z.B. „Spitzwegerich“ im Kapitel „Husten“).
Um Ihnen das Arbeiten in der Praxis etwas zu erleichtern, habe ich die „Bewährten Rezepturen“ zum Abschluss jedes Kapitels übersichtlich zusammengefasst.
Am Ende der einzelnen Indikationen haben Sie dann die Möglichkeit, Ihr Wissen über die wichtigsten Grundlagen zu überprüfen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Fragen im Repetitorium zu beantworten. Der Lernerfolg wird Sie ermutigen. Alle Antworten ergeben sich aus dem Text der Lektion. Aus diesem Grund wurden den Fragen von mir auch absichtlich keine Antworten zugeordnet – denn es ist viel sinnvoller, die Lektion zu wiederholen, wenn Sie sich noch nicht sicher sein sollten.
Im Anhang (ab Kap. ▶ 37) schließlich finden Sie drei tabellarische Verzeichnisse, mit denen Sie sich einen raschen Überblick verschaffen und die gewünschten Informationen im Buch schnell auffinden können.
Drei Verzeichnisse – rasche Orientierung
Sie wollen auf die Schnelle eine bestimmte Pflanze mitsamt ihren wichtigsten Einsatzmöglichkeiten finden? Das ▶ „Pflanzenverzeichnis Deutsch mit Indikationen“ gibt in Kap. 37 den Überblick über sämtliche Pflanzen im Buch - mitsamt deren Indikationen, wenn diese ein Pflanzenporträt im Therapieteil haben. Beim deutschen Pflanzennamen finden Sie die lateinische Bezeichnung (in Klammern) angefügt.
In der nachfolgenden ▶ „Indikationstabelle Heilpflanzen“ sehen Sie auf einen Blick, bei welcher Indikation welche Arzneipflanzen zur Anwendung kommen können.
Im ▶ Kap. 39 „Pflanzenverzeichnis Latein – Deutsch“ finden interessierte Leser zu allen im Buch besprochenen Pflanzen den lateinischen Pflanzennamen und die deutschsprachige Bezeichnung.
Daneben enthält der Anhang auch einige Anregungen für weitergehende Praxisanwendungen. Auch wenn diese vielleicht nicht im „klassischen“ Verständnis von Phytotherapie gelehrt werden, runden sie das Verständnis von und die Verbindung zur Heilpflanzenkunde ab.
Wir haben uns entschieden, in diesem Buch keine Fertigarzneimittel mehr aufzuführen. Zu schnell ändern sich die Präparate oder deren Bezeichnungen, sie waren teils schon zum Zeitpunkt der Drucklegung der vorhergehenden Auflagen nicht mehr aktuell. Einige „Klassiker“ oder spezifische neue Präparate werden im Text erwähnt, ansonsten finden Sie Präparate im Buch „Praxis Heilpflanzenkunde“ (Ursel Bühring, Michaela Girsch) vorgestellt. Oder Sie belesen sich in pflanzenheilkundlichen bzw. naturheilkundlichen Fachzeitschriften, z.B. Zeitschrift für Phytotherapie (D), Naturheilpraxis (D), DHZ (D), Phytotherapie Austria oder der Grünen Liste (Präparateliste Naturheilkunde: https://www.praeparateliste-naturheilkunde.de/praeparateliste-naturheilkunde-die-gruene-liste.html).
Nun wünsche ich Ihnen eine lehrreiche und inspirierende Lektüre. Und vergessen Sie dabei bitte auch nicht, dass ganzheitliches Lernen alle Sinne beinhaltet. Der Gang in die freie Natur gehört als Erholungspause oder Exkursion ganz selbstverständlich dazu, denn „das beste Buch ist die Natur selbst“ (Paracelsus).
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Geleitwort
Geleitwort
Geleitwort
Vorwort zur 6. Auflage
Danksagung
Über die Autorin
Zur Arbeit mit diesem Buch
Teil I Einführung
1 Die Geschichte der Pflanzenheilkunde
1.1 Allgemeines
1.2 3000 v. Chr.
1.3 2500 v. Chr.
1.4 1900 v. Chr.
1.5 1700–1600 v. Chr.
1.6 500–400 v. Chr.
1.7 200 v. Chr.
1.8 100 v. Chr.
1.9 100 n. Chr.
1.10 200 n. Chr.
1.11 800 n. Chr.
1.12 1000–1100 n. Chr.
1.13 1100–1200 n. Chr.
1.14 1300 Jahre n. Chr.
1.15 1500–1600 n. Chr.
1.16 Zeit der Hexenverfolgung
1.17 Paracelsus
1.18 1600–1700 n. Chr.
1.19 1800 n. Chr.
1.20 1900 n. Chr.
1.21 20. Jahrhundert
2 Wissenschaftliche Sachverständigenkommissionen für pflanzliche Arzneimittel
2.1 Allgemeines
2.2 Kommission E
2.2.1 Traditionell angewendet bei …
2.2.2 Besondere Therapierichtungen
2.3 ESCOP – European Scientific Cooperative on Phytotherapy
2.3.1 HMPC – Herbal Medicinal Product Committee
2.4 WHO-Monografien
2.5 Medizinische Leitlinien
Teil II Praxis-Grundlagen
3 Erntewissen
3.1 Pflanzenkundig werden
3.1.1 Pflanzen kennenlernen
3.1.2 Herbarium anlegen
3.2 Sammeln
3.2.1 Wie wird gesammelt?
3.2.2 Sammeltipps für die Wildkräuterküche
3.2.3 Wo wird gesammelt?
3.2.4 Wo sollte nicht gesammelt werden?
3.2.5 Die Sammelausrüstung
3.2.6 Wann wird gesammelt?
3.3 Trocknen
3.3.1 Wie wird getrocknet?
3.3.2 Traditionell: Aufhängen in Kräutersträußen
3.4 Aufbewahren
3.4.1 Die richtige Lagerung
3.4.2 Weiterverwendung
4 Heilpflanzentees
4.1 Allgemeines
4.2 Die Kunst der Heiltee-Zubereitung
4.2.1 Infus: heißer Aufguss
4.2.2 Mazerat: Kaltwasserauszug
4.2.3 Dekokt: Abkochung
4.2.4 Kombinationsmethoden
4.2.5 Teezubereitungen
4.3 Die Kunst der Teemischung
4.3.1 Zubereitung
4.3.2 Dosierung und Anwendungsdauer
4.4 Frische Kräuter
4.5 Rezeptieren
4.5.1 Der verwendete Pflanzenteil
5 Tinkturen
5.1 Allgemeines
5.2 Alkoholische Extrakte
5.2.1 Urtinkturen
5.2.2 Definitionen spezieller alkoholischer Pflanzenauszüge
5.3 Tinkturen für die eigene Hausapotheke
5.3.1 Tinkturen aus Trockenpflanzen
5.3.2 Frischpflanzenauszüge
5.3.3 Alkoholkonzentration
5.4 Kreuzregel
6 Salben, Cremes und Gele
6.1 Allgemeines
6.2 Salben (Unguentum)
6.2.1 Salbenzubereitung
6.3 Cremes
6.3.1 Bewährte Cremegrundlage
6.3.2 Fettcreme
6.4 Gel
6.5 Körperlotion
6.6 Linimente
6.7 Pasten
7 Fette Öle in der äußerlichen Anwendung
7.1 Medizinische Auszugsöle
7.1.1 Zubereitung
7.2 Massageöle und Heilöle mit ätherischen Ölen
7.3 Auszugsöle
8 Medizinalwein und Theriak
8.1 Medizinalwein
8.2 Wurzelwein: Magenbitter
8.3 Theriak – Lebenselixier
9 Wickel und Auflagen
9.1 Wickel
9.1.1 Wadenwickel bei Fieber
9.2 Auflagen, Kompressen und Kataplasmen
9.3 Ölkompressen
10 Bäder mit Heilpflanzen
10.1 Allgemeines
10.2 Vollbäder
10.3 Sitzbäder
10.4 Hand- und Fußbäder
10.5 Augenbäder
10.6 Inhalationen und Dampfbäder
10.7 Gurgeln und Mundspülungen
10.8 Waschungen
10.8.1 Waschzusätze
11 Aromamischungen und Kräuterkissen
11.1 Aromaspray
11.1.1 Empfehlungen reiner ätherischer Öle für Raumspraymischungen
11.2 Hydrolate – aromatische Pflanzenwässer
11.2.1 Anwendungsgebiete der Hydrolate
11.2.2 Hydrolate und ihre Indikationen
11.2.3 Für den Hausgebrauch
11.3 Duftlampe
11.4 Kräuterkissen – ein wirksames, bewährtes Volksheilmittel
11.4.1 Herstellung
11.4.2 Einige bekannte Rezepturen
11.4.3 Rezeptbeispiele
12 Räuchern
12.1 Allgemeines
12.2 Was passiert beim Räuchern?
12.3 Was wird zum Räuchern benötigt und wie wird geräuchert?
12.4 Wann wird geräuchert?
12.4.1 Früher und in anderen Kulturen
12.5 Die wichtigsten Räucherpflanzen
12.5.1 Räucherpflanzen aus unserem Kulturkreis
12.6 Räuchermischungen
12.6.1 Rezeptbeispiele
Teil III Wirkstoffe
13 Zur Dosierung, Wirksamkeit und Gliederung von Pflanzenstoffen
13.1 Dosierung von Heilpflanzen
13.1.1 Dosierung in der Kinderheilkunde
13.1.2 Dosierung in der Geriatrie
13.2 Wirksamkeit – und was wirkt noch?
13.3 Gliederung von Pflanzenstoffen
14 Kohlenhydrate/Pflanzenschleime
14.1 Allgemeines
14.1.1 Pflanzenphysiologie
14.2 Eigenschaften
14.2.1 Wirkungen
14.3 Anwendungen
14.3.1 Innerlich
14.3.2 Äußerlich
14.3.3 Pflanzen mit Kohlenhydraten: Schleimstoffe
15 Glykoside
15.1 Allgemeines
15.1.1 Pflanzenphysiologie
15.2 Eigenschaften
15.2.1 Wirkungen
16 Phenolische Verbindungen
16.1 Salicylate (Salicin)
16.1.1 Allgemeines
16.1.2 Pflanzenphysiologie
16.1.3 Wirkungen
16.1.4 Anwendungen
16.1.5 Pflanzen mit Salicin
16.2 Arbutin
16.2.1 Wirkungen und Anwendungen
16.2.2 Pflanzen mit Arbutin
16.3 Cumarine
16.3.1 Allgemeines und Geschichte
16.3.2 Pflanzenphysiologie und Eigenschaften
16.3.3 Wirkungen
16.3.4 Anwendungen
16.3.5 Pflanzen mit Cumarinen
16.4 Flavonoide
16.4.1 Allgemeines
16.4.2 Pflanzenphysiologie
16.4.3 Eigenschaften
16.4.4 Wirkungen
16.4.5 Anwendungen
16.4.6 Pflanzen mit Flavonoiden
16.5 Anthozyane
16.5.1 Allgemeines
16.5.2 Pflanzen mit Anthozyanen
16.6 Gerbstoffe
16.6.1 Geschichte
16.6.2 Pflanzenphysiologie
16.6.3 Eigenschaften
16.6.4 Gerbstoffe und Alkaloide
16.6.5 Wirkungen
16.6.6 Anwendungen
16.6.7 Pflanzen mit Gerbstoffen
16.7 Anthranoide
16.7.1 Wirkungen und Anwendungen
16.7.2 Pflanzen mit Anthranoiden
17 Terpenoide Verbindungen
17.1 Ätherische Öle
17.1.1 Allgemeines
17.1.2 Pflanzenphysiologie
17.1.3 Eigenschaften
17.1.4 Wirkungen: über Haut, Mund und Nase
17.1.5 Anwendungen
17.1.6 Pflanzen mit ätherischen Ölen
17.2 Harze – durch Wunden heilen
17.2.1 Geschichte
17.2.2 Pflanzenphysiologie
17.2.3 Eigenschaften
17.2.4 Wirkung und Anwendung
17.2.5 Pflanzen mit Harzen
17.3 Bitterstoffe
17.3.1 Geschichte
17.3.2 Pflanzenphysiologie
17.3.3 Eigenschaften
17.3.4 Unterscheidung der Bittermittel
17.3.5 Wirkungen und Anwendungen
17.3.6 Wirkungen auf Magen und Darm
17.3.7 Resorptionsförderung
17.3.8 Wirkungen auf Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse
17.3.9 Unterstützung des Immunsystems und der Blutbildung
17.3.10 Wirkungen auf das Vegetativum
17.3.11 Bitterstoffe für die Haut
17.3.12 Pflanzen mit Bitterstoffen
17.4 Saponine
17.4.1 Allgemeines und Geschichte
17.4.2 Eigenschaften
17.4.3 Wirkungen
17.4.4 Anwendungen
17.4.5 Pflanzen mit Saponinen
17.5 Herzwirksame Glykoside
17.5.1 Allgemeines
17.5.2 Eigenschaften
17.5.3 Wirkungen und Anwendungen
17.5.4 Pflanzen mit Herzglykosiden
18 Alkaloide
18.1 Geschichte
18.2 Pflanzenphysiologie
18.3 Eigenschaften
18.3.1 Wirkungen
18.3.2 Anwendungen
18.3.3 Pflanzen mit Alkaloiden
18.3.4 Pflanzen mit Pyrrolizidinalkaloiden (PA)
19 Scharfstoffe/Senföle
19.1 Allgemeines
19.1.1 Pflanzenphysiologie
19.2 Eigenschaften
19.2.1 Wirkungen
19.3 Anwendungen
19.3.1 Pflanzen mit Senfölen
Teil IV Heilen mit Pflanzen
20 Darmerkrankungen
20.1 Allgemeines
20.1.1 Der Darm als Multitalent
20.1.2 Darmflora – Darmmikrobiom
20.1.3 Darmgesundheit
20.2 Durchfallerkrankungen (Diarrhö)
20.2.1 Grundlagen
20.2.2 Akuter Durchfall
20.2.3 Chronischer Durchfall, chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED)
20.2.4 Reizdarmsyndrom (Colon irritabile)
20.2.5 Heilpflanzen bei Durchfallerkrankungen
20.3 Verstopfung
20.3.1 Grundlagen
20.3.2 Akute Verstopfung
20.3.3 Chronische Verstopfung
20.3.4 Heilpflanzen bei Verstopfung: Abführmittel (Laxanzien)
20.3.5 Stuhlregulierende Heilpflanzen bei Verstopfung
20.3.6 Stimulierend wirkende Abführmittel: Laxanzien
20.4 Blähungen
20.4.1 Grundlagen
20.4.2 Heilpflanzen gegen Blähungen: Karminativa
20.5 Analerkrankungen/Hämorrhoiden
20.5.1 Grundlagen
20.5.2 Heilpflanzen bei Hämorrhoidalerkrankungen zur äußeren Behandlung
20.6 Bewährte Rezepturen bei Darmerkrankungen
21 Magenerkrankungen
21.1 Allgemeines
21.1.1 Phytotherapie
21.2 Akute, unkomplizierte Magenerkrankungen
21.2.1 Übelkeit und Erbrechen
21.2.2 Reisekrankheit
21.2.3 Magenkrämpfe
21.2.4 Akute unkomplizierte Gastritis
21.2.5 Heilpflanzen bei akuten, unkomplizierten Magenerkrankungen
21.3 Sodbrennen, chronische Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür
21.3.1 Sodbrennen
21.3.2 Chronische Gastritis
21.3.3 Reizmagen
21.3.4 Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür
21.3.5 Heilpflanzen bei Sodbrennen, chronischer Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür
21.4 Verdauungsstörungen (funktionelle Dyspepsie, Reizmagen)
21.4.1 Grundlagen
21.4.2 Reizmagen
21.4.3 Krämpfe
21.4.4 Appetitlosigkeit
21.4.5 Blähungen
21.4.6 Heilpflanzen bei Appetitlosigkeit und funktionellen Verdauungsstörungen
21.4.7 Reine Bittermittel: Amara tonica, simplex, pura
21.4.8 Bittermittel mit ätherischen Ölen: Amara aromatica
21.4.9 Bittermittel mit Scharfstoffen: Amara acria
21.4.10 Bittermittel mit Pflanzenschleimen: Amara mucilaginosa
21.4.11 Weitere Heilpflanzen bei dyspeptischen Beschwerden
21.5 Bewährte Rezepturen bei Magenerkrankungen
22 Leber – Galle – Pankreas
22.1 Allgemeines
22.2 Lebererkrankungen
22.2.1 Grundlagen
22.2.2 Leberentzündung: Hepatitis
22.2.3 Fettleber
22.2.4 Leberzirrhose
22.2.5 Naturheilkunde bei Hepatopathien
22.2.6 Heilpflanzen bei Lebererkrankungen: Hepatoprotektiva
22.3 Gallenblasenerkrankungen
22.3.1 Grundlagen
22.3.2 Heilpflanzen bei funktionellen Gallenstörungen: Cholagoga
22.3.3 Gallensteine (Cholelithiasis)
22.4 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen
22.4.1 Akute Pankreatitis
22.4.2 Chronische Pankreatitis
22.4.3 Exokrine Pankreasinsuffizienz (Funktionsschwäche der Bauchspeicheldrüse)
22.4.4 Heilpflanzen bei exokriner Pankreasinsuffizienz
22.5 Bewährte Rezepturen bei Leber-, Gallen- und Pankreaserkrankungen
23 Atemwegserkrankungen
23.1 Allgemeines
23.2 Erkältungskrankheiten: grippaler Infekt
23.2.1 Erkältung
23.2.2 Echte Grippe, Influenza
23.2.3 COVID-19, „Corona“
23.2.4 Schwitzen
23.2.5 Fieber
23.2.6 Schweißtreibende Heilpflanzen: Diaphoretika
23.2.7 Fiebersenkende und schmerzlindernde Heilpflanzen: Antipyretika
23.2.8 Resistenzsteigerung bei Infektanfälligkeit
23.2.9 Heilpflanzen zur Resistenzsteigerung bei Infektanfälligkeit
23.2.10 Resistenzsteigernde Vitamin-C-Drogen
23.2.11 Pflanzliche „Antibiotika“: Phytobiotika
23.3 Husten und Bronchitis
23.3.1 Grundlagen
23.3.2 Reizhusten, trockener, unproduktiver Husten
23.3.3 Heilpflanzen bei unproduktivem, trockenem Reizhusten: Mucilaginosa
23.3.4 Bronchitis: produktiver Husten
23.3.5 Heilpflanzen bei Bronchitis
23.3.6 Spastische Bronchitis, Keuchhusten, Krupphusten und Asthma
23.3.7 Phytotherapie bei Asthma
23.3.8 Bronchospasmolytika
23.3.9 Kieselsäurehaltige Pflanzen zur Lungenstärkung
23.4 Schnupfen – Rhinitis
23.4.1 Grundlagen
23.4.2 Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
23.4.3 Heuschnupfen
23.5 Mund- und Rachenerkrankungen
23.5.1 Mundhöhle
23.5.2 Rachen
23.5.3 Heilpflanzen für den Mund-Rachen-Raum
23.5.4 Pflanzen mit Gerbstoffen
23.5.5 Pflanzen mit Schleimstoffen
23.5.6 Pflanzen mit ätherischen Ölen
23.5.7 Angina – Tonsillitis
23.5.8 Entzündungen von Rachen, Kehlkopf und Luftröhre (Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis)
23.6 Heilpflanzen zur äußerlichen Anwendung bei Atemwegserkrankungen
23.6.1 Inhalationen, Brustkompressen, Einreibungen, Teil- oder Vollbäder
23.7 Bewährte Rezepturen bei Atemwegserkrankungen
24 Harnwegs- und Prostataerkrankungen
24.1 Nieren- und Blasenerkrankungen
24.1.1 Grundlagen
24.1.2 Harnwegsinfekte
24.1.3 Harnwegsdesinfizierende Heilpflanzen
24.1.4 Durchspülung mit Aquaretika
24.1.5 Heilpflanzen zur Durchspülung (Aquaretika)
24.1.6 Nieren- und Harnleitersteine
24.1.7 Heilpflanzen bei Nieren- und Harnleitersteinen
24.2 Funktionelle Beschwerden
24.2.1 Reizblase und Prostatitis
24.2.2 Heilpflanzen bei Reizblase und Prostatitis
24.2.3 Bettnässen
24.3 Prostataerkrankungen
24.3.1 Prostatahyperplasie, benigne (BPH): gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse
24.3.2 Heilpflanzen bei benigner Prostatahyperplasie (Prostataadenom)
24.4 Bewährte Rezepturen bei Harnwegs- und Prostataerkrankungen
25 Rheumatische Erkrankungen
25.1 Was heißt „Rheuma“?
25.1.1 Grundlagen
25.2 Degenerativ-rheumatische Erkrankungen: Arthrose
25.2.1 Grundlagen
25.2.2 Heilpflanzen bei Arthrose
25.3 Entzündlich-rheumatische Erkrankungen: Arthritis
25.3.1 Grundlagen
25.3.2 Heilpflanzen bei entzündlichen rheumatischen Beschwerden
25.4 Fibromyalgie
25.4.1 Grundlagen
25.5 Gicht
25.5.1 Grundlagen
25.5.2 Heilpflanzen bei Gicht
25.6 Äußerliche Heilpflanzenanwendungen bei rheumatischen und neuralgischen Beschwerden
25.6.1 Kräuterbäder
25.6.2 Packungen und Kompressen
25.6.3 Einreibungen
25.6.4 Heilpflanzen bei degenerativen rheumatischen Erkrankungen
25.6.5 Heilpflanzen bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen
25.7 Bewährte Rezepturen bei rheumatischen Erkrankungen
26 Wundbehandlung und Hauterkrankungen
26.1 Die Haut
26.1.1 Naturkosmetik
26.1.2 Altershaut
26.2 Wundbehandlung
26.2.1 Wundbehandlung: akute Wunden und offene Verletzungen
26.2.2 Wundbehandlung: chronische Wunden, gestörte Narbenbildung
26.2.3 Wundbehandlung: Abszess, Furunkel, Karbunkel, Panaritium
26.2.4 Wundbehandlung: Ulcus cruris (Beingeschwür)
26.2.5 Wundbehandlung: geschlossene Wunden, stumpfe Traumen, unblutige Verletzungen
26.2.6 Heilpflanzen in der Wundbehandlung
26.3 Chronische Hauterkrankungen: Dermatitis und Ekzeme
26.3.1 Grundlagen
26.3.2 Neurodermitis (endogenes Ekzem, atopische Dermatitis)
26.3.3 Psoriasis (Schuppenflechte)
26.3.4 Heilpflanzen bei chronischen Hauterkrankungen
26.4 Hauterkrankungen, unspezifische
26.4.1 Akne
26.4.2 Urtikaria (Nesselsucht), Allergien, Photo- und Phytodermatitis
26.4.3 Juckreiz, Pruritus
26.4.4 Herpes labialis, Herpes simplex, Lippenbläschen
26.4.5 Gürtelrose (Herpes zoster)
26.4.6 Sonnenbrand, Sonnenallergie, Verbrennung, Verbrühung
26.4.7 Erfrierungen, Frostbeulen
26.4.8 Haut- und Fußpilze, Tinea; Dermatomykose
26.4.9 Warzen (Verrucae)
26.4.10 Sebostase, trockene Haut
26.4.11 Seborrhö, „fettige“ Haut und „fettige“ Haare
26.4.12 Übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrosis)
26.4.13 Hühneraugen
26.4.14 Insektenstiche
26.4.15 Ödeme
26.4.16 Cellulite
26.4.17 Pigmenterkrankungen
26.4.18 Haarpflege, Haarausfall (Alopezie)
26.4.19 Heilpflanzen bei diversen Hauterkrankungen
26.5 Bewährte Rezepturen bei Hauterkrankungen
27 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
27.1 Allgemeines
27.1.1 Aufgaben des Herzens
27.1.2 Phytotherapie: Phytokardiaka (pflanzliche Herzmittel)
27.2 Herzerkrankungen
27.2.1 Funktionelle Herzbeschwerden
27.2.2 Heilpflanzen bei funktionellen Herzbeschwerden
27.2.3 Äußerliche Anwendungen: Herzsalben
27.2.4 Herzinsuffizienz (NYHA I und II), Altersherz
27.2.5 Herzglykoside
27.2.6 Herzrhythmusstörungen
27.3 Blutdruckerkrankungen
27.3.1 Hypertonie und Hypotonie
27.3.2 Erhöhter Blutdruck (arterielle Hypertonie)
27.3.3 Heilpflanzen bei Bluthochdruck: Antihypertonika
27.3.4 Erniedrigter Blutdruck (arterielle Hypotonie)
27.3.5 Heilpflanzen bei Kreislaufbeschwerden: Antihypotonika
27.4 Arterielle Gefäßkrankheiten
27.4.1 Arteriosklerose und Hyperlipidämie
27.4.2 Heilpflanzen bei Arteriosklerose
27.4.3 Koronare Herzkrankheit (KHK)
27.4.4 Heilpflanzen bei koronarer Herzkrankheit (KHK)
27.4.5 Arterielle Gefäßerkrankungen: periphere (Claudicatio intermittens) und zentrale (vaskuläre Demenz)
27.4.6 Heilpflanzen bei arteriellen Durchblutungsstörungen
27.5 Venöse Gefäßerkrankungen: chronische-venöse Insuffizienz
27.5.1 Grundlagen
27.5.2 Heilpflanzen bei venösen Gefäßerkrankungen
27.6 Bewährte Rezepturen bei Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
28 Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche
28.1 Allgemeines
28.2 Schlafstörungen, nervöse Unruhe
28.2.1 Schlafstörungen
28.2.2 Nervosität und Unruhe
28.2.3 Heilpflanzen bei Schlafstörungen, Nervosität und Unruhe
28.3 Erschöpfungszustände, Wetterfühligkeit, Burn-out-Syndrom
28.3.1 Grundlagen Erschöpfung
28.3.2 Wetterfühligkeit
28.3.3 Burn-out-Syndrom
28.3.4 Adaptogene: Heilpflanzen bei Erschöpfung
28.3.5 Heilpflanzen bei Erschöpfung und Burn-out
28.4 Depressive Verstimmungen und Ängste
28.4.1 Depressionen
28.4.2 Ängste
28.4.3 Heilpflanzen bei depressiven Verstimmungen und Ängsten
28.5 Schmerzen/Kopfschmerzen
28.5.1 Chronische Schmerzen
28.5.2 Kopfschmerzen
28.5.3 Migräne
28.5.4 Heilpflanzen bei Kopfschmerz und Migräne
28.6 Tipps zur Prüfungsvorbereitung
28.7 Bewährte Rezepturen bei Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche
29 Heilpflanzen für Frauen
29.1 Allgemeines
29.2 Menstruation und Menstruationsbeschwerden
29.2.1 Dysmenorrhö (schmerzhafte Regelblutung)
29.2.2 Heilpflanzen bei Dysmenorrhö
29.2.3 Menorrhagie und Hypermenorrhö (verlängerte und zu starke Regelblutung)
29.2.4 Metrorrhagie (außerhalb der Menstruation auftretende Zusatzblutung)
29.2.5 Amenorrhö und Hypomenorrhö (ausbleibende und zu schwache Regelblutung)
29.2.6 Prämenstruelles Syndrom (PMS)
29.2.7 Mastodynie
29.3 Klimakterium: Wechseljahre
29.3.1 Grundlagen
29.3.2 Hitzewallungen in den Wechseljahren
29.3.3 Trockene Haut und Schleimhaut in den Wechseljahren
29.3.4 Gelenkschmerzen in den Wechseljahren
29.3.5 Osteoporose in den Wechseljahren
29.4 Bewährte Rezepturen für Frauen
30 Ausleitung und Regeneration
30.1 Frühjahrskur – Entgiftungskur
30.1.1 Grundlagen
30.1.2 Anleitung zur Durchführung der Frühjahrskur
30.2 Darmsanierung
30.2.1 Grundlagen
30.2.2 Heilpflanzen zur Darmsanierung
30.3 Darmmykose
30.3.1 Grundlagen
30.4 Schwermetall-/Amalgamausleitung
30.4.1 Zahnamalgam
30.4.2 Amalgamausleitung
30.4.3 Heilpflanzen zur Aktivierung der Ausscheidung
30.4.4 Verwendung von Algen
30.4.5 Heilpflanzen mit Gerbstoffen – zum Binden
30.4.6 Schwefelverbindungen – zum Binden
30.4.7 Ausleitung nach Dr. Klinghardt
30.5 Bewährte Rezepturen zur Ausleitung
Teil V Anhang
31 Aus Freyas Zaubergarten
31.1 Allgemeines
31.2 Gesundes Wildgemüse
31.2.1 Wie die wilden Pflanzen schmecken
31.2.2 Tees aus Wildpflanzen
31.2.3 Essbare Blüten – Schönheiten zum Vernaschen
31.2.4 Die wichtigsten essbaren Blüten
31.2.5 Wildpflanzen, die auch zur Winterzeit zu finden sind
31.2.6 Sammelkalender – eine Auswahl
31.2.7 Pflanzen für die Naturapotheke – frisch von der Wiese
31.3 Wildgemüse – Kulturgemüse: eine Gegenüberstellung
32 Gesundheit auf dem Teller
32.1 Wildgemüsemenü
32.1.1 Spitzwegerichsüppchen
32.1.2 Bunter Wiesensalat
32.1.3 Wildkräuterpesto zu Spaghetti
32.1.4 Nymphenspeise
32.1.5 Blütenreiches Maidessert
32.1.6 Wildkräuterbowle
32.1.7 Abendmenü
33 Kommunikation mit Pflanzen
33.1 Allgemeines
33.2 Kluge Pflanzen
33.2.1 Sehen
33.2.2 Bewegen
33.2.3 Spüren
33.2.4 Riechen
33.2.5 Rechnen
33.3 Kommunikation zwischen Pflanzen- und Tierreich
33.4 Kommunikation zwischen Pflanze und Mensch
33.4.1 Pflanzenmeditationen
33.4.2 Meditationen (nach Dr. Wolf-Dieter Storl)
34 Sonnentee und Blütenessenzen: „Bachblüten“ selbst gemacht
34.1 Allgemeines
34.1.1 Sonnentee ansetzen und anwenden
35 Kräuterbräuche heutzutage
35.1 Allgemeines
35.2 Jahreskreisfeste
35.2.1 Wintersonnenwende (Julfest): 20.–23. Dezember
35.2.2 (Maria) Lichtmess (Imbolc): 31. Januar–2. Februar (in der Neumondphase)
35.2.3 Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche (Ostara): 20.–23. März
35.2.4 Walpurgis (Beltane): 30. April
35.2.5 Sommersonnenwende (Johanni oder Litha): 21. Juni
35.2.6 Schnitterinnenfest (Lugnasad): 2. August und Kräuterweihe (Maria Himmelfahrt): 15. August
35.2.7 Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche: Erntedank (Mabon) 22. September
35.2.8 Allerseelen (Samain), Dunkelheitsfest, Halloween: 31. Oktober auf 1. November
36 Verzeichnis der Abkürzungen
37 Pflanzenverzeichnis Deutsch mit Indikationen
38 Indikationstabelle Heilpflanzen
39 Pflanzenverzeichnis Latein – Deutsch
40 Weiterführende Adressen
40.1 Bezugsquellen Pflanzen und/oder Samen
40.2 Kräuter, Medizinaltees und Tinkturen
40.3 Ätherische Öle
40.4 Wickelzubehör/Bienenwachsauflagen
40.5 Heilpflanzengärten
40.6 Internetadressen
40.7 Zeitschriften
41 Literatur
41.1 Botanische Bücher (inkl. Bestimmung)
41.2 Geschichte der Heilpflanzenkunde, Mythologie/Etymologie
41.3 Giftpflanzen
41.4 Grundlagenwerke (Klassiker, Lehr- und Ausbildungsbücher)
41.5 Grundlagenwerke (Phytotherapie allgemein)
41.6 Grundlagen –Wirkstoffe
41.7 Heilpflanzen- und Kräuterbücher
41.8 Heilpflanzen in der Kinderheilkunde/für Kinder
41.9 Heilpflanzen in der Kosmetik
41.10 Heilpflanzen in der Küche/Gewürze
41.11 Kräutermärchen
41.12 Naturheilkunde
41.13 Phytotherapie für verschiedene Berufsgruppen
41.14 Phytotherapie bei verschiedenen Indikationen
41.15 Praxis/Anwendung Aromatherapie
41.16 Praxis/Anwendung Bachblüten
41.17 Praxis/Anwendung Räuchern
41.18 Praxis/Anwendung Wickel
41.19 Studien und Quellen
41.20 Internetquellen
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Einführung
1 Die Geschichte der Pflanzenheilkunde
2 Wissenschaftliche Sachverständigenkommissionen für pflanzliche Arzneimittel