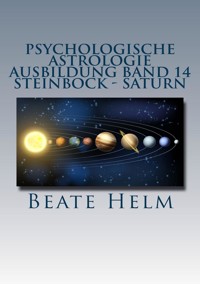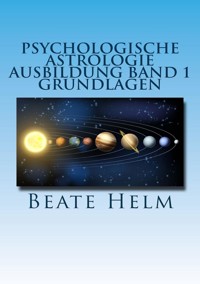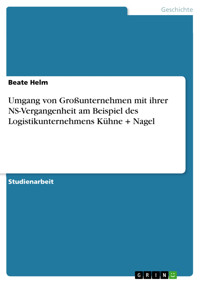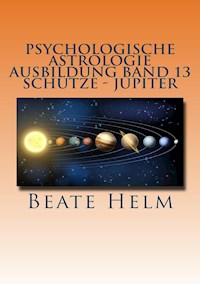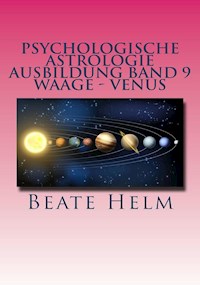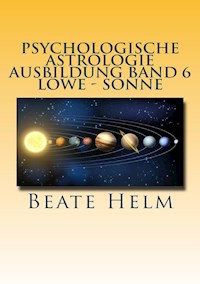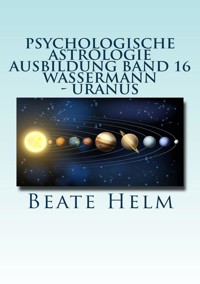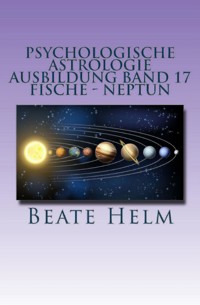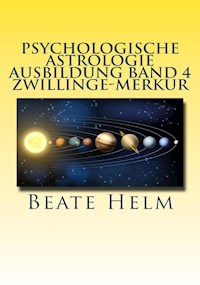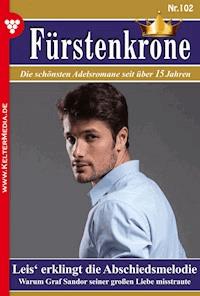
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. Gräfin Coletta Tihany stand vor dem hohen goldumrahmten Spiegel und warf einen letzten kritischen Blick über ihre schlanke Gestalt im schwarzen Nachmittagskleid, dessen einziger wertvoller Schmuck die dreireihige rosaschimmernde Perlenkette war, die ihr verstorbener Mann ihr noch vor wenigen Wochen geschenkt hatte. Vor drei Minuten hatte ihr Kammerdiener Ludwig gemeldet, dass ihr Stiefsohn Sandor gekommen sei, den sie vor ein paar Tagen telegrafisch vom Tod seines Vaters benachrichtigt hatte. Während Graf Sandor im Empfangssalon auf sie wartete, stand sie hier im eleganten Ankleidezimmer und versuchte, eine würdevolle Haltung einzunehmen. Seit zehn Jahren hatte sie ihren Stiefsohn nicht gesehen. Damals war Sandor siebzehn gewesen und hatte auf der exklusiven Universität von Cambridge studiert, wohin ihn sein Vater geschickt hatte. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war damals schon sehr gespannt gewesen und hatte den endgültigen Bruch bekommen, als sie kurz nach dem Tod von Sandors Mutter als neue Herrin ins Schloss Tihany einzog. Von diesem Tag an gab es nur noch einen kühlen und kurzen Schriftwechsel zwischen Vater und Sohn. Sandor war dann nach seinem Studium nach Kanada gegangen, und die Verbindung war ganz abgerissen. Gräfin Coletta war nicht ganz unschuldig daran, das wusste sie, und auch jetzt wäre ihr lieber gewesen, wenn der Stiefsohn ferngeblieben wäre. Aber es wäre unverantwortlich gewesen, ihn nicht vom plötzlichen Tod seines Vaters zu unterrichten und sein Kommen zu erbitten. Zufrieden betrachtete sie ihr Spiegelbild. Sie war dreißig Jahre alt, und sie sah sehr gut aus. Sandor musste jetzt siebenundzwanzig Jahre alt sein. Wenn noch keine andere Frau sein Herz erobert
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 102–
Leis' erklingt die Abschiedsmelodie
Warum Graf Sandor seiner großen Liebe misstraute
Beate Helm
Gräfin Coletta Tihany stand vor dem hohen goldumrahmten Spiegel und warf einen letzten kritischen Blick über ihre schlanke Gestalt im schwarzen Nachmittagskleid, dessen einziger wertvoller Schmuck die dreireihige rosaschimmernde Perlenkette war, die ihr verstorbener Mann ihr noch vor wenigen Wochen geschenkt hatte.
Vor drei Minuten hatte ihr Kammerdiener Ludwig gemeldet, dass ihr Stiefsohn Sandor gekommen sei, den sie vor ein paar Tagen telegrafisch vom Tod seines Vaters benachrichtigt hatte.
Während Graf Sandor im Empfangssalon auf sie wartete, stand sie hier im eleganten Ankleidezimmer und versuchte, eine würdevolle Haltung einzunehmen.
Seit zehn Jahren hatte sie ihren Stiefsohn nicht gesehen. Damals war Sandor siebzehn gewesen und hatte auf der exklusiven Universität von Cambridge studiert, wohin ihn sein Vater geschickt hatte.
Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war damals schon sehr gespannt gewesen und hatte den endgültigen Bruch bekommen, als sie kurz nach dem Tod von Sandors Mutter als neue Herrin ins Schloss Tihany einzog. Von diesem Tag an gab es nur noch einen kühlen und kurzen Schriftwechsel zwischen Vater und Sohn. Sandor war dann nach seinem Studium nach Kanada gegangen, und die Verbindung war ganz abgerissen.
Gräfin Coletta war nicht ganz unschuldig daran, das wusste sie, und auch jetzt wäre ihr lieber gewesen, wenn der Stiefsohn ferngeblieben wäre. Aber es wäre unverantwortlich gewesen, ihn nicht vom plötzlichen Tod seines Vaters zu unterrichten und sein Kommen zu erbitten.
Zufrieden betrachtete sie ihr Spiegelbild. Sie war dreißig Jahre alt, und sie sah sehr gut aus. Sandor musste jetzt siebenundzwanzig Jahre alt sein. Wenn noch keine andere Frau sein Herz erobert hatte, konnte es ihr doch nicht schwerfallen, ihn um den Finger zu wickeln.
Im Empfangssalon, einem Raum mit dunkelgrünen Samtportieren und einer sonnengelben Sesselgarnitur, ging Graf Sandor Tihany ungeduldig auf und ab.
Mit Befremden hatte er die neue Adresse seiner Stiefmutter zur Kenntnis gekommen. Und mit dem gleichen Befremden war er hier in diesem kleinen Palais erschienen, das in der vornehmsten Gegend der Stadt lag, umgeben von einem großen Garten, der von hohen Eisengittern umzäunt war.
Gedankenverloren starrte er auf verschiedene Gegenstände, die ihm seltsam bekannt vorkamen. Dann wurde ihm ganz plötzlich bewusst, dass dies alles Dinge waren, die ihm aus der Kindheit und frühen Jugend vertraut waren. Alle diese Gegenstände hatten damals Schloss Tihany geziert, in dem er großgeworden war. Die vergoldete Rokokouhr hatte ihren Platz auf dem Marmorkamin im Salon seiner geliebten Mutter gehabt, das Gemälde von Degas hatte im Musikzimmer gehangen, und der riesige Bronzeleuchter hatte in der Halle gestanden.
Wie war sein Vater dazu gekommen, diese Gegenstände aus Tihany zu entfernen und sie hier in seinem neuen Palais aufzustellen? Oder hatte seine Stiefmutter das veranlasst?
In seine Gedanken hinein öffnete sich beinahe lautlos die Tür, und Gräfin Coletta trat ein.
Sie hatte ein Taschentuch in der Hand und hielt es sekundenlang gegen ihre Lippen, als ob sie einen schmerzlichen Aufschrei unterdrücken wollte. Ihre ganze Miene drückte tiefe Trauer aus. Einige Momente stand sie da und musterte Sandor, wobei sie feststellte, dass er ein ausgesprochen schöner Mann geworden war. Dann ging sie schwankend auf ihn zu und sank ihm mit einem Wehlaut an die Brust.
Graf Sandor war derart überrascht, dass er wie gelähmt dastand, ehe er ein paar beruhigende Worte murmeln konnte. Er fasste seine Stiefmutter sanft an den Armen und schob sie etwas zurück, denn die Berührung war ihm sehr peinlich.
»Bitte«, sagte er leise, aber eindringlich, »fassen Sie sich, Gräfin.«
Sie hob den Kopf und starrte ihn an.
»Aber, Sandor, warum redest du mich mit Sie an? Das darfst du nicht tun! Es ist entsetzlich genug für mich, jetzt allein zu sein.«
»Ich habe nie das Du gebraucht«, erwiderte er, »wir sind uns fremd. Ich entsinne mich, dass auch Sie nie den Wunsch äußerten, mich mit Du anzureden.«
»Ach, das war damals«, entgegnete sie mit einer wegwerfenden Geste, »da warst du auch so abweisend zu mir. Vergessen wir das alles, bitte! Der Schmerz um deinen Vater, meinen geliebten Gatten, muss uns vereinigen. Ich bin so froh, dass du da bist.«
Ihre Augen hingen an seinem rassigen Gesicht mit den graublauen Augen und dem dunklen Haar.
»Du bist allein gekommen, Sandor. Bist du nicht verheiratet oder verlobt?«
Sein braungetöntes Gesicht verfinsterte sich leicht.
»Ich hatte wenig Zeit, mich nach einer passenden Lebensgefährtin umzusehen. Und eine leichtfertige Wahl kann ich nicht treffen, denn ich bin nicht mit Reichtümern gesegnet.«
Sie lachte leise auf, sah seinen erschreckten Blick und wurde sofort wieder ernst.
»Du bist doch nicht arm«, meinte sie und fasste nach seinem Arm. »Komm, ich werde dir das schönste Gästezimmer des Hauses zeigen! Dort machst du dich etwas frisch, und dann essen wir eine Kleinigkeit, ja?«
»Wo ist mein Vater aufgebahrt?«, fragte er dumpf.
»In der Friedhofskapelle natürlich. Dorthin fahren wir später. Ach, es war entsetzlich für mich! Ich war so allein. Nie hätte ich geglaubt, dass Stefan mich so früh verlassen würde.«
Graf Sandor sah seine Stiefmutter prüfend an. Sie war immer noch sehr hübsch, ja, beinahe auffallend reizvoll. Das Schwarz stand ihr gut, und ihr dunkles, schimmerndes Haar lag in weichen Wellen um den Kopf. Sie gefiel ihm besser als damals. Oder lag es daran, dass der Tod seines Vaters ihn versöhnlicher stimmte?
Sie schien wirklich sehr um den Vater zu trauern.
»Sie hätten bedenken müssen, dass mein Vater fünfundzwanzig Jahre älter war als Sie.«, sagte er sanft.
»Warum kannst du dich nicht an das Du gewöhnen«, entgegnete sie, während sie seinen Arm festhielt und ihn hinausführte. »Lass uns gute Freunde sein und den alten Hader vergessen.«
Ihre braunen Samtaugen flehten ihn an.
»Wenn du es willst«, murmelte er nachgebend.
Sie atmete sichtlich auf.
Das Gastzimmer war wirklich sehr gemütlich. Sein Koffer war bereits ausgepackt, Blumen standen auf dem kleinen Tisch, und einige ausgesuchte Bücher lagen zum Lesen bereit.
»Sehr aufmerksam von dir«, bemerkte er, und fast war er nahe daran, sich zu schämen, dass er sie nie gemocht hatte.
»Na siehst du«, schmeichelte sie. »Ich lasse dich ein Stündchen allein. Wir speisen dann unten im Esszimmer.«
»Wohnt ihr hier schon lange? Hat mein Vater dieses Palais erworben?«, fragte er, als sie schon an der Tür war.
»Seit einem Jahr etwa haben wir uns jeweils einige Monate hier aufgehalten. Dein Vater konnte es günstig erwerben. Natürlich musste eine Menge Geld hineingesteckt werden. Es war arg vernachlässigt.«
Sie winkte ihm noch kurz zu, und ehe er weitere Fragen an sie richten konnte, war sie hinausgeschlüpft.
Er brauchte nicht lange, um sich von den Strapazen der Reise zu erholen. Eine seltsame innere Unruhe hatte ihn erfasst. Wieso hatte sein Vater dieses Palais gekauft, da er doch Schloss Tihany und das etwa sieben Kilometer von diesem entfernte Jagdschloss Erlau besaß? Die Erhaltung von drei Schlössern musste doch riesige Summen verschlingen.
Graf Sandor verließ sein Gastzimmer. Er schlenderte die Gänge entlang, durchmaß eine langgestreckte Zimmerflucht und stellte immer wieder mit Betroffenheit fest, dass wertvolle Gemälde, kostbare Porzellane und Teppiche aus Schloss Tihany jetzt dieses Haus hier schmückten.
Die Gräfin erwartete ihn im Esszimmer, das mit dunklen Mahagonimöbeln ausgestattet war.
Auf seine Bitte hin erzählte sie ihm von den letzten Stunden seines Vaters.
»Die Trauerfeier wird doch sicher in Tihany stattfinden, nicht wahr?«, fragte Graf Sandor.
Seine Stiefmutter schüttelte den Kopf und sagte: »Nein! Sie findet hier statt. Wir haben hier eine Menge guter Freunde. Die kleine Kapelle in Tihany würde die Trauergemeinde nicht fassen. Erst die Urne wird im Erbbegräbnis von Tihany beigesetzt. Dein Vater wollte es so, und ich werde seinen letzten Wunsch getreulich erfüllen. Verstehst du das?«
»Ja, natürlich«, murmelte er tonlos.
»Tihany wird dir allein gehören, Sandor. Das weißt du doch, nicht wahr? Da aus meiner Ehe mit deinem Vater leider keine Kinder entsprossen sind, fällt Tihany an dich.«
Graf Sandor verfärbte sich.
»Daran habe ich nie mehr gedacht. Ich nahm an, dass du dort leben würdest und dass es dir auch so lange gehört.«
»Nein! An diesem Erbfolgerecht konnte niemand etwas ändern.«
»Das tut mir leid«, sagte er hastig, »ich habe auf keinen Fall die Absicht, dich dort zu verdrängen.«
Gräfin Coletta lachte leise auf.
»Habe keine Angst, ich werde nicht dort leben. Ich habe hier mein Palais, das mir dein Vater zum Geschenk gemacht hat. Es gefällt mir. Für mich wäre die Einsamkeit in Tihany jetzt besonders bedrückend. Hier habe ich Menschen um mich, die mich in meinem großen Schmerz aufrichten. Ich werde dich öfter besuchen kommen, wenn du magst.«
»Du bist jederzeit willkommen«, sagte er offen.
»Wie lieb von dir.« Sie fuhr zart über seine Hand. »Ich bedaure sehr, dass wir all die Jahre so wenig voneinander gehört haben. Aber du warst ein großer Trotzkopf, Sandor. Dein Vater war einfach noch zu jung, um allein zu bleiben. Du bist jetzt älter geworden und wirst das nötige Verständnis dafür aufbringen.«
»Ja, natürlich«, sagte er knapp.
Sie lächelte ihn gewinnend an.
»Ich vermute, du wirst auch nicht immer auf Tihany leben wollen und es höchstens zu deiner Sommerresidenz machen. Oder hast du die Absicht, deinen Beruf in Kanada aufzugeben.«
»Ich weiß nicht«, gestand er. »Der Tod meines Vaters kam so überraschend für mich, dass ich bisher keine Zeit fand, über meine Zukunft nachzudenken.«
»Das braucht auch seine Zeit. Überstürze nichts. Und wenn du Rat suchst, lieber Sandor, so stehe ich ganz zu deiner Verfügung. Ich bin zwar nur ein paar Jährchen älter als du, aber eine Frau sieht manchmal weiter als ein Mann.«
Wieder fuhr sie sanft liebkosend über seinen Handrücken.
*
Die nächsten beiden Tage vergingen für Graf Sandor wie ein unangenehmer Traum. Er empfand wohl echte Trauer um den Vater, aber diese Gefühle hielten nicht allzu lange an, denn er hatte seinen Vater Jahre hindurch nicht gesehen und zu wenig Liebe von ihm erfahren.
Die Trauerfeier war für seine Begriffe viel zu pompös. Manchmal hatte er während der Zeremonie das Gefühl, als ginge es seiner schönen Stiefmutter nur darum, eine allseits bewunderte Rolle zu spielen. Sie stand neben ihm und stützte sich auf seinen Arm, als müsse sie jeden Moment befürchten umzufallen.
Sie bat ihn nach der Feier inständig, doch noch ein bis zwei Tage bei ihr zu bleiben, und er willigte notgedrungen ein, obwohl es ihn mit Macht nach Tihany zog.
Sie war rührend um ihn bemüht und versuchte, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen, sodass er im Stillen Abbitte leistete, dass er sie bisher so ungerecht behandelt hatte.
Graf Sandor hatte etwa hundert Kilometer zu fahren, bis er den kleinen Ort Neuburg erreichte, der etwa vier Kilometer von Schloss Tihany entfernt lag und die einzige Bahnstation weit und breit war.
Als er in der prallen Mittagssonne ausstieg und den Bahnhof verließ, bedauerte er, keinen Wagen vom Schloss bestellt zu haben, der ihn hier abholte.
Er hatte seine Stiefmutter gebeten, mit ihm zu fahren, damit sie Gesellschaft habe, aber Gräfin Colette hatte abgelehnt. »Ich würde in Tihany zu sehr an alles erinnert werden«, hatte sie erklärt und tief aufgeseufzt. Und er hatte sofort Verständnis für ihre Haltung gezeigt.
Seinen Koffer gab er bei der Gepäckaufbewahrung ab. Dann trat er auf die Straße und bog kurz hinter dem letzten Haus in einen schmalen Feldweg ein.
Der Ort hatte sich verändert. Neue Häuser waren gebaut worden, einige neue Plätze entstanden, die ein Brunnen und Blumenrabatten zierten.
Aber der Feldweg war noch derselbe. Er führte zwischen Wiesen und Äckern hindurch, die ab und zu von einer kleinen Waldung unterbrochen wurden.
Das Herz ging dem jungen Grafen auf, denn all dies gehörte zu seiner Heimat, war ihm vertraut von Kindheit an. Die zehn Jahre seiner Abwesenheit kamen ihm heute wie ein Tag vor. Als sei es gestern gewesen, blieb er stehen, blickte über die Tannenschonung hinweg und glaubte das rote Ziegeldach des Mitteltraktes von Tihany zu sehen.
Er seufzte auf und beschleunigte seine Schritte, bis er heftig atmend vor der hohen Mauer stand, die den Park von Tihany umsäumte. Er musste noch etwa hundert Schritt gehen, bis er das hohe Eisentor erreicht hatte.
Die freudige Erwartung, die ihn die ganze Zeit erfüllt hatte, wich jedoch jäh namenlosen Entsetzen.
Der Park war nicht mehr sorgsam gepflegt wie einst, sondern verwildert, die Rasenflächen nicht geschoren, keine Blumen blühten in bunter Fülle, und das riesige Wasserbecken lag still und öde vor ihm.
Graf Sandor stand einige Minuten wie vom Blitz getroffen. Dann öffnete er die schwere Eichentür und betrat den Park. Niemand war zu erblicken.
Langsam schritt er durch die breite Anfahrtsallee auf das riesige Schloss zu, aus dem alles Leben gewichen schien. Kein Fenster war geöffnet, das große Eingangsportal war fest geschlossen.
Erst stand er unschlüssig vor der breiten Freitreppe und sah zum Portal hinauf. Dann lief er die Stufen hinauf und setzte die Messingklingel in Bewegung. Sein Herz pochte wie rasend, während er auf jedes Geräusch achtete. Aber es näherten sich keine Schritte, kein Fenster wurde geöffnet. Es blieb totenstill.
Graf Sandor rief: »Hallo!« Er klingelte wieder und wieder, aber es tat sich nichts.
Gab es denn kein Personal mehr in Tihany? Träumte er, oder narrte ihn ein Spuk?
Er schritt die gesamte Front des alten Schlosses ab. Aber niemand war zu sehen, niemand gab Antwort auf seine Rufe. Das Schloss schien von allen Menschen verlassen. Auch die Seiteneingänge und das Gartenportal waren fest verschlossen.
Graf Sandor setzte sich erschöpft auf eine der weißen Marmorbänke, die den Parkweg zierten. Sein Auge glitt über den hinteren Teil des Parks, der genauso ungepflegt war wie die vordere Seite.
Warum hatte seine Stiefmutter ihn nicht darauf vorbereitet, dass Schloss Tihany offensichtlich unbewohnt war? Sie wusste es doch! Aber warum das alles? Das Schloss musste doch saubergehalten werden. Oder hatte sie das Personal beurlaubt, solange sie in ihrem Stadtpalais wohnte? Ja, so musste es sein.
Er beruhigte sich wieder etwas, aber dass seine Stiefmutter ihn hierherfahren ließ, ohne ihn einzuweihen, war unverantwortlich. War sie so in ihren Schmerz um den Verlust des Gatten verstrickt, dass sie das vergessen hatte?
Was sollte er tun? Zurückfahren? O nein, nun war er einmal hier und wollte die Dinge klären. Irgendjemand musste einen Schlüssel zum Schloss haben. Auch das hätte die Gräfin ihm sagen müssen.
Zu seiner Erleichterung fiel ihm der Gutsbetrieb ein, der zum Schloss gehörte und zu dem ein Fahrweg von etwa zweieinhalb Kilometern führte. Hoffentlich war das Gut wenigstens bewohnt.
Seufzend erhob er sich und machte sich auf den Weg, der durch ein kleines Wäldchen führte, das kurz vor dem Wohngebäude des Gutes endete.
Schon von Weitem hatte er das Wiehern der Pferde und das Gegacker des Federviehs gehört, das vom Rattern der Traktoren auf den Feldern mehrfach übertönt wurde. Gott sei Dank, hier war noch Leben, hier wurde offenbar genauso gearbeitet wie früher.
Die Tür zum Wohnhaus von Gutsverwalter Lindemann stand offen. Das Haus war frisch gestrichen, Blumenkästen hingen an den Fenstern.
Zögernd betrat Graf Sandor die matt erhellte Diele des Hauses. Im gleichen Moment kam Frau Lindemann aus der Küche. Sie blieb wie erstarrt stehen, als sie den Fremden erblickte, und dann schrie sie auf:
»Mein Gott, Herr Graf! Sind Sie es wirklich?« Sie rannte ins Wohnzimmer und rief: »Gustav, komm schnell! Der Herr Graf ist da! Mein Gott, nein, so etwas!«
Dann stürzte sie wieder auf Graf Sandor zu und griff nach seinen Händen.
»Herr Graf«, stammelte sie, während Tränen über ihr Gesicht rannen, »dass Sie wieder da sind! Nein, das ist zu viel für mich. Ich muss einfach weinen. Verzeihen Sie mir.«
Sie trocknete ihre Tränen an der Küchenschürze und sah verlegen weg. Inzwischen war auch ihr Mann herausgekommen. Er stand ebenso verdattert da und starrte den Grafen an. Er war genauso gerührt wie seine Frau, versuchte aber, es zu verbergen, was ihm nur sehr schlecht gelang. Er bat den Grafen ins Wohnzimmer und bot ihm in einem Sessel Platz an.
»Warum haben Sie mir nicht geschrieben, Herr Graf? Ich hätte Sie abgeholt. Waren Sie etwa zuerst im Schloss?«
Entsetzt sah er den Grafen an.
»Ja, natürlich«, murmelte Graf Sandor. »Würden Sie mir bitte eine Erklärung geben, Herr Lindemann?«
»Das muss ich ja wohl, Herr Graf. Zuerst aber ruhen Sie sich mal etwas aus. Meine Frau wird Ihnen eine Tasse Kaffee machen. Kommen Sie direkt von Kanada, Herr Graf?«
»Nein, ich war im Palais meiner Stiefmutter. Sie können sich denken, dass mich das alles sehr befremdet hat. Ist denn kein Mensch in Tihany?«
Herr Lindemann senkte den Blick. Das Eintreten seiner Frau mit einem Tablett, auf dem eine Kanne Kaffee und frischer Kuchen standen, enthob ihn zunächst einer Antwort.
»So, Herr Graf«, sagte er, »trinken Sie. Sind Sie denn den ganzen Weg von Neuburg hierher zu Fuß gegangen? Ich hätte doch den Wagen geschickt. Aber ich dachte, Sie kämen erst in vierzehn Tagen zur Beisetzung der Urne Ihres Herrn Vaters. Ich wollte bis dahin im Park und im Schloss ein wenig Ordnung machen. Den Schlüssel habe ich ja noch. Tut mir schrecklich leid, Herr Graf. Das muss wirklich eine böse Überraschung für Sie gewesen sein. Ich hätte Sie gern langsam darauf vorbereitet, dass Ihr Herr Vater mit seiner jungen Gattin seit einem Jahr nicht mehr auf Schloss Tihany gelebt hat.«
»Warum?«, fragte Graf Sandor außer sich.
Herr Lindemann zuckte mit den Achseln.
»Ich habe mir meine eigenen Gedanken darüber gemacht. Ob sie stimmen, weiß ich nicht. Ich dachte, die Gräfin hätte Ihnen den Grund dafür genannt.«
»Nein«, erwiderte Graf Sandor hart. »Sie hat mich völlig im Unklaren darüber gelassen. Ich möchte ins Schloss. Bitte, geben Sie mir die Schlüssel!«
»Ich werde Sie begleiten, Herr Graf. Während der Fahrt werde ich Ihnen dann meine Ansicht über den Wegzug Ihres Herrn Vaters darlegen. Meine Frau hat immer noch Angst, dass die Gräfin uns schaden könnte. Aber ich weiß, dass Sie jetzt allein über Tihany zu bestimmen haben. Nicht wahr, so ist es doch?«
»Ja, das ist richtig, aber ich weiß gar nicht, ob es mich noch glücklich macht. Gehen wir! Ich werde erst ruhiger sein, wenn ich in Tihany bin. Läuft der Gutsbetrieb wie sonst, Herr Lindemann?«
»Na, so einigermaßen. Ich gebe mir wahrlich alle Mühe, möglichst viel herauszuschlagen. Ihr Herr Vater war zwar nie zufrieden mit den Erträgen, aber wenn nichts hineingesteckt wird, kann man auch nichts herausholen. Sie können sich in den nächsten Tagen von allem überzeugen, Herr Graf. Ich habe mit den wenigen Landarbeitern, die hiergeblieben sind, so viel Ackerland bestellt wie nur möglich war.«
»Wenige Leute? Wo sind die anderen geblieben?«
»Alle abgewandert, Herr Graf. Aber nur weil Ihr Herr Vater die Leute zu schlecht bezahlt hat. Es tut mir leid, über einen Toten so zu sprechen, aber Tatsachen kann man nicht verschweigen.«
Graf Sandor war blass geworden. Er erhob sich.
»Alles, was ich von Ihnen höre, versetzt mich in immer größeres Erstaunen, Herr Lindemann«, murmelte er.
In einem alten klapprigen Auto fuhr der Gutsverwalter den jungen Grafen zum Schloss.
»Herr Graf«, begann Gustav Lindemann, »ich will Sie nicht gegen Ihre Frau Stiefmutter aufhetzen, das liegt mir fern, aber ich mache Sie schon jetzt darauf aufmerksam, dass eine Menge wertvoller Gegenstände vom Schloss in das neue Stadtpalais gewandert ist. Seit einem Jahr war die Gräfin nicht mehr hier, und Ihr Herr Vater kam nur, um die Gelder für die Ernteerträge abzuholen.«
Graf Sandor lehnte sich etwas zurück. Um seine Mundwinkel zuckte es.
»Sagen Sie mir alles, Lindemann, ich bin auf das Schlimmste gefasst.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: