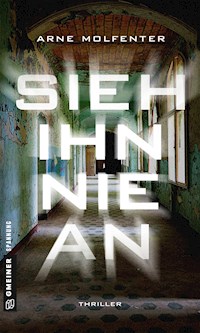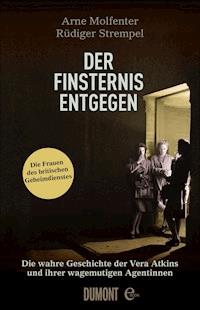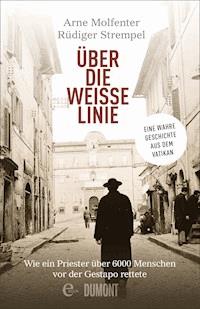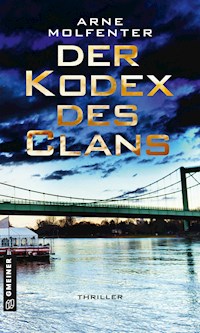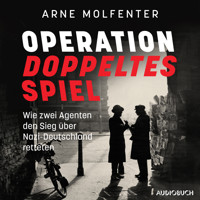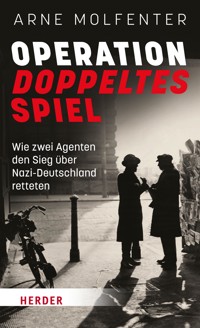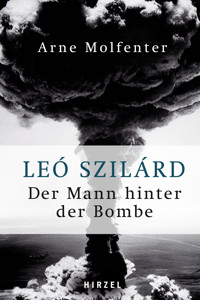
21,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: S. Hirzel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von der roten Ampel bis zur ersten Atombombe
Leó Szilárd ist ein brillanter Physiker – dabei hat er sein Studium in Berlin ursprünglich begonnen, ohne überhaupt immatrikuliert zu sein. Mit seinem Professor und Nachbarn Albert Einstein diskutiert er auf langen Spaziergängen von der Universität nach Hause über wissenschaftliche Fragen aller Art. Szilárd, der jüdischen Abstammung ist, flieht 1933 aufgrund der Machtergreifung Hitlers nach London. Mit der Entdeckung des Neutrons entwickelt er eine neue Obsession: Wie kann es gelingen, die unglaubliche Energie, die in einem Atomkern steckt, freizusetzen und nutzbar zu machen? Ausgerechnet an einer roten Ampel kommt ihm die entscheidende Idee.
- Von der Entdeckung der atomaren Kettenreaktion bis zur Zündung der ersten Atombombe
- Die spannende Biografie des berühmten Physikers als erzählendes Sachbuch
- Ein tolles Geschenk für alle, die an Wissenschaft und Geschichte interessiert sind
- Die Entwicklung der Atombombe als ein Akt des Pazifismus? Szilárds Reaktion auf den Trinity-Test
- Ein bedeutendes Stück Geschichte des 20. Jahrhunderts, erzählt anhand der Lebensgeschichte des bekannten Wissenschaftlers Szilárd
Der Wettlauf um die Entwicklung der Atombombe
Leó Szilárds Ziel ist es, zu verhindern, dass die Deutschen als erste über Atomwaffen verfügen. Zusammen mit Albert Einstein und anderen Wissenschaftlern stellt er sich in den Dienst der amerikanischen Regierung, um die Entwicklung einer Atombombe zu Verteidigungszwecken voranzutreiben.
Als er begreift, dass es beim Manhattan-Projekt nicht um die Verteidigung, sondern um einen Angriff auf Japan geht, ist er entsetzt. Der Autor und Journalist Arne Molfenter zeichnet den Lebensweg des genialen Mannes nach, dessen Erfindung völlig gegen seine Intention verwendet wurde. Ein spannendes Buch über einen Wissenschaftler, dessen Forschungen den Lauf der Geschichte beeinflussten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arne Molfenter
Leó Szilárd – Der Mann hinter der Bombe
Für Ruth
»Ich möchte lieber Wurzeln als Flügel haben, aber wenn ich keine Wurzeln haben kann, werde ich Flügel haben.«
Leó Szilárd
PROLOG
Los Alamos, New Mexico, Juli 1945
In der Wüste geht niemand ans Telefon. Es ist Juli 1945, in Europa ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, aber im Pazifikraum wird weiterhin gekämpft.
Normalerweise wäre es nicht beunruhigend, wenn in der Wüstenstadt Los Alamos im US-Bundesstaat New Mexico keiner den Telefonhörer abnimmt. Aber für Leó Szilárd bedeutet die Stille am anderen Ende der Leitung Unheil. Er befürchtet, was niemand zugeben wird: Das streng geheime Manhattan-Projekt ist bereit für den ersten Test der Atombombe.
Die brillantesten Wissenschaftler der Welt haben an dieser Bombe gearbeitet. Sie haben einige der schnellsten wissenschaftlichen Fortschritte in der Geschichte der Menschheit erzielt. Theoretisch müsste die Bombe perfekt funktionieren, aber bisher sind die ersten Tests der einzelnen Komponenten alle gescheitert.
Wie eine Matrjoschka, eine schachtelbare russische Puppe, ist die Bombe in Schichten aufgebaut. Die explosivste, am stärksten brennbare Substanz, befindet sich im Kern. Dort werden die ersten Neutronen abgefeuert, die die Spaltung und eine nukleare Kettenreaktion auslösen.
Das ist der Prozess, auf den Leó Szilárd vor über einem Jahrzehnt erstmals an einer Londoner Straßenkreuzung gekommen ist. Atome brechen auseinander, weitere Neutronen werden freigesetzt, die weitere Atome zertrümmern, Energie erzeugen und weitere Neutronen und immer mehr Energie. Das Ziel ist es, diese nukleare Kettenreaktion so groß und zerstörerisch wie möglich zu machen.
Am 16. Juli 1945 um 5:25 Uhr wird die Bombe tief in der Wüste von New Mexico zum ersten Mal getestet. Die nächstgelegenen Beobachtungsstationen sind alle mindestens acht Kilometer vom Explosionsort entfernt. Einige der Wissenschaftler haben halb im Scherz Wetten darüber abgeschlossen, ob die Bombe die Atmosphäre entzünden wird. Der Test könnte funktionieren. Aber er könnte auch zu gut funktionieren.
Die Wissenschaftler und Soldaten sind unsicher, was sie erwartet. Die Theorie ist eine Sache, die Realität eine andere. Sie haben keine Ahnung, was gleich geschehen wird. Manche fürchten das Schlimmste.
Leó Szilárd fühlt sich so machtlos wie noch nie. Er weiß, dass die Bombe, wenn sie funktioniert, schon bald unsagbar viel Tod und Zerstörung bringen wird. Szilárd hat eine Petition an den US-Präsidenten verfasst, in der er sich gegen den Einsatz der Bombe ausspricht.
Aber er gibt sich keinen Illusionen hin, dass dies den Lauf der Dinge aufhalten wird. Er kann nur noch abwarten. Dann erreicht ihn die Nachricht, die er so lange gefürchtet hat: Die Kettenreaktion ist in Gang gesetzt, die Bombe gezündet worden.
Durch ihn, den einst unbekannten Physiker, der in Berlin studiert und eine bedeutende Erkenntnis beigetragen hat, wurde all das ermöglicht.
Schon früh begann er sich für die geheimnisvolle Welt der Atome zu interessieren, in deren Kern Protonen und Neutronen auf unvorstellbar kleinem Raum dicht aneinandergepackt sind, gebunden durch die stärkste bekannte Kraft, die es gibt. Diese Kraft zu nutzen bedeutet, die Grundlagen unserer Welt, wie wir sie kennen, in Frage zu stellen, sie zu brechen, als würde man das Gefüge des Universums selbst zerreißen. Das Atom birgt das unendliche Potenzial der Zerstörung.
Noch wenige Jahre zuvor galt es als unmöglich, diese Kraft zu entfesseln. Aber Szilárd hat all das vor allen anderen kommen sehen. Für den Rest seines Lebens wird er von den Folgen der Bombe heimgesucht. Hat er alles in seiner Macht Stehende getan, um die grausamen Folgen zu verhindern? Oder haben seine Bemühungen auf tragische Weise genau die Zukunft herbeigeführt, die er so gefürchtet hat? Dies ist die Geschichte von Leó Szilárd – dem Mann im Schatten der Bombe, die ihn für den Rest seines Lebens verfolgt und unsere Welt für immer verändert hat.[1]
Nur ein Tag
Berlin, Januar 1920
Unterschiedlicher konnten die beiden Männer kaum sein, die sich regelmäßig zum Spazierengehen verabredeten. Der eine dünn, mit einem gewaltigen Schnauzbart und grau melierten Haaren, die in alle Richtungen wie kleine Antennen abstanden, kaum zu bändigen waren und jeder Bewegung seines Kopfes mit etwas Verzögerung folgten. Der andere mit 1,67 Meter von geringem Wuchs und ein wenig dicklich, mit braunen Augen, einer starken Brille und braunen, nach hinten gekämmten Haaren, die trotz seines jungen Alters bereits von seiner Stirn zurückwichen und dünner wurden.
Der eine war Professor und weltbekannt. Der andere ein aus Ungarn geflohener Student, der für die Vorlesungen, die er anfangs besuchte, nicht einmal ordnungsgemäß eingeschrieben war. Nicht nur der Altersunterschied von 19 Jahren liegt zwischen Albert Einstein und Leó Szilárd, auch sonst trennt sie auf den ersten Blick mehr, als sie verbindet.
Als ständiges Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften und seit 1917 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik – ein Posten, der für ihn extra geschaffen wurde – gilt Einstein bereits als Legende und als berühmtester Wissenschaftler der Welt. Jeder weiß, dass Einstein am liebsten allein arbeitet, alle Studenten gehen ihm an der Universität ehrfurchtsvoll aus dem Weg und würden es nie wagen, diesen Giganten der Wissenschaft anzusprechen. Nicht so Leó Szilárd.
Im Januar 1920 kommt Szilárd in Berlin an und schreibt sich an der Technischen Hochschule Berlin ein. Die deutsche Hauptstadt ist voller Energie und das trotz der tiefen menschlichen und wirtschaftlichen Verwüstungen, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hat. Staunend steht der junge Szilárd auf der Friedrichstraße. Das gemächliche Hufeisenklappern der Pferde, die noch die Kutschen in seiner Heimat Budapest ziehen, ist hier bereits ersetzt worden durch das beständige Rauschen der Autos, Busse, S- und Straßenbahnen. Grell blendet ihn das Licht der sich unablässig drehenden Reklametafeln, alles ist laut, hektisch, und die Stadt bombardiert den Ankömmling mit Hunderten neuen Eindrücken.
Zeitungsverkäufer preisen lauthals die neuesten Ausgaben an. Geschäftsleute hetzen zum nächsten Termin, adrett gekleidete Damen flanieren an den Schaufenstern entlang, Bettler und Straßenmusiker versuchen, die eine oder andere Reichsmark einzunehmen. Berlin bietet viele Attraktionen. Doch Szilárd hat einen besonderen Grund, in die deutsche Hauptstadt zu kommen. Denn hier lehren und forschen die hellsten Köpfe der modernen Physik.
Als er aus Budapest kommend in Berlin eintrifft, studiert er offiziell noch Ingenieurwesen, aber das langweilt ihn seit einiger Zeit. »Ingenieurwissenschaften«, schrieb Szilárd später, »zogen mich immer weniger an, die Physik zog mich immer mehr an, und schließlich wurde die Anziehungskraft so groß, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage war, einer der Vorlesungen über Ingenieurwesen zu folgen, die ich mehr oder weniger ungeduldig hörte.«[2]
Und obwohl er bisher kaum etwas über Physik weiß, beschließt er, die wissenschaftlichen Kolloquien dieser Disziplin zu besuchen. Offiziell ist er dafür nicht eingeschrieben, aber das kümmert ihn nicht. Leó Szilárd erscheint einfach und zeigt sich schnell so brillant, dass er damit durchkommt. Nachdem er das erste Physik-Kolloquium besucht hat, versäumt er kein weiteres mehr. Er lernt Physik mit absoluter Hingabe, und das Fach wird zum Wendepunkt seines Lebens.
Die Berliner Kolloquien sind keine herkömmlichen Treffen irgendwelcher Wissenschaftler. In den frühen 1920er Jahren treffen hier die Weltgrößen der modernen Physik aufeinander. Unter ihnen sind Max Planck, Max von Laue, Fritz Haber und Gustav Hertz. Fast alle haben bereits einen Nobelpreis erhalten. Und wer von ihnen noch keinen besitzt, wird den höchsten Preis der Wissenschaft in den nächsten Jahren bekommen.
Im berühmten Mittwochs-Kolloquium von Max von Laue, in dem Professoren und Doktoranden über neue wissenschaftliche Aufsätze referieren, sitzen manchmal bis zu sieben Nobelpreisträger gleichzeitig – dazu manchmal auch noch ein paar künftige Preisträger wie Wolfgang Pauli und Werner Heisenberg.
Szilárd hat dort nichts verloren, doch das hält ihn nicht davon ab, gebannt zuzuhören und alles in sich aufzusaugen. Er hat seine Passion gefunden. Saß er anfangs im Frühjahr noch in der letzten Reihe, so hat er im Herbst die Entscheidung getroffen, sich endgültig vom Ingenieurwesen zu verabschieden, um sich für Physik einzuschreiben, mit dem Ziel, einen Doktortitel zu erlangen. Er findet, dass dies auch der geeignete Zeitpunkt ist, voller Selbstbewusstsein aus der letzten in die erste Reihe vorzurücken. Szilárd fühlt sich erstmals am richtigen Platz. Noch ist er in dieser Runde nur ein kleiner Doktorand. Doch in den Diskussionsrunden geht es absolut demokratisch zu. Ob Student oder Wissenschaftler von Weltruhm, in den Diskussionen spielen Hierarchie oder Nobelpreise kaum eine Rolle. Was zählt, ist allein das wissenschaftliche Argument.
Die Größten der Physik üben auf viele seiner Mitstudenten eine einschüchternde Wirkung aus – nicht so auf Szilárd. Dem großen Max Planck erklärt er während einer Diskussion im November 1920 in einer Mischung aus Mut und jugendlichem Größenwahn: »Ich will hier lediglich die Fakten der Physik kennenlernen. Die Theorien werde ich selbst entwickeln«.[3] Szilárds Auftreten gegenüber Männern wie Max Planck, dem Nobelpreisträger und Pionier der Quantenphysik, ist mindestens naiv, manchmal unerschrocken und meistens ganz einfach frech.
Für sein erstes Semester in Berlin schreibt sich Szilárd für so viele Kurse wie möglich ein. Als ob er die als Ingenieursstudent verlorene Zeit wettmachen wollte. Neben verschiedenen Gebieten der Physik belegt er auch Seminare in Philosophie und Ethik. Nachdem eine seiner Physikvorlesungen vorbei ist, geht Szilárd die Stufen des Hörsaals hinunter, zum Pult des vortragenden Professors und wendet sich mit einigen Fragen an ihn, um das besprochene Thema zu vertiefen. Es ist Szilárds erste direkte Begegnung mit Abert Einstein, der 1920 längst Weltruhm erlangt hat und ein Jahr später für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis erhalten wird.
Ihm gegenüber steht nun Leó Szilárd. Ein wenig ungepflegt erscheint er und auch noch ein wenig ungelenk im Umgang mit den Größen der Wissenschaft. Noch besitzt er nichts von Einsteins Charisma und Eloquenz. Doch obwohl Szilárds Physikkenntnisse bisher nur elementar sind, führt seine intellektuelle Brillanz dazu, dass er und Einstein von Anfang an neugierig aufeinander sind. Für Leó Szilárd öffnet dieser ihm noch kaum bekannte Professor Einstein endgültig die Tür zu einer neuen, geheimnisvollen Welt.
Einstein und der Kühlschrank
Berlin, 1920 bis 1922
Innerhalb weniger Wochen entwickelt sich zwischen Szilárd und Einstein aus einer flüchtigen Bekanntschaft schon bald eine tiefe Freundschaft. Trotz aller Differenzen – vom akademischen Status bis zum Altersunterscheid – wächst die gegenseitige Wertschätzung. Beide werden zu intellektuellen Sparringspartnern, diskutieren über Literatur, Weltgeschehen und Wissenschaft. Besonders bewundert Szilárd Einsteins stets skeptische Haltung gegenüber vermeintlich neuen physikalischen Entdeckungen sowie dessen stetigen Willen zum Widerspruch. »Ach nein!«, sagt Einstein häufig im Kolloquium, nachdem einer der Vortragenden seine Argumente vorgetragen hat. »So einfach sind die Dinge nicht.«
So wie die Renaissance die großen Maler nach Europa gelockt und das Zeitalter des Barock die besten Musiker angezogen hatte, ist Berlin der Magnet für die klügsten Physiker der 1920er Jahre. Aus der ganzen Welt drängt es theoretische Physiker in die deutsche Hauptstadt. In den letzten Jahren, bevor die Dunkelheit über Deutschland hereinbricht, vollzieht sich eine Revolution, die unser Verständnis von Raum und Zeit verändert. Beginnend mit Max Plancks Entdeckungen über Strahlung und Energie im Jahr 1900, entschlüsselt diese eingeschworene Bruderschaft (mit viel zu wenigen Schwestern, da sie nur im Ausnahmefall Zugang erhalten) das Geheimnis des Verhaltens von Molekülen und Atomen.
Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie von 1905 gilt als die herausragende Erkenntnis dieses Zeitalters. Aber es gibt noch viele mehr. Ein Däne, Niels Bohr, der zwischen Kopenhagen und Deutschland pendelt, durchdringt das Wasserstoffatom. Werner Heisenberg formuliert die Unschärferelation. Erwin Schrödinger entdeckt neue, produktive Formen der Atomtheorie. Einsteins enger Freund Max Born veröffentlicht seine Arbeit über Wahrscheinlichkeit und Kausalität. Gemeinsam bereiten diese Wissenschaftler nicht nur den Beginn des Atomzeitalters vor, sondern liefern auch schon die Grundlagen für die Epoche des Computers und des Internets.
Das Leben in dem im neo-klassizistischen Stil erbauten Gebäude der Friedrich-Wilhelms-Universität (der heutigen Humboldt-Universität) und im Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik im Vorort Dahlem knistert vor Spannung, wenn übermütige junge und ältere Männer miteinander wetteifern, um bisherige Annahmen über Raum und Zeit zu überwinden. An der Universität herrscht eine fast grenzenlose akademische Freiheit, und die Studenten werden ermutigt, Kurse aller Disziplinen zu belegen, die sie inspirieren. Innerhalb kürzester Zeit hinterfragt und entschlüsselt eine neue Generation von Physikern die grundlegenden Naturgesetze, so wie es Kopernikus und Newton zu ihrer Zeit getan hatten.
Schon bald entwickelt Szilárd die Eigenschaften, die ihn in Zukunft so berühmt wie berüchtigt machen werden: eine gewaltige Portion Unverfrorenheit, unerschütterlichen Mut und eiserne Beharrlichkeit. Was Szilárd will, versucht er zu bekommen. Einstein fragt er, ob dieser einen Kurs in statistischer Physik unterrichten könne. Einstein zögert merklich, doch Szilárd hakt so lange nach, bis sein Lehrer Einstein, der an der Preußischen Akademie der Wissenschaften und am Kaiser-Wilhelm-Institut mit genügend Arbeit eingedeckt ist, schweren Herzens schließlich einwilligt.
Nach den Kursen in statistischer Physik spazieren die beiden Männer oft noch gemeinsam durch Berlin. Häufig begleitet Szilárd Einstein bis nach Hause – vom Institut für Physik hinter dem Reichstag, vorbei am Brandenburger Tor und am Tiergarten bis zu Einsteins Wohnung im nahegelegenen Schöneberg.
Zunehmend schätzt Einstein das unorthodoxe Denken Szilárds zu allen erdenklichen Themen. Beide kümmern sich nicht um die steifen, überkommenen Höflichkeiten des deutschen akademischen Lebens. Beide lieben es, über Problemen zu brüten, die andere zu lösen versucht hatten und daran gescheitert waren. Und sie gehören zu den Menschen, die wieder zu Kindern werden und die Welt um sich herum vergessen können, sobald sie sich in ein Problem vertiefen.
Beide sehen die höchste Freude des Lebens nicht in menschlicher Interaktion, sondern, wie Einstein es ausdrückte, »in der Flucht vor dem Ich und dem Wir zum Es der Wissenschaft«. Beide Männer sind soziale Außenseiter, sie erfreuen sich an den Lehren der modernen Physik, teilen den Sinn für Ironie und Spott und entdecken allmählich ihre tiefer werdende Verbindung – den Trost, der einen Außenseiter mit dem anderen vereint. Einstein spielt den scheinbar strengen Kritiker für Szilárds Anregungen und Kommentare, und im Lauf der Zeit entwickelt sich eine Beziehung, die beide Männer sehr genießen. Sie treffen sich fast jeden Tag.[4]
Neben ihren Ideen verbindet Einstein und Szilárd auch die Schüchternheit. »Ich kann nicht gut mit Menschen umgehen«, gesteht Einstein.[5] Und Szilárd bleibt trotz seiner Wortgewalt in den Hörsälen und Kaffeehäusern Berlins die meiste Zeit seines Lebens ein zerstreuter Einzelgänger.
Szilárd saugt alles auf, worüber die großen Wissenschaftler sprechen. Oft kann er kaum fassen, welche intellektuellen Größen Tag für Tag vor ihm in den Hörsälen stehen. Er ist so wissensdurstig, dass er sie manchmal in den Fluren der Universität und in den Cafés am Boulevard Unter den Linden regelrecht bedrängt. Auch er will an vorderster Front der Revolution der Wissenschaft stehen – ganz gleich womit. Hauptsache, auch er wird seinen Anteil am Fortschritt liefern. Das führt zu wilden Ideen – und oftmals nicht zu den besten.
In seiner Freizeit entwickelt er »einen Friseurstuhl, der eine elektrische Spannung nutzt, damit Haare nach oben stehen, und einfacher geschnitten werden können.« Genauso erdenkt er (aus seiner Sicht) philosophisch erhabene Konzepte für eine »utopische Organisation, die eine weltweite Führungsrolle übernehmen kann«. Unablässig zerbricht sich Szilárd den Kopf, wenn er rund um die Universitätsgebäude spaziert, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, und ein hoffnungsloses Projekt nach dem anderen entwickelt. Nur wenige Disziplinen lässt er aus – beschäftigt sich beständig mit seinem Lieblingsfach Physik, dann doch wieder mit der zuvor so verschmähten Ingenieurwissenschaft und schließlich mit Chemie und Wirtschaft sowie mit Politik und am Ende mit reiner Fiktion. Er mäandert zwischen den kleinsten Details des Universums und gewaltigen Fantasiegebilden – ohne jegliches Ergebnis. Doch alle Anstrengungen eint etwas: Leó Szilárd hat stets ein höheres Ziel vor Augen. Er will die Welt verbessern – womit und wie auch immer.
Sowohl Einstein als auch Szilárd streben danach, wissenschaftliche Erkenntnisse mit eleganten, abstrakten Theorien zu vereinen. Aber sie können auch äußerst praktisch arbeiten. Nachdem Szilárd in der Zeitung gelesen hat, dass eine Berliner Familie ums Leben gekommen ist, als in ihrer Wohnung giftiges Kühlschrankkühlmittel ausgetreten ist, fragen er und Einstein sich, wie ein solcher Unfall verhindert werden könnte. Da eine ausgefallene Umwälzpumpe undicht gewesen war, müsste theoretisch die einfachste Lösung darin bestehen, eine Pumpe zu bauen, die nicht lecken kann. Um Undichtigkeiten zu vermeiden, sollte die neue Pumpe keine beweglichen Teile und damit auch keine Dichtungen und Dichtstoffe haben, die versagen könnten, argumentieren Einstein und Szilárd. Je mehr sie darüber nachdenken, umso neugieriger werden die beiden. Sie betrachten das menschliche Herz, das durch Muskelkontraktionen arbeitet. Was wäre, wenn diese Kräfte nicht durch mechanische Oberflächen, die sich bewegen, sondern durch eine andere Kraft dupliziert werden könnten? Die Idee wird schnell zur Realität. Das Herzstück des neuen Einstein-Szilárd-Kühlschrankdesigns wird eine Pumpe, die ein flüssiges Metallkühlmittel umwälzt, indem sie elektromagnetische Impulse in einer Reihe von Spulen um ein langes Rohr erzeugt. Es ist genau die Art eleganter Schlichtheit, die beide Männer schätzen. Mit der Zeit melden Einstein und Szilárd acht gemeinsame Patente für die von ihnen entworfene Kühlpumpe an. Anfangs »heulte die Pumpe wie ein Schakal«, wie beteiligte Techniker bemerkten. Aber Szilárd und Einstein entwickeln die Pumpe beständig fort und die Firma AEG kauft schließlich ihre Idee. Insgesamt kommen Szilárd und Einstein in sieben Jahren Zusammenarbeit auf 45 Patente in sechs Ländern.[6]
Inspiriert durch seine Spaziergänge und Diskussionen mit Einstein macht sich Szilárd schließlich auf die Suche nach einem Thema für seine Doktorarbeit. Mit seinem Professor Max von Laue, der 1914 den Nobelpreis für Physik erhalten hat, versteht sich Szilárd bestens. Zusammen haben sie immer wieder hitzig über Einsteins Relativitätstheorie diskutiert, was von Laue imponiert hat. Schließlich willigt er nach einigem Zögern ein, den jungen Szilárd zu betreuen.
Der ehrwürdige Professor von Laue ist von seinem vorlauten Doktoranden mehr als überrascht, als dieser ihm bereits nach ein paar Wochen einige Grundzüge seines geplanten Werks erläutert. Ohne von Laue Bescheid zu geben, hat Szilárd das ihm zugeteilte Thema, eine Analyse zur Relativitätstheorie, das er als nicht schwierig genug empfand, noch erweitert. »Innerhalb von drei Wochen hatte ich ein wirklich originelles Manuskript verfasst«, erklärt er wenig bescheiden. »Aber ich habe es nicht gewagt, es zu von Laue zu bringen, weil es nicht das war, worum er mich gebeten hat.«[7]
Stattdessen wendet sich Szilárd mit der Bitte um Rat an seinen Freund und Förderer, er ruft Einstein zur Hilfe. Zunächst bittet Szilárd ihn um die Möglichkeit, seinen Versuch einer Doktorarbeit beschreiben zu dürfen. Der höfliche Einstein nickt und hört geduldig Szilárds Berechnungen und seinen Ergebnissen zu. Schließlich ist Szilárd fertig und blickte fragend seinen väterlichen Freund an. Der schüttelt den Kopf, atmet tief ein, und tief aus. Nach einer langen Pause sagt er: »Das ist unmöglich. Das ist etwas, was man eigentlich nicht schaffen kann.«
»Na ja«, antwortet Szilárd, »aber ich habe es geschafft.« Er kann die diebische Freude über das Erreichte nicht mehr verbergen.
»Die Frage ist vor allem: Wie hast du das geschafft?«, entgegnet Einstein. Er hat keine zehn Minuten gebraucht, um zu erkennen, dass Szilárds Dissertation bahnbrechende Ergebnisse liefert, die geeignet sind, die Relativitätstheorie – Einsteins ureigenes Forschungsgebiet – weiterzuentwickeln.
Die Reaktion von Einstein verleiht Szilárd den Mut, sich nach Ende der Weihnachtsferien im Januar 1922 von Laue zu stellen. Obwohl er sich selten dazu entschließt, kann Szilárd bei Bedarf seinen Hochschullehrern großen Respekt entgegenbringen. Jetzt ist genau das nötig. Er wartet, bis die Vorlesung zu Ende ist, geht auf von Laue zu und gesteht ihm, dass er das ihm zugewiesene Thema in seiner Arbeit nicht so behandelt hat, wie es sich von Laue wohl vorgestellt hatte. Aber er HAT eine Arbeit geschrieben. »Etwas Originelles in der Thermodynamik«, wie er ihm erklärt. Es ist das Fachgebiet von Laues. All das hat Szilárd aber mit Einsteins Theorien verbunden. Könnte diese neue Arbeit als seine Dissertation angesehen werden? Von Laue sieht Szilárd fragend an, seufzt, nimmt aber das Manuskript in die Hand, und erklärt sich bereit, es zu lesen. Dann lässt er Szilárd wortlos stehen.
Früh am nächsten Morgen klingelt das Telefon in Szilárds Wohnheim, zwei Blocks von der Universität entfernt. »Am Apparat war von Laue«, schreibt Szilárd in seinen Erinnerungen. Auf einmal wird ihm schwindlig vor Aufregung.
Ein Florett und keine Freunde
Budapest, 1916 bis 1920
Bereits in der Schulzeit ist Leó Szilárds starker Wille erkennbar – genauso wie seine Abneigungen. Physik, Chemie und Mathematik sind seine Lieblingsfächer, sportliche Aktivitäten verabscheut er schon als Kind. Er lernt nie Fahrradfahren oder Schwimmen. Wann immer möglich, schwänzt er den Sportunterricht. Wenn es nicht zu vermeiden ist, nimmt er an Wettläufen im Sprint teil, Rennen auf der Mittel- oder Langdistanz, Hochsprung und Weitsprung lehnt er strikt ab. Genauso verhasst sind ihm Turnübungen – ob am Barren, dem Pauschenpferd oder dem Reck. Wann immer diese Disziplinen auf dem Stundenplan stehen, geht der junge Szilárd in einen beharrlichen Streik, setzt sich auf eine Bank an den Rand der Turnhalle und beginnt, ein Buch zu lesen. Ganz egal, welche Strafe ihm der Sportlehrer erteilen wird.
Der einzige Sport, der ihn begeistern kann – zumindest für eine Weile, ist das Fechten. Es ist eine beliebte Disziplin in seiner Zeit und gilt als unverzichtbarer Teil der Ausbildung für Ungarns Mittel- und Oberschicht. Szilárd erhält seine Fechtlektionen in einer Halle am prunkvollen Andrássy-Boulevard in der Nähe der Budapester Oper. Er erweist sich als äußerst geschickt. Aber als der Fechtlehrer seine Schüler auffordert, den Gegner immer aggressiver mit dem Florett zu attackieren, zeigt Leó Szilárd eine eindeutige Reaktion. Er hört zwar seinem Ausbilder weiter stumm zu, der ihn immer wieder auffordert, mehr Aggressivität in der Attacke zu demonstrieren. Dann aber reagiert der junge Fechtschüler überraschend: Er wirft Florett und Maske in die Ecke, verbeugt sich ehrerbietig vor seinem Lehrer und verlässt, ohne ein Wort zu sagen, die Planche. Es ist das erste klare Zeichen, wie sehr Szilárd physische Gewalt verachtet.
Im Alter von zehn Jahren nimmt Szilárd ein Buch in die Hand, das sein Lebenswerk – und den Lauf der Geschichte – prägen sollte. »Die Tragödie des Menschen« des ungarischen Schriftstellers Imre Madách ist ein langes, dramatisches Gedicht, das oft mit Goethes Faust verglichen wird. Es ist ein theologisches Spektakel in 15 Szenen und handelt von der Versuchung des Menschen durch den Teufel. Später bezeichnet Szilárd dieses Gedicht »neben den Erzählungen meiner Mutter als den wichtigsten Einfluss auf mein Leben.« Besonders fasziniert ist Szilárd von der Szene, in der der Teufel Adam die Zukunft des Menschen zeigt. Da die Sonne langsam an Kraft verliert und die Erde sich abkühlt, überleben nur die Inuit am Polarkreis, und die fangen zu wenig Robben, um sich zu ernähren. Es gibt jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn sich die Überlebenden vernünftig verhalten. Leó Szilárd konnte diese Passage für den Rest seines Lebens Wort für Wort zitieren.
Die Schule langweilt ihn meist. Freunde findet er keine, aber dafür ein neues, brennendes Interesse. Ohne jegliche Vorbereitung erringt er im nationalen Schulwettbewerb den zweiten Platz in Physik. Schnell weiß er genau, was er kann, und besitzt alle intellektuellen Fähigkeiten, die für hervorragende Noten nötig sind. Er setzt sie nur ein, wenn er muss. Viel lieber treibt er sich in den Cafés der Stadt herum, das »New York Café« wird sein Lieblingsort. Dort findet sich immer jemand, der bereit ist, mit dem jungen Szilárd zu diskutieren – über Wissenschaft, Kunst und Literatur. Und zeitgleich wird Szilárd in dieser Umgebung und in einer Stadt, in der täglich Dutzende Zeitungen mit Tages-, Abend- und Nachtausgaben erscheinen, zum Nachrichten-Süchtigen, immer auf der Suche nach den neuesten Informationen. Dem jungen Leó Szilárd fehlt es an nichts, dafür sorgt auch seine Familie.
Der Aufstieg der Familie Szilárd hatte sich auch durch eine Änderung ihres Nachnamens beschleunigt. Zwei Jahre nach Leó Szilárds Geburt, am 11. Februar 1898, änderten die Eltern ihren Familiennamen Spitz, den sie unter Habsburgischer Herrschaft im 18. Jahrhundert erhalten hatten, in den ungarischer klingenden Namen Szilárd (was »solide« auf Ungarisch bedeutet). Ihrem Judentum misst die Familie keine besonders große Bedeutung zu.
Die Szilárds ziehen in eine große Villa, ein steinernes Zeugnis ihres Ehrgeizes und Wohlstands. Das Haus liegt im Gartenviertel von Pest, in der Nähe des Andrássy-Boulevards. Die Nachbarn sind von Adel oder zu neuem Reichtum gekommene Bankiers und Geschäftsleute. Die Wirtschaft floriert, die Zukunft erscheint allen, die hier leben, prächtig.
Gemeinsame Familienabende der Szilárds in der Oper oder im Nationaltheater, die beide nur wenige Minuten von ihrer Villa entfernt liegen, enden häufig in Restaurants. Mutter und Vater schaffen ihren Kindern perfekte Bedingungen. Auf die Söhne Leó und Béla folgt noch Schwester Rószi. Der Vater, ein Ingenieur, bestückt die Hausbibliothek mit Werken von Goethe, Schiller und Heine. Bevor Leó Szilárd in die Schule kommt, spricht er neben Ungarisch auch fließend Französisch und Deutsch.
Als er 1916 die Schule mit Bestnoten abschließt, ist ihm schnell klar, dass ausgerechnet sein Lieblingsfach ihm nichts nutzen würde. »Mit Physik konnte man in Ungarn zu dieser Zeit nichts werden«, erinnert er sich später.[8] Stattdessen schreibt er sich in der Ingenieursfakultät in Budapest für Chemie und allgemeine Mechanik ein. Schnell beginnt er sich zu langweilen und nutzt stattdessen alles, was Budapest ihm als vibrierende Metropole bieten kann. Sechshundert Cafés und eine gewaltige Zahl von Theatern und Cabarets bestimmen den Rhythmus der Stadt. Auf den prächtigen Boulevards drängen sich die Passanten – schon früh am Morgen genauso wie weit nach Mitternacht. Szilárd lebt erst einmal in den Tag und die Nächte hinein.
Wie in vielen Nachbarländern ist auch in Ungarn der Antisemitismus tief verwurzelt. Der erste Ausbruch gegen Juden hat sich während der Revolution 1848 ereignet. Der zweite im sogenannten »Liberalen Zeitalter« 1882/83. Die Juden in Ungarn besitzen ein klares Bewusstsein, wie schnell sich Situationen ändern können. Und auch, wie wichtig es manchmal ist, sich in neue Rollen und Identitäten einzufinden, sollten es die Umstände erzwingen.
1917 erhält der junge Szilárd den Einberufungsbefehl in die österreichisch-ungarische Armee. Da er an Grippe erkrankt, bleibt ihm der Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg erspart, und er kehrt bereits ein Jahr später nach Budapest zurück. Die Waffen schweigen in Europa – aber auch in Budapest ist das Goldene Zeitalter vorüber. Die Familie Szilárd hat ihr gesamtes Vermögen verloren.
Ungarn wird von den siegreichen Alliierten auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe reduziert, ein Land mit nur noch 7,5 Millionen Menschen. Historische Städte wie Pozsony und Temesvár fallen an die Tschechoslowakei beziehungsweise Rumänien und heißen fortan Bratislava und Timișoara. 3,3 Millionen Ungarn befinden sich plötzlich unter fremder Herrschaft, es setzen massive Migrationsbewegungen ein.
Der aufkommende Faschismus in Ungarn unter Miklós Horthy flößt Szilárd Angst ein. In den Jahren 1919/20 kommt es zu zahlreichen Aktionen gegen Sozialisten, Kommunisten und Juden. Szilárd und sein Bruder konvertieren zum Protestantismus, auch weil sich die düsteren Anzeichen der Judenfeindlichkeit für sie mehren.
Als Leó und Béla Szilárd sich im September 1919 an ihrer Ingenieursschule zurückmelden wollen, die jetzt Technische Universität Budapest heißt, werden sie auf den Stufen, die in das Hauptgebäude führen, von einer Gruppe Studenten gestoppt. »Ihr dürft hier nicht studieren!«, schreit einer die beiden an. »Ihr seid Juden!« Leó Szilárd schüttelt den Kopf, und versucht, mit seinen Kommilitonen zu diskutieren. »Wir sind Protestanten, und wir besitzen die Papiere, um das zu beweisen.« Aber das macht die Studentengruppe nur noch wütender. Mit Gewalt stoßen sie die beiden Szilárd-Brüder die breiten Stufen aus Marmor hinab. Leó Szilárd spürt, dass er hier nicht mehr sicher ist. Für den Rest seines Lebens weigert er sich, darüber zu sprechen, was es für ihn bedeutet hat, als Jude in einem zunehmend rassistischen und antisemitischer werdenden Budapest leben zu müssen.
Er hat erfahren müssen, wie sich seine Heimat in Blitzgeschwindigkeit mit dem Gift von Hass und Extremismus infiziert hat, und ist nun entschlossen, sein Land zu verlassen. Schnell sendet er seine Bewerbung an das Technische Institut in Berlin, sein Bruder Béla tut es ihm bald nach.
Nach einem gescheiterten Versuch, ein Ausreisevisum zu erhalten, gelingt es Leó Szilárd im zweiten Anlauf. Das Passamt erteilt ihm am 18. Dezember 1919 eine Ausreisegenehmigung und lässt ihm nicht viel Zeit. Zwischen dem 25. Dezember 1919 und dem 5. Januar 1920 muss er Ungarn verlassen. Für seinen Reisepass braucht Szilárd noch ein neues Foto. Es zeigt einen neugierigen, aber auch besorgt blickenden jungen Mann, der im Halbdunkel sitzt und seitlich in die Kamera blickt. Szilárd ist erleichtert, aber auch zutiefst bedrückt. Erleichtert, da nun ein neues Leben ohne Diskriminierung und Verfolgung für ihn beginnen kann. Bedrückt, da er seine Familie hinter sich lassen muss.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover
PROLOG
Nur ein Tag
Einstein und der Kühlschrank
Ein Florett und keine Freunde
Die Zeitmaschine
Zwei Koffer
Die rote Ampel
Das Patent
Der Durchbruch
Der große Fehler ihres Lebens
Termin im Weißen Haus
Schweres Wasser
Die Bildstörung
Der General tritt an
Der Mann mit der Axt
Katz und Maus
Der klügste Mann im Baseball
Postfach 1663
Zurückgelassen
Die tote Leitung
Auf dem Weg zur Dreifaltigkeit
Das Weiße Haus in Potsdam
Enola Gay
Vater der Bombe
Sein eigener Feind
Dr. Wife
Düstere Nachrichten
Flaches Wasser
Die intellektuelle Hummel
Drachenfrau und heißer Draht
Der Rat für eine lebenswerte Welt
Vierzehn Koffer
Die Pink Lady
Epilog
Danksagung
Anhang
Anmerkungen
Der Autor
Anmerkungen
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum