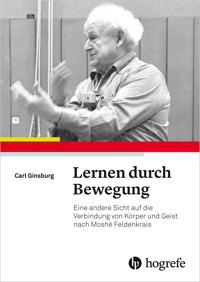
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein "missing link" zwischen wissenschaftlich gewonnener Erkenntnis und konkret erfahrbarem Wissen Seit seiner Ausbildung bei Moshé Feldenkrais leitet der Autor selbst Feldenkrais-Ausbildungsprogramme. Als Summe seiner Erfahrungen wird in diesem Werk die der Feldenkrais-Methode zugrundeliegende Erforschung von Bewegung und Wahrnehmung nachvollziehbar vorgestellt und anhand von konkreten Fallstudien aus seiner jahrelangen Praxis erläutert. Dabei ermutigt er den Leser, sein Verständnis von Wissen und Erlerntem in Frage zu stellen und gibt ihm Übungen an die Hand, die einen spannenden anderen Blick auf das Selbst und die Welt ermöglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lernen durch Bewegung
Carl Ginsburg
Carl Ginsburg
Lernen durch Bewegung
Eine andere Sicht auf die Verbindung von Körper und Geist nach Moshé Feldenkrais
unter Mitarbeit von
Lucía Schütte-Ginsburg
Aus dem Amerikanischen
von Lucía Schütte-Ginsburg
und Claus-Jürgen Kocka
Lucía Schütte-Ginsburg und Carl Ginsburg
Zum Quellenpark 38
65812 Bad Soden
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Gesundheit
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea
Lektorat Übersetzung: Cornelia Berens, Giekau
Bearbeitung: Claus-Jürgen Kocka, Nürnberg
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Irene Sieben, Berlin
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s. r. o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
1. Auflage 2016
© 2016 Hogrefe Verlag, Bern
E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95347-2
E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75347-8
ISBN 978-3-456-85347-5
http://doi.org/10.1024/85347-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Widmung
In Erinnerung an Moshé Feldenkrais, der einen Weg zur selbstgesteuerten Verbesserung entdeckte und ein neues Verständnis des Biologischen, das uns Wachstum und Entwicklung beschert.
Sowie den vielen Studenten und Kollegen gewidmet, die diese Ideen so bekannt machen, dass viele Menschen davon profitieren.
Geleitwort
Wenn es Frühling wird und die Zugvögel aus ihren südlichen Winterquartieren wieder zu uns zurückkehren, sind plötzlich auch die Bachstelzen wieder da und erinnern mich mit ihren eigenartigen, wippenden Bewegungen an einen Hinweis meines Biologielehrers, den ich bis heute nicht vergessen habe: „Sie sehen nur das, was sich bewegt“. Wie die Welt um sie herum beschaffen ist, können sie nur erkennen, indem sie sich selbst bewegen. Deshalb beginnen sie mit ihrem Körper zu wippen, sobald sie sich irgendwo niederlassen. Damals war das für mich eine logische Erklärung. Ich wusste noch nicht, wie sehr dieses Bild der wippenden Bachstelzen meine gesamte spätere Forschungstätigkeit als Biologe und als Neurobiologe bestimmen sollte. Es wurde für mich zu einer Metapher für die Art und Weise, wie Lebewesen sich ihre jeweilige Lebenswelt erschließen: eben nicht als passive Reiz-Reaktions-Maschinen, sondern als eigenständige, aktive Gestalter. Als handelnde – und damit als sich selbst bewegende – intentionale Subjekte. Und natürlich gilt das nicht nur für Bachstelzen und deren Verhalten, es gilt auch für Pflanzen, die sich dem Licht entgegenstrecken und es gilt sogar für Pantoffeltierchen, also für frei lebende Einzeller, die sich auf einen Nahrungsbrocken zu- und von einer Gefahrenquelle wegbewegen. Aber allem voran bildet dieses aktive, die Welt durch eigene Bewegungen erkundende Handeln die Grundlage für die wichtigste Leistung, die alle Lebewesen von unbelebten Objekten unterscheidet: das Lernen.
„Lernen durch Bewegung“ haben Carl Ginsburg und Lucía Schütte-Ginsburg als Titel für dieses Buch gewählt, in dem sie die in ihrer langjährigen Forschungstätigkeit gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen. In drei aufeinander aufbauenden Teilen machen sie deutlich, wie grundsätzlich sich das Verständnis lebendiger Entwicklungsprozesse zu verändern beginnt, wenn Zellen, Tiere und nicht zuletzt Menschen als autonom handelnde, sich selbst bewegende Subjekte erkannt und nicht länger als passive Objekte wissenschaftlicher Analysen behandelt und bis in ihre Einzelbausteine zerlegt werden. Sehr bewusst vermeiden die Autoren eine Bewertung des von den „Mutterdisziplinen“ der Biologie, der Physik und Chemie übernommenen objektivierenden Ansatzes. Ohne eine möglichst genaue Kenntnis der molekularen Grundlagen des Kontraktionsprozesses und der Rolle von Aktin- und Myosinfibrillen in den Muskelfasern, könnten wir ja auch gar nicht beschreiben, was in unseren Muskeln passiert, wenn wir uns bewegen. Aber um zu verstehen, weshalb eine Bachstelze zu wippen beginnt, wenn sie sich auf einem Stein niederlässt, hilft uns dieses Wissen nicht weiter. Dazu müssten wir dieses Bewegungsmuster als Ausdruck ihrer eigenen Versuche verstehen, sich in ihrer Lebenswelt mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu orientieren. In gleicher Weise gilt das auch für Kinder, die sich ihre Welt beobachtend, erprobend und gestaltend erschließen.
Um zu verstehen, wie jedes einzelne Kind das auf seine Weise bewerkstelligt und was es dabei alles lernt, ist eine möglichst detaillierte Kenntnis, der in seinem Gehirn ablaufenden Prozesse eine zwar hilfreiche, aber eben nicht ausreichende Voraussetzung. Und genau darum, um diesen nur aus der Perspektive des betreffenden Kindes verstehbaren Grund für seine Lernbemühungen und um die dabei von ihm ausgewählten und eingesetzten Verhaltens- und Bewegungsmuster geht es Carl Ginsburg und Lucía Schütte-Ginsburg in diesem Buch. Sie nehmen darin genau das in den Blick, was von den bisher vorherrschenden, „objektiven“ Untersuchungen von Lernprozessen mehr oder weniger bewusst als „unwissenschaftlich“ ausgeklammert worden ist. Deshalb ist dieses Buch im besten Wortsinn „richtungsweisend“. Mit ihren grundsätzlichen entwicklungsbiologischen Überlegungen (Teil I) und den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen zur Bedeutung von Affekten für Lernprozesse, insbesondere während der frühen Kindheit (Teil II) und den abschließend dargestellten Praxisbeispielen (Teil III) schärfen die Autoren das Bewusstsein für all jene Aspekte der Entwicklung des Lebendigen, die erst verstehbar werden, wenn ein Lebewesen in seiner Subjekthaftigkeit als handelnder Akteur betrachtet wird. Auf diese Weise wird es möglich, die in den letzten Jahrzehnten von Entwicklungsbiologen entwickelten Vorstellungen von Kohärenz, von Selbstorganisation und Potentialentfaltung verständlich – und künftig gezielter als bisher wissenschaftlich untersuchbar – zu machen.
Es ist in diesem Zusammenhang recht interessant, dass die entscheidenden Impulse für diese neue, für Biologen, Mediziner und Therapeuten äußerst interessante Betrachtungsweise von Moshé Feldenkrais stammen und Carl Ginsburg zu den wenigen Personen gehört, die von diesem Pionier der Lernforschung noch selbst erfahren haben, was er mit seinem Leitsatz „Bewegung ist der Schlüssel zum Leben“ zusammengefasst hat. In einer Epoche, die ganz wesentlich von der Vorstellung bestimmt war, dass die Entschlüsselung des Erbgutes, also die Sequenzierung der DNA-codierten genetischen Anlagen der entscheidende Schritt auf dem Weg zur „Entschlüsselung des Lebens“ sei, war es die Lektüre von Moshé Feldenkrais’ Arbeiten, die auch mich selbst nachhaltig ermutigt hat, Lebewesen nicht als zum Zweck der eigenen Reproduktion von ihren genetischen Anlagen geschaffene Container zu betrachten. Auch deshalb bin ich froh, dass dieses Buch von Carl Ginsburg und Lucía Schütte-Ginsburg nun auch ins Deutsche übersetzt und für Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum verfügbar gemacht worden ist.
Göttingen, 15. April 2016 Gerald Hüther
„Ihr Buch und Ihre Arbeit reichen so tief. Sie sind elegant, einfach und schön. Beide sind ein Beitrag zu dem kulturellen Transformationsprozess, den Menschen überall auf der Welt leben. Eine Transformation auf der Basis der Feldenkrais-Arbeit, die den Geist und den Reichtum seiner Arbeit erhält, eröffnet die Möglichkeit, unser Verständnis der Lebenswissenschaften zu verändern.“
Aus einem Brief, den Prof. Dr. Humberto Maturana nach der Lektüre des Buchs an Dr. Carl Ginsburg und Lucía Schütte-Ginsburg schrieb.
Vorwort
Während ich an meinem Computer sitze, bin ich mir meiner Finger bewusst, wie sie sich über die Tasten bewegen, meines Atems, des Bildschirms vor mir und der Tastatur, wenn ich meinen Kopf bewege, um sie zu sehen. Die Worte kommen in mein Bewusstsein, während ich in Sätze fasse, was ich zu sagen beabsichtige. Zugleich bin ich mir meines persönlichen Umfelds und des weiteren Raums bewusst. Ich bemerke die Bewegung meines Atems, die gleichmäßig und flach ist, ohne Anstrengung; ich nehme sowohl das Gefühl von Leben in meinen Beinen, meinem Rumpf, meinen Armen, meinen Füßen, meinem Kopf wahr als auch das meines Gewichts auf dem Stuhl. Wenn ich meinen Kopf hebe und aus meinem Fenster schaue, werde ich mir der Natur draußen bewusst, erkenne den wachsenden Kastanienbaum und seine Blüten, die Brise, die durch die Büsche und Bäume weht, ein bisschen blauen Himmel und ein paar Wolken. Es ist alles sehr gewöhnlich und doch außerordentlich. Ich bin gerade dabei zu schreiben, dass das nicht immer so war in meinem Leben, und nehme plötzlich wahr, dass ich mein linkes Knie von einer Seite zur anderen wippen lasse. Der Gedanke mündete in ein leichtes Unbehagen. Dieses kaum wahrnehmbare Gefühl hat sich mit dem wippenden Bein in Bewegung ausgedrückt. In der Vielfältigkeit jedes Gegenwartsmomentes gibt es viele Bewusstseinsschichten.
Das war nicht immer so. Ich denke zurück an die Anfänge meines jetzigen Lebens, an den Lehrstuhl für Anorganische Chemie an einem kleinen amerikanischen College, das in den 60ern mit einer größeren Universität verbunden war. Damals waren meine Gegenwartsmomente nicht so ausgefüllt. Ich bin sicher, dass die Gefühle und Empfindungen von Lebendigsein in mir versteckt waren; gewohnheitsmäßige Bewegungen habe ich nicht bemerkt, meine Umgebung habe ich nicht als gegenwärtig empfunden, sondern als eine Quelle von Unwohlsein. Ich erinnere mich, dass ich häufig das Empfinden hatte, nicht zugehörig oder ein Fremder auf Erden zu sein. Zu unterrichten war mühsam; d.h. ich erlebte mich müde, schwer und wartete fast ängstlich auf die Klingel, sodass ich aufhören und zurück zu meinem Schreibtisch flüchten konnte. Ich litt unter allen möglichen Beschwerden, darunter immer wiederkehrende Rückenschmerzen und einem chronischem Reizdarm. Bewegung empfand ich als lästige Arbeit. Das Schönste war, die Nase in ein Buch zu stecken.
Damals las ich gierig alles über Psychologie, Entfremdung, Politik, Existenzialismus und alles was verwandt war. Ich las Freud, Norman O. Brown, Paul Goodman, Norman Mailer, Camus, Sartre, Martin Buber und Wilhelm Reich. Ich abonnierte Encounter und Commentary. Dieses Interesse hatte nichts mit der Schule zu tun. Ich las viel im Bereich der Philosophie der Naturwissenschaften und betrachtete mich selbst als sehr rational. Ich glaubte an eine objektive Wahrheit, die sich am besten durch wissenschaftliche Experimente entschlüsseln lassen würde. Ich war überzeugt, normal zu sein. Und doch hatte das, was man damals in der wissenschaftlichen Psychologie verstand, nur eine schwache Verbindung zu der Erfahrung lebendig zu sein. Begrenzt, wie ich damals war, erahnte ich, dass es noch vieles gab, was ich nicht erfahren und verstanden hatte. Mein Lesen und Studieren machte mein Leben nicht schlauer, eleganter oder besser. Der Lebensweg schien ohne Wahlmöglichkeiten weiterzugehen.
Bevor der Schmerz allgegenwärtig wurde, war meine bewusste Erfahrung vorwiegend mit verbalem Denken beschäftigt, Tagträumen oder Kritzeln. Das Leben mit meinen Freunden war mit Gesprächen gefüllt. Mit meiner damaligen Frau gab es viele Streitigkeiten und Ärger. Ich überlegte, dass sie sich die Kränkungen und Fehler, die uns in Konflikt brachten, nur einbildete. Ein Wochenende in einer Selbsthilfegruppe enthüllte mich mir selbst. Es war ein Schock für mich zu verstehen, dass ich mich vor mir selbst versteckte und vor den anderen um mich herum. Wie hatte ich das gemacht? Was hatte ich dadurch gewonnen, was verloren? Wie hatte dieser Sachverhalt meine Ideen, meine Wahrnehmung verzerrt?
Ich erwähne diese persönlichen Details nur, um zu zeigen, dass, obwohl dieser Zustand mein persönliches Leben zu der Zeit bestimmte, es ein kulturbedingtes Leiden ist, das viele Menschen betrifft. Der Welt zeigte ich eine Maske der Ruhe (sogar mir selbst gegenüber). Ich war sehr von meinen Gefühlen und Erregungen abgeschnitten, welche sich am Rande meiner Erfahrung zeigten, die aber in ihrem Ausdruck gehemmt waren. Ich fühlte das Leben in mir nicht in seiner Fülle. In einer der ersten Selbsthilfegruppen zeigte ich den andern gegenüber eine vermeintliche Ruhe und Überlegenheit, wenn sie in verschiedenen Situationen ihre Gefühle ausdrückten. Während des zweiten Wochenendes explodierte ich in unerwarteter Wut. Nach dem ersten Schock spürte ich Erleichterung, meine Atmung war offen, ein Gefühl von Loslassen breitete sich aus. Wilhelm Reich leuchtete mir plötzlich ein. Er hatte angenommen, dass alles was versteckt und dem widerstanden wird, sich in der Muskulatur und im Körper ausdrückt. Reich gehörte ursprünglich zu Freuds innerem Kreis, wurde aber später aus der Gruppe der Psychoanalytiker ausgestoßen. Später betrachtete man ihn als unausgeglichen und paranoid. Doch viele seiner Einsichten und Anschauungen gelten heute nicht länger als radikal.
Mitte der siebziger Jahre hatte ich meine Karriere als Hochschullehrer aufgegeben und war in einer Ausbildungsgruppe von Dr. rer. nat. Moshé Feldenkrais in San Francisco. Den Doktortitel in Naturwissenschaften hatte er für seine Arbeit im Pariser Labor von Frédéric Joliot-Curie in den 30ern und kurz nach dem 2. Weltkrieg bekommen. Doch was Moshe Feldenkrais präsentierte, schien uns weit weg von Physik und Maschinenbau. Das Thema war Bewegung, aber nicht aus einer äußerlichen Perspektive. Es war nicht Tanz, keine Performance, keine Kunsttheorie, keine äußerliche Analyse von Bewegung, sondern eine Erforschung unserer eigenen kinästhetischen Erfahrung und des Reichtums, der sich daraus entwickelte.
Im Jahr davor hatte ich die Gelegenheit bekommen, seine Bewegungslektionen bei einem Lehrer, der an ein paar Workshops von Feldenkrais teilgenommen hatte, auszuprobieren. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir überaus gewahr, dass die Art und Weise, wie ich Gefühle hemmte, mit den Bewegungen zu tun hatten, die nötig waren, genau diese Gefühle auszudrücken. Das war mir nicht unbedingt bewusst. Jedoch mir gewahr zu werden, was ich tat und wie ich es tat, was sich mir in den verschiedenen Feldenkrais-Lektionen enthüllte, war ein wichtiger Schritt auf dem Weg etliche Schwierigkeiten in meinem Leben zu lösen. Die Erfahrung eines Gefühls von Freiheit in meinen Bewegungen, im Tanzen, im Handeln eröffnete weitere Möglichkeiten von einem verkörperten (embodied)1 Leben. Die Wahrnehmung, nicht dazuzugehören, mich nicht mit anderen verbinden zu können, lichtete sich. Ich konnte mich nun auf den Boden legen und die Spannung in der Muskulatur, die mir Schmerzen verursachte, lindern. Es brauchte Jahre, mich mit dem Leben, der Natur und den Menschen um mich herum wohl zu fühlen. Die Reise, die ich den späten sechziger und während der siebziger Jahre begonnen hatte, führte mich auf einen Weg, der mir unvorstellbar gewesen war, bevor ich ihn begann. Ich hatte verschiedene wichtige Begleiter auf meinem Weg, darunter den Körpertherapeuten Ron Kurtz, den Gestalttherapeuten Jack Canfield, jedoch die Arbeit mit Moshe Feldenkrais zwischen 1975 und 1978 war entscheidend, um meine Weltsicht und meinen Denkprozess zu überarbeiten. Was für mich praktisch durchführbar war, wurde nun das, was ich mit anderen teilte – für den Rest meines Lebens. Ich begann die Feldenkrais-Methode zu unterrichten und wurde schließlich Trainer. Meine akademische Karriere und die Chemie gab ich vollständig auf.
Es gab noch einen anderen Aspekt, warum ich vier Sommer mit Feldenkrais verbrachte. Ich hatte mich durch die Erforschung meiner Bewegungen und Gefühle von der intellektuellen Welt entfernt, er jedoch war ein erstklassiger Denker. Er lud den Neurowissenschaftler Karl Pribram von der Stanford Universityzu drei Gesprächen in die Trainingsgruppe ein. Später besuchten uns der Kybernetiker Heinz von Förster und die Anthropologin Margret Mead. Feldenkrais ermutigte uns, alles zu lesen, was wichtig war in Bezug zu dem, was wir experimentell erforschten. Er untermauerte seine Bewegungslektionen von der ersten Stunde an mit Vorträgen und Geschichten, um uns sein Denken in Bezug zur jeweiligen Lektion zu verdeutlichen. Er eröffnete die Denkmöglichkeit, dass wir Bewegung nicht mehr als ein ergänzendes System einer Person oder eines Organismus’ betrachteten, sondern als einen grundlegenden Aspekt alles Lebendigen. Wie wir Bewegung erforschten, würde alles in uns beeinflussen. Nichts im Lebensprozess war vorstellbar ohne Bewegung. Ich war am Anfang der Idee gegenüber sehr skeptisch, dass das Verändern von Bewegungsmustern z.B. auch mit einem Wandel im Denken und Konzeptualisieren einhergehen würde. Aber nach vier Jahren Training war es für mich zur Gewissheit geworden. Was er uns intellektuell präsentierte, hing mit den Bewegungslektionen zusammen. Er ermutigte uns zu lernen, wie er es tat, und nichts selbstverständlich zu nehmen. Wir waren in eine Methode des Erforschens und in ein System von Selbsterfahrung eingetaucht. Zwei Aspekte dieses Tuns waren für mich besonders attraktiv: Erstens, dass Denken Empfinden, Gefühl und Handeln beinhaltet. Denken in Wörtern ohne das Fundament aus den Sinneseindrücken und der Erfahrung war fruchtlos. Zweitens, jeder Mensch hat die Fähigkeit für sich selbst etwas zu entdecken und muss das auch tun. Fehler waren oft das Ergebnis, wenn man nach vorgefertigten Ideen handelte.
Wir Menschen neigen dazu, die vorschriftsmäßige Sichtweise und die richtige Antwort zu suchen. Obwohl ich Sehnsucht nach Selbstständigkeit und selbstbestimmtem Fortschritt hatte, war sein Programm eine Herausforderung. Ich wollte oft die richtige Antwort für die Rätsel, die er präsentierte. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, dass menschliche Probleme oft undurchsichtig sind; Denken in der Kategorie, „was ist die Ursache und was die Wirkung“, führte oft nicht zu Lösungen oder nur zu begrenzten oder teilweise gültigen. Wir mussten außerhalb unserer gelernten kognitiven Strukturen denken. Ich begann mich von der Idee zu lösen, dass Bewegung etwas Zusätzliches ist; als Mensch habe ich ein Bewegungssystem, das verantwortlich ist für meine sensomotorische Koordination. Je geschickter ich mit der Methode wurde, umso mehr brachten mich meine erweiterten Möglichkeiten zu einem wirkungsvollen Denken und Handeln. Gleichzeitig war ich überzeugt, dass es einen starken Mittelweg zwischen anerzogenen Glaubenssätzen und dem Anarchismus, das alles möglich sei, gäbe. Lebendige Systeme sind hochkomplex und in einem strengen Sinn letztendlich unvorhersehbar. Gleichzeitig agieren und reagieren sie innerhalb vernünftiger Gesetzmäßigkeiten. Lernen findet in einer Umgebung statt, in welcher sich der Körper und das Nervensystem in wechselseitigem Zusammenspiel entwickeln, um sich selbst zu erhalten, sich selbst zu reproduzieren und zu beschützen. Leben wird erhalten durch die Aktivitäten, die es aufrechterhält. Leben geht weiter, auch wenn individuelle Organismen geboren werden, sich entwickeln und sterben. Aber jeder Organismus „weiß“, wie er so lange wie möglich überleben kann. Bewegung und Intelligenz sind die Schlüsselfäden für diesen fortwährenden Prozess. Irgendwie neigen wir in unserer westlichen Kultur dazu, die lebendige Verbindung zu diesen Fäden zu verlieren. Philosophen und Wissenschaftler haben erst kürzlich wieder Bewegung und die intime Verbindung von Geist und körperlicher Erfahrung entdeckt. Unlängst wurde Intelligenz als eine Eigenschaft aller lebenden Wesen wiedergefunden, einschließlich der einfachsten.2 Feldenkrais war mit diesem Denken in vorderster Linie und ohne die Wirkung seiner Arbeit auf mich wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Seine Methodik schien mir geheimnisvoll, sogar noch nach vielen Jahren. Seine an uns weitergeleiteten Ideen keimten auf, zusammen mit der Erfahrung in der Arbeit und meinem wissenschaftlichen Lesen, das ich weiter betrieb. Somit begriff ich langsam, wie seine Methodik zu Muster-Veränderungen führt – und einem anderen Sinn fürs Leben. Mit dieser Einsicht wird es klar, wie ein somatischer Standpunkt, der die Beziehungen von „Geist-Körper-Umgebung-Welt“ umfasst, zu einer Praxis von Bewusstheit und Engagement führt. Das Buch, das folgt, ist eine Untersuchung dieses radikal biologischen Standpunkts und der Konsequenzen daraus.
Eine Einleitung zum Buch
Die Bedeutung von Bewegung als einer biologischen Größenordnung
Für uns als Betrachter bewegen sich im Universum viele Dinge. Aber es zeigt sich, dass nur lebendige Wesen sich selbst bewegen. Moshé Feldenkrais sagt, „Bewegung ist der Schlüssel zum Leben.“ Was könnte er damit gemeint haben? Eine Lebensform, die in der Lage zur Selbsterhaltung ist und sich dabei selbst zu bewegen, muss empfindlich auf ihre Umgebung reagieren, deshalb lautet der Titel des Buchs „Lernen durch Bewegung“. Alles Lebendige bewegt sich und besitzt zumindest etwas Bewegungsautonomie im Verhältnis zu seinem weiteren Lebensumfeld. Der Anthropologe und Wissenschaftsautor Jeremy Narby präsentiert in seinem Buch „Intelligenz in der Natur“ (2006) den wissenschaftlichen und experimentellen Nachweis, dass Intelligenz auf jeder Ebene von Entwicklung vorhanden ist, vom Bakterium bis zum höchstentwickelten Lebewesen in der Evolution. Narby verfeinert die Vorstellung von Intelligenz, indem er sagt, Intelligenz meint die Anpassung und Veränderlichkeit in Reaktion auf die Lebensumstände, in denen Leben erhalten werden kann. Um das zu erreichen, ist Eigenbewegung unbedingt nötig.
Exakte Wissenschaft als Lern-, Denk- und Untersuchungsmodalität ist durch etablierte Gewohnheiten und normative Untersuchungstechniken eingeschränkt. In den meisten Fällen denken wir, dass uns das methodische Vorgehen die „Gedankenfreiheit“ gebracht hat, auf die sich unsere moderne Welt gründet, ihre Begrenzungen nehmen wir eher nicht wahr. Höflicher könnte man sagen, die Tätigkeit, die wir Wissenschaft nennen, hat strenge Vorgehensweisen entwickelt, um das zu etablieren, was in unserer Welt „so“ ist. Wir wollen wissen, dass unsere Konzepte fundiert und richtig sind. Die Erfolge in Physik und Chemie und deren Umsetzung in der Umwelttechnik sind bewundernswert, aber die Anwendung ihrer Methodologie auf lebendige Wesen schafft unerwartete Probleme. Die Methodenlehren der exakten Wissenschaft fixieren ihre Aufmerksamkeit auf isolierte Mechanismen, finden Ursache und Wirkung, verengen Aufmerksamkeit auf begrenzte Gebiete und beschränken Denken auf einen künstlichen Bereich, den man Objektivität nennt. Das heißt nicht, dass das reduktionistische und objektivistische Programm kein Wissen von der lebendigen Welt abwerfen kann. Viele wichtige Entdeckungen über uns selbst und andere lebendige Wesen waren das Resultat. Wir kennen jetzt viele Details über die biologischen Mechanismen der Gene, der Zellaktivität, der Übertragung von Nervenimpulsen und wie Lernen auf der Ebene von strukturellen Änderungen in den Nervenzellen vor sich geht. Es ist etabliertes Wissen, dass viele dieser Details für Organismen von ansonsten erheblich unterschiedlichen Ebenen von Komplexität üblich sind.
Die Vielschichtigkeit selbst hat sich andererseits für die reduktionistischen Modelle als schwierig erwiesen. Die Sache ist die, dass die integrativen und die Beziehungsaspekte lebendiger Systeme mehr verlangen, als einfach die Teile zu addieren. Wir brauchen eine biology of coherence, eine Biologie des Zusammenhangs, um unser Verstehen zu verbessern. Dennoch bilden wir uns ein, dass der im Moment populäre technische Weg unsere Lebensprobleme anzugehen, zu einem weit besseren Leben führen wird. Wir glauben, dass wir weit mehr über uns selbst wissen als unsere Vorfahren. Andererseits produzieren wir immer neue Katastrophen und versuchen unseren Mangel an Verständnis zu vertuschen. Ich erinnere mich oft an Albert Einsteins Aussage „Wahnsinn ist, die gleiche Sache immer wieder zu tun, aber einen anderen Ausgang zu erwarten“, und Moshé Feldenkrais’ Satz, „Ihr seht, es ist auch schwierig, zum ersten Mal einen Gedanken zu haben, der dem entgegengesetzt ist, was allgemein geglaubt wird.“
Die Feldenkrais-Arbeit zu praktizieren, zwang mich dazu, viele anerzogene Denk- und Handlungsweisen, die mir in meiner langen Schulzeit zur Gewohnheit geworden waren, beiseite zu legen. Ich entwickelte in der Folge eine sehr andere Sicht auf das Leben und entdeckte die Notwendigkeit, einfach zu denken: Empfinden, Fühlen und Handeln ohne die Sprache als Vermittler. Man kann das als unmittelbares Denken in Bewegung beschreiben. Die strikte Einhaltung des objektiven Standpunktes stand einer wirksamen Untersuchung der menschlichen Gegebenheiten im Wege – bei mir selbst und bei anderen, die meine Hilfe suchten. Lösungen kamen oft indirekt und ohne, dass ich darüber nachdenken musste, bis ich es verstand. Dieser Perspektivwechsel im Denken und die Rückkehr zur Erfahrung hatten praktische Konsequenzen. Später beim Nachdenken konnte ich zur Sprache zurückgehen. Sie ist wichtig für die Vermittlung von Gedanken. Der Kern von Feldenkrais’ Arbeit war, abstrakte Begriffe konkret greifbar zu machen. Alles in seiner Arbeit konnte vorgeführt werden.
Feldenkrais’ Arbeit, unvergleichlich darin, wie sie Bewegungserkundung als Weg zur Erweiterung von Bewusstheit und Wachstum nutzte, war aber auch Teil eines zunehmenden Trends im modernen Denken. Nicht alle wissenschaftlichen Herangehensweisen blieben beim strikten Objektivismus. Was wertvoll ist, sollte für alle beobachtbar und deshalb auch feststellbar sein. Feldenkrais hatte mit vielen bahnbrechenden Denkern und Wissenschaftlern Kontakt, die wegweisend waren in der Biologie, in der Psychologie und in den Neurowissenschaften. Unter ihnen waren Aaron Katzir-Katchalsky, der am Anfang der dynamischen Systemtheorie stand, Karl Pribram, der zu der Zeit ein Hologramm-Modell der Hirnfunktionen entwickelte, und andere Gründer und Ausarbeiter der kybernetischen Bewegung, Gregory Bateson, Magret Mead, Heinz von Foerster und Francisco Varela. Sie alle schätzten etwas in Feldenkrais’ Arbeit, das einen Widerhall ihrer eigenen neuen Ansätze bedeutete. Wir alle beobachteten, dass er durch die Art, wie er Kontakt zu Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemen knüpfte, allen half, einen Weg zum besseren Umgang mit sich und ihrer Umgebung zu finden, selbst bei denjenigen, denen zuvor keine Intervention Besserung gebracht hatte. Es sah aus wie ein Wunder. Dennoch nutzte er einfach sein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen und sein Verständnis der menschlichen Komplexität, um Menschen zur Selbstveränderung zu führen. Er vertraute darauf, dass jede lebende Person über diese Kapazität verfügt – als Konsequenz aus der fundamentalen Fähigkeit zu lernen. Heute nennen das viele Denker Selbstorganisation.
Arbeit, die menschliche Bewegung und Bewusstheit kombiniert, hat eine lange Tradition in der Praxis. Bereits seit den orientalischen Heiltechniken und den Kampfkünsten beinhalten diese somatischen Prozesse Selbstbeobachtung und Bewusstheit. Diese Qualitäten finden sich auch in den zunehmenden Arbeiten aus der Praxis, die sich auf die Werke von Elsa Gindler, Heinrich Jacoby, Ida Rolf und F.M. Alexander gründen. Feldenkrais hat sich mit all diesen Arbeiten beschäftigt. 1975 jedoch war Bewegung in den meisten Disziplinen nicht vorhanden, oder eigenen Feldern zugeordnet, wie dem motor learning (Bewegungslernen) oder der Verhaltensforschung. Im letzten Jahrhundert wurde das, was man heute embodiment3 nennt, vornehmlich von der Phänomenologie, besonders im Werk von Edmund Husserl und Maurice Merleau-Ponty, beschrieben. Es wurde auch in der an die Psychoanalyse angelehnten Arbeit von Wilhelm Reich und Paul Schilder dargestellt. Eine bemerkenswerte Ausnahme in der Wissenschaft war die Pionierarbeit des russischen Physiologen und Psychologen Nicolai Bernstein. Wir werden ihm in einem späteren Teil des Buches begegnen.
Heute verändert sich die Situation radikal. Neurowissenschaftler spekulieren jetzt, dass ohne eine gegenseitige dynamische Verbindung von lebendigem Körper und seiner Umgebung kein Nervensystem funktionieren kann. Professor György Buzsáki, Neurowissenschaftler an der Rutgers-Universität, schreibt in seinem neuesten Buch „Rhythms of the Brain“ (2006, S. 221): „Hingegen kann keine noch so große Menge an sensorischer Stimulation ohne das Ergebnis einer Interaktion von Körper und Umgebung ein brauchbares Hirn produzieren.“4 Und der Professor der Neurophysiologe, Giacomo Rizzolattí von der Universität Parma, sowie der Kognitionswissenschaftler, Professor Corrado Sinigaglia von der Universität Mailand, schreiben in „Empathie und Spiegelneurone: Die biologische Basis des Mitgefühls“ (2008, S. 13): „Die starre Abgrenzung zwischen perzeptiven, kognitiven und motorischen Prozessen entpuppt sich am Ende als weitgehend künstlich. Nicht nur scheint die Wahrnehmung in die Dynamik der Handlung verwickelt und stärker artikuliert zu sein, als man bisher gedacht hat; vielmehr ist das agierende Gehirn auch und vor allem ein verstehendes Gehirn.“
Diese Äußerungen verdanken sich vielen neuen Entdeckungen über das Nervensystem. Allerdings wurde die ganze Frage zum Zusammenhang von Geist und Körper(body-mind) in den vergangenen Jahren von Wissenschaftlern und Philosophen neu überdacht. Das bahnbrechende Buch, das der Idee und Diskussion von der Wahrnehmung von Geist und Körper (embodied cognitive science) in den kognitiven Wissenschaften eine neue positive Richtung gab, war „Der mittlere Weg der Erkenntnis: der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Erfahrung“ (dt., 1992) des Biologen und Neurowissenschaftlers Francisco Varela, gemeinsam mit dem Philosophen Evan Thompson und der Psychologin Eleanor Rosch. Sie beschreiben ihr Buch als eine „exploration of deep circularity“ (S. 17)5. Philosophen wie Shaun Gallagher mit seinem Buch „How the Body Shapes the Mind“ (2005a), Alva Noë mit „Action in Perception“ (2004), und Evan Thompson mit „Mind in Life: Biology, Phenomenology and the Sciences of Mind“ (2007) haben die Diskussion in der Philosophie des Geistes weitergeführt. Nichtsdestotrotz gibt es einen starken Widerstand bei vielen Wissenschaftlern und Philosophen gegen diesen neuen Trend. Sie wollen die altbekannte wissenschaftliche Suche nach objektivem Wissen, wie unsere Kultur sie hervorgebracht hat, beibehalten. Es gibt einen Glauben, dass Wissenschaft vom Objektivismus abhängt und nur als eine Serie von langsamen kleinen Schritten weitergeführt werden kann. Viele Wissenschaftler agieren in ihren Recherchen, als ob jeder Aspekt ihrer Untersuchung eine unabhängige, eigenständige Entität wäre. Sie haben die Idee, dass die Anhäufung kleiner Teile ein Warenhaus voller Wissen kreieren könnte. Es gab aber immer wieder Vorgänger, die ahnten, dass eine solche Vorgehensweise nicht genügt. Sie glaubten, dass wir wahrnehmende Wesen aus Geist und Körper sind, und dieser Sachverhalt alleine den Objektivismus herausfordere. Ich erwähne nur einige dieser Wissenschaftler und Philosophen, die Überlegungen ins Feld führten, dass Bewegung und embodiment wichtig für eine vollständige Sicht aufs Leben mit all seinen Aspekten ist und dass wir selbst in dieser Betrachtung unerlässlich sind. Es gibt keinen Blick von außerhalb. Ich beziehe den Psychologen J.J. Gibson und seine Mitarbeiter E.J. Gibson, Edward Reed und Michael Turvey ein, den Biologen Humberto Maturana, die Kognitionswissenschaftler George Lakoff und Mark Johnson, Bewegungswissenschaftler Marc Jeannerod und J.A. Scott Kelso, die Entwicklungspsychologin Esther Thelen, den Philosophen und Psychotherapeuten Eugene Gendlin, den Psychiater Daniel N. Stern und den Neurowissenschaftler und Musiker Manfred Clynes. Schließlich würde ich dieser Liste noch Charles Darwin, Henri Poincaré, William James und John Dewey aus unserer weiter entfernten Vergangenheit hinzufügen.
Zwei Bücher aus den letzten Jahren, die Bewegung als zentrales oder hauptsächliches Thema haben, schaffen Bewusstheit für die eminent lebenswichtige Bedeutung von Bewegung an sich: das Buch des Neuro-Physiologen Alain Berthoz‘ „The Brain’s Sense of Movement“ (2000) und „The Primacy of Movement“ (1999) der Philosophin, Biologin und Tänzerin Maxine Sheets-Johnstone. Diese Bücher sind wichtige Quellen für weitere Studien und Themen, die ich in diesem Buch behandle, genauso wie für viel mehr Details von der wissenschaftlichen Basis und dem intellektuellen Diskurs, der für die Themen dieses Buchs von Bedeutung ist. Wenn Bewegung wirklich so grundlegend ist, müssen wir sie als integral für alle lebendigen Wesen ansehen und nicht als Teilaspekt des Lebens, der unabhängig untersucht werden kann.
Somit ist das Thema dieses Buches Bewegung im Verhältnis zu allem anderen. Viele Fragen stellen sich: Wie werden wir da erwachsen, wo wir mit anderen Menschen leben, wie wirken wir aufeinander ein, wie sprechen wir miteinander, wie lieben wir uns, wie kämpfen wir und wie betreiben wir all unsere anderen Aktivitäten? Es ist unmöglich zu denken, dass wir ohne die Matrix anderer Menschen und anderer Lebensformen um uns herum leben könnten. Wie entwickeln wir unsere Kapazitäten im Verhältnis zu dieser Matrix? Wir lernen in einem intimen Kontakt mit den Menschen, die uns versorgen, seien es nun unsere Eltern oder andere Bezugspersonen. Wir lernen ebenso in einer Umwelt, die alle Ressourcen bereitstellt, die für unser Leben lebensnotwendig sind. Und diese Umwelt schließt auch die Schwerkraft ein, die eine besondere Anforderung an unser Wachstum und unsere Entwicklung stellt. Entwicklung ist eine ernste Angelegenheit für belebte, interagierende Wesen. Dementsprechend müssen wir viele verschiedene Interaktionsebenen betrachten, von der molekularen zur sozialen und dann zur ökologischen Ebene.
Da ich kein aktiver Wissenschaftler mehr bin, kommt das, was ich beizutragen habe, vielmehr aus meiner 34-jährigen praktischen Arbeit und Erfahrung mit der Feldenkrais-Methode. Die Beiträge meiner Frau Lucía Schütte-Ginsburg kommen ebenfalls aus ihrer aktiven Praxis, besonders mit Kindern. Vieles in der Feldenkrais-Arbeit ist einzigartig, was später im Buch ersichtlich wird. Dementsprechend will dieses Buch, soweit das überhaupt im Medium eines Buchs möglich ist, persönliche Erfahrung betonen. Diese stellt meiner Meinung nach einen sehr guten Weg zur Weisheit dar, wenn sie sorgfältig trainiert wird. Weisheit ist nicht dasselbe wie technisches und wissenschaftliches Wissen. Dieses erfordert spezifische Methoden der Untersuchung, andere, als ich hier vorschlage. Aber auch persönliche Erfahrung bedarf einer disziplinierten Untersuchungsmethode, um zu einer nützlichen Perspektive zu kommen. Damit können wir dann das Spinngewebe der Konzeptualisierungen, das unser Empfinden, Fühlen, Handeln und damit unser Denken verwirrt, hinwegfegen. Es ist nicht die Frage, Wissen zu bekämpfen, das auf andere Art erworben wurde. Es ist tatsächlich wesentlich, gerade das nicht zu tun. Aber eine disziplinierte persönliche Erforschung kann etwas klären, sowohl konzeptuelle Konfusion, die aus unserer Anhänglichkeit an Dritte-Person-Beschreibungen kommt, als auch wie wir unsere persönliche Erfahrung verstehen. Letztendlich sollten beide Gebiete zueinander in Beziehung stehen. Ich hoffe deshalb, Sie als Leser auf dieser Reise so mitreißen zu können, dass Sie sich von anerzogenem Wissen, in welchem Grad auch immer, zu einem Selbstherausfinden bewegen lassen. Unsere Frage ist nämlich das „Wie“. Dann können wir fragen, wie wir wahrnehmen und wie sich das vom Empfinden unterscheidet, wie Begreifen Wahrnehmen auf die Ebene des Denkens bringt, wie Bewegung zu Wahrnehmen und Begreifen führt und wie sorgfältige Selbstwahrnehmung zu einem besseren Leben und besserem Denken für uns selbst führen kann. Bewegung bringt uns auch zu einem anderen Bereich in der Wahrnehmung und im Denken. Und das ist der Bereich der Affekte. Affekte sind mehr als das, was wir als Gefühle beschreiben. Ohne Affekt kann Intelligenz nicht funktionieren. Der Kontext der Nachforschung ist die Matrix der Wechselwirkung, in der wir leben und in welcher wir uns entwickelt haben.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil untersuchen wir die Basis dieses neuen Denkens über das Leben und seinen Ursprung. Wir beginnen mit der Einsicht, dass sich im biologischen Leben das erste Lebewesen mit einer Membrane umgab. Innerhalb dieser Grenze gab es Struktur und Funktion, die Selbst-Antrieb ermöglichten. Nichts lebt oder überlebt ohne diese Absonderung und ohne irgendeine Form von Empfindungsvermögen. Wir spannen dann den Bogen zur Untersuchung von Intention, Handlung und Wahrnehmung und wie das zu Konzepten, wie z.B. der Idee von Raum und Zeit, führt.
Im zweiten Teil wird die Frage von Lernen und Entwicklung beleuchtet als auch das riesige Thema Affekt und Gefühl. Wir werden hervorheben, wie Bewegung nötig ist für Affekte und wie Affekte notwendig sind fürs Denken, Lernen und die Selbstentwicklung. Wir werden weiterhin die Frage berühren, wie Affekt und Sprachentwicklung zusammenhängen, und die Beziehung des Affekts zur Musik und zu anderen Kunstformen betrachten. Wir werden untersuchen, wie grundlegend Bewegung und embodiment sind für die Entwicklung des Denkens, das ohne Wörter beginnt und das zum Sprechen wird in einer Umgebung von sprechenden Menschen.
Der dritte Teil wird uns zu den praktischen Aspekten dieses neuen Denkens über das Leben bringen. Durch Beispiele werden wir zeigen, dass es möglich ist, bestimmte Probleme in uns zu lösen. Wir können entdecken, dass es möglich ist, uns durch Denken in Bewegung aus gewohnten Sackgassen zu befreien. Präzise Bewegungs-Erforschungen werden vorgeschlagen, sodass der Leser den Lernprozess ganz unmittelbar erfahren kann. Dann wird hoffentlich jeder Mensch einen Weg finden, der ihn zu einem logischeren Handeln im Leben führen wird – mit größerem Vergnügen und größerer Verbindung zum Leben. Und letztendlich werden wir zusammenfassen, wie dieses sich entwickelnde Verstehen einer neuen Sichtweise aufs Leben dazu führt, viele Fragen übers Lernen, Handeln und Leben erneut zu überdenken.
Eine Anmerkung für den Leser: Das Buch ist so geschrieben, dass sich die Themen aus den vorherigen entwickeln. Es kann jedoch sein, dass einige Leser Teil I beim ersten Lesen schleierhaft finden. Sie können dann mit Teil II oder auch Teil III beginnen. Wenn ein Abschnitt schwer zu verstehen ist, lassen Sie ihn liegen und kommen Sie später darauf zurück.
Teil I Vom Ursprung zur Wahrnehmung
2 Ursprünge
Bewegung ist der Schlüssel zum Leben. Moshé Feldenkrais
Es ist nicht leicht, mit den Anfängen und Ursprüngen anzufangen. Als Erwachsene denken wir, wir wüssten schon alles und haben unser Leben und Denken danach strukturiert. Wir werden in eine Welt und in eine Gesellschaft von Menschen hinein geboren. In unserer Kindheit verbringen wir eine Menge Zeit damit, uns nach den anderen Menschen um uns herum zu richten und an die Umgebung anzupassen, weil wir weiterleben wollen. Diesen Prozess der Orientierung nennen wir Lernen und Sozialisation. Dann gibt es noch ein fundamentaleres Lernen, dieses Lernen geht mit Entwicklung einher. Wir kommen in dieses Leben und sind durch unser biologisches Erbe auf diesen Lernprozess, der von Bewegung und Interaktion abhängt, vorbereitet. Wir werden diesen Entwicklungsprozess im zweiten Teil des Buches untersuchen. Für den Moment reicht es zu sagen, dass wir viel lernen, bevor wir fähig sind zu sprechen.
Sprechen erweitert unsere Möglichkeiten und es engt gleichzeitig unsere Erfahrungen ein. Während wir in das Sprechen hineinwachsen, wollen wir das, was wir schon aus Erfahrung wissen, mit der neuen Domäne in Übereinstimmung bringen. Deshalb verbringen kleine Kinder, so um das Alter von vier herum oder auch früher, viel Zeit mit Fragen z.B. „Wie das?“ und „Warum das?“. Das ist oft schwierig für Erwachsene, die diese Fragen meistens verwirrend und rätselhaft finden. So bringen die Großen, besonders die Eltern, ihre Kinder schließlich dazu, mit diesen „Warum“-Fragen aufzuhören und beim etablierten Programm zu bleiben. Wir lernen, keine lächerlichen Fragen zu stellen. Dann werden wir in die Schule geschickt. Wir lernen stolz auf unser Wissen zu sein und uns für unser Unwissen zu schämen. Dieses Wissen jedoch ist oft nur das, was die Anerkennung der anderen in unserem sozialen Umfeld hat und was ihrer Überzeugung entspricht.
Der französische Philosoph René Descartes versuchte ganz tief unten zu beginnen. Er benutzte eine Methode, die alles, was er kannte, anzweifelte, bis er zu etwas kam, was er nicht mehr anzweifeln konnte. Wir haben nun einen Namen für diesen Ort. Wir nennen ihn „Cogito“ nach dem lateinischen Ausspruch Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Descartes handelte nichtsdestotrotz aus einer Tradition, in der Vernunft wichtiger war als die Sinne. Damit waren die Würfel von Anfang an gezinkt. Man könnte genauso von einer anderen Perspektive aus sagen, „ich bewege mich selbst, also existiere ich“. Descartes benutzte seine Methode des Zweifels, um diese Möglichkeit zu eliminieren. Dennoch hatte er sein Experiment an einem sehr kalten Tag begonnen, in einem kleinen Raum mit einem Ofen, in dessen Wärme er baden konnte. Wäre er im Kalten geblieben, hätten wir wahrscheinlich niemals den „Cogito“ bekommen. Andererseits werden „kalt“ und „warm“ durch das Sich- bewusst-Machen (den aktiven Standpunkt) oder durch das Bewusstsein eingeschätzt, das Descartes mit dem Geist assoziierte, der vom Körper unterschieden und maschinenähnlich für ihn war. Seiner Idee nach ist das Verhältnis von Körper und Geist so, dass der Geist den Körper dirigiert. Auf diese Art können wir wahrnehmen, wie wir uns bewegen, und dass wir selbst die Verursacher dieser Bewegung sind.
Selbst wenn wir sagen, „Ich bewege mich selbst, also existiere ich“, müssen wir diesen Sinn für Urheberschaft schon entwickelt haben. Das heißt, wir haben bereits eine Wahrnehmung verkörperten Bewegens und eigenen Handelns entwickelt. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Entwicklung dieses Sinns für Urheberschaft der Entwicklung des Sprachvermögens vorausgeht. Wir werden auch im geistigen Bereich beobachtungsfähig. Beobachten fängt ebenfalls vor dem Sprechen an. Doch mit der Sprache können wir auf der Ebene der Erkenntnisse einfach vermitteln, was wir beobachtet haben. Sprache gehört zum sozialen Bereich und wir nehmen an, dass sie unserer individuellen Existenz vorangegangen ist. Geistiges wird durch diese Domäne vermittelt und diese Vermittlung erfordert ein Tun. Auf diese Weise tritt die Trennung von Geist und physischem Körper zurück und wir nähern uns einer Einheit beider.7





























