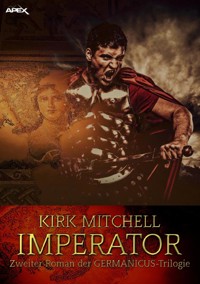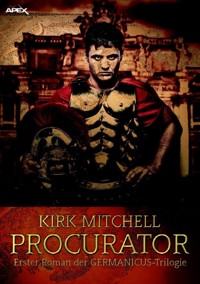7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Revolution beginnt!
Zweitausend Jahre, nachdem Pilatus einen gewissen Jesus von Nazareth begnadigte, beherrschen die Römer noch immer die Welt. Mit den modernen Waffen des 20. Jahrhunderts hat Imperator Germanicus alle Feinde Roms besiegt, und doch steht seine Herrschaft auf tönernen Füßen. Denn der Kaiser selbst plant den Umsturz: Er will das Römische Reich in eine Republik verwandeln. Seine Feinde sind grausam und gefährlich. Und als sie von seinen Plänen erfahren, holen sie zum Gegenschlag aus - der Herrscher von Rom muss fliehen...
Die Revolution frisst ihren Vater!
Mit diesem Roman schließt Kirk Mitchell seine Germanicus-Trilogie ab, die mit Procurator und Imperator begann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
KIRK MITCHELL
Liberator
Dritter Roman der GERMANICUS-Trilogie
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
Das Buch
LIBERATOR
Prolog
Codex I – Claudia
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Codex II – Mara
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Codex III - Glaesea
XVIII.
XIX.
XX.
Epilog
Der Autor
Kirk Mitchell, Jahrgang 1950.
Kirk (John) Mitchell ist ein US-amerikanischer Autor. Er beschäftigt sich vor allem mit Science Fiction und Alternative History und schreibt Romane zu Filmen. Teilweise schreibt er auch unter dem Pseudonym Joel Norst.
Im deutschsprachigen Raum wurde er hauptsächlich durch seine Germanicus-Trilogie bekannt: Procurator (1984, dt.: Procurator, 1988), The New Barbarians (1988, dt.: Imperator, 1989) und Cry Republic (1989, dt.: Liberator, 1990).
Mitchell studierte an der University of Redlands Englische Literatur und machte seinen Abschluss magna cum laude. Bevor er sich mehr der Schriftstellerei zuwandte, absolvierte er zunächst eine Ausbildung an der San Bernardino County Sheriff’s Academy und diente danach eine Weile als Hilfssheriff in einem Indianerreservat im Osten der Sierra Nevada, wo er zusammen mit einigen Paiute, Shoshone, und Comanche auf Wüstenpatrouille ging. Diese Erfahrung löste ein anhaltendes Interesse an den Kulturen dieser Völker und an ihrem modernen Stammesleben aus. Er beendete seine Karriere in der Strafverfolgung im Rang eines SWAT Sergeant von Südkalifornien.
Seit 1983 ist er hauptberuflich als Schriftsteller tätig.
Zu seinen bekanntestens Roman-Adaptionen von Filmen zählen (teilweise verfasst unter dem Pseudonym Joel Norst): The Delta Force (1986), Lethal Weapon (1987), Colors (1988), Mississippi Burning (1989) und Backdraft (1991).
Sein aktuellster Roman ist Under The Killer Sun: A Death Valley Mystery (2011).
Der Apex-Verlag veröffentlicht Neu-Ausgaben seiner Romane Procurator, Imperator und Liberator.
Das Buch
Die Revolution beginnt!
Zweitausend Jahre, nachdem Pilatus einen gewissen Jesus von Nazareth begnadigte, beherrschen die Römer noch immer die Welt. Mit den modernen Waffen des 20. Jahrhunderts hat Imperator Germanicus alle Feinde Roms besiegt, und doch steht seine Herrschaft auf tönernen Füßen. Denn der Kaiser selbst plant den Umsturz: Er will das Römische Reich in eine Republik verwandeln. Seine Feinde sind grausam und gefährlich. Und als sie von seinen Plänen erfahren, holen sie zum Gegenschlag aus - der Herrscher von Rom muss fliehen...
Die Revolution frisst ihren Vater!
Mit diesem Roman schließt Kirk Mitchell seine Germanicus-Trilogie ab, die mit Procurator und Imperator begann.
LIBERATOR
Prolog
Zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen nach Wahl des Volkes freizulassen. Und zu jener Zeit hatte er gerade einen berüchtigten Gefangenen namens Barrabas. Als sich das Volk dann versammelt hatte, sagte Pilatus zur Menge: »Wen soll ich freilassen, Barrabas oder Josua Bar Joseph, der von euch Hellenen Christos genannt wird?« Derweil er auf dem Richterthrone saß, ließ seine Frau ihm eine Botschaft überbringen: »Lass ab von diesem Gerechten, denn seinetwegen habe ich heute im Traum schwer gelitten.«
Nun redeten die Hohepriester und die Ältesten auf das Volk ein, dass es Barrabas verlangen und Josua verderben solle. Der Statthalter sprach erneut zu ihnen: Welchen von beiden soll ich euch nach eurem Willen übergeben?« Und sie antworteten: »Barrabas.« Pilatus sagte zu ihnen: »Was soll ich dann mit Josua machen, der Christos genannt wird?« Und alle sagten: »Schlage ihn ans Kreuz.«
Mit besorgter Miene versank der Statthalter darob in Gedanken. Und als er daraus erwachte, ließ er die Festwachen verdoppeln und befahl, Josua Bar Joseph freizugeben. Das Volk stimmte ein großes Geschrei gegen ihn an. Aber Pilatus zeigte sich unnachgiebig.
Der Statthalter ehrte seine Frau ob ihrer Träume.
- Aus einer alten perushischen Schriftrolle, aufgefunden in der Nähe des Asphaltitis-Sees während der Herrschaft des Caesar Fabius.
Codex I – Claudia
I.
Weit unter der dünnen Schicht der Morgenwolken, tief im grünen Konus des Mons Vesuvius, fachte der Vulkan die Kohlen seiner Schmiede an.
Schon seit Wochen hatte der Gott der Schmiede Campania und Latium mit Beben erschüttert, die bis zur kleinen Stadt Forum Appii gereicht hatten; allerdings hatten auch einige sensible Zeitgenossen, die sich weit vom Ort des Geschehens – etwa in Rom – aufhielten, behauptet, dass sie wegen seiner Umtriebe Unbehagen empfunden hätten. Während einer mondbeschienenen Nacht, in der Schwefelgestank in der Luft hing, war das Wasser im Hafen von Puteoli ins Kochen geraten, und als schließlich der Morgen dämmerte, entdeckte man, dass die alte Mole sich volle sechs Zoll über die Höhe des Tyrrhenischen Meeres erhoben hatte. Ein Senator, der ein Haus in Baiae besaß, hatte in einem Brief an Caesar Germanicus geschrieben, dass seine Quelle, für gewöhnlich die kälteste und süßeste in der Gegend, durch Hitze und den Geschmack von verfaulten Eiern verdorben worden war. Der Imperator solle sich in allen Dingen achtsam zeigen, da Böses und abscheuliche Dinge in der Luft lägen, hatte der Patrizier nahegelegt. War nicht in Moguntiacum, dem Geburtsort von Germanicus Julius Agricola, ein Schwein mit Klauen geboren worden? Und hatte es nicht die Nachricht über eine Frau in Pannonien gegeben, die zwei Bestien das Leben geschenkt hatte? War es nicht schon immer so gewesen, wenn der Vesuvius seinen Schlummer überwand?
Unsinn.
Dennoch war es eben die Nachricht über eine plötzlich heiß gewordene Quelle, die Tora aus seinen Gemächern in Caesars Palast auf dem Palatin nach Campania zu eilen veranlasst hatte. Aus Erfahrungen seinem eigenen vulkanreichen Land wusste er, dass dies jene Veränderung anzeigte, die Italia mit Votiv- und Tieropfern abzuwenden versucht hatte.
Er wendete seine Wolkengaleere, um ein weiteres Mal um den Gipfel zu schweben. Schimmernd erstreckte sich der Golf von Neapolis unter ihm. Sonnenlicht funkelte über der See. Heftig wehte ihm der Wind ins Gesicht. Seine Augen zogen sich zu Schlitzen zusammen, und sein glattes Haar flatterte um seinen Kopf.
»Unsinn«, murmelte er zu sich selbst, als er wieder an Gott Vulcan dachte.
Tora war kein Römer, daher zog er ungleich dem italischen Menschen keinen Trost und Glauben aus Opferungen an die jovianischen Götter. Doch in seiner Heimat war es dasselbe, in Nihonia, einem weit im Osten gelegenen Halbmond aus bewaldeten Inseln, der ein Vasallenstaat der Seidenmacher war – oder der Serizaner, wie die Römer die Xing immer noch nannten. Allerdings wurden in seinem Heimatland die Kami durch Gaben bestochen, die heiligen Geister, die auf solch gewalttätigen Bergen wie dem Vesuvius lebten. Aber Tora hatte nicht mehr Vertrauen in die Tüchtigkeit der Kami als in das Haus Jupiters. Dass weltweit Hunderte von Millionen Menschen sich derartigen Mächten beugten und ihnen opferten, machte diese Mächte nicht weniger imaginär.
Er war ein Machinator, ein Mann, der sich Maschinen widmete und den Prinzipien, nach denen sie erbaut wurden und arbeiteten. Aber was noch wichtiger war – er war ein Anhänger Yinshayas, einer Philosophie und Lebensweise, die er den starrsinnigen Römern nur als vollständige Hingabe an die Vernunft zu verdeutlichen vermocht hatte. Und weil seine Verpflichtung gegenüber Yinshaya alle anderen Verpflichtungen in seinem Leben übertraf, hatte er seinen zunehmend beunruhigten Kaiser zurückgelassen und sein Fahrzeug gen Süden gelenkt, um den Römern zu beweisen, dass die Unruhe des Vesuvius nicht dem Wüten eines Gottes, sondern dem Zusammenspiel aus überhitzten Gasen, Silikaten und Wasser zu verdanken war. Nur Caesar Germanicus, ein Römer mit einer bemerkenswerten Neigung zur Vernunft, schien der Erklärung, dass dies die Ursache für Vulcans zunehmenden Wahnsinn war, aufgeschlossen gegenüberzustehen. Er war sogar so weit gegangen, sich laut zu fragen, wie Gott Vulcan, dessen ursprüngliche Behausung innerhalb des Berges Aetna auf der Insel Sizilien gelegen hatte, seine riesige Schmiede gen Norden zum Vesuvius verlagert hatte, ganz besonders angesichts der vom Pontifex Maximus, dem Obersten Priester festgestellten Tatsache, dass die Zyklopen, gigantische einäugige Diener des Schmiedegottes, tot waren – was einem Streit mit ihrer Mutter Terra zuzuschreiben war.
Tora war davon überzeugt, dass es sich bei Rom um die abergläubischste Großmacht der Weltgeschichte handelte. Das einzige echte Wunder bestand für Tora darin, dass Roms Legionen seit mehr als zwei Jahrtausenden den halben Globus in ihrem Griff hatten. Und auch dieser Griff lockerte sich immer mehr. Tora stemmte sich gegen seinen Steuerknüppel und strebte Vesuvius’ schimmernder Krone zu.
Eine kleine Dampffeder war gerade aus einer Fumarole aufgestiegen. Zuvor hatte er im Dämmerlicht des Morgengrauens einen unirdischen blauen Schimmer in einem dieser natürlichen Ventile gesehen, und jetzt wollte er etwas von dem entweichenden Gas in einer Glasphiole einfangen. In diesen flüchtigen Entladungen hoffte er Spuren von Schwefeldioxid zu finden – einem weiteren Zeichen dafür, dass Vulcan sich alsbald zu räuspern gedachte.
Die Luft, die über die Flanken des Berges strich, war ruhig, und Toras Wolkengaleere glitt auf den bereits abnehmenden Ausstoß zu.
»Wolkengaleere«, sagte er kopfschüttelnd. Lästig – diese römische Beharrlichkeit, alles, was sich bewegte, mit der Bezeichnung ihrer alten Seefahrzeuge zu versehen, aber wie stets hatte er sich ihren Vorlieben gebeugt. Er hatte einen Xing gegen einen Römer eingetauscht, wusste jedoch, dass ihn alles andere als Treue entehren würde. »Dann also Wolkengaleere...« Er warf einen liebevollen Blick auf sein Fluggerät: Möwenschwingen und ein Kasten aus Aluminiumröhren und Kupferdrähten, der ein kleines Eisenherz umschloss, das mit einem Elixier aus Petroleum und Öl gespeist wurde.
Eine Bewegung lenkte seinen Blick erneut zum Vesuvius. »Was gibt es dort?«, fragte er sich. Es schien, als ob der äußerlich verformte und mit tiefen Rissen durchzogene Hang, der die Fumarole umgab, plötzlich zu zittern begann. Und dann wurde dieser flüchtige Eindruck von einem anderen abgelöst – dass eine Schwellung hervorwuchs und dabei Staubvorhänge ausspie. Aber auch dies war nicht von Dauer, denn weniger als eine Sekunde später begann die gesamte Aufwerfung in sich zusammenzufallen und in einer Schlucht zu verschwinden, die Augenblicke zuvor noch nicht existiert hatte.
»Nein!«, schrie er und brachte genügend Geistesgegenwart auf, um die beiden Drehkontrollen gleichzeitig voranzuschieben. »Das ist zu früh!«
Seine Furcht gebot ihm aufzusteigen, dennoch tauchte er hinab und richtete entschlossen seinen Blick auf die Insel Aenaria im Westen, während er darauf wartete, dass Vulcans heiße Faust seine Wolkengaleere von hinten zermalmte.
Ein seitlicher Ausbruch – er wusste, dass dies wahrscheinlicher war als eine weniger gefährliche vertikale Explosion. Die Kraft der Eruption würde unmittelbar in seine Richtung gehen. Es würde nur noch Sekunden dauern.
Ich hätte nie gedacht, dass es so plötzlich kommen würde. Es hätte sich durch zahllose Beben ankündigen sollen! Und anschließend hätte aller Erfahrung nach Stille eintreten müssen. Und selbst wenn diese Zeichen ausgeblieben wären, hätte während der letzten Stunden der Ausstoß an Schwefeldioxid um das Dreißigfache ansteigen müssen!
Dann traf ihn der brüllende Sturm, der ihm beinahe den ägyptischen Musselin von den Flügeln riss.
Er presste die Zähne aufeinander und kniff die Augen zusammen.
Als der Orkan seine Wolkengaleere erfasste, spürte er, wie das Fahrzeug erbebte, einen trügerischen Augenblick lang ruhig schwebte und. dann in einen Wirbel geriet. Dabei erhaschte Tora immer wieder zwei Ausblicke: das Meer, von der Hoffnung beleuchtet, dass er doch noch überleben würde, und Vesuvius, der hinter einer großen Aschenwolke lag.
Er kämpfte das Verlangen nieder, die Drehkontrollen wie Zügel an sich zu ziehen, und tauchte immer tiefer, um die Geschwindigkeit zu erreichen, die er benötigen würde, um sich aus diesem Mahlstrom zu befreien – was umso schwieriger war, als der überhitzte Aufwind einen Gegensog erzeugte, der die zerklüfteten Berghänge hinabheulte und dabei das winzige Fahrzeug mit sich fortriss.
Er fühlte, wie sich das Blut in seinem Schädel sammelte, was heftige Schmerzen hervorrief, die er durch einen langgezogenen Schrei zu lindern hoffte.
Endlich vermochte er die wilde Drehung zu beenden, stellte jedoch fest, dass es ihm nicht möglich war, den Sturzflug des Fluggerätes abzufangen.
Immer noch raste er mit einer Geschwindigkeit dem Boden entgegen, die seine Wolkengaleere auf Dauer auseinanderreißen würde.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich die Asche gen Himmel reckte, ein dunkelgrauer Pilz, der von eigenartig zarten Blitzen durchzuckt wurde. Grausige Gottesgesichter entstanden und verschwanden wieder. Vulcan und sein Gefolge triumphierten. Spukbilder, gewiss – dennoch mit der Macht, ihn in Furcht zu versetzen.
Er brüllte ein weiteres Mal auf, um den Druck in seinem Kopf zu mildem, dann unternahm er einen anderen Versuch und zog die Drehkontrollen mit beiden Händen zurück.
Die Weingärten am Fuß des Berges kamen rasch, viel zu rasch auf ihn zu.
Kurz vor dem erwarteten Aufprall ordnete er seine Gedanken, was der Mentalität jener Kriegerklasse entsprach, in die er geboren worden war: die Gleichgültigkeit dem eigenen Tod gegenüber zu verstärken, indem man die Schönheit der Welt ein letztes Mal in sich aufnahm. Die Wärme des Frühsommers hatten die Weinranken unter ihm mit einem lebhaften Grün versehen. Und es gab Menschen, die sagten, dass unter diesen Weingärten eine uralte Stadt unter Vulkanasche und Schlamm begraben lag. Vielleicht war dies die Unterwelt, in die Tora nun eingehen würde, obgleich ein Nihonier im Augenblick seines Todes zur Sonne blickte.
Wahrscheinlich stellten diese Worte sein Todesgedicht dar.
Aber dann kündigte die Erde ihre Nähe durch dichter werdende Luftschichten an. Beinahe berührten sich die Spitzen der gebogenen Flügel der Wolkengaleere, doch stemmte sich noch ausreichend Musselin dieser dichteren Luftschicht entgegen, um seinen Sturz zu verlangsamen – und als das Fahrzeug nur wenige Fuß über den Weinreihen in einem langgezogenen Bogen wieder gen Himmel strebte, spürte er, wie das Blut wieder in seinen Rumpf und seinen Beinen zurückströmte.
Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, galt sein erster Gedanke der Richtung des Windes. Er kam aus dem Süden und trieb die Asche rasch weiter gen Norden auf Rom zu.
Erschöpft flog er über den Nordrand der Bucht, mied die Stadtmitte von Neapolis für den Fall, dass der Motor seiner Maschine ausfallen und eine vorzeitige Landung erforderlich machen würde, und ging schließlich auf einer Wiese in der Nähe von Puteoli nieder. Dort saßen die fünf Prätorianerwachen, die ihn in der letzten Nacht über die Via Appia eskortiert hatten, auf dem Zedernholzdach ihres eberköpfigen Wagens, ohne auf seine Landung auf der holperigen Wiese zu achten. Sie starrten auf den Ausbruch des Vesuvius.
Allerdings stand eine weitere Prätorianergruppe bei ihnen. Diese Angehörigen der Leibgarde des Imperators schienen an Vesuvius wenig Interesse zu hegen, und sie blickten Tora mit derartiger Rücksichtslosigkeit an, dass er sogleich an sein Katana, sein Langschwert, dachte, das in dem Frachtraum hinter seinem Sitz verstaut lag.
Der Zenturio der Prätorianer kam näher. »Auf ein Wort, Tora-san«, sagte er über das ersterbende Knattern des Motors der Wolkengaleere, bevor Tora die Maschine mit einem kurzen Umlegen eines Hebels zum Schweigen brachte.
»Ja?«
»Wir sollen Euch auf der Stelle nach Rom zurückgeleiten.«
»Auf wessen Anordnung?«
»Auf Anordnung Caesars...« Der Blick des Zenturios strafte seine Worte Lügen.
»Dann werde ich den Campus Martius direkt aufsuchen.«
»Wie wollt Ihr das anstellen, Herr?«
»Mit dieser Maschine.«
Der Mann suchte seine plötzliche Verärgerung mit einem Lächeln zu überspielen. »Solltet Ihr das tun, handelt Ihr den Wünschen des Antonius Nepos zuwider.«
»Also ist es der Präfekt der Prätorianer und nicht der Imperator, der mich nach Rom zurückbefiehlt.«
»Wenn Ihr erst einmal längere Zeit in unserem Land verbracht habt, Herr, werdet Ihr gewahr werden, dass die Anordnungen des Präfekten und die des Imperators häufig genug ein und dieselbe Sache sind.«
»Aber nicht immer...«
Der Zenturio setzte erneut sein verwirrtes Lächeln auf. »Nein, und ich erkenne jetzt, dass es stimmt, was man sagt – Euer Verstand ist so präzise wie Euer Latein.« In einer möglicherweise unbewussten Geste griff der Zenturio nach dem Heft seines Kurzschwertes und rasselte mit der Klinge. »Wenn es Euch genehm ist, so folgt mir zur Sandgaleere des Präfekten.«
»Ja, wenn Ihr mir gestattet, meine Maschine zum Auftanken zum Wagen zu bringen.«
»Gewiss.« Der Zenturio steckte sich ein Lungenkraut an, inhalierte, stieß den Rauch aus und neigte seinen silbernen Helm in Richtung Vesuvius. »Er lässt ganz schön Dampf ab, was?«
»In der Tat... er lässt Dampf ab.« Tora startete den Motor wieder und setzte die Wolkengaleere in Bewegung. Aber anstatt sich zum Wagen zu wenden, wo zwei Prätorianer bereits die Riemen fertigmachten, beschleunigte er auf die Wiese und erhob sich – nach einem kurzen Rennen mit den Wachen, die Arme schwenkend und brüllend die Verfolgung aufgenommen hatten – in den dunklen Mittagshimmel. Ein kräftiger vulkanischer Hagel fauchte ihm entgegen, also wandte er sich dem Meer zu.
Sie marschierten aus ihrer Bastion beim Castra Praetoria heraus – eine volle Kohorte, tausend Mann stark, deren Rüstungen und rote Umhänge prächtig in der Sonne leuchteten. An ihrer Spitze marschierte Decimus Antonius Nepos, einer Tradition folgend, die beinahe zweitausend Jahre bis zu Caesar Tiberius zurückreichte, der Mitstreiter in den Bemühungen des Kaisers, der Mann, der stets seinen Finger am unregelmäßigen Puls Roms hatte.
»Rechts schwenkt!«, brüllte sein Erster Zenturio, worauf die Kolonne in eine Seitenstraße einschwenkte.
Nepos war ein Mann von verdächtig gutem Aussehen mit feinen regelmäßigen Gesichtszügen, die jeder italischer Patrizier voller Stolz einer physiognomischen Prüfung unterzogen hätte, obgleich er so lusitanisch wie gewöhnlicher Kork war. Seine Herkunft aber war nicht dazu angetan, sie in seiner ansonsten angenehmen und vertraulichen Anwesenheit zu erwähnen.
»Laufschritt, Erster Zenturio.«
»Jawohl, Präfekt. Laufschritt – marsch!«
Keine dampfspeienden ratternden Fahrzeuge verzögerten das Vorankommen der Prätorianer. Nach altem Edikt durften diese Vehikel Roms enge Straßen während der ersten zehn Tagesstunden nicht befahren. Daher ordnete sich die Kohorte innerhalb von Minuten unter den Befehlen des Ersten Zenturio in einer Doppelreihe an, die die Curia vollständig umschloss.
Nepos betrat das Senatshaus allein, und behäbige Aristokraten erhoben sich von ihren Bänken und applaudierten bei seinem Eintritt. Es handelte sich um Patrizier, die es noch vor einem Jahr vermieden hätten, dem Sohn eines Korkhändlers die Hand zu schütteln, wie er sich mit einem schiefen Lächeln ins Gedächtnis rief.
Er erwiderte ihre lärmende Begrüßung mit einem militärischen Salut und ließ sich dann auf einem Sitz am Ende der Curia nieder.
Der Präsident des Senats – ein Tattergreis, der nur für den Beruf eines Walkers geeignet gewesen wäre und seine Tage in einem Kotfass gefristet hätte, wäre er nicht in eine alte und adlige Familie hineingeboren worden – erhob sich mit knirschenden Gelenken aus seinem Kurulensessel auf dem niedrigen Podest am Vorderende des Raumes. Während er unsicher auf den Beinen schwankte, floss der Saum seiner Toga wie eine purpurne Welle um seine geschwollenen Knöchel. »Patres Conscripti«, begann er in seiner lächerlich schwächlichen Stimme, »jene aus unseren Reihen, die im Kolleg der Pontifices eingeschrieben sind, haben sich hier auf den Ruf des Pontifex Maximus zusammengefunden...« Mit stoischer Beharrlichkeit zeigte Nepos keinerlei Gefühle, als der Hohepriester erwähnt wurde, noch wechselte er irgendwelche Blicke mit dem düster dreinblickenden Mann, der seinerseits aus der Anonymität erhoben worden war, als Germanicus dieses höchste geistliche Amt abgelehnt hatte. Vor kurzem sich Caesar auch das Amt des Censors abgegeben und sich dadurch gesetzlich die oberste Autorität über den Senat versagt – eigenartig für einen Julischen Imperator. »...um eine Angelegenheit von möglicherweise göttlicher Bedeutung zu untersuchen« – der Präsident zwinkerte über eine Wachstafel hinweg, die ihm von einem der Kindersklaven vor die Nase gehalten wurde – »die sich im Sanktuarium des Helios zu Augusta Treverorum ereignete oder auch nicht ereignete, und zwar an den Kalenden des vergangenen Monats – oder waren es die Iden? Verdammt, Knabe, halte die verflixte Tafel ruhig!«
Welches Datum es auch gewesen sein mochte – Nepos erinnerte sich jenes Tages in Belgica in völliger Klarheit, obgleich das, was sich nun tatsächlich oder auch nicht ereignet hatte, wenig Bedeutung für dasjenige hatte, was heute entschieden werden würde. Was zählte, war der Eindruck, der sich in den öden, weindurchtränkten Hirnen dieser Männer niederschlagen würde.
Stirnrunzelnd schlug der Präsident die Tafel plötzlich bei Seite. »Nun, der edle Pontifex Maximus wird die Angelegenheit sicher klarstellen.«
Ja, in der Tat, murmelte Nepos in Gedanken.
Dann standen einhundert Männer auf – von ihren Vätern selbst für Militärdienste als zu dumm erachtet –, um dem nutzlosen Oberhaupt ihres gleichermaßen nutzlosen Kollegs von Märchenbewahrem und Haarspaltern ihre Ehrerbietung zu erweisen. Existierte das Trojanische Pferd als historischer Gegenstand, oder stellte es Homers Symbol für das göttliche Eingreifen Poseidons in Form eines Erdbebens dar, das die Mauern Trojas niederriss? Von eben diesem Stuhl aus hatte Nepos ungläubig zugesehen, wie eine Woche Sitzungszeit auf diese lebenswichtige Frage verschwendet worden war.
Zwei Sklaven stellten ein Kurulum in die Mitte des Marmorhalbkreises, der von der Krümmung der Bänke geformt wurde, dennoch nahm der Pontifex nicht darauf Platz. Stattdessen rief er Antonius Nepos zur Befragung nach vom.
Mit angemessen ernster Miene stieg Nepos die breiten Stufen hinab und ließ sich auf Aufforderung des Pontifex im Sessel nieder, wobei er sich leicht vorbeugte, um einen aufmerksamen Eindruck zu machen. Menschen entscheiden sich häufig ob dieser kleinen Gesten.
Der Pontifex legte den gekrümmten Zeigefinger über seinen Nasenrücken – eine Geste außerordentlicher Konzentration. Schweigend verharrte er mehrere Augenblicke lang in dieser Haltung, dann sagte er zu Nepos: »Begegnungen jener Art, wie sie hier verkündet wurde, sind ernste Angelegenheiten. Äußerst ernst, in der Tat – besonders, wenn hohe Persönlichkeiten darin verwickelt sind. Denn wenn eine derartige Begegnung tatsächlich stattgefunden hat, wird uns Sterblichen ein flüchtiger Blick auf das himmlische Wohlwollen oder Missfallen offenbart. In der Wendung derartiger Augurien können sich Imperien erheben oder aber zu Staub zerfallen. Aus diesem Grund muss eine jede Befragung zu einem solchen Vorfall über die gute Sitte hinaus mit größter Gründlichkeit vollzogen werden. Könnt Ihr, Decimus Antonius Nepos, die Notwendigkeit zur Offenheit verstehen, selbst wenn sie den Ersten Bürger Roms betrifft? Versteht Ihr sie als der Mann, der jenem Bürger die größte Treue schuldig ist?«
Nach einer kunstvollen Pause antwortete Nepos: »Ich glaube, dass ich es kann.«
»Sehr gut. Bevor wir darauf eingehen, was sich zu Augusta Treverorum ereignet hat, würde ich gern gewisse Tatsachen feststellen, die sich für diesen Fall als bedeutsam erweisen könnten. Zunächst Eure Verwandtschaft mit Germanicus Julius Agricola. Seid Ihr Mitglied der Julischen Gens?«
»Ich bin kein Blutsverwandter Caesars, hoher Pontifex.«
»Aber Ihr seid verwandt mit Claudia Nero, der Mutter des jungen Quintus Agricola, dem Adoptivsohn des Caesar?«
»Das stimmt.«
»Wäret Ihr der Ansicht, dass dieser Umstand bei Eurer Ernennung zum Präfekten der Prätorianer eine Rolle gespielt hätte?«
Nepos’ Augen blitzten zornig auf, aber er fasste sich rasch. »Nein – aus zweierlei Gründen«, fuhr er gleichmütig fort. »Erstens war meine Cousine Claudia Antonia mit dem verstorbenen Gaius Nero verheiratet, dessen Verrat der schlimmste an Rom seit dem des Coriolanus war. Allein aus diesem Grund hätte Caesar einen anderen benennen können. Was er jedoch nicht tat. Und dies verleiht meinem zweiten Argument Glaubwürdigkeit – dass Caesar nicht auf meine Abstammung sah, sondern auf meinen Mut während der Belagerung der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán im letzten Jahre. Man sagt, dass es in der Zehnten Legion an jenem letzten Tag keinen Tapfereren als Decimus Antonius Nepos gegeben hätte.« Er lächelte, als ob ihm zu Bewusstsein gekommen wäre, dass er die Grenzen der Schicklichkeit überschritten hätte. »Ihr müsst mir meine unbescheidenen Worte vergeben, aber darin liegt eine größere Tugend als die Demut. Denn den Ruhm zu leugnen heißt die Güte zu leugnen. Und ich kann meiner eigenen Güte nicht blinder gegenüberstehen als der Güte Caesars... oder der Roms.«
Diese Bemerkung fand lautstarke Zustimmung – die, dessen war der Prätorianerpräfekt sicher, eher Nepos als Germanicus galt. In letzter Zeit hielt man in vielen Kreisen Caesars natürliche Bescheidenheit für eine lügnerische Pose.
»Nun gut«, sagte der Pontifex. »Wenden wir uns jenem letzten Tag vor Tenochtitlán zu – wurde Caesar verwundet?«
»Ja, und zwar schwer.«
»Und die Art dieser Verletzungen?«
Nepos zögerte und machte wieder ein unbehagliches Gesicht. »Nun, seine Beine waren gebrochen...«
»Und war er nicht auch einige Tage lang wechselweise ohne Bewusstsein oder im Wahn?«
Nepos presste die Lippen zusammen und nickte schließlich.
»Und war nicht Caesars Leibarzt, der Grieche Epizelus, der Meinung, dass die Kopfverletzung, die er vor Tenochtitlán erlitt, eine ältere wieder entzündet hätte, die Caesar während des Anatolischen Aufstandes davongetragen hatte?«
»Von dieser Prognose wusste ich nichts. Zu jener Zeit hatte ich alle Hände voll mit aztekischen Adlerrittern zu tun.«
»Euch war aber ein Bericht bekannt, der besagt, dass Germanicus Agricola, der damalige Procurator Anatoliens, sich mehrere Tage lang mit dem Geist des vergöttlichten Gaius Julius Caesar unterhielt?«
Nepos ließ sein Schweigen für ihn sprechen.
»Lasst uns dann zu jüngeren Ereignissen kommen«, sagte der Pontifex brüsk. »Welche Geschäfte führten den Imperator nach Augusta Treverorum – sofern Ihr Euch frei darüber äußern könnt?«
»Ja, das kann ich. Es geht um die bevorstehende Übertragung der Provinz aus der kaiserlichen Kontrolle in die Obhut des Senats...« Diese Bemerkung reichte aus, um bei einigen Senatoren finstere Mienen hervorzurufen. Caesars Vorhaben mochte den Senatoren zwar weitere Machtbefugnisse einbringen, stellte jedoch beinahe sicher, dass sich ihr Träger und bequemer Status quo seinem Ende zuneigte. Wie Nepos jedoch nur zu gut wusste, war es aber auch ein ungleich wichtiger Hinweis auf etwas noch Unbekanntes in der zukünftigen Gestaltung des imperialen Behördenapparats, auf dem ihrer aller Sicherheit und Wohlstand beruhte.
»Und welchen Grund gab Caesar an, den Heliostempel aufzusuchen?«
»Vor langer Zeit brachte sein Vater nach einem Sieg über die Germanen ein Dankesopfer dar. Ich stand unter dem Eindruck, dass Caesar diesen Tag erneut zu durchleben gedachte.«
»Also betratet Ihr und der Imperator gemeinsam das Sanktuarium...«
»Nein, hoher Pontifex. Caesar befahl seiner Wache, vor dem Tempel zu bleiben. Er betrat ihn allein.«
»Aber was war mit seinem germanischen Legionär, der bekanntermaßen niemals von seiner Seite weicht?«
»Der Zenturio Rolf blieb bei uns im Hof.«
»Ich verstehe... ich verstehe...« Der Pontifex klopfte sich mit einem Knöchel auf die Unterlippe. »Wie würdet Ihr Caesars Stimmung an jenem Tag beschreiben?«
»Nicht ganz bei der Sache, würde ich sagen. Es gab vieles, was seinen Geist nach der Rückkehr von seinem Feldzug gegen die Azteken beschäftigt hielt.«
»Und wie war seine Stimmung, als er das Sanktuarium wieder verließ?«
Nepos seufzte. »Erschüttert. Ich denke, mir fällt kein besserer Ausdruck ein.«
»War er blass?«
»Totenblass.«
»Sprach er zusammenhängend?«
»Ja, aber rasch und atemlos. Ich bekam nicht alles mit, was er sagte.«
»Aber das, was Ihr mitbekamt, Präfekt – sagt es uns bitte.«
Nepos warf einen Blick zur Dachöffnung empor. Dann folgte er dem Lichtstrahl, der sich auf den Glatzen der Senatoren spiegelte. »Er sagte, dass er vor der Bronzefigur des Helios gebetet hätte, als sie plötzlich zum Leben erwacht sei...« Er hielt inne; in der Curia war es so still, dass er das Geräusch von Sandalen auf dem Forum Romanum außerhalb des Raumes zu hören vermochte. »Und als Caesar sich umwandte, um zu fliehen, stand Victoria vor ihm. Sie hielt einen Lorbeerkranz in der Hand, den sie ihm versprach, wenn er auf immer den Purpur ablegen würde...« Die erschreckten Keuchlaute und das folgende Gemurmel machten es Nepos schwer, nicht zu lächeln. Dieses Zeugnis des Unbehagens unter den alten Männern entsprach seinen Erwartungen.
Der Pontifex Maximus begegnete seinem Blick und hielt ihm stand. Gerade wollte er eine weitere Frage stellen, da kam in eben diesem Augenblick ein Prätorianeroberst hereingestürmt und schrie: »Der Vesuvius ist ausgebrochen!«
Wie auf ein Kommando rafften die Senatoren die Säume ihrer Togen und humpelten nach draußen, wo sie gen Süden auf die riesige braune Wolke starrten, die auf Rom zutrieb.
Der Präfekt und der Pontifex blieben jedoch in der Curia zurück.
Sie hatten schon seit über einer Stunde von dem Ausbruch gewusst – jedoch nicht den Wunsch gehegt, den anderen die Überraschung zu verderben. Oft dreht sich die Welt um Überraschungen.
II.
Er schritt durch Flure, die weder Fenster noch Atrium aufwiesen. Hier und da brannte eine Öllampe an einer feuchten Mauer im lichtlosen Herz des Palatins. Man hatte ihm gesagt, dass draußen die ersten Ascheflocken des Vesuvius den nachmittäglichen Himmel Roms zu trüben begannen. Vielleicht ein Vorzeichen. Dennoch fühlte er sich an Körper und Geist zu sehr erschöpft, um sich von Omen sonderlich beunruhigen zu lassen.
Er war ein untersetzter Mann, der bei der letzten Schlacht um Tenochtitlán eine Beinverletzung davongetragen hatte und nun leicht hinkte. Er eilte von Tür zu Tür, rüttelte an Schlössern, und fragte die gelangweilten Prätorianer, die er in den Vestibülen zwischen den verschiedenen Räumen seines Hauses antraf: »Habt ihr das Kind gesehen, Männer? Wo ist der junge Quintus jetzt?«
Niemand schien es zu wissen.
Kurz vor der achten Tagesstunde, als der Geruch von Rauch und Asche durch den Palast zu wehen begann, gab er den Versuch auf, seinen Adoptivsohn durch Umherwandern zu finden, und verlegte sich stattdessen auf die alte latinische Schläue. Er erinnerte sich an einen Rauchabzug aus den Forschungsjahren seiner Jugendzeit in diesem altehrwürdigen Haus seiner Gens, bückte sich und kletterte in das nun sommerkühle Heizrohr, das unter den prunkvollen Gemächern der Witwe Claudia Nero verlief, deren Wände und Säulen zweifellos ohne Ausnahme mit Erotica verziert waren. Er gelangte schließlich in den Heizraum eines kleinen Bades, das einst der Befriedigung der niederen Gelüste des verstorbenen Imperators Fabius gedient hatte.
Immerhin hatte Claudia ihre Umgebung nach traditionellen Gesichtspunkten erwählt, wenngleich die Tradition auch perverser Art war – und diese vergoldete Halle bewies es sehr deutlich.
Der hinkende Mann benutzte seine starken Arme, um ein Eisengitter aus einer rostigen Verankerung zu lösen. Dann kroch er unter einigem Grunzen und Stöhnen durch diese Öffnung in das Tepidarium, nur um dort von einem reichlich verdatterten Wächter angerufen zu werden: »Caesar Germanicus?«
»Onkel!«, krächzte Quintus aus der lauwarmen Wanne heraus; er war noch nicht so recht vertraut mit der Tatsache, dass er der einzige Erbe des Kaisers war, der Imperator Designatus, wie die meisten ihn bezeichneten – eine Zurschaustellung der Unschuld, die Germanicus schier das Herz zerriss. »Bade mit mir!«
»Gleich, mein Junge.« Germanicus wandte sich dem Prätorianer zu: »Du beziehst im Frigidarium Posten!«
»Aber Caesar, die Erbwitwe hat angeordnet...«
»Es gibt keine Erbwitwe auf dem Palatin. Die Erb... was!«
»Aber ich habe meine...«
»Anweisungen von mir! Und solltest du zu irgendjemandem ein Wort darüber verlieren, schlage ich dich höchstpersönlich zu Boden! Verstanden?«
Der Mann salutierte und zog sich zurück. Für einen freien Bürger gab es keine größere Schande, als geschlagen zu werden – einer Ohrfeige wurde selbst ein Schwertstreich vorgezogen. Zu anderen, besseren Zeiten hätte Germanicus eine derart heftige Beleidigung bedauert. Aber die Zeiten waren nicht gut.
Er ließ seine einfache Stofftunika auf die Kacheln gleiten und stieg nackt in die große Wanne. Gebannt starrte der Knabe auf die Narben des älteren Mannes. Einige waren im Laufe der Jahre verblasst, andere wiesen noch frischen Schmerzenspurpur auf. Mit gleicher Faszination betrachtete Germanicus die reine glatte Haut des Jungen. War auch die seine je so makellos gewesen? Korrumpierte der missgünstige menschliche Geist schließlich auch den Körper selbst?
»Fühlst du dich unwohl, mein Kind?«
»Nein, Onkel.«
Also war es eine weitere Lüge Claudias gewesen, als sie das Gegenteil behauptet hatte, aber Germanicus erwähnte es nicht. »Ich habe dich vermisst, Quintus.«
»Und ich dich, Caesar. Mutter sagte, du wärst...« Der klare Blick trübte sich auf der Suche nach einem passenden Wort, »leidend gewesen.«
Germanicus formte mit der Hand eine Schale und goss sich Wasser über eine Schulter, die vor Jahrzehnten von einem anatolischen Bogenschützen getroffen und nun mit einer kraterförmigen Narbe geziert war.
»Bist du krank gewesen?«, fragte der Knabe in aller Unschuld weiter.
»Ich denke schon...«
»Was war es?«
Germanicus versuchte, nicht allzu bitter zu klingen; allerdings verdiente sein Sohn die Wahrheit über seine innersten Gefühle zu erfahren. »Ich leide an jener Krankheit, die daher rührt, dass man sieht, wie die Mühen eines Lebens den Gestank der Vergeblichkeit anzunehmen beginnen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Das wirst du noch früh genug verstehen. Früher oder später passiert es allen, den Mächtigen wie auch den Machtlosen – wir alle kennen diese Krankheit. Manche sagen, dass die Götter uns damit anstecken.«
»Warum?«
»Um uns auf den Tod vorzubereiten.« Dann lächelte er traurig und streichelte dem Kind über das nasse strohfarbene Haar. Angesichts seines Vorhabens war es Wahnsinn gewesen, Quintus zu adoptieren; allerdings gab es wenige Möglichkeiten für einen römischen Kaiser, seine Liebe zu einem Menschen zu manifestieren. Die Bürger des Imperiums verlangten von Caesar Wohlstand und Sicherheit, keine Liebe. Und die Liebe, die sie ihm vorheuchelten, war so hohl wie Schilf und so brackig wie ein stehender Tümpel.
Unausweichlich war in der Adoption ein politisches wie auch privates Motiv verborgen gewesen: Germanicus wollte damit öffentlich zum Ausdruck bringen, dass die Heimtücke von Quintus’ totem Vater Gaius Nero im Bunde mit den Azteken keine Gefahr für die Sicherheit seiner Familie und Klientel bedeutete, wie es in der Vergangenheit bei verurteilten Verrätern allzu häufig der Fall gewesen war.
Allerdings hatte Claudia Nero – die schlaue Hurenwitwe des Gaius – in der Adoption mehr gesehen als die Hingabe des einsamen Germanicus an ein Kind, das so sehr seinem eigenen Sohn ähnelte, den er im Krieg verloren hatte. Für sie war es nur logisch, dass Caesars Adoption ihres Sohnes unausweichlich dazu führen würde, dass sie Kaiserin wurde. Und da sie keine Frau war, die den Dingen ihren eigenen Lauf ließ, hatte sie sich eine lauschige Vollmondnacht erwählt (in der die Arterien eines Mannes dem Vernehmen nach vor Leidenschaft überschäumten), um sich in Germanicus’ Gemächer zu stehlen und ihn auf seinem feldmäßigen Lager zu erwarten. Ihr Fleisch schimmerte unter Salben, und ihr gefärbtes Blondhaar fiel ihr um die Schultern. Aber Germanicus Agricola hatte es sich nicht zur Gewohnheit gemacht, die Witwen seiner toten Adoptivneffen zu beglücken – was er ihr auch in aller Ruhe verdeutlicht hatte.
Nach jener scheußlichen Nacht begann sie Quintus von seinen täglichen Übungsstunden mit Germanicus fernzuhalten. Quintus fühlt sich nicht wohl, ließ sie immer wieder verlauten. Germanicus hatte lange genug auf dem Palatin gelebt, um zu erkennen, dass Claudias Zorn darüber hinausgehen mochte, ihm den Jungen nur zu entziehen. Schon nannte sie sich ja selbst Erbwitwe – übrigens zu Unrecht, weil auch der Anspruch auf den Purpur, den Gaius Nero einst erhoben hatte, unrechtmäßig gewesen war.
Beunruhigender jedoch als jede Bedrohung, die Claudia gegen ihn zusammenzubrauen vermochte, war ein Gerücht, das besagte, dass die Erste Prätorianerkohorte, jene Truppe, die momentan für die Sicherheit seiner Person verantwortlich war, kurz vor der Meuterei stand.
Zur Mittagszeit hatte Germanicus seinen persönlichen Leibwächter, Zenturio Rolf, zu den Castra Praetoria gesandt, um zu erkunden, ob dieses Gerücht der Wahrheit entsprach. Wie gewöhnlich hatte der Germane ob der Aussicht, von Caesars Seite weichen zu müssen, gemurrt, sich letztendlich aber seinen Befehlen gefügt.
»Bist du müde, Onkel?«, fragte Quintus jetzt in einem Anflug von Frühreife.
»Ja, mein Junge. Sehr müde.«
»Warum bist du denn in letzter Zeit immer so müde?«
Germanicus antwortete nicht sofort, sondern formulierte die Worte sorgfältig vor, bevor er sie aussprach. Dieses Kind, das jetzt gerade die Handflächen zusammenpresste, um Wasserstrahlen durch das Becken zu schleudern, mochte sein einziger Verteidiger in einer Zukunft sein, die erweisen konnte, dass es sinnlos gewesen war, den Bürgerkrieg riskiert zu haben, um die Republik wiederherzustellen. »Im Laufe der Jahrhunderte«, sagte er schließlich, »haben die Römer etwas sehr Törichtes getan...«
»Wie können wahre Römer denn töricht sein, Onkel?«
Er lächelte wieder. »Oh, das können sie sehr gut, das kannst du mir glauben. Doch was auch immer der Grund sein mag, nun, wir Römer widmeten all unsere Kraft und Fähigkeiten immer nur einem einzigen Mann. Und diesem Mann kommt es häufig so vor, dass sich seine Untertanen in dem Augenblick, da er ihnen den Rücken zukehrt, auf der Stelle in Stein verwandeln.«
Quintus sah ihn aufmerksam an. Diese Worte beunruhigten ihn, denn seine Augen glichen jetzt denen seiner Mutter. »Ist dieser Mann der Imperator, Onkel?«
»Was glaubst du?«
»Ich glaube schon.« Er wischte sich mit dem Arm über das schweißüberströmte Gesicht. »Sollten wir also keinen Imperator haben?«
Eine Frage, die an sich schlicht und harmlos war – dennoch eine, die den Frieden und den Wohlstand der halben Welt zu zerstören vermochte. Germanicus hatte ob dieser Frage seit Monaten keinen ruhigen Schlaf mehr gehabt.
»Vor langer Zeit«, fuhr er mit schulmeisterlichem Tonfall fort, »in jenen guten tapferen Tagen, als wir Römer unseren letzten König gestürzt hatten, da glaubte man, dass Männer von gutem Charakter und Erziehung sich zu gleichen Teilen jene Bürde teilen sollten, die wir dieser Tage einem einzigen Mann zumuten...« Und die Liebe zur Republik in den Herzen der modernen Römer neu zu entfachen, war ungefähr so einfach, wie die Ägypter von heute davon zu überzeugen, sich wieder dem Pyramidenbau zu widmen.
»Bist du ein Republikaner, Onkel?«
Gütiger Jupiter – hatte Claudia ihn darauf gebracht?
»Ich bin ein schrulliger alter Mann von dreiundfünfzig Sommern, den der Gedanke wütend macht, dass du seit unserer letzten Sitzung keinen Codex mehr angerührt hast!«
»Das ist nicht wahr. Mit Dio Cassius bin ich durch – wie Caesar es befohlen hat.«
Germanicus’ Augen wurden sanfter. »Danke, Quintus. Caesar entschuldigt sich. Du weißt nicht, was ihm das bedeutet. Besonders jetzt... besonders jetzt.« Darauf erhob er sich triefend aus dem Becken und legte seine Tunika an, die ihm am Körper klebte. »Bist du eines Geheimnisses würdig?«
»Ja, natürlich!«
»Es ist aber ein schreckliches Geheimnis.«
»Umso besser, Onkel!«
Germanicus senkte die Stimme: »Sollte dich eines Tages ein Fremder aufsuchen, der dir folgendes sagt: Sohn, rege dich, rufe den Zephyr, nimm deine Flügel und gleite – dann musst du mit diesem Mann gehen. Du musst selbst gegen den Wunsch deiner Mutter mit ihm gehen. Versprichst du mir das?«
Einige Augenblicke lang zeigte Quintus’ Gesicht eine nahezu schmerzliche Ernsthaftigkeit. »Jawohl, Caesar.«
Germanicus nickte. »Und für den Preis einer Sesterze – woher stammt dieses Zitat?«
»Aus der Aeneis.«
»Sehr gut.« Dann fiel Germanicus auf einmal ein, dass er keine Münzen bei sich trug. Quintus schien jedoch mit anderen Dingen als Sesterzen beschäftigt zu sein.
»Onkel...«
»Ja?«
»Hast du wirklich Helios und Victoria gesehen?«
Germanicus berührte seine Stirn, als ob er plötzlich Schmerzen hätte. »Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Die Sonne brannte sehr heiß und hell an jenem Tag. Und häufig sieht ein Mann das, was er sehen muss, um weitermachen zu können. Für heute lebwohl – und sage nichts von dieser Begegnung.«
»Das verspreche ich, Onkel.«
Auf halbem Wege zwischen dem Castra Praetoria und den Diokletianischen Bädern befand sich in einer Seitengasse, die so schmal war, dass man nur Handkarren hindurchschieben konnte, ein Weinladen namens Der Rote Umhang. Er unterschied sich von allen anderen Weinläden in der Stadt dadurch, dass seine Tische zu keiner Zeit von Tiberschiffern, entlaufenen Sklaven und dem üblichen Provinzgesocks heimgesucht wurde. Der Rote Umhang rühmte sich einer ausgesuchten Kundschaft. Er war der bevorzugte Aufenthaltsort von Prätorianern, die dienstfrei hatten.
Allerdings traf der große und kräftig gebaute Germane im groben Wollüberwurf, der aus dem leichten Ascheregen die Kneipe betrat, nur eine Handvoll Gardisten an.
Mürrisch sahen sie von ihren Bechern auf, doch es genügte ein Blick, um die kriegerische Haltung des Germanen zu erkennen – wenn die Anwesenden nicht sogar die kaum wahrnehmbare Ausbeulung eines Kurzschwertes unter dem zivilen Reisemantel des Ankömmlings bemerkten. Nachdem sie zufrieden festgestellt hatten, dass niemand von niederem Stand in die stille Schummrigkeit des Roten Umhangs eingedrungen war, wandten sie sich erneut dem umständlichen römischen Ritual zu, Wein mit der maximal achtfachen Menge Wasser zu vermischen. Nur ein Barbar würde den Wein unverdünnt zu sich nehmen, ein Barbar wie der Germane, der jetzt an einer vernarbten Tischbank Platz nahm, wobei er mit dem breiten Rücken zur Wand saß und seinen Blick auf den gezackten Rundbögen geheftet hielt, die sich zur Straße hin öffneten.
Während er auf eine Erfrischung wartete, strich er sich über den blonden Schnurrbart. Dann stellte er einige Berechnungen an, die die Mannschaftsstärke der neun Prätorianerkohorten betrafen, die in der Stadt stationiert waren: Eine Kohorte diente wie stets auf dem Palatin. Eintausend Mann, die mit ihren nagelbeschlagenen Sandalen die kostbaren und kunstvollen Mosaike zerkratzten.
Fünf Kohorten wurden in ihrer steinernen Festung in ständiger Bereitschaft gehalten, jederzeit auf dem Sprung, vom Viminal zum Esquilin zu stürmen, um das Leben des Imperators zu schützen.
Somit blieben drei Kohorten zur freien Verwendung übrig, die sich entweder in ihren Baracken oder in den Weinläden und den Bordellen der näheren Umgebung aufhalten mussten. Dennoch hatte der Germane bereits herausgefunden, dass die dreitausend Gardisten sich nicht in den Baracken aufhielten, und jetzt schien es offenkundig zu sein, dass man sie auch nicht in allzu großer Zahl außerhalb der Castra Prätoria antreffen würde.
Wenn sich auf dem Meer ein Sturm zusammenbraute, beobachtete man den Horizont. Was Stürme innerhalb Roms anging, so tat man gut daran, ein Auge auf der Prätorianergarde zu haben. Irgendetwas stimmte nicht!
Der Besitzer des Roten Umhangs bemerkte jetzt den neuen Gast und humpelte mit einer Weinkaraffe und zwei kleinen Schalen an den Tisch heran. Ebenso wie der Germane war er ein langschädeliger Mann mit rotblonden Haaren und Sommersprossen, die von seinen Dienstjahren unter der sengenden Sonne des Mare Nostrum herrührten. Er knallte die Schalen unsanft auf den Tisch, nahm Platz und schenkte ihnen beiden ein. Nicht nur, dass er davon absah, das Getränk wie dieses zimperliche Halbinselvolk mit Wasser zu verschneiden – er verzichtete von vornherein auf Wein und trank stattdessen Met, ein stärkeres Gebräu aus Honig und Malz. »Scheißen also auch für den alten Mann, eh?«
»Ich scheißen für keinen Mann«, knurrte der Germane am Tisch zurück.
»Nicht einmal für dich selbst? Dann sein es das, warum du so mürrisch, Rolf von den hirnlosen Marcomanni.«
Rolf lächelte leicht. »Genug dieser feinen Cherusci-Begrüßung. Ich haben Durst.«
»Das sein nichts Neues.«
Sie tranken, dann schenkte der Wirt nach. Diese Runde kosteten sie in einer Geschwindigkeit aus, die auch für die durstigen römischen Kehlen immer noch barbarisch gewesen wäre. Wie auch Rolf, der den Dienst in der Garde für einen Legionärsposten aufgegeben hatte, um näher bei seinem sterbenden Vater zu sein, war auch der Wirt früher Prätorianer gewesen – bis ihm ein parthischer Krieger eine Lanze durch die Hüften gerammt hatte. Als unruhige junge Männer, die frisch aus den Wäldern Germaniens gekommen waren, hatten die beiden gemeinsam dem Imperator Fabius in einer ihm fremden Welt gedient, an die sie sich jetzt in einem Augenblick stiller Sehnsucht erinnerten.
»Auf Caesar Germanicus«, sagte Rolf und hob seine Schale.
»Aye, auf den guten Germanicus«, erwiderte der Wirt, ohne zu zögern.
Rolfs Augen verengten sich. »Auf die Gesundheit des Präfekten Nepos.«
Der Wirt zögerte einige Sekunden, dann sagte er gleichmütig: »Aye, auch auf den Präfekten.«
Und daraus zog Rolf die Erkenntnis, dass der Wirt keine besondere Zuneigung für Decimus Antonius Nepos hegte, dass er ihn vermutlich als unwürdigen Emporkömmling in der Bruderschaft des Roten Umhangs betrachtete.
Beide verfielen in düsteres Schweigen und tranken.
Rolf war versucht, sich für seine nächsten Fragen der gotischen Sprache zu bedienen. Jedoch war er Marcomanne und der Wirt ein Cheruscer, und die Mundarten der beiden Stämme waren einander zu unähnlich, um in einer so schwierigen – und explosiven Angelegenheit wie dieser das Latein ersetzen zu können. Zudem erweckte gotisches Geflüster bei den meisten Römern immer noch Furcht, die schon beim kleinsten Anzeichen einen Aufstand der langschädeligen Stämme vermuteten, obgleich die meisten Germanen seit beinahe zweitausend Jahren schon einigermaßen romanisiert waren.
Rolf wies mit dem Kinn auf die leeren Tische. »Schlechtes Geschäft, aye?«
»Seit gestern Abend... aye.«
»Vielleicht wegen Vesuvius?«
»Nee, sie trinken sogar mehr, wenn Vulcan pustet. Liegt nicht am Vesuvius.«
»An der Disziplin? Bleiben die Jungs in den Baracken?«
»Nee, nee...« Der Wirt schenkte erneut nach. »Drei Kohorten sein letzte Nacht nach Etrurien auf gebrochen.«
»Etrurien?«, wiederholte Rolf verwirrt. »Wo sein denn dort ihre Garnison?«
»Keine Garnison. Feldlager, soweit ich hören – die armen Schweine kämpfen mit den Grillen um Schlaf.«
»Welchen Kohorten sein dieses Glück zuteil?«
Der Wirt nannte sie ihm. Und wenn Rolf in diesem Augenblick hätte wetten müssen, welche drei der neun Kohorten Caesar am ergebensten waren, dann hätte er jene genannt, die von ihrem Präfekten in die Landstriche nördlich von Rom geschickt worden waren.
Offensichtlich roch auch der Wirt, dass hier etwas faul war, obgleich seine Miene sich nicht veränderte. »Ich hören, dass die hirnlosen Marcomanni sich zur Versammlung treffen.«
Rolf zuckte die Achseln. »Aye, früher als üblich.«
»Du werden auch gehen?«
»Nee, ich haben hier zu tun.«
Die Augen des Wirtes bohrten sich hart in die seines Gegenübers. »Wie lange noch bis zum Ruhestand?«
»Für mich?«
»Aye, für Caesars eigenen Leibwächter.«
Rolf antwortete nicht.
»Kehre heim in den Wald, Rolf von den Marcomanni. Eile dich, und geh heim.« Der Wirt stand auf und widmete sich anderen Gästen, obwohl sie ihn noch gar nicht gerufen hatten.
Zur zehnten Stunde lag Rom unter einer bronzefarbenen Decke. Sie war die gesamte Strecke vom Vesuvius bis zum Tiber von einem Südwind herbeigetragen worden, der während der letzten Minuten plötzlich erstorben war und dicke Aschenvorhänge durch die lastende Stille wehen ließ. Die Millionen Einwohner Roms hatten sich in ihre Anwesen und Mietshäuser zurückgezogen. Läden waren dicht verrammelt, die Fensterverkleidung heruntergelassen worden, und die ungewohnte Leere der Straßen wurde nur von den sich aus dem Pflaster erhebenden Schrittsteinen an den Kreuzungen durchbrochen, die durch die runden, darauf abgelagerten Aschehaufen wie riesige Pilze aussahen.
Es schien, dass nur ein Gebäude in ganz Rom ein geöffnetes Deckenfenster aufwies. Unter diesem Fenster entspannte sich Antonius Nepos mit seiner Cousine ersten Grades im Bett, der selbsternannten Erbwitwe Claudia Nero.
Sie waren beide vom Liebesspiel erschöpft. Allerdings beobachtete Antonius Nepos mit müden Augen Vesuvius’ glitzernd hinabsinkenden Staub, als ob dies das für ihn denkbar beste Omen bedeutete. Er wischte die graue Asche nicht ab, die sich auf Stirn, Kinn und Wangenknochen gesammelt hatte. »Welche Stunde ist es?«, fragte er, ohne auch nur einen Augenblick den Blick vom grauen Himmel loszureißen.
Sie erhob sich halb und spähte hinüber zur alten Wasseruhr auf der anderen Seite des Raumes. Ihre schweren Brüste bebten, als sie sich wieder niederließ. »Kurz nach der zehnten.«
»Gut. Dein Sohn ist mittlerweile aus dem Palast heraus. In einer Stunde wird der Gegenstand deiner zukünftigen Regentschaft sicher in der Garnison zu Fidenae verborgen sein.« Er seufzte. »Ich dürste nach Nachricht aus dem Süden. Marschieren die Hundesöhne endlich? Der Dritten Augusta habe ich nie getraut. Wenn man mir allerdings die Siebte Geminia gäbe, dann...«
»Ich wünsche mir so sehr, dass Quintus in meiner Sänfte hätte mitkommen können. Die Vorhänge waren zugezogen...«
»Nein, das war einfach nicht möglich. Der alte Republikaner-Bastard hat all seine Fühler ausgestreckt. Ein einziges Gefahrenzeichen, und er wird versuchen, die Garde um sich zu versammeln.«
»Was würde ihm das schon nützen?« Eine juwelengeschmückte Hand löste sich von seiner nackten Brust und strich ihm sanft die Asche aus dem Gesicht. »Die Garde steht zu dir.«
Er lachte so verächtlich, wie er es wagen konnte – noch brauchte er sie. »Ein Teil davon steht zu mir. Und ein Mann in meiner Lage ist sich selten sicher, welcher Teil zu ihm steht. Es ist schon kühn genug, auch nur daran zu denken, Caesar zu töten. Ich sehe keine Veranlassung zur Tollkühnheit.« Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Ascheregen zu, und Zufriedenheit spiegelte sich auf seinem Gesicht. »Seine Welt geht in Rauch auf. Das bedeutet es in Wirklichkeit. Sein Imperium löst sich auf...«
Für die Damast-Decke war es zu warm, und er trat sie herunter, sodass sie sich um seine Knöchel kräuselte. Als Claudia, die offenbar fror wie eine Natter bei kühlem Wetter, hinabgriff, um sie wieder über ihren Leib zu ziehen, ließ sein wütender Blick sie innehalten. »Schon als Kind warst du kalt wie eine Schlange.«
»Tatsächlich?«
»Ja, aber ich hoffe, du bist nicht beleidigt.«
»Oh nein.« Mit plötzlich undurchdringlichem Gesicht begann sie seine Brust zu streicheln, packte dann jedoch eine Handvoll Haare und riss daran, so fest sie konnte. Sie öffnete die Finger und beobachtete, wie das dunkelbraune Büschel Brusthaar auf das Laken rieselte.
Er schlug sie. Sie reagierte darauf mit einem frechen Grinsen.
Dann jedoch entzündete sich seine Leidenschaft, und er küsste sie. Und sie erwiderte seine Glut, als ob kein Zorn zwischen ihnen gestanden hätte.
»Sage mir...«
Ihr Atem strich kalt über seine Wange. »Was, mein Liebling?«
»In aller Offenheit: Hättest du dich von dem alten Bastard anrühren lassen können?«
Sie zog sich einige Zoll von ihm zurück und schwieg.
»Hättest du um diesen Preis seine Kaiserin werden können?«
Wieder dieses freche, aber kindisch triumphierende Grinsen. »Er verfügt über eine Virilität, die mich anzieht.«
»Gütiger Mars, er ist alt genug, um dein Vater zu sein.«
»Ich liebte meinen Vater«, sagte sie ein wenig doppeldeutig. Sie strich sich das Haar aus der Stirn und enthüllte durch diese Bewegung die Speckfalten am Oberarm. Ihm missfielen Unvollkommenheiten jedweder Art an einer Frau, und er schaute weg. »Zudem kann eins nicht geleugnet werden – Germanicus ist von hoher Geburt, von höherer Geburt als sonst jemand unter den Lebenden. Meinst du nicht auch?«
Seine zuversichtliche Miene schwand für einen Augenblick und entblößte einen gewissen Mangel an Selbstsicherheit, die er ansonsten sorgfältig vor der Welt tarnte. Eben dieses innere Nagen war es, das Menschen von niederer Geburt den Pfad des ungezügelten Ehrgeizes einschlagen ließ – ja, selbst hochgeborene Eroberer auf der Suche nach ihrer Bestimmung in fremde Länder ziehen ließ. Er und Claudia hatten sich gegenseitig einer gemeinsamen Vergangenheit überantwortet: Ihr Onkel, sein eigener Vater, hatte lusitanischen Kork nach Rom exportiert – ein Spundkrämer, wie ihn Claudia hämisch bezeichnete; und sein Onkel, ihr Vater, hatte sich eines nur unwesentlich höheren Status erfreut: Er war Steuereintreiber in einem entlegenen Bezirk in der Gegend um Olisipo gewesen.
Nepos begriff, dass sie ihn ermorden lassen würde, sobald es in ihrer Macht lag.
Und wenn da nicht Quintus gewesen wäre, würde er sicherlich versuchen, sie zu ermorden – sie mit eigenen Händen zu erwürgen, wie er es sich manchmal fast genüsslich vorstellte. Aber er brauchte ihren Sohn, um den Purpur zu erlangen. Von allen Männern Roms verdiente er, Decimus Antonius Nepos, die Führung des Imperiums.
Durch strikte Disziplin in seinen persönlichen Gewohnheiten – obgleich Zügellosigkeit weit eher nach seinem Geschmack war – hatte er eine gewisse gesellschaftliche Gewandtheit erlangt, um sich in patrizischen Kreisen sicher und selbstbewusst bewegen zu können. Und durch äußerste Rücksichtslosigkeit in der Schlacht hatte er sich den Ruf der Furchtlosigkeit und Männlichkeit verschafft; niemand bestritt, dass er ein Soldat war, mit dem man rechnen musste. Trotzdem sagte ihm Claudia Nero nun, dass nichts davon zählte, dass er immer noch der Sohn eines Korkhändlers war.
Genau wie es der ruhigen Art ihres Zorns entsprach, hatte sie seinen körperlichen Schlag geistig erwidert. Claudia schlug selten zu. Aber wenn, dann umso heftiger, dann wartete sie stets auf einen Augenblick ungehinderten Vorteils, bevor sie ihre Fänge entblößte.
Doch kannte sie ihn gut, wie er sich selbst zugeben musste. Und er kannte seinerseits sie in gleichem Maße – und mit der gleichen Gefühllosigkeit –, diese beiden Dinge waren für ihn unvermeidlicherweise ein und dasselbe. Denn einen anderen Menschen intim zu kennen bedeutete, ihn zu verabscheuen und ihm zu misstrauen. Dadurch, dass er im Umgang mit anderen an diesem Prinzip eisern festhielt, hatte er für einen Mann, der mitten in der römischen Politik stand, lange Zeit überlebt.
Er war neunundzwanzig Jahre alt.
Nachdem er Puteoli hinter sich gelassen hatte, war Tora zwanzig römische Meilen in Richtung auf das offene Meer geflogen und hielt dann einen nördlichen Kurs parallel zur campanischen Küste, der ihn an den Rand der sich rasch ausbreitenden Aschendecke brachte. Seit er von der Wiese und seinem Prätorianergeleit abgehoben hatte, hatte sich die Farbe der Wolke, die vom Gipfel des Vesuvius ausgespien wurde, von Dunkelgrau zu Schwarz und schließlich zu einem tiefen Umbra gewandelt – Anzeichen, dass frisches Magma an die Oberfläche drängte.
Schließlich zwang ihn eine Nebelbank um die Insel Pontia wieder zum Festland und in die dunstigen Ausläufer der vulkanischen Wolke zurück. Selbst diese geringfügige Dichte schwebender Ascheteilchen ließ seine Augen brennen und versengte ihm die Lungen – jedes Teilchen war wie ein winziger Glassplitter, der mit jedem Zwinkern, jedem Atemzug das Gewebe aufzuschneiden schien.
Er hatte beinahe Tarracina erreicht, als der Motor seines Fluggeräts zu stottern begann. Der Auspuff stank nach Gas, und auch die Veränderung der Treibstoffzufuhr konnte das laute Knattern nicht beenden.
Er lauschte genauer auf das Klappern der Kolben und befürchtete schon, dass sie sich festfressen und sein Fluggerät wie ein trockenes Blatt in einen kreiselnden Sturz zwingen würden.
Rom. Er musste zur Hauptstadt zurück.
An der spröden Höflichkeit des Zenturios, den Antonius Nepos nach Puteoli gesandt hatte, hatte er es bemerkt: In Rom stand irgendetwas kurz vor der Explosion.
Er griff nach oben und zog am Kupferdraht der Lenkung. Als er wieder in Richtung Vesuvius gewendet hatte, sah er, dass die Aschenwolke jetzt eine haubengleiche Form angenommen hatte, die dem Kopf einer Königskobra ähnelte und sich gen Norden über Campanien nach Latium ausbreitete, während die steife südliche Brise sie auf Rom zuschob.
In drei Stunden würde der Himmel über dem Forum Romanum kohlschwarz sein, dessen war er sicher. Aber lange vorher würde ihn die Aschewolke überholen und einen Weiterflug unmöglich machen – wenn er nicht irgendwie die Luftdüsen reinigen und sich rasch auf den Weiterweg machen konnte.
Er huschte über einen Olivenhain und begann auf ein Dinkelfeld niederzugehen, musste jedoch vor einer Spargelreihe, die einen verborgenen Kanal bezeichnete, wieder in die Höhe steigen. Schließlich ging er holperig in einem reifen Winterweizenfeld nieder – der Motor erstarb, bevor er ihn abstellen konnte –, und in der Nähe von einem Dutzend Sklaven, die hinter einem staubspeienden Mähdrescher Stroh zusammenbündelten, kam die Wolkengaleere schließlich ruckartig zum Stehen.
Zuerst zeigten die ledernen Gesichter der Sklaven keine Regung, dann aber verzerrten sie sich vor Furcht. Einige Männer versuchten sich den Anblick der sonderbaren Maschine zu ersparen, indem sie die Hände vor die Augen hielten. Nacheinander begannen sie unbeholfen auf den Windhain zuzulaufen, als wären Dämonen hinter ihnen her.
»Halt!«, schrie Tora. »Im Namen des Imperators!«
Ein Mann, der sich humpelnd fortbewegt hatte, gab seine Bemühungen auf und drehte sich zu dem Nihonier um.
»Wer seid Ihr, Herr?«, fragte er. Vielleicht hielt er Tora und seine Maschine für ein Ungeheuer, das aus dem feurigen Schlund des Vesuvius ausgebrochen war. Sein fliehendes Kinn zitterte, als er sich verneigte. »Habe ich Euch schon einmal ein Opfer dargebracht, Herr?«
»Ich bin kein Gott – nur ein Legionär, im Auftrag Caesars unterwegs. Sag dem Fahrer, dass er seinen Wagen hierherbringen soll!«
»Sofort.«
Währenddessen löste Tora die Luftfilter und überprüfte sie. Wie er erwartet hatte, waren die Seidenmembranen verstopft.
Wo blieb der verdammte Wagen?
Wütend erkannte er wieder einmal, warum Rom, das zahllose Male am Rand des entdeckerischen Durchbruchs gestanden hatte, bis zu seiner Ankunft keine Wolkengaleere erbaut und in die Höhe gebracht hatte. Selbst in seinem Schrecken war der römische Sklave so behäbig wie ein gezähmter Wasserbüffel.
Schließlich tuckerte der Wagen heran, dessen Aufbauten von Sklaven wimmelten, deren Neugier mittlerweile die Furcht überwog.