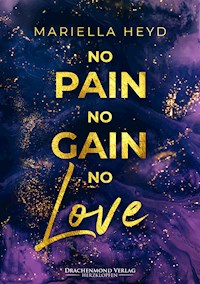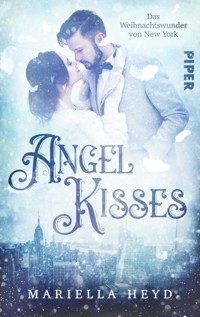4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine anrührende Liebesgeschichte um zwei junge Außenseiter - und die Bewohner eines französischen Altenheims, die den beiden zu ihrem Glück verhelfen wollen Während andere junge Leute Partys feiern, sich verlieben und verloben, ist Philine mit ihrem Dasein als Altenpflegerin in dem französischen Städtchen Rioudieu zwischen Menschen aus einer längst vergangenen Zeit ganz zufrieden. Das einzige, was Philine stört: dass sie sie ständig darauf hinweisen, dass die Zeit rennt. Alle sehen in dem rationalen wie introvertierten Mathematik- und Physikstudenten Tristan, der vor Kurzem in Philines Leben getreten ist, den perfekten Partner für sie. Leider hat dieser völlig andere Ansichten als Philine und außerdem nichts für sie übrig. Gegensätze ziehen sich allerdings an; das muss auch Tristan zugeben. Dummerweise gibt es da ein Geheimnis, das Philine ausgerechnet dann zum Lügen zwingt, als er endlich Vertrauen fasst...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
© 2019 Piper Verlag GmbH, MünchenRedaktion: Julia FeldbaumCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: unter Verwendung von Bildmaterialien von Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Je regrette
Eine Dauerschleife mit Ende
Der geheime Sohn
Sechs Löffel Zucker gegen den Tod
Atos guter Wille
Ein letzter Wunsch
Monsieur Bertrands Schätze
Der Glanz goldener Zeiten
Tatas Getuschel
Wenn der Postbote zweimal klingelt
Ein Nebenjob mit Verantwortung
Gegensätze ziehen sich an
Das Ende eines Sonntagmorgens
Das Wissen des Monsieur Flaubert
Ein Strauß Pfingstrosen
Ein Arzt mit Ficus benjamina
Filou
Eine Perle für jede Frau
Eine Ente voller Erinnerungen
Ménage-à-trois
Späte Reue
Erster Schnee
Wassermolekül
Hebel-Herz-Gesetz
Das Geheimnis von Schneeflocken
Schrödingers Tristans Katze
Ein Moment für die Ewigkeit
Lex Prima
Das dritte Axiom
Liebe in der Fibonacci-Spirale
Silbernes Serotonin
Gewissensbisse
Lilou und bis ans Ende der Welt
Der Tod klopft immer nachts an
Einsteins spezielle Relativitätstheorie
Gib der Zeit Zeit
Die Ausnahme im Kosmos
Das Lomonossow-Lavoisier-Gesetz
Der Goldene Schnitt
Non, je ne regrette rien
Merci
Je regrette
Heute Nacht würde jemand sterben. Auf Philines Gefühl war stets Verlass. Sie war sich sicher, dass es Madame Dupont treffen würde. Die liebenswerte alte Dame wartete schon lange darauf, gehen zu dürfen. Die schönen Dinge des Lebens gehörten für sie der Vergangenheit an, ebenso wie ihre eigene Schönheit. Nun sehnte sie sich danach, den letzten Weg gehen zu dürfen, den schon so viele ihrer Lieben vor ihr gegangen waren. Philine stellten sich bei dem Gedanken daran schon jetzt die Nackenhaare auf. Sie hasste es, im Halbdunkeln ein Zimmer zu betreten und zu lauschen, ob sich darin jemand regte. Es erinnerte sie immer wieder aufs Neue an das erste Mal, dass sie diese unheilvolle Stille wahrgenommen hatte.
Ja, man konnte sie hören. Die Stille, die eintrat, wenn jemand starb, war so quälend leise, dass es in den Ohren sirrte. Vor ihrem inneren Auge beschwor Philine Bilder eines Zimmers herauf, das noch heute leer stand. Sogar der süßlich-faulige Geruch dieses gewissen Sommernachmittags kroch ihr in die Nase, als hätte sie sich soeben zurück in die Vergangenheit katapultiert. Genauso stark machte sich auch das Gefühl der Reue in ihrer Brust breit.
»Hallo? Hörst du zu?« Manon wedelte mit einem Übergabezettel vor Philines Gesicht herum.
»Ja, ich habe es mir notiert. Madame Dupont kann bei Bedarf Schmerzmittel haben.« Wirkstoff, Dosis, Darreichungsform und alles, was sie wissen musste, standen auf dem Papier, das ihre Kollegin ihr gerade entgegenhielt, und zudem nochmals auf dem Medikamentenblatt in der Akte, die für den Fall der Fälle bereits auf dem Mahagonischreibtisch im Dienstzimmer lag.
Manon lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, der unter ihrem Gewicht knarzte, und verschränkte die behaarten Arme vor ihrer Brust. Ihr üppiger Busen wurde dabei so zusammengequetscht, dass Philine sich wunderte, wie Manon die Arme überhaupt überkreuzen konnte. Da die Kollegin insgesamt gedrungen und kurvig war, passte ihre Oberweite jedoch zum Rest des Körpers. Manon schnaubte, wie sie es immer tat, wenn der Fahrstuhl kaputt war und sie die Treppen nehmen musste oder ihr etwas missfiel – so wie jetzt.
»Madame Dupont ist wirklich eine besondere Frau. Es ist schade, dass sie geht. Natürlich ist es besser für sie, aber ich werde sie vermissen. Da kommt bestimmt nichts Besseres nach.« Dass sie geht … In all den Jahren hatte sich diese Redensart im Altenheim eingebürgert. Niemand sprach gern vom Sterben, gerade weil die Zeit für alle gnadenlos ablief. Gehen war angenehmer als sterben, weniger beängstigend. Ein jeder war frei, dort hinzugehen, wo es ihm gefiel. »So, wo waren wir? Ach ja, Madame Laurent im Zimmer nebenan macht einen Zirkus, weil ihr Sohn vergessen hat, Meerwasser-Nasenspray mitzubringen. Stell dich schon mal darauf ein, dass du heute Nacht den Krankenwagen rufen musst, weil sie sich einbildet zu ersticken. Zum Glück habe ich Feierabend. Wie sagt man so schön? Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.«
Philine malte ein großes rotes Ausrufezeichen neben den Namen der Bewohnerin. Madame Laurent war für ihre Allüren bekannt.
»Kleine, ich sage es nur ungern, aber das könnte eine anstrengende Nacht für dich werden. Manchmal frage ich mich, ob die Bewohner drüben in dem noblen Schickimicki-Altenheim auch so kleinlich sind. Da hat doch bestimmt jeder eine Eins-zu-eins-Betreuung und einen Shot Schmerzmittel aufs Haus.«
»Ich glaube, das hat nichts mit dem Heim zu tun oder mit dem Geld, das sie besitzen.« Die Erfahrung hatte Philine gelehrt, dass die Bedeutung von Geld mit zunehmendem Alter an Wert verlor. Das Alter brachte in der Regel Todesfälle und Einbußen mit sich, die sich auch nicht mit schnödem Mammon aufwiegen ließen. Das Leben büßte dadurch für viele, die in früheren Jahren einiges auf Scheine und Münzen gegeben hatten, an Glanz ein.
»Sondern?« Manon nickte Philine auffordernd zu. »Einen Grund muss es für das schlechte Benehmen ja geben. Den Respekt vor dem Alter verliert man jedenfalls, wenn man manche Leutchen hier genauer beobachtet.«
Notorische Unzufriedenheit und Nörgeleien waren in der Tat keine Seltenheit.
Philine fuhr fort: »Die Leute haben in dem Alter doch nichts anderes mehr. Sie haben keinen Beruf mehr und dadurch viel zu viel Zeit, die sie nie nutzen konnten, weil sie ihr Leben lang gebuckelt haben. Mit achtzig stehen sie dann da, sind gebrechlich und können in all den vierundzwanzig Stunden, die ein Tag zu bieten hat, nicht einmal mehr das tun, was ihnen Freude bereitet. Zumindest nicht alles. Die meisten können ja nicht einmal ohne Begleitung das Haus verlassen. Die Tabletten, die Mahlzeiten und wir sind das Einzige, was ihren Tag füllt.«
»Was ist mit all unseren Betreuungsangeboten? Die Leute nehmen sie zum Teil überhaupt nicht in Anspruch.«
»Hättest du Lust, dich jeden Tag zum Backen mit Frauen zu treffen, mit denen du als Jugendliche schon nicht befreundet sein wolltest? Oder nimm Monsieur Biot. Er sammelt Briefmarken und Münzen. Niemand außer ihm hat dieses Hobby. Mit wem soll er sich darüber austauschen? Unser Angebot ist wie ein Pauschalreise: Man denkt, man bekommt für sein Geld alles, was man braucht, und stellt dann auf halber Strecke fest, dass es nicht das ist, wonach man gesucht, was man sich vorgestellt hat.«
»Du bist zu gut für diesen Job.« Manon schüttelte lachend den Kopf. »Dein Verständnis ist schier grenzenlos. Manchmal glaube ich, in dir steckt eine alte Seele. Du verstehst unsere Leutchen ja besser als die sich selbst. Du weißt genauer als die Angehörigen, was die Bewohner mögen und was nicht.«
»Das glaube ich nicht. Ich versetze mich nur in die Lage unserer Bewohner.« Entgegen ihrer Aussage hatte sie auch ab und zu den Eindruck, dass das Altenheim eine vorzeitig alternde Seele aus ihr gemacht hatte, aber wer, der gerade einmal vierundzwanzig Jahre alt war, würde das schon zugeben wollen?
»Genau das meine ich. Du bist zu gut. Du zerbrichst dir deinen hübschen Kopf über alles und jeden hier. Wahrscheinlich denkst du auch zu Hause noch darüber nach, ob du alles erledigt und nichts vergessen hast.«
Philine kniff die Lippen zusammen und schwieg ertappt. Schon oft hatte sie nach der Arbeit noch mal im Wohnbereich angerufen, um sicherzugehen, dass sie alle Medikamentenänderungen richtig weitergegeben hatte. Quittiert wurden solche Nachfragen in der Regel mit einem Schnaufen, weil sie bisher noch nie etwas vergessen oder falsch dokumentiert hatte, oder mit einem Lachen, weil das nun mal Philine war, wie man sie kannte und mochte.
»Wie dem auch sei, Kleine. Ich mache mich auf den Heimweg. Mein Ex-Mann wartet auf mich.« Sie rollte mit den Augen und stöhnte. »Er nervt. Ich wünschte, er würde endlich komplett aus meinem Leben verschwinden. Monate habe ich ihn nicht gesehen, und plötzlich fällt ihm ein, dass er noch eine Laubsäge in meiner Garage hat. Wahrscheinlich will sein junger Hüpfer, den er nun an seiner Seite hat, einen schönen Garten, damit sie sich ihre ellenlangen Beine im nächsten Sommer bräunen kann. Ich habe die Nase voll von Männern – langsam aber sicher solltest du dir aber einen suchen, bevor du faltig wirst. Glaub mir, die Alten färben ab. Wenn du es merkst, ist es schon zu spät. Am besten nimmst du dir gleich einen, der seine Midlife-Crisis schon hinter sich hat. Dann ist die Gefahr geringer, dass er dich irgendwann für eine Jüngere sitzen lässt.«
Man merkte Manon noch immer an, dass die Trennung ein Schlag ins Gesicht gewesen war. Während sie eine Familie geplant hatte, hatte ihr untreuer Ehemann den Umzug zu seiner Freundin in Angriff genommen, die obendrein weniger Lenze zählte als seine eigene Nichte.
»Du redest Unsinn.« Philine hasste es, wenn Manon in mütterlicher Manier auf das Männerthema zu sprechen kam. Mannthema traf es schon eher, denn auf die Mehrzahl konnte Philine nicht zurückblicken.
»Ein Mann würde dich auf jeden Fall davon abhalten, ständig Überstunden zu machen. Du musst hier endlich mal raus. Du bist viel zu jung, um hier drin zu versauern. Wäre Jules nichts für dich? Er hat heute auch Nachtdienst. Eine super Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.«
»Du machst hoffentlich Witze.«
»Wieso?«
»Sehe ich etwa so verzweifelt aus?«
Manon kniff die Lippen zusammen und schaute nach unten, als würde sie nicht so recht auf diese Frage antworten wollen. »Er ist in deinem Alter, sieht gut aus und ist fleißig.«
»Ich scheine ja echt den Eindruck zu vermitteln, als hätte ich wahnsinnig hohe Ansprüche. Willst du ihn mir gleich noch schmackhaft machen, indem du mir sagst, dass er atmet?«
»Ach, komm schon, Philine.«
»Außerdem hast du vergessen, dass er Gras raucht.«
Manon winkte ab. »Als ich noch jung war, haben wir das alle getan, und keiner hat sich beschwert. Heute nimmt doch jeder Jugendliche mal was, um auszuprobieren, wie ein Trip ist.« Sie hob abwehrend die Hände. »Nicht dass ich das gutheißen würde, aber so ist es eben. Im Fernsehen sieht man das andauernd.«
Ich nicht. Philine hatte so manche Einladung zu Partys erhalten, aber noch nie eine miterlebt. Sie hatte schon als Jugendliche ein anderes Leben geführt als ihre Mitschüler. Feiern? Freunde? Den Tag vertrödeln? Fehlanzeige!
Manon schien zu merken, dass das Gespräch ins Stocken geriet, und sagte: »So, jetzt aber wirklich, ich hau ab.« Sie klopfte auf den Tisch, packte ihre Tupper-Schüsseln vom Mittagessen zusammen und verschwand, bevor noch ein Bewohner auftauchte und nach ihr verlangte. Philine blieb im Dienstzimmer zurück und richtete die Medikamente für die Nacht in Plastikbecherchen.
Jules, pah! Manon ist doch verrückt. Der Gedanke war so absurd, dass Philine nicht einmal wusste, wie Manon überhaupt darauf kommen konnte. Immer wenn er und Philine Nachtdienst hatten, war sie auf sich allein gestellt. Sobald alle Mitarbeiter das Haus verlassen hatten, machte er es sich auf der kleinen Holzbank vor dem Wintergarten bequem und rauchte einen Joint. Wann immer Philine aus einem der zahlreichen Fenster im Flur in den Innenhof mit der verdorrten Weide in der Mitte schaute, sah sie seine Umrisse und einen rot glühenden Punkt. Bei gekipptem Fenster konnte sie sogar den unverwechselbaren Geruch von Marihuana wahrnehmen. Danach lümmelte er sich auf einen Pflegerollstuhl im Lagerraum unter dem Dach und machte ein Nickerchen, bis morgens um halb fünf der letzte Rundgang anstand. In all den Stunden dazwischen rannte Philine von einer Klingel zur nächsten und übernahm all die Aufgaben, die eigentlich zwei Leute erledigen sollten. Als sie ihn einmal zur Rede gestellt hatte, hatte er altklug geantwortet, sie sei die Fachkraft, und die meisten Bewohner seien ohnehin weiblich und würden sich ungern von einem Mann zur Toilette begleiten lassen. Damit hatte er voll ins Schwarze getroffen. Bedarfsmedikamente durfte nur sie verabreichen, und da er der einzige männliche Pfleger war, hatten nur die Frauen von dem Wohnbereich Vertrauen zu ihm aufgebaut, in dem er auch tagsüber arbeitete. Alle anderen schämten sich, ihren faltigen Hintern vor ihm zu entblößen.
Trotzdem war Philine der Meinung, dass er wenigstens bei Positionswechseln der Bewohner helfen, Urinflaschen leeren und die Vorlagen der bettlägerigen Bewohner auswechseln könnte. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, den Laden allein zu schmeißen. Immerhin wusste sie dann sicher, dass alles seine Richtigkeit hatte.
Mit dem ratternden Medikamentenwagen machte sich Philine auf den Weg zum ersten Rundgang. Alle paar Meter trat sie gegen das eiernde Hinterrad, um den Wagen auf Spur zu halten. Die Bewohner waren auf drei Stockwerke verteilt, wobei sich im Dachgeschoss nur eine Handvoll kleiner Wohnungen befand, deren Mieter nächtliche Zimmervisiten ablehnten. Manchmal gewann man den Eindruck, dass die vom unterm Dach, wie sie von anderen Bewohnern oft genannt wurden, ein Eigenleben führten.
Philine klopfte an die erste Tür für diese Nacht. Bis zum Morgen würden ihre Fingerknöchel rot sein.
»Herein«, antwortete eine heisere Männerstimme.
»Guten Abend, Monsieur Perrault. Wie geht es Ihnen heute?« Philine reichte ihm einen transparenten Becher mit bunten Pillen.
»Es könnte besser gehen, aber so ist das nun einmal, wenn man alt wird.« Er schüttelte die Tabletten und zählte sie nach.
Philine schenkte ihm ein mitleidiges Lächeln. »Dagegen habe ich leider keine Medizin, aber erfreuen Sie sich doch daran, dass Sie trotz kleiner Wehwehchen so ein hohes Alter erleben dürfen. Die meisten bekommen nicht einmal ihre erste Rentenauszahlung, wenn ich meiner Tante glauben darf, und die arbeitet bei einer Krankenversicherung.«
»Wie wahr.« Er legte den Kopf in den Nacken, schluckte die Medikamente ohne Wasser. Den Becher reichte er ihr. »Gute Nacht, Schwester. Wenn Sie später noch mal reinschauen und ich schon schlafe, schalten Sie bitte den Fernseher aus. Ich schrecke sonst immer irgendwann von der Werbung auf. Die ist so teuflisch laut.«
»Das mache ich. Gute Nacht, Monsieur Perrault.«
Philine schloss leise die Tür, aber sofort schellte im Zimmer nebenan die Klingel, und das rote Licht über der Tür von Madame Sarrazin erhellte den abgedunkelten Flur. Auch wenn man sich anschlich wie ein Meisterdieb, manchen Bewohnern entging nicht einmal das Niesen einer Biene drei Häuserblocks weiter. Philine trat beim zweiten Klingeln ein, ohne zu klopfen. Madame Sarrazin wünschte das so. Sie fand es affig, wenn jemand anklopfte, obwohl die Tür sowieso nicht abgeschlossen war. Für sie war das nichts weiter als Heuchelei in Bezug auf eine nicht vorhandene Privatsphäre.
»Guten Abend, Madame Sarrazin. Wie kann ich Ihnen helfen?« Philine erahnte die Antwort bereits. Die Dame legte ihr Buch unter die mit Troddeln bestückte Nachttischlampe auf dem Beistelltisch und rückte ihre Brille zur Nasenspitze. Bei jeder Bewegung gab der Schmuck, den sie trug, ein Geräusch von sich, als würde ein Sack Murmeln umfallen. Madame Sarrazin war einst eine reiche und bildschöne Frau gewesen. Mit dem Alter und einem spielsüchtigen Ehemann hatte sie beides eingebüßt. Heute erinnerten nur noch lange Gold- und Perlenketten sowie muffige Pelzmäntel an den Glanz vergangener Zeiten. Im Altenheim ging das Gerücht um, dass Madame Sarrazin ihren Schmuck nur trug, weil sie glaubte, die Schwestern würden sie bestehlen.
»Guten Abend, Mademoiselle. Guckt der alte Quatschkopf nebenan wieder Fußball?«
»Ja. Heute spielen …«
»Mir egal, wer spielt. Die Kiste ist zu laut. Sagen Sie ihm, er soll das Ding ausmachen und schlafen wie alle anderen auch.«
Sie haben schon wieder Streit. Philine stöhnte leise. Jede Nachtschicht dasselbe Spiel. Madame Sarrazin und Monsieur Perrault waren sich vor wenigen Wochen durch einen Aufstand während der Bastelrunde nähergekommen. Die beiden hatten gemeinschaftlich zum Boykott der kindergartentauglichen Beschäftigungsmaßnahmen aufgerufen und waren kläglich gescheitert. Dafür hatten sie Freundschaft geschlossen und ein Betreuungsangebot pro Woche weniger. Das Glück hatte jedoch nur wenige Tage gehalten.
Seitdem herrschte zwischen den beiden Eiszeit, und ausbaden mussten es die Schwestern, die als Streitschlichter und Nachrichtenübermittler missbraucht wurden. »Das werde ich, wenn ich später wieder hier vorbeikomme. Zuerst muss ich die Medikamente verteilen und bei allen nach dem Rechten sehen. Das verstehen Sie sicher?« Philine hoffte, dass Monsieur Perrault dann schon schlief.
»Gewiss, gewiss. Ich wollte Sie auch nicht von der Arbeit abhalten. Ich möchte Ihnen nur noch einen Ratschlag geben.« Sie legte eine bedeutungsschwangere Pause ein.
Suchen Sie sich einen reichen Mann, und hängen Sie diesen Job an den Nagel.
»Suchen Sie sich einen reichen Mann, und hängen Sie diesen Job an den Nagel.«
Diesen Ratschlag hörte Philine an jedem Abend wieder.
»Sie sind hübsch und werden nicht lange suchen müssen. Achten Sie nur darauf, dass der Mann mit Geld umzugehen weiß. Reichtum ist schließlich keine Selbstverständlichkeit, die wie Regen vom Himmel fällt.«
Hübsch … Immer nannten die Bewohner sie hübsch oder ansehnlich. Philine betrachtete sich verstohlen in einem mit Gold und Schnörkeln verzierten Wandspiegel. Mit ihren Sommersprossen und den kastanienfarbenen Haaren, die sie zu einem Dutt gebunden hatte, fand sie sich nicht hübsch. Der weiße Kasack und die viel zu weite helle Leinenhose taten ihr Übriges, sie wie einen Sack Mehl aussehen und auch so fühlen zu lassen. Wenigstens besaß sie eine zierliche Statur und mit einem Meter fünfundsechzig auch eine gewisse Größe, um nicht mit einem Beutel Weizenmehl Typ 405 verwechselt zu werden. Durch die Mittags- und Nachtdienste im Altenheim hatte sie im Sommer kaum Sonne gesehen und dadurch auch keine gesunde Bräune, die ihr in der immer ungemütlicher werdenden Jahreszeit etwas Farbe verlieh. Wie sehr sie manchmal die Frauen beneidete, die sich hübsche Kleidung zur Arbeit anziehen durften. Vielleicht würde sie sich mit einem netten Kleid und einem Hauch Make-up auch etwas hübscher fühlen.
Philine wurde den Gedanken nicht los, dass alte Menschen jeden hübsch fanden, der in der Blüte seines Lebens stand. In Wahrheit beneideten die Alten die Jungen einfach bloß um ihre Jugend und die Möglichkeiten, die ein noch frisches Leben in dieser modernen Welt bot. Dabei ahnte niemand, dass ihr diese Welt nie so offengestanden hatte wie allen anderen.
»Ich werde Ihren Rat beherzigen, aber nun muss ich weiter.« Im Flur hörte Philine schon wieder das helle Piepen einer Klingel. Natürlich bewegt sich Jules keinen Meter. Missmutig rollte Philine den Wagen vor sich her, bis sie an der nächsten roten Klingel verharrte.
Schon vor der Zimmertür konnte sie den Zigarettenrauch wahrnehmen, der ihr förmlich in die Nase biss. Wenn Monsieur Flaubert eines Tages starb, würde das gesamte Zimmer renoviert werden müssen, denn die eigentlich blütenweiße Wand war mittlerweile nikotingelb.
»Monsieur Flaubert, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass Rauchen im …« Das letzte Wort blieb ihr im Hals stecken, als sie die Tür öffnete und einen Blick ins Zimmer des alten Mannes warf. Der Aschenbecher qualmte, und ein Feuer loderte darin, das auf eine Gardine überzugreifen drohte. Davor stand Monsieur Flaubert, der mit einem Papiertaschentuch hantierte und damit die Flammen zu ersticken versuchte. Vor Schreck ließ Philine die Tablette mitsamt Plastikbecher fallen, schnappte sich die Vase mit den Blumen, die der Bewohner zu seinem Geburtstag vom Heim geschenkt bekommen hatte, und goss das Wasser über dem Brandherd aus. Eine graue dichte Qualmwolke drängte sich bis unter die Zimmerdecke und schlängelte sich gemächlich aus dem geöffneten Fenster, während die kalte Nachtluft hineinströmte. Philine schaute nach oben und neigte fragend den Kopf. Der Rauchmelder an der Decke gab keinen Mucks von sich. »Wieso reagiert das blöde Teil denn nicht?«
Monsieur Flaubert blinzelte spitzbübisch zu einer Kneifzange mit rotem Griff, die auf dem Tisch lag.
»Haben Sie etwa die Kabel durchtrennt?«
»Ich kann doch nicht jedes Mal die Strafe dafür zahlen, dass die Feuerwehr hier anrückt.«
»Hören Sie doch einfach damit auf, im Zimmer zu rauchen. Irgendwann brennen Sie noch das ganze Haus nieder. Hier leben Menschen, die sich nicht binnen Sekunden in Sicherheit bringen können. Das Haus ist so alt, dass es auch keine Sicherheitstüren besitzt.« Philine schluckte ihre Wut hinunter und bemühte sich um Sachlichkeit. Mit ihrer aufkeimenden Wut im Bauch würde sie dem Sturkopf nicht beikommen.
»Dann würde hier wenigstens endlich mal etwas Spannendes passieren.« Diese Aussage hörte Philine nicht zum ersten Mal. Erwartungsgemäß reagierte er nicht einsichtig. Deshalb ließ sie solche Sätze meist unkommentiert, besonders jetzt, da sie Monsieur Flaubert nicht auch noch ermutigen wollte, weiter Sprüche zu klopfen.
»Was müsste denn geschehen, damit das Leben hier für Sie spannend ist?«, fragte sie stattdessen und kümmerte sich um die graue Zigarettenstummelbrühe, die vom Tisch auf den Boden tropfte.
Er wiegte nachdenklich den Kopf hin und her, während er ihr dabei zusah. »Die Liebe. Die war immer spannend.«
»Vielleicht sollten Sie sich einfach ein wenig umsehen. Hier leben viele alleinstehende Damen.«
»Die sind doch so aufregend wie eingeschlafene Füße.«
Schlafen … Die für den Raucher bestimmte Tablette war auf Nimmerwiedersehen unters Bett gerollt. »Ich bringe Ihnen später noch eine neue Schlaftablette vorbei. Die andere ist abhanden gekommen.«
Als sich der Rauch verzogen hatte, schloss Philine das Fenster, nahm Monsieur Flaubert sein Feuerzeug ab und setzte ihren Rundgang fort. Inzwischen schrillten zwei Klingeln. Als sie bei Monsieur Diderot eintraf, verstummte die Klingel augenblicklich, obwohl sie sie nicht ausgeschaltet hatte.
Nanu …
Sie hörte Stimmen. Jules hatte sich offenbar dazu bequemt, auf das Läuten zu reagieren. In dem Moment, in dem Philine sich auf den Weg zum nächsten Patienten machen wollte, der nach ihr verlangte, verließ Jules das Zimmer und kollidierte mit Philines Medikamentenwagen.
»Pass doch auf«, raunte er ihr mit roten Augen und geweiteten Pupillen zu.
»Pass du lieber auf, dass du nichts verschüttest. Die Urinflasche ist randvoll.« Sie zeigte auf den Plastikbehälter in seiner Hand.
»Ja, ja. Wieso bist du nicht gegangen? Diderot liebt dich. Er sah richtig enttäuscht aus, als ich zu ihm ins Zimmer gekommen bin.«
»Er liebt alle jungen Pflegerinnen. In seiner Schublade hat er etliche Zeichnungen, und manche davon willst du wirklich nicht sehen.«
Jules grinste. »Künstler sind so.«
»Falls es dich interessiert: Monsieur Flaubert hätte beinahe das Altersheim niedergebrannt. Er hat seinen Aschenbecher in Brand gesteckt.«
»Klingt ganz nach dem alten Kerl.«
»Wie kannst du das bloß auf die leichte Schulter nehmen? Wir tragen die Verantwortung, wenn etwas passiert. Ich habe ihm zwar sein Feuerzeug weggenommen, wäre dir aber trotzdem dankbar, wenn du ein Auge auf ihn haben könntest. Irgendwo hat er bestimmt auch noch Streichhölzer versteckt.«
»Wenn nicht, kann er mein Feuerzeug haben.« Jules grinste, als hätte er den Witz des Jahrhunderts gerissen.
»Jules, bitte.« Sie sah ihn drohend und flehend zugleich an.
»Kein Problem. Ich geh ihm mal Hallo sagen, und danach nehme ich dir sogar noch die Zimmer im Keller ab.«
»Danke.«
Philine setzte ihren Weg in die entgegengesetzte Richtung fort. Madame Duponts Zimmer lag am Ende des Flurs. Bevor der nächste Bewohner klingeln würde, wollte sie ihr einen kurzen Besuch abstatten. Madame Dupont hatte schon öfter erwähnt, dass sie sich gut aufgehoben fühle, wenn Philine nachts durch die Gänge schleiche.
Leise dudelte Musik aus einem Grammofon und kämpfte sowohl gegen den Lärm des peitschenden Windes als auch gegen den Herbstregen an, der gemeinsam mit Ästen einer Trauerweide an das Fenster schlug. Seit Philine die alte Dame kannte, brachte sie sie mit dem Apparat in Verbindung. Seit Jahren erfüllten französische Chansons aus den Dreißigern diesen Raum. Anfangs hatte Madame Dupont noch ausschweifend dazu getanzt, ihren Schal geschwungen und war leichtfüßig mit einem imaginären Partner durchs Zimmer geschwebt. Sie wurde nie müde zu erzählen, dass sie seit dem Tod ihres Mannes mit keinem anderen mehr getanzt habe und es sich deshalb immer noch so anfühle, als würde er sie führen. Nach einem Sturz und der darauffolgenden Operation im Frühsommer hatte sie nur noch am Rollator zaghaft ihre Kreise ziehen können. Doch seit zwei Wochen lag sie nur noch im Bett und wippte ihren Kopf sanft im Takt der Musik.
»Madame Dupont?« Philine setzte sich an ihre Seite und legte die Hand auf ihre. Die beiden verband ein inniges Verhältnis, weshalb Nähe zwischen ihnen noch nie befremdlich gewesen war. Ihre Hand fühlte sich kalt an. »Madame …«
»Ist ihre Stimme nicht wunderschön? Sie geht mir durch Mark und Bein«, säuselte die alte Dame mit geschlossenen Augen. Édith Piaf schmetterte voller Überzeugung Non, je ne regrette rien aus der Metallblume.
»Ja, das ist sie.«
»Deshalb hat sie auch die Zeit und den Tod überdauert. Die Leute werden ihre Lieder noch in einhundert Jahren hören.«
»Das hoffe ich. Es wäre zu schade, wenn ein solches Talent in Vergessenheit geraten würde.«
»Heutzutage gibt es nur noch Bumm-bumm-Musik. Sicherlich haben die jungen Menschen ebenfalls schöne Erinnerungen an diese modernen Lieder. Wilde Nächte, leidenschaftliche Nächte und Nächte, die Leiden schaffen. Ich will niemandem zu nahe treten, aber für mich sind es Klänge ohne Seele.«
Philine nickte. Wenn sie am Wochenende in der Disco arbeitete, dröhnte ihr jedes Mal am Ende der Schicht der Kopf. Zwar konnte sie zu dieser Musik tanzen, wenn sie an wenigen Abenden im Jahr auf einen Geburtstag ging und ihre Jugend nachholte, aber privat bevorzugte sie nostalgische Melodien und solche, die Ruhe in ihren Alltag brachten. Gemeinsam lauschten sie einen Moment Madame Piaf, die nichts bereute und mit der Vergangenheit im Reinen war.
Ich wünschte, das wäre ich auch.
Eine Dauerschleife mit Ende
Nachdem Philine Vorhänge vorgezogen, Insulin gespritzt und ein paar Bewohner zur Toilette begleitet hatte, machte sie sich auf den Rückweg zum Dienstzimmer. Es war der einzige Raum im ganzen Gebäude, der rund um die Uhr beleuchtet war. Allerdings vermied Philine die kalten Neonröhren an der Decke, unter denen stets Motten flatterten, und schaltete stattdessen die altmodische Stehlampe mit dem vergilbten Lampenschirm und den Troddeln an, auf dem eine englische Jagdszenerie abgebildet war. Hin und wieder flackerte die Glühbirne zwar, weil das Kabel an manchen Stellen geknickt war, aber das störte kaum. Die Lampe war das Vermächtnis eines verstorbenen Bewohners, an den sich alle dank der Leuchte und seiner Persönlichkeit für immer erinnern würden.
Philine gönnte sich nachts keine Pause und schon gar kein Nickerchen. Im Gegenteil: In ruhigen Nächten konnte sie Dinge erledigen, die tagsüber liegen blieben. Wenn ihre Augen schwer wurden, vertrieb sie sich die Zeit mit dem Überarbeiten von Pflegeplanungen oder wischte Spinnweben weg, die sich über die alten Akten auf den Regalen gelegt hatten. Andere nutzten die ruhigen Stunden stattdessen, um verliebte SMS mit ihren Partnern oder Geliebten auszutauschen, ein Buch zu lesen oder auch einfach zu schlafen. Oft lauschte Philine während der Büroarbeit den einsamen Anrufern einer Mitternachtssendung im Radio. Was waren das für Menschen, die nachts kein Auge zutaten und ihre Sorgen und Musikwünsche einem Moderator und der fremden Zuhörerschaft anvertrauten? Noch hatte Philine kein richtiges Muster entdeckt. Meistens waren es Leute, die das sechzigste Lebensjahr schon hinter sich gelassen hatten. War das die Grenze, die die Nacht zum Tag machte, ohne dass eine Party stattfand?
Manchmal gab es auch den ein oder anderen Bewohner, der schlaflos durch die Flure irrte und sich über ein belangloses Gespräch bei einer Tasse Tee freute. Die anderen Pflegerinnen fragten sich häufig, weshalb Philine so viel über die Leute im Haus erzählen konnte, aber das Geheimnis, dass Nächte in einem Altenheim etwas ganz Besonderes waren, wahrte sie für sich und die Menschen, die dort lebten. Jeder brachte mit seinen Koffern und den wenigen Habseligkeiten, die in den Zimmern Platz fanden, auch seine ganz eigene Geschichte mit. Die einen servierten sie einem direkt auf dem Silbertablett und ließen dabei kein Detail aus, die anderen nahmen jedes noch so kleine Geheimnis mit ins Grab. Nur eines verband sie alle miteinander: Nachts stand die Welt still. Nachts war die Welt eine andere, und die Leute vertrauten ihre Ängste, Sorgen und Gedanken nur zu gern jemandem an, um sie zu teilen. Gelegentlich brauchte es gar keine Worte. Es genügte oftmals ein nachdenklicher Blick, um Philine wissen zu lassen, dass die Person vor ihr gerade von den Geistern ihrer Vergangenheit Besuch erhielt. Wenn man eine Weile in einer Pflegeeinrichtung arbeitete, entwickelte man ein Gefühl für diese besonderen Nächte. Dann war es so spürbar und real wie Wind am Meer. Heute war eine solche Nacht. Vielleicht hatte der Sturm es mit sich gebracht. Philine hatte es bei Madame Dupont ganz deutlich gespürt.
Da man diese speziellen Momente jedoch nicht jagen oder suchen konnte und sie nur dann und wann aus ihrem Versteck kamen, wenn die Zeit reif dazu war, zeichnete Philine die Akten ab, als habe sie keine Vorahnung, dass die Nacht noch eine besondere Atmosphäre bereithielt. Danach richtete sie eine neue Schlaftablette für Monsieur Flaubert und machte sich auf den Weg zu ihm. Im Haus war es still, während draußen der angekündigte Herbststurm tobte. So ganz ohne Klingeln war es in dem U-förmigen Gebäude beängstigend still. In manchen Nächten hatte man das Gefühl, als hätten sich die Bewohner untereinander abgesprochen, besonders viel oder besonders wenig zu klingeln. Heute schien eine der ruhigen Nächte zu sein. Dennoch fürchtete sich Philine in der Stille des Hauses nicht. Der Wind spielte seine Lieder, wenn er durch undichte Fensterritzen pfiff. Außerdem war der Charme des Hauses einlullend wie eine warme Decke im Winter. Der knarzende Holzfußboden und das ächzende Gebälk waren noch dieselben wie zu Schulhauszeiten. Einst eine kleine Schule diente das Gebäude über Jahrzehnte und Kriege hinweg als Waisenhaus, Lazarett, Internat und zuletzt als Pflegeheim. Inzwischen kannte Philine sogar die Bretter, die besonders laut knarzten und die sie deshalb entweder mied oder bewusst zum Knarren brachte, wenn sie Licht unter einem Türspalt sah und den Bewohner dahinter auf subtile Art wissen lassen wollte, dass er nicht allein mit seiner nächtlichen Unruhe war. Auch die alte Pausenklingel hatte man hängen lassen. Bei gekippten Fenstern und starkem Wind hörte man von Zeit zu Zeit ein leises Bing! Manche Bewohner behaupteten, sogar das Kinderlachen oder die Schreie von Soldaten aus vergangenen Zeiten hören zu können. Diesen Gedanken schüttelte Philine allerdings schnell wieder ab.
Zielstrebig steuerte sie auf Monsieur Flauberts Zimmertür zu. Neben dem Namensschild hing ein eingerahmtes Foto von ihm und als Erkennungsmerkmal eine Zeichentrickzigarette, damit er sein Zimmer leichter wiederfand, wenn er an manchen Tagen zu wenig trank und leicht verwirrt über die Etage irrte.
»Monsieur Flaubert, ich habe hier Ihre Schlaf-« Philine hielt im Satz inne und schüttelte den Kopf, als könnte sie nicht glauben, was sie da sah. Bei Monsieur Flaubert verschlug es ihr stets die Sprache. Heute trug Jules aber auch etwas dazu bei. »Ist das wirklich dein Ernst?« Sie strafte Jules mit einem mahnenden Blick in Richtung Joint, den er soeben an Monsieur Flaubert weiterreichte. Der wiederum zog kräftig daran und blies den dichten Rauch in die Luft.
»Er war müde, konnte aber ohne Tablette nicht schlafen«, verteidigte sich Jules.
»Die Tablette habe ich hier. Sind ein paar Minuten Warten zu viel verlangt?« Sie blickte zu Monsieur Flaubert. »Sie nehmen sie doch sonst auch erst kurz vor Mitternacht.«
»Behalten Sie die Tablette«, erwiderte Monsieur Flaubert und nahm noch einen tiefen Zug, wodurch der Joint aufglühte.
»Monsieur, das sind Drogen. Das ist illegal. Jules könnte seine Stelle verlieren. Und Sie … na ja … Ins Gefängnis würde man einen alten Mann deshalb wohl kaum stecken.«
Jules rollte mit den Augen und lehnte sich auf dem Sessel zurück. »Personalmangel, schon davon gehört? Ich kann tun und lassen, was ich will, ohne gefeuert zu werden, solange ich niemandem Leid zufüge. Und was die Drogen angeht«, er setzte das Wort in Gänsefüßchen, »dann hast du die in deinem Becher. Das hier«, er wies auf den Joint, »ist Natur pur und das«, er zeigte auf die Schlaftablette, »ist eine Chemiebombe.«
Jetzt mischte sich auch Monsieur Flaubert ein, der sich über seine spröden Lippen leckte, als er die Tüte weiterreichte. »Außerdem wissen wir fast alle, dass der Junge seine Kräuterzigaretten raucht. Nur die Etepetetes aus dem Dachgeschoss kriegen nichts mit.« Monsieur Flaubert ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und nahm einen weiteren Zug, ehe er die Haschisch-Zigarette Jules zurückgab.
Philine kapitulierte. Auch wenn sie das, was sie da sah, nicht guthieß, wollte sie den beiden nicht den Spaß verderben. Flaubert wirkte entspannt, und das wollte sie ihm nicht nehmen. Schließlich war sie es, die sich immer für die individuellen Gewohnheiten und Lebensstile ihrer Bewohner einsetzte, auch wenn diese noch so ungewöhnlich waren. Zuletzt hatte sie erst nach Rechtfertigungen für die Sexspielzeuge eines Bewohners gesucht, obwohl es sie davor selbst ekelte. Und ob Jules dem alten Mann Gesellschaft leistete oder draußen vor der Tür saß und seine Tüte rauchte, war nun wirklich egal. Immerhin war er so auf gewisse Weise bei der Arbeit. Zumindest versuchte sie, sich das einzureden. Eine Bewohnerklingel spaltete Philine von dem Zweiergespann.
Madame Laurent.
Philine hatte gehofft, sie würde schlafen und erst morgen früh einen hypochondrischen Anfall erleiden. Bevor sie selbst den Notarzt wählte, weil man sie einfach sterben ließ, wie sie behauptete, nahm Philine ihre Beine in die Hand und spurtete zu ihrem Zimmer. »Bin schon da!«
»Das wird aber auch Zeit. Ich warte schon seit einer halben Stunde. Ich dachte schon, der Notrufknopf wäre defekt.«
Philine lag es auf der Zunge, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch keine fünf Minuten geklingelt hatte, aber was wollte sie damit bezwecken? Für gewöhnlich blieb Madame Laurent bei ihren Übertreibungen, und sobald man ihr eine Flunkerei unterstellte, musste man am nächsten Tag bei der Heimleitung für alle Aussagen geradestehen. Ihre Chefin hatte sich für solche Gespräche erst kürzlich eine dieser hollywoodtauglichen Tischlämpchen zugelegt, die bei einem Verhör auf einen gerichtet wurden. »Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe mich wirklich beeilt. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Madame Laurent schien sie zu mustern, ob sie es auch ernst meinte oder die Entschuldigung nur flapsig dahergesagt war, um sie zu besänftigen. Philine hielt ihrem Blick stand, bis sich die steifen Schultern der alten Dame entspannten und sie wieder in ihr mit Edelweiß besticktes Kissen sank.
»Mein Sohn hat das Nasenspray vergessen. Er hat versprochen, es mir heute mitzubringen.« Sie stach mit ihrem Zeigefinger immer wieder pedantisch in die Bettdecke, um dem gebrochenen Versprechen Nachdruck zu verleihen. »Ich bekomme überhaupt keine Luft. Meine Lippen sind schon ganz blau.«
Philine nickte, obwohl der Mund der Bewohnerin schmal und rosig wie immer wirkte.
»Mir ist schon ganz schwindelig. Sehen Sie, wie hoch ich liege? Das kann man gar nicht liegen nennen. Ich schlafe im Sitzen. Es ist unerhört, dass mein eigener Sohn mir das antut. Als mein Sprössling ist er verpflichtet, sich um mich zu kümmern. Es war schon ein großes, großes Zugeständnis von mir, dass ich überhaupt hier eingezogen bin. Als Dank lässt er mich links liegen.« Sie setzte sich auf und schnappte nach Luft. Hektisch klopfte sie auf ihre spindeldürre Brust. Unter dem Nachthemd zeichnete sich jede einzelne Rippe ab.
Madame Laurent konnte Philine dennoch nichts vormachen: Sie erkannte inzwischen die Schauspielkünste der alten Dame. War sie anfangs noch darauf hereingefallen und selbst in Panik ausgebrochen, konnte sie heute abgeklärt mit der Situation umgehen. Dennoch nahm sie Madame Laurent ernst, denn sie wusste, dass hinter der hysterischen Fassade nur der Wunsch nach Aufmerksamkeit und die Angst vor dem Alleinsein steckte.
»Ich könnte Ihnen einen Erkältungstee kochen? Oder möchten Sie vielleicht inhalieren?«
»Das ist nett, aber ich brauche mein Meerwassernasenspray.« Sie schien sich dennoch zu beruhigen, denn sie legte endlich den Notrufknopf aus der Hand. »Alles andere nutzt ja doch nichts. Ich werde versuchen, auch so über die Runden zu kommen.« Nach Luft hechelnd, als wäre sie soeben einen Marathon gelaufen, richtete sie ihr Kissen und sank erneut hinein. »Ich versuche, mich etwas auszuruhen. Ich werde klingeln, wenn ich einen Arzt brauche. Dann müssen Sie sofort kommen. Das kann nicht warten, das wissen Sie ja.«
»Ich werde ein besonderes Auge auf die Klingel haben.« Philine nutzte den Moment und verabschiedete sich vorerst. Leise schloss sie die Tür, um keine weiteren noch schlafenden Hunde zu wecken. So garstig und anstrengend Madame Laurent auch sein konnte, so leid tat sie ihr. Eigentlich hatte Madame Laurent bei ihrem Sohn und dessen Familie einziehen wollen. Geplant gewesen war eine kleine, seniorengerechte Wohnung im Kellergeschoss des Hauses. Dafür hätte sie sogar ihre Eigentumswohnung für einen schuhkartongroßen Raum ohne Fenster, nur mit Oberlichtern, aufgegeben. Als ihre Wohnung dann endlich verkauft gewesen war und sie mit Sack und Pack bei ihrem Sohn hatte einziehen wollen, hatte ein drittes Enkelkind ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Obwohl sie sich als mamie angeboten hatte, auf die Kinder aufzupassen, sie zum Kindergarten zu bringen und wieder abzuholen, für sie zu kochen und mit ihnen zu spielen, hatte ihre Schwiegertochter darauf beharrt, aus dem Keller ein weiteres Kinderzimmer zu machen, statt den Säugling bei dessen Bruder unterzubringen. Kurzerhand hatte mamie von ihrer Wunschvorstellung zurücktreten und sich als Madame Laurent im Altenheim einquartieren müssen. Seitdem war ihr Sohn so gut wie verschollen, was Madame Laurent sehr persönlich nahm. Je mehr er sich fernhielt, desto kränklicher wurde sie. Auch an diese Insiderinformation war Philine in einer der seltsamen Nächte gekommen, als sich Madame Laurent ihr anvertraut hatte. Womit konnte man als alter Mensch denn sonst noch auf sich aufmerksam machen, wenn nicht mit Krankheiten und dem nahenden Ende? Die alte Dame fürchtete, dass sich ihr Sohn nur noch mehr distanzierte, wenn sie sagte, dass es ihr gut ging. So konnte sie immerhin an sein schlechtes Gewissen appellieren.
Als Philine auf dem Flur stand, vernahm sie wieder Édith Piafs Stimme. Der Gesang zog sie magisch an. Als sie näher an das Zimmer trat, hörte sie, dass Édith sich immer wieder wiederholte. Die Platte hing.
Wieso klingelt sie nicht?
Es war keine Seltenheit, dass eine Platte einen Hänger hatte, aber für gewöhnlich meldete sich Madame Dupont sofort. Mit schnellen Schritten stürmte Philine ins Zimmer.
Der geheime Sohn
»Madame?« Philine hielt die Luft an.
»Keine Angst, ich lebe noch.«
Erleichtert atmete Philine auf. »Soll ich die Nadel neu ansetzen?« Sofort war alles wie immer. Philine wollte sich ihre Sorge nicht anmerken lassen. Unruhe übertrug sich schneller als eine Grippeepidemie.
»Ja, bitte.«
»Wie lange hängt die Platte denn schon?«
»Sekunden, Minuten … eine halbe Stunde. Wer weiß das schon?« Madame Dupont hob die Hände und ließ sie dann auf die Bettdecke fallen.
»Sie sollen doch klingeln.«
»Wegen Édith scheuche ich dich Backfisch doch nicht quer durchs Haus. Dann stottert sie eben ein bisschen vor sich hin.«
»Es ist meine Aufgabe, mich um Sie zu kümmern.«
»Um mich und um hundert andere«, konterte sie. »Ich höre doch, wie oft die Klingel angeht. Und ich weiß, dass dieser Faulenzer namens Jules nicht einen Finger rührt.«
»Sie dürfen gern egoistischer sein. Ich bin hier, um zu arbeiten. Haben Sie denn Schmerzen, oder weshalb sind Sie noch wach? Der Arzt hat Ihnen Medikamente aufgeschrieben. Sagen Sie Bescheid, und ich bringe Ihnen etwas.« Abwartend stand Philine am Fußende des Bettes, wo bereits ein frischer Pyjama für den kommenden Tag hing.
»In meinem Alter schläft man tagsüber zu viel und nachts zu wenig. Alles steht auf dem Kopf. Da helfen auch keine Medikamente mehr. Schmerzen habe ich sowieso immer, und von den Tabletten bekomme ich Magenweh.« Sie winkte ab.
»Soll ich morgen fragen, ob Sie ein Pflaster bekommen können? Das schont ihren Magen. Doktor Perrin hat sicher nichts dagegen. Ihr Wohl liegt ihm sehr am Herzen.«
»Ach, Liebes, bis morgen ist noch lange hin.«
Selbst im Halbdunkeln konnte Philine die Augen der alten Dame wissend blitzen sehen. Philine entgegnete nichts, sondern legte La vie en rose auf. »Kennen Sie Monsieur Flaubert? Er saß im Speisesaal immer schräg gegenüber von Ihnen.«
»Ja, ein großer, hagerer Mann, der immer nach Zigaretten roch. Was ist mit ihm? Ist er etwa gestorben?«
»Nein, wenn man davon absieht, dass er sich vorhin beinahe selbst eingeäschert hätte.«
Madame Dupont kicherte, aber es klang erschöpft. Allmählich verließen sie die Lebensgeister.
»Monsieur Flaubert langweilt sich. Er sagt, hier passiert nichts Spannendes.«
»War er denn nicht lange genug jung, um spannende Erinnerungen für das Alter zu sammeln?«
»Ich weiß es nicht.« Über Monsieur Flaubert wusste Philine in der Tat nicht allzu viel. Er war einer dieser Geheimniskrämer, die nicht mehr über sich preisgaben als nötig.
»Ich für meinen Teil könnte jeden Tag eine andere Anekdote erzählen, die mir in meiner Jugend widerfahren ist. Tanzabende mit Männern boten die besten Gelegenheiten, heitere Erinnerungen zu schaffen. Mir reicht schon das Rauschen des Grammofons, um die Vergangenheit aufleben zu lassen. Ich muss mich nicht bewegen, um tanzen zu können.« Madame Dupont wusste mit Worten zu spielen. Vermutlich hatte sie mit ihrer charmanten Art früher so manchem Mann den Kopf verdreht. »Was würde Monsieur Flaubert sich denn wünschen? Eine Zeitreise vielleicht? Ein Ufo sehnt er sich hoffentlich nicht herbei.«
»Die Liebe. Er sagt, die sei immer aufregend gewesen in seinem Leben.«
»Na, das ist in seinem Alter ja mindestens genauso unwahrscheinlich wie ein kleines grünes Männchen auf seiner Bettdecke.« Sie zuckte mit den Achseln.
»Wieso? Hier gibt es doch so viele alleinstehende Frauen. Eine wäre da doch sicher dabei, die sich über etwas Gesellschaft freuen würde.« Philine dachte an Tata, von der sie nicht einmal wusste, ob sie je verheiratet gewesen war. In ihrem Zimmer befanden sich jedenfalls keine Fotos eines Mannes, was darauf schließen ließ, dass es nie einen gegeben hatte oder ihr Mann einer von der Sorte gewesen war, an den sie sich nicht gern erinnerte.
»Hm …« Madame Dupont überlegte eine Sekunde, dann schürzte sie die Lippen und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, im Alter wird man wählerischer. Die meisten hier haben den Großteil ihres Lebens mit einem Menschen gefristet, der bis heute als Maßstab gilt; egal, ob dieser jemand ein guter oder schlechter Partner gewesen ist. Den Ansprüchen kann niemand mehr gerecht werden. Und die, die immer schon allein waren, geben ihre Freiheit auch im Alter nicht auf.«
»Mag sein, aber das wäre sehr schade für Monsieur Flaubert.«
»Schade finde ich, dass du junges Ding dein Leben bei uns Alten vergeudest. Du solltest draußen sein, angeheitert am Ufer der Seine entlangtanzen – mit einem schönen, intelligenten und stattlichen Mann.« Ihre Stimme wurde lauter und lebendiger, als hätte sie für den Moment ein paar Lebensjahre zurückgewonnen. Philine fühlte sich dagegen steinalt, wenn man so mit ihr oder über sie sprach.
Natürlich kam das Thema wieder auf sie zu sprechen – wie immer. Egal, ob bei Bewohnern oder Kollegen, Philines Liebesleben war der Dreh- und Angelpunkt des Altenheims. Selbst Probleme wie der Fachkräftemangel konnten mit ihrem angestaubten Beziehungsstatus nicht mithalten. Alle Bewohnerinnen, die spätestens mit Anfang zwanzig unter der Haube gewesen waren, konnten nicht verstehen, dass Philine nicht einmal einen Verehrer hatte. Nur wenige akzeptierten, dass sich die Zeiten gewandelt hatten und man nicht zwangsläufig nach Ablauf des zweiten Lebensjahrzehnts verheiratet sein musste.
Philine lebte sowieso in einer eigenen Zeitzone. Wenn man in der Pflege tätig war, kannte man keine Wochenenden, keine Feiertage und allgemein nur sehr, sehr wenig Freizeit. Selbst ihre Geburtstage verbrachte sie auf der Arbeit. Es war ihr praktisch unmöglich, jemanden kennenzulernen. Selbst wenn sich die Chance dazu böte, wusste sie schon jetzt, dass sie nie die Zeit würde aufbringen können, um eine Beziehung zu pflegen, denn die Arbeit ging vor. »Wissen Sie, manchmal bietet das Leben einfach keinen Platz für solche Dinge.«
»Unsinn, das Leben besteht aus solchen Dingen. Besonders aus der Liebe.«
»Ich fürchte, nicht für mich.«
»Aha, du fürchtest. Du sehnst dich also doch danach.«
Philine schmunzelte. Madame Dupont war gewitzt. Ihr entging kein Detail. »Momentan habe ich einfach viel zu tun. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann.« Sie hoffte, die Dame damit besänftigen zu können.
»Nun ja … Ich würde gern etwas für dich tun, um das zu ändern. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, aber es gibt da etwas, was ich versuchen könnte.«
»Das ist wirklich nicht nötig.« Verkupplungsversuche waren das Schlimmste, was sich Philine vorstellen konnte. Wie musste es sich anfühlen, wenn zwei Personen voreinander saßen und der eine vom anderen wusste, dass man etwas wie ein Restposten war; ein Trostpreis auf dem Jahrmarkt.
»Ich möchte es aber tun. Für dich und für meinen Sohn. Der Gute steht nämlich auch ziemlich allein da.«
Philine konnte den Sonderpostenaufkleber auf ihrer Stirn beinahe fühlen. »Weihen Sie mich wenigstens ein?« Über Madame Duponts Sohn wusste Philine nicht mehr, als dass er ein Mann war. Welch ernüchternde Erkenntnis über jemanden, der einem schmackhaft gemacht werden sollte.
»Doktor Perrin ist mein Sohn.«
»Unser Heimarzt ist Ihr Sohn?« Philine staunte nicht schlecht. Die beiden sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Vielleicht hatte dafür aber auch einfach das Alter mit seinen Falten und trüben Augen gesorgt. Viel mehr wunderte sie sich darüber, dass niemand je davon erfahren hatte, obwohl Doktor Perrin hier nahezu täglich ein und aus ging.
»Ja. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ich wollte nicht, dass es jemand erfährt. Sonst heißt es noch, er würde mich bevorzugt behandeln.«
»Diese Geheimniskrämerei ist Ihnen gelungen. Ich glaube, davon weiß niemand. Ich dachte immer, Ihr Sohn lebt vielleicht weit weg und kann Sie deshalb nicht besuchen.«
»Manon weiß es und die Leitung des Altenheims. Zum Versteckspiel haben aber auch unsere unterschiedlichen Nachnamen beigetragen. Er heißt wie sein Vater. Nach der Scheidung habe ich meinen Mädchennamen wieder angenommen.«
»Ich wusste gar nicht, dass Sie geschieden sind.« Trotz all der Biografiearbeit gab es eben doch immer wieder Neues zu erfahren. Noch lebte in dem Altenheim eine Generation, in der Scheidungen eine Seltenheit waren. Die meisten hielten es aus Angst vor bösen Zungen meistens auch dann mit ihrem Partner aus, wenn andere ihn in der heutigen Zeit längst aus dem Haus gejagt hätten.
»Ja, das hat damals für Aufregung in meiner Familie gesorgt. Ich hatte mich nach fünfundzwanzig Ehejahren in einen Künstler verliebt und beschlossen, mein Leben mit ihm zu verbringen, obwohl mein erster Ehemann ein herzensguter war. Was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt. Mit meinem zweiten Mann habe ich immerhin fünfzehn Jahre meines Lebens verbracht, und der Beziehung zu meinem Sohn hat es nicht geschadet. Nur heiraten wollte ich meinen Künstler nie, trotz der Anträge, die er mir im Laufe der Jahre gemacht hat. Er hieß Robin mit Nachnamen. Das hat mir nie gefallen. Robin … Das ist so sang- und klanglos. Ich glaube, bei der zweiten Ehe darf man etwas wählerischer sein. Ein Nachname verleiht schließlich auch ein bisschen Charakter oder sollte sich dem eigenen wenigstens anpassen. Wäre Perrin nicht perfekt für dich? Philine Perrin. Es klingt beinahe so fantastisch wie der Flügelschlag eines Zitronenfalters.«
Philine ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. Er klang wirklich melodisch. Aber passte Doktor Perrin zu ihr? Madame Dupont war erst mit fünfundvierzig Jahren Mutter geworden. Doktor Perrin war also Mitte dreißig und damit gut zehn Jahre älter als sie. Bisher hatte sie ihn nie als potenziellen Partner wahrgenommen. Das tat sie nie bei irgendwem. Sie dachte an die Begegnungen mit dem jungen Doktor, die sich stets um Krankheiten und Medikamente drehten. Er war groß, schlank, trug sein dunkles Haar fein gescheitelt, besaß allerdings den gleichen Witz und dieselbe Raffinesse wie seine Mutter. Daran hätte sie eigentlich erkennen müssen, dass die beiden mehr waren als Arzt und Patientin.
»Er ist sehr höflich und zuvorkommend. Ich habe ihn zu einem Gentleman erzogen«, versuchte Madame Dupont, Überzeugungsarbeit zu leisten.
»Sie müssen ihn mir nicht schmackhaft machen. Ich weiß, dass er ein guter Fang für jede Frau wäre.« Tatsächlich hielt er ihr immer die Tür auf, ging stets einen halben Schritt hinter ihr, um ihr den Vortritt zu lassen, und grüßte immer mit einem Handschlag und Blickkontakt. Jedes seiner Worte war erlesen. Noch nie hatte sie ihn etwas Dummes sagen hören, ganz im Gegenteil zu den sturzbetrunkenen Halbstarken in der Disco.
»Also darf ich alles einfädeln?« Madame Duponts Augen blitzten aufgeregt.
»Madame … Ich weiß nicht, ob das der Laufe der Dinge …«
»Bitte. Bitte, lass es mich tun.« Sie legte ihre kalte Hand um Philines und drückte sie sanft. »Heute ist meine letzte Nacht auf dieser Welt. Dessen bin ich mir sicher. Ich will dem Schicksal nur noch einen kleinen Schubs geben dürfen. Nur noch ein letztes Mal.«
Philine fühlte sich in die Enge getrieben, auch wenn es Madame Dupont nur gut mit ihr meinte. Das Schicksal und Philine standen auf Kriegsfuß miteinander. »Aber was, wenn es nicht funkt? Ich müsste mir mein Leben lang Vorwürfe machen, dass ich Ihren letzten Wunsch nicht erfüllen konnte.«
»Nein, nein. So habe ich das nicht gemeint. Liebe, wen du zu lieben fähig bist. Ich möchte das Schicksal nur ein wenig antreiben, egal, in welche Richtung es sich dann ausbreitet. Du bist mir zu nichts verpflichtet.«
»Wenn das so ist, möchte ich Ihrem kleinen Abenteuer natürlich nicht im Weg stehen.« Philine hatte letzte Wünsche von Bewohnern noch nie ausschlagen können. In der Regel befassten sich deren Bitten mit Essen, Getränken, einer letzten Motorradfahrt oder der Versorgung ihrer Haustiere nach dem Tod. Dagegen war dieser Wunsch doch sehr speziell, aber dennoch so einfach, dass sie sich nicht querstellen wollte. Eine Klingel störte das Gespräch. Ausgerechnet jetzt. Auch wenn die Klingel für viele Bewohner Sicherheit bedeutete und die einzige Möglichkeit, um nach Hilfe zu rufen, ärgerte sich Philine in Momenten wie diesen darüber. Jede Pflegekraft sollte genügend Zeit haben, um Gespräche über letzte Wünsche ihrer Schützlinge nicht mittendrin unterbrechen zu müssen. Die Waagschale auf der Seite des Lebensendes wog für sie eigentlich schwerer als die auf der Seite der dringenden Bedürfnisse. »Es tut mir leid. Ich muss kurz nach dem Rechten sehen.«
»Natürlich. Ich habe heute Nacht auch noch viel zu tun.« Die alte Dame grinste verschmitzt. Philine war sich bei der Energie, die Madame Dupont plötzlich ausstrahlte, gar nicht mehr so sicher, ob sie wirklich so schnell versterben würde wie angekündigt, oder ob es nur ein wenig Melodramatik gewesen war, um Philine zu überreden.
Bevor Philine Monsieur Bertrands Zimmer unter dem Dach betrat, warf sie einen Blick aus dem Fenster, das zum Innenhof führte und damit nahezu einen Rundumblick in die Zimmer bot, die auf der Innenseite des dreiflügeligen Gebäudes lagen. Bei Monsieur Flaubert brannte noch immer Licht. Sie konnte sehen, dass Jules auf dem Sessel saß und sich mit Monsieur Flaubert eine Sendung im Fernsehen ansah. Einerseits ärgerte sie sich, dass er es nicht für nötig hielt, ihr unter die Arme zu greifen, andererseits sah sie Monsieur Flauberts strahlendes Lächeln, und das wollte sie dem einsamen Mann, der keine Kinder hatte, nicht nehmen. Als es erneut hinter ihr klingelte, klopfte Philine an die Tür.
Monsieur Bertrand wohnte im Dachgeschoss in einem der Zimmer, die nachts eigentlich keine Kontrollgänge für sich in Anspruch nahmen und für die sie auch keine Schlüssel besaß. Im Zimmer nebenan sah sich Monsieur Benoist eine Folge der Schwarz-Weiß-Serie Raumpatrouille – Die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion an. Wann immer sie an dem Zimmer vorbeilief, hörte sie, wie Commander Cliff Allister McLane seine Missionen unter Kontrolle hatte.
Philine klopfte noch einmal lauter, um gegen die Intromelodie anzukommen.
Sie vernahm schlurfende Schritte, dann das Knacken des Türschlosses. Als Monsieur Bertrand ihr öffnete und sie bat einzutreten, war sie ein wenig erstaunt. Sein Zimmer war karg eingerichtet und hinterließ den Eindruck, als wäre er erst vor Kurzem eingezogen und lebe nicht bereits seit Monaten hier. Die meisten staffierten ihre Zimmer mit allem aus, was sie ins Altenheim zu tragen vermochten, um so wenige Gegenstände wie möglich aus ihrem alten Leben zurücklassen zu müssen. Monsieur Bertrand war scheinbar eine Ausnahme. Philine vermutete, er hatte entweder kein Geschick, was die Einrichtung eines Zimmers betraf, oder aber Erinnerungen waren für ihn nicht materieller Natur. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Mir geht es nicht gut, Schwester. Es ist der Krebs.« Er setzte sich auf sein Bett und hielt sich stöhnend den Bauch. »Ich wollte lange nicht daran glauben, dass da wirklich etwas in mir steckt, aber ich merke es langsam, aber sicher.«
»Meinen Sie damit, dass Sie Schmerzen haben?« Manchmal musste man zwischen den Zeilen lesen, um herauszufinden, was die Bewohner brauchten.
»Schmerzen, noch mehr Schmerzen, und ich glaube, dieser Tumor zwingt meine Gedanken auch, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen.« Die nächtlichen Ängste, die viele Bewohner von Zeit zu Zeit plagten, machten auch vor Monsieur Bertrand nicht halt.
»Ich werde nachsehen, welche Tabletten oder Tropfen Sie bekommen können. Dann wird es Ihnen bald besser gehen. Sie werden sehen, wenn die Schmerzen erst unterdrückt sind, beschäftigen Sie sich auch nicht mehr so sehr damit.« Es war zwar unausweichlich, sich damit auseinanderzusetzen, und eigentlich unterstützte Philine die Bewohner dabei, ihrer Furcht vor dem Ableben Herr zu werden, aber gerade wollte sie nichts sehnlicher, als bei Madame Dupont zu sein; auch wenn es bedeutete, dass sie Monsieur Bertrand vorerst abspeisen musste. Es würde noch genügend Möglichkeiten geben, bei denen sie sich in Ruhe unterhalten konnten.
»Tabletten helfen da nicht mehr. Ich komme nicht mehr klar.« Er schaltete die Deckenlampe an, und Philine sah, was er meinte. Neben Monsieur Bertrands Bett stapelte sich ein Berg Schmutzwäsche. Der Mülleimer war schon vor langer Zeit übergequollen. Zeitungen türmten sich neben dem Sofatisch.
»Sie bräuchten jemanden, der Ihnen im Haushalt hilft«, schloss Philine.
»Ich denke, es wäre am besten, wenn ich hier sofort ausziehe und mir ein Bett in den Wohnbereichen unten nehme. Ich komme wirklich nicht mehr zurecht.« Er musste nicht ins Detail gehen, damit Philine wusste, dass er damit auf die Körperpflege anspielte. Sie warf einen zaghaften Blick durch den Türspalt ins Bad. Auch hier quoll der Mülleimer mit Stomabeuteln über, und Handtücher lagen auf einem Haufen in der Dusche. Der Duschvorhang zeigte bereits rote Schimmelspuren.
Philine warf einen Blick auf die Uhr. Inzwischen war es nach Mitternacht, und auch, wenn er soeben den Entschluss gefasst hatte, konnte sie ihn nicht in einer Nacht- und Nebelaktion in ein anderes Zimmer umziehen lassen. »Ich werde es morgen bei der Übergabe erwähnen, dann können die Teams beratschlagen, wo Sie am besten aufgehoben wären.« Sie wollte ihm nicht sagen, dass derzeit alle Zimmer belegt waren und ein Umzug nicht ohne Weiteres durchgeführt werden konnte.
»Das klingt gut.« Er zog seine Pantoffeln aus, legte die Beine ins Bett und schaltete den Fernseher ein. »Ich werde mir dann mal die Stunden bis zur Dämmerung um die Ohren schlagen.«
»Ich wünsche Ihnen trotzdem eine ruhige Nacht, Monsieur.«
»Die werde ich haben. Hier oben regt sich nichts außer den Tauben auf dem Gebälk.« Wie zur Bestätigung gurrte es.
Nachdem Philine noch einmal bei Madame Dupont vorbeigeschaute hatte, die tief und fest schlief, schlich sie auf Zehenspitzen zum Dienstzimmer, um die Ruhe im Haus nicht zu zerstören und nicht unnötig auf sich aufmerksam zu machen. Bis der nächste Bewohner nach ihr läutete, schnappte sie sich eine Bewohnerakte und begann, das darin liegende Medikamentenblatt sauber auf ein neues Dokument zu übertragen. Auch eine der Arbeiten, für die tagsüber nie genügend Zeit war, weshalb das alte Blatt kreuz und quer durchgestrichen und ausgebessert war. Die Lampe flackerte immer wieder, und Philine hoffte, dass die Stromleitungen dem Sturm standhielten. Für den Ernstfall gab es ein Notstromaggregat, aber das behielt sich vor, nur dann anzuspringen, wenn man es lieb fragte.
Als Philine gerade die zweite Akte zurück in den Rollwagen steckte, piepste ihr Handy. Ihre beste Freundin und Arbeitskollegin Gabriella hatte ihr ein Foto gesendet. Darauf zu sehen waren Gabriella in einem eng anliegenden roten Kleid und ihr Freund Matteo in einem Anzug. Das Tuch in seiner Jacketttasche war perfekt auf Gabriellas Kleid abgestimmt. Die beiden posierten mit einer gemeinsamen Arbeitskollegin, die heute geheiratet hatte. Mit ihren glänzenden Gesichtern und den halb leeren Gläsern in den Händen ließen sie keinen Zweifel daran, dass es feuchtfröhlich herging.
01:05 Du verpasst eine tolle Party!
01:06 Du tust so, als würde ich sie freiwillig verpassen :-/
01:09 Du hättest nicht gleich zusagen müssen, als man dich gefragt hat, ob du einspringen kannst. Du hattest zugesagt, dass du kommst!
01:11 Alina ist kurzfristig abgesprungen.
01:13 Und du hattest langfristig schon etwas geplant.
So war es immer. Philine fehlte bei allen Festen, Geburtstagen und Familienfeiern, weil sie arbeiten musste. Es glich einem Highlight, wenn sie sich doch einmal irgendwo blicken ließ. Dann wurden in der Regel Sprüche geklopft, ob es sich wirklich um die echte Philine oder um eine Doppelgängerin handelte. Über solche Scherze konnte sie nur müde lachen, denn sie fühlte sich den Bewohnern gegenüber verpflichtet.
01:16 Du weißt, weshalb ich eingesprungen bin. Madame Dupont geht es schlecht, und ich wollte sie nicht mit Jules allein lassen.
01:23 Nimm es mir nicht übel, aber ich möchte heute eigentlich nicht über die Arbeit sprechen und darüber, dass bald wieder ein Zimmer frei wird :-*
01:24 Du hast angefangen :-* Bis Morgen!
Funkstille. Philine saß wieder abgeschottet von der Außenwelt in ihrem Kämmerchen und wartete darauf, dass die Zeit vorbeiging.
Tatsächlich blieb es bis zum letzten Rundgang um halb fünf ruhig. Sogar im Radio lief eine Musiksendung in Endlosschleife – ohne Anrufer dazwischen. Es war, als hätte der Sturm für alle einen tiefen Schlaf mitgebracht. Sogar Philine wurde von der Müdigkeit überrollt, was angesichts ihrer häufigen Nachtdienste sehr selten vorkam, da sich ihr Schlafrhythmus bereits den unnatürlichen Zeiten angepasst hatte.
Als sie zum letzten Rundgang aufbrach, wickelte sie sich in ihre Strickweste, die sie über ihrem Kasack trug. Ihr Schlafbedürfnis ließ sie frösteln. Sie öffnete Tür für Tür und warf einen vorsichtigen Blick in die Betten, um sicherzugehen, dass niemand hingefallen war. In den meisten Zimmern wurde gleichmäßig geatmet, in anderen geschnarcht, und in wieder anderen flackerte durchgehend ein Fernseher. Sogar Madame Sarrazin schlief ruhig, obwohl bei Monsieur Perrault noch immer lautstark die Kiste lief, in der sich eine nackte Frau mit einer einprägsamen Telefonnummer rekelte. Philine schlich ins Zimmer und schaltete den altmodischen Röhrenfernseher aus, der mit einem elektrischen Brizzeln erstarb. Jules und Monsieur Flaubert ein paar Zimmer weiter waren beide auf den Sesseln eingeschlafen. Philine ruckelte an Jules Schulter, um ihn zu wecken.
»Letzter Rundgang«, flüsterte sie, als er sich die Augen rieb und zuerst orientieren musste, wo er denn war. Er nickte, rappelte sich auf und schlurfte hinter Philine her. Zwei Zimmer weiter lag Madame Marchand. Sobald man das Zimmer betrat, sah sie einen erschreckt an. Ihre kristallblauen Augen waren immer weit aufgerissen, als hätte sie soeben einen Geist gesehen.
»Wie geht es Ihnen heute, Madame Marchand?«, fragte Philine und stellte sich neben sie.
Madame Marchand nestelte an der Bettdecke, zog die Beine an und zuckte mit den Schultern.
»Sie versteht dich doch sowieso nicht. Die ist doch völlig dement.«
Philine strich ihr übers Haar. »Trotzdem sollte man höflich mit ihr umgehen. Ich bin mir sicher, sie spürt, ob man sie mag oder nicht.«
»Wenn das so ist: Hallo, Madame Marchand. So, wie es hier riecht, ist wohl wieder etwas in die Windel gegangen.«
Wieder zuckte Madame Marchand mit den Schultern und sah sich ratsuchend um, als stünde hinter Philine ein ganzer Pulk Menschen.
»Sag nicht Windel. Sie ist kein Baby.« Manchmal fragte sich Philine, ob Jules während der Ausbildung nicht aufgepasst hatte, den coolen Macho raushängen lassen wollte oder schlicht und ergreifend ohne Anstand erzogen worden war.
Jules rollte mit den Augen. »Meinetwegen.«
Draußen sprang eine Klingel an. Jules warf einen Blick auf den Piepser. »Madame Laurent. Soll ich, oder gehst du?«
»Ich habe vorhin schon mit ihr gesprochen und sie besänftigen können. Ich glaube, heute Nacht habe ich sie ganz gut im Griff.« Philine wollte vermeiden, dass Jules mit seiner plumpen Art ihre ganze Beruhigungsarbeit zunichtemachte.
»Dann werde ich das kleine Malheur hier beseitigen.« Er griff in seine Tasche, zog ein paar Gummihandschuhe heraus und zog sie sich über.
»Mach bloß keine Dummheiten. Spar dir deine Sprüche für jemand anderen auf, der dir Kontra geben kann.«
»Ja, Maman.«
Philine überhörte die Spitze bewusst. Jules mochte so alt wie sie sein, aber er war ein Clown. Philine hingegen machte ihren Job seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr. Zuerst war es nur eine Familienangelegenheit gewesen, die sich dann zu ihrem Beruf entwickelt hatte. Jules pflegte Menschen, weil seine Mutter hier arbeitete und sie die Nase voll von ihrem Sohn hatte, der ihr nichtsnutzig auf der Tasche lag und außer Computerspielen nichts im Sinn hatte. Vielleicht wäre ich auch nicht die, die ich heute bin, wenn meine Vergangenheit anders verlaufen wäre.
Madame Laurent röchelte so laut, dass es selbst durch die geschlossene Zimmertür zu hören war. Hätte Philine es nicht besser gewusst, hätte sie geglaubt, dahinter treibe ein Alien sein Unwesen.
Philine trat ein.
»Notarzt«, krächzte Madame Laurent, hustete und spuckte in ein Taschentuch. »Schnell!«
Statt einen Krankenwagen zu rufen, setzte sich Philine auf einen Stuhl, über dessen Lehne bereits die Kleidung für den morgigen Tag hing. Es waren die normalen Anziehsachen der alten Dame und nicht eine der schicken Blusen und Stoffhosen, die sie trug, wenn ihr Sohn sie besuchte oder zum Essen abholte. Er hatte seine Mutter also schon wieder versetzt.
»Hilfe«, quiekte Madame Laurent erneut. »Keine Luft …«