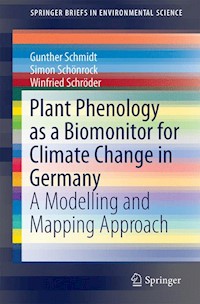Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hypnose und Hypnotherapie
- Sprache: Deutsch
Gunther Schmidt gilt als einer der maßgeblichen Pioniere für die Integration systemischer Modelle und ericksonscher Hypnosetherapie zu einem ganzheitlich-lösungsfokussierenden Konzept. Im Zentrum seines Beratungsansatzes stehen die Orientierung auf Kompetenzen, Ressourcen und Lösungen und die vielfältigen Anwendungsbereiche in Therapie und Beratung. In diesem ersten umfassenden Buch zur hypnosystemischen Therapie und Beratung lässt Gunther Schmidt den Leser an dieser erfolgreichen Vorgehensweise teilhaben und gibt zugleich viele Anregungen für die tägliche Praxis, u. a. in den Bereichen: Familien- und Paartherapie, Sucht- und Traumatherapie, stationär-klinische Psychosomatik, Psychosen, Depression, Team- und Organisationsentwicklung, Coaching, Supervision, u. a. m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Andrea und Scerstine, Julia, Leonard und Dario
Liebesaffären zwischen Problem und Lösung
Gunther Schmidt
Hypnosystemisches Arbeiten in schwierigen Kontexten
Zehnte Auflage, 2023
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer ✝ (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin ✝ (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Zehnte Auflage, 2023
ISBN 978-3-8497-0191-8 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8285-6 (ePUB)
© 2004, 2023 Carl-Auer-Systeme Verlag und
Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Geleitwort
Vorwort
Einführung
Der Weg vom systemischen zum hypnosystemischen Ansatz
Zum Titel des Buches
Grundannahmen des hypnosystemischen Ansatzes
Teil I: Grundsätzliche Aspekte
Hypnosystemische Kompetenzentfaltung – Möglichkeiten der Nutzung von Problemkonstruktionen
Übersicht
Probleme – gibt’s die?
Utilisation von gemeinsamem Problem Talk als Prüfmöglichkeit für zieldienliche Kooperation
Utilisation von problem talk, der als beziehungsstiftendes Ritual gedacht war
Utilisation von problem talk, der als unverzichtbares Mittel für „Ursachenforschung“ gedacht war
Wie „bastelt“ man ein Problem, und wie kann man gerade dies für erfüllende „Lösungen“ nutzen?
Grundüberlegungen für Musterinterventionen
Nutzung der mit bisherigen Problemmustern einhergehenden Zielvorstellungen
Typische Phasen eines Beratungsprozesses
Abschluss
Gedanken zum ericksonschen Ansatz aus einer systemorientierten Perspektive
Erickson, ein systemischer Praktiker
Symptome systemisch gesehen und die Relevanz des „Überweisungskontextes“
Hypnotherapie und Trance, ein kontextuelles Geschehen
Das ericksonsche Unbewusste, ein Beispiel für die Nützlichkeit einer Verdinglichung
Zum Abschluss
Systemische Familientherapie als zirkuläre Hypnotherapie
Einleitung
Prämissen
Formen indirekter Suggestionen
Suggestive Kommunikation in Familien
Praktische Konsequenzen einer hypnotherapeutischen Perspektive für den systemischen Ansatz
Einige Anwendungsmöglichkeiten indirekt-suggestiver Strategien im systemischen Ansatz
„Wahrgebungen“ aus der „inneren“ und „äußeren Welt“ des Therapeuten und ihre Nutzung für zieldienliche therapeutische Kooperation
Therapeuten und Berater als strategische Gesprächs-„Führer“
Konstruierte Wahrnehmung und hypnotische Prozesse
Aufmerksamkeitsfokussierung
Trance
Problemmuster und Lösungsmuster
Das Prinzip der Utilisation und die Rolle der Therapeuten
Wechselseitige „Hypnose“ in Interaktionen
Aufbau von therapeutischen Systeme zu optimal zieldienlichen Kooperationssystemen
Aufbau der optimalen Therapeutentrance
Nutzung der inneren Reflecting Teams
Hypnosystemische „Senoi“-Konversation
Utilisation von Auftragsdilemmata
Fallbeispiele
Teil II: Therapeutische Anwendungsfelder
Systemische und hypnotherapeutische Konzepte für die Arbeit mit als psychotisch definierten Klienten
Ergebnisse der Familientherapieforschung
Therapeutische Interventionsmöglichkeiten
Systemisch-hypnotherapeutische Konzepte für die Kooperation mit als depressiv definierten Menschen und ihren Beziehungssystemen
Einführung
Prämissen
Therapeutische Interventionen – Intervention als Unterschiedsbildung
Zur zeitlichen Orientierung durch Fragen in der Therapie
Individuumzentriertes oder systemzentriertes Arbeiten?
Das Prinzip der Utilisation
Zur Beziehungsgestaltung in der Therapie und zum Aufbau des Therapiesystems als zieldienliches, kompetenzstärkendes und als sinnvoll erlebtes Kooperationssystem
Utilisation des Attributionsstils
Dissoziationstechniken und „innere Konferenzen“
Depressionen übersetzen als Information über wertvolle, berechtigte Bedürfnisse
Depression symbolisieren als „Besucher“ und andere symbolische, rituelle Interventionen
Balance zwischen Lösungsfokussierung und Wertschätzung des „Problems“
Können wir der Familie eine erfolgreiche Hypnosetherapie ihres „Patienten“ zumuten?
Einführende Bemerkungen
Das Interview
Abschlusskommentare
Sucht-„Krankheit“ und/oder Such(t)-Kompetenzen – Lösungsorientierte systemische Therapiekonzepte für eine gleichrangigpartnerschaftliche Umgestaltung von „Sucht“ in Beziehungs- und Lebensressourcen
Zur Technik der Lösungsorientierung
Suchtmuster und suchtstabilisierende Glaubenssysteme – Suchtverhalten als beziehungsgestaltende Interventionen
Suchtregulation als dissoziative „Trance“-Regulation
Sucht als implizite Suchkompetenz
Implikationen aus der Ressourcenperspektive für die Haltung der Therapeuten gegenüber der „süchtigen“ Seite und für die Bestimmung der therapeutischen Ziele
Wer definiert die Ziele? Die therapeutische Haltung: Entwicklung eines gleichrangig-kooperativen therapeutischen Kontexts
Nachteile einer Pathologieorientierung
Vom so genannten Rückfall zur Nutzung von „Ehrenrunden“ als wertvoller Informationsquelle
Ist der „Rückfall“ vom Umfall(en) bedroht?
Vom „Bröckeln“ einer Bastion
Fortschritt oder „Ehrenrunde“ – eine kompetenzorientierte Definition von Prozessen, die bisher „Rückfall“ genannt wurden
Die Realitätskonstruktion „Rückfall“ wirkt hypnotisch
Den so genannten „Rückfall“ als Lösungsversuch anerkennen
„Ehrenrunden“ als wichtige Informationsfortschritte und wie man sie therapeutisch nutzt
„Ehrenrunde“ als Informationsgewinn für stimmigere Zielgestaltung
Achtung der unterschiedlichen Aufträge
Zielkonstruktion und die Frage der Abstinenz
Loyalitätskonflikte durch Nutzung der Lösungskompetenz
„Ehrenrunden“ als Information über ungestillte Sehnsüchte
„Ehrenrunden“ als Information über die Stärke der „Problemtrance“
Teil III: Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Team- und Organisationsentwicklung
Das Team als Kompetenztreibhaus – Hypnosystemische Teamentwicklung
Teams – gibt’s die?
Systemische Prämissen
Schritte einer hypnosystemischen Teamentwicklung
Anwendungsmethoden
Die Klinik als lernende Organisation
Hypnosystemische Prämissen
Grundsatzüberlegungen zu Aspekten einer „Lernenden Organisation“
Was hat eine Organisation zu beachten, um eine LO zu werden und zu bleiben?
Optimale Balance zwischen Aspekten einer lernenden und einer wissenden Organisation
Was man noch so alles lernen kann beim Lernen?
Tempo und Klima des Lernens
Relevante Musterebenen einer LO
Beispiel: Eine Klinik und ihre Ziele
Einige Ebenen, auf denen Lernprozesse für diese Ziele in der und für die Klinik gefördert werden können
Literatur
Veröffentlichungshinweise
Über den Autor
Geleitwort
Die meisten Angehörigen unserer systemisch-therapeutischen Zunft kennen Gunther Schmidt als einen hinreißenden Redner, dem die Ideen und Worte nie auszugehen scheinen. Das bekundet sich nicht zuletzt in den vielen Audiokassetten, die inzwischen von ihm im Handel sind. Dass er auch gut schreiben kann, wissen vergleichsweise wenige. Es werden viel mehr sein, wenn sich das Erscheinen dieses Buches erst einmal herumgesprochen hat.
Ich selbst habe Gunther Schmidt viel zu verdanken. Vor bald einem Vierteljahrhundert begann unsere Zusammenarbeit an der damals von mir geleiteten Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie der Universität Heidelberg. Die Arbeit, die uns immer wieder begeisterte und uns immer wieder zu neuen Einsichten verhalf, vollzog sich in einem Team von zumeist nur vier Mitarbeitern.
Darin waren gerade Gunthers Begeisterung und Innovationsfreude ansteckend. Und er lieferte noch einen ganz speziellen Beitrag: Als einziges Teammitglied hatte er den legendären Hypnotherapeuten Milton H. Erickson persönlich kennen gelernt. Er vermochte uns schnell zu belehren, dass Hypnose keine magische Zirkustrickserei ist, die sich anbietet, um passiv gebaute Menschen einzulullen und zu manipulieren – dies eine Vorstellung, die auch Freud geteilt und bewogen haben könnte, sich von der Hypnose ab- und der Psychoanalyse zuzuwenden. Vielmehr vermochte mich Gunther bald zu überzeugen, dass die Hypnotherapie, die er von Milton H. Erickson lernte und dann selbst als systemischer Therapeut weiter entwickelte, nicht nur therapeutisch ungewöhnlich wirksam sein kann, sondern auch unserer Fähigkeit zu autonomem Handeln keinen Abbruch tut, vielmehr diese Fähigkeit noch auszuweiten vermag.
Aber es liegt mir fern, Gunther als Hypnotherapeuten einzuordnen. Angesichts seiner lebendigen Neugier und Energie, die ihn immer wieder neue Forschungs- und Praxisbereiche erschließen lassen, entzieht er sich allen Etikettierungen. Das werden auch die vielen Leser und Leserinnen, die ich diesem Buch wünsche und die es sicher auch finden wird, bestätigen.
Helm Stierlin
Mai 2004
Vorwort
WAS LANGE WÄHRT, WIRD ENDLICH WAHR?
Seit Jahren drängen mich Freunde und Kollegen, ich solle doch endlich einmal meine Arbeiten zum hypnosystemischen Ansatz in Buchform bringen. Zwar fand ich die Idee grundsätzlich auch gut, da ich aber immer wieder neue Projekte anging und es mir einfach wichtiger war, einige andere Visionen umzusetzen (wie z. B. den Aufbau der hypnosystemischen Psychosomatik an der Fachklinik am Hardberg in Siedelsbrunn und die SysTelos-Klinik in Bad Hersfeld), habe ich dieses Vorhaben immer wieder in die so genannte Zukunft geschoben.
Dabei konnte ich mich immer wieder damit trösten, dass ja viele der Konzepte und Interventionsideen, die ich über die Jahre entwickelt habe, auf Audiocassetten oder als Video-Editionen erschienen sind. Andererseits hat diese Haltung mit dazu beigetragen, dass inzwischen viele Kollegen, die bei mir an diversen Weiterbildungen und Ausbildungsprogrammen teilgenommen haben, diese Konzepte von mir übernommen und in eigenen Veröffentlichungen verwendet haben. Dies hat mir die Ehre beschert, für mindestens acht solcher Bücher ein Vorwort zu schreiben, was ich auch gerne getan habe, weil dort wenigstens die Quellen fair zitiert wurden. Dafür möchte ich mich bei den Kollegen bedanken.
Allerdings gab es auch andere Phänomene, so z. B., als vor einigen Jahren ein vorher von mir als Freund angesehener Mensch die Inhalte eines meiner Seminare mit dem (von Bernhard Trenkle und mir entworfenen) Titel „Familientherapie ohne Familie“ als Teilnehmer aufgezeichnet hatte. Wie sich schließlich herausstellte, hatte er ohne Rücksprache und Zustimmung sowohl den Titel als auch die Inhalte meines Seminars in seinem Buch verwendet und als von ihm stammend ausgegeben. Ich muss gestehen, dass es mir nicht sofort gelang, dieses Verhalten meines Bekannten (den ich seitdem auch nicht mehr nahe stehen lasse) als Ehrung meiner Originalbeiträge auf seine (verschämte?) Art anzusehen. Da hilft, wie mein Sohn mir empfiehlt, am besten die buddhistische Haltung des Nicht-Anhaftens.
Schon um nicht mehr mit gequältem Gesicht auf die Fragen danach, wann denn nun endlich ein Buch von mir erscheine, reagieren zu müssen, habe ich mich nun doch entschlossen, dieses hier vorzulegen. Neben einer ausführlichen Einführung enthält es verschiedene Artikel zu diversen Schwerpunktthemen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern des hypnosystemischen Konzepts. Diese Artikel sind in ihrer Ursprungsform im Verlauf der letzten 20 Jahre in verschiedenen Büchern und Fachzeitschriften erschienen. Sie stellen eine kleine Auswahl aus meinen Veröffentlichungen dar, die repräsentativ sowohl für psychotherapeutische als auch für Organisationskontexte sein können. Zwar hätte man noch viele weitere Artikel aufnehmen können, aber das hätte den Rahmen des Buches gesprengt. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch einmal ein ähnliches Projekt … Die Artikel wurden aktualisiert, aber im Wesentlichen in der Originalfassung belassen. Diese Entscheidung wurde mit Bedacht getroffen, um den Lesern auch die Möglichkeit zu geben, Entwicklungen nachvollziehen zu können, die sich in 20 Jahren vollzogen haben. So braucht auch, wer sich für diese Konzepte interessiert, nicht mehr mühsam durchs Netz zu surfen, um die bisher verstreuten Artikel (hoffentlich) genießen zu können.
Mein Freund Bernhard Trenkle charakterisiert mich gerne mit der Bemerkung, er habe gehört, dass ich vor einiger Zeit selbst etwas irritiert gewesen sei, als ich auf dem Weg zu einer professionellen Verpflichtung beim Blick aus dem Fenster des ICE-Speisewagens im entgegenkommenden ICE im dortigen Speisewagen mich selbst habe sitzen sehen, auf dem Weg zu einer anderen professionellen Verpflichtung an einem anderen Ort. Ich kann dazu nur sagen, dass mich diese Legende ehrt, ich wahrscheinlich (unbewusst) zwar auch seit langer Zeit an dem Phänomen der Bilokalisation arbeite, so weit nun aber doch nicht gediehen bin.
Mit einem hat Bernhard allerdings Recht: Ich war viel unterwegs in den letzten Jahren. Bei dem Versuch, die diversen Kontexte einigermaßen zufrieden stellend auszujonglieren, habe ich immer wieder dazu geneigt, die Vollendung dieses Buches zu verschieben – zumal ich selbst der Meinung war (und es immer noch bin), dass man nicht jede Idee und jede Interventionsstrategie, die man entwickelt hat, sofort an die große Glocke hängen muss und sich ob ihrer vermeintlichen Bedeutungsschwere quasi gleich ethisch verpflichtet fühlen muss, sie der breiten Öffentlichkeit kundzutun. Letztlich war es mir doch eine große Hilfe, so konsequent mahnende (und manchmal auch quälende) Erinnerungshilfen dafür zu bekommen.
Deshalb möchte ich mich bei allen, die nicht locker ließen, wenn ich sie vertröstet habe, sehr herzlich bedanken. Insbesondere gilt dieser Dank Helm Stierlin, Fritz Simon, Gunthard Weber, Bernhard Trenkle, Bernd Schmid und Jeffrey Zeig. Und ich hoffe auch, dass Helm Stierlin so jetzt endlich das Gefühl entwickeln kann, mich „sauber“ zitieren zu können und nicht immer auf (für ihn) so exotische Audio-Publikationen verweisen zu müssen.
Gunther Schmidt
im Juli 2004
Einführung
DER WEG VOM SYSTEMISCHEN ZUM HYPNOSYSTEMISCHEN ANSATZ
In diesem Buch möchte ich einige der vielen Chancen beschreiben, die sich im Feld der Psychotherapie und der Beratung von Individuen, Teams und Organisationen durch hypnosystemische Konzepte eröffnen. Ich habe diesen Begriff „hypnosystemisch“ vor ca. 20 Jahren geprägt, um eine spezifische Form der Integration systemisch- konstruktivistischer und ericksonscher Hypnotherapiekonzepte zu kennzeichnen, für deren differenzierte Ausgestaltung ich mich engagiere, seit ich 1979 das Glück hatte, an Milton Ericksons unbeschreiblicher Verbindung von Genius, Fleiß und riesiger Erfahrung teilhaben zu dürfen.
In den weiteren Kapiteln bietet das Buch Artikel zu diversen Anwendungsfeldern der hypnosystemischen Arbeit. Da ich den Vorzug genieße, auch begünstigt durch meine beiden Berufe als Diplomvolkswirt und Facharzt für psychotherapeutische Medizin, in unterschiedlichsten Kontexten als Psychotherapeut, Berater, Coach, aber auch als Führungskraft zu arbeiten, konnte ich die hier beschriebenen Konzepte in all diesen Kontexten anwenden. Die dabei gemachten Erfahrungen fließen ein in die verschiedenen Kapitel. Diese Artikel wurden in ihrer ursprünglichen Form im Laufe meiner professionellen Entwicklung zu verschiedenen Zeiten geschrieben und in verschiedenen Büchern und Fachzeitschriften veröffentlicht. Sie wurden für das hier vorliegende Buch überarbeitet und aktualisiert. Sie sind in sich selbst jeweils als geschlossene Gestalt nebeneinander gestellt und erheben gerade nicht den Anspruch, aufeinander aufzubauen. Da und dort werden die Leser und Leserinnen deshalb auch bemerken, dass sich bestimmte wesentliche Aspekte des hypnosystemischen Konzepts in ihnen manchmal in unterschiedlicher Beleuchtung wieder finden, eine hoffentlich eher hilfreich wirkende, das kontextbezogene Verständnis des Konzepts vertiefende Redundanz. Dabei habe ich aber Wert darauf gelegt, dass ihre ursprünglichen Grundaussagen erhalten blieben, schon deshalb, damit auch meine eigene Entwicklung deutlich nachvollziehbar wird, hin zu immer mehr Transparenz, Achtung und, ja, sogar einer gewissen Demut vor der autonomen Kompetenz der Klienten und Klientinnen, mit denen ich arbeiten durfte. Ein für mich wichtiger Wahlspruch ist: „Wer einigermaßen der Gleiche bleiben will, muss sich ständig verändern.“ Und bedeutsam ist für mich Maturanas Urteil: „Leben ist ein Erkenntnis gewinnender Prozess“ (1982). Ständige Lernprozesse als der entscheidende Wirkstoff für Lebendigkeit resultieren daraus. Dieses Buch soll auch ein wenig überprüfbar machen, ob es mir möglich war, solche (hoffentlich hilfreichen) Lernprozesse zu machen.
Durch die Verbindung dieser beiden zentralen Konzepte (und ihre Anreicherung durch diverse andere wichtige Einflüsse wie z. B. Psychodrama, Ideen aus Gendlins Focusing (1981), Transaktionsanalyse und Körpertherapien wie z. B. Hakomi) lässt sich das Spektrum von Beschreibungs- und Interventionsmöglichkeiten, welches wir aus den „klassischeren” systemisch-konstruktivistischen Ansätzen kennen, deutlich erweitern. Dadurch ergeben sich sehr viel mehr Chancen, die professionellen Angebote in Therapien und Beratungsprozessen passgenau auf die Einzigartigkeit der Kundensysteme abzustimmen und ihnen so würdigend gerecht zu werden. Mit „klassischer“ meine ich hier Modelle wie z. B. den Mailänder Ansatz (Boscolo, Cecchin, Prata, Selvini Palazzoli) und dessen diverse Weiterentwicklungen, die Konzepte unserer so genannten Neuen Heidelberger Schule (Stierlin, Simon, Weber, Schmidt, Retzer, Schweitzer u. a.), so genannte narrative Ansätze wie z. B. der Gruppe um Goolishian und Anderson, Hoffmann, Tomm, White, Andersen (Reflecting Team) u. v. a. Dabei dürfte es ja ohnehin Konsens darüber geben, dass es „die“ systemische Therapie oder Beratung nicht gibt, sondern sich ihre Geschichte auszeichnet durch das vielfältige, gleichzeitige Blühen vieler Ausdifferenzierungen der Grundansätze.
ZUM TITEL DES BUCHES
Als Teil dieser Integration zum hypnosystemischen Modell erweist es sich oft als besonders wichtig, die Prozesse, welche bisher von den Klienten und Klientinnen und ihrem Beziehungssystem als „Symptome“, „Probleme“ erlebt und bezeichnet wurden, aus einer kompetenzfokussierenden Perspektive zu beleuchten. Solche Symptome lassen sich dann verstehen und behandeln nicht als reines Defizit, sondern als (oft unterbewusste) Interventionen im Dienste bestimmter Bedürfnisse, in ihren Auswirkungen können sie als beziehungsgestaltende Kompetenzen bewertet werden. Dadurch verändert sich typischerweise die Auftragsdynamik in einer Therapie oder Beratung nachhaltig. So können dann Aufträge entwickelt werden, die sowohl den bisher bewusst wahrgenommenen Zielen als auch den Anliegen gerecht werden können, die bisher (mehr unbewusst) durch die Symptome repräsentiert wurden. Die so genannten Probleme stehen dann nicht mehr in massivem Gegensatz zu den gewünschten „Lösungen“, sondern beide Aspekte lassen sich ergänzen und verbinden sich zu optimierten, zieldienlichen Synergieprozessen. So kann Therapie bzw. Beratung mehr zur Versöhnung bisher antagonistischer Kräfte und zu ganzheitlicheren Entwicklungen beitragen. Um dies besonders herauszuheben, habe ich diesem Buch gezielt seinen zugegebenermaßen etwas romantizierenden Titel gegeben, der eben darauf hinweisen soll, wie „Problemmuster“ und „Lösungsmuster“ erfreuliche, über ihr ursprüngliches Wesen hinausgehende Entwicklungen (im schönsten Falle „Liebesbeziehungen mit Folgen“) anregen können.
GRUNDANNAHMEN DES HYPNOSYSTEMISCHEN ANSATZES
In diesem Buch möchte ich Sie nicht langweilen mit weiteren endlosen Entwürfen zur Systemtheorie. Davon gibt es schon genug, zweifellos auch sehr verdienstvolle. Viele Interessierte in der Praxis der Therapie und Beratung aber, das erlebe ich noch immer fast täglich, stöhnen angesichts der ihnen als Ungetüme erscheinenden hochkomplexen Theoriegebirge und rätseln darüber, mehr oder weniger konfusioniert, was das alles denn für ihre konkrete Arbeit heißen könnte. Deshalb geht es mir vor allem darum, den Theoriehintergrund systemischer und hypnotherapeutischer Ansätze praxisorientiert zu übersetzen, damit daraus viele konkrete Handlungsschritte abgeleitet werden können. Als Mittel dafür möchte ich den Weg meiner eigenen Entwicklung hin zum hypnosystemischen Ansatz nutzen.
So werde ich hier die theoretischen Prämissen nur relativ kurz skizzieren. Die systemischen Grundannahmen dürften inzwischen den meisten Lesern und Leserinnen ohnehin eher vertraut sein (außerdem gibt es dazu sehr bewährte Arbeiten, z. B. von Schlippe u. Schweitzer 1996, Mücke 2002 u. a.).
Der Systemische Ansatz
Die inzwischen sehr weit verbreiteten systemischen Beratungskonzepte haben ihre Wurzeln in der Tradition der Familientherapie (Hoffman 1982; von Schlippe u. Schweitzer 1996). Im Laufe der letzten 25 Jahre haben sie sich aber darüber hinaus zu einem allgemeineren Metakonzept entwickelt, innerhalb dessen systemisch-familientherapeutische Arbeit nur ein (wenn auch relativ wichtiges) Anwendungsfeld ist.
Heute werden systemische Konzepte nicht nur für die Beratung von Familien, sondern auch intensiv für die Beratung anderer sozialer Systeme genutzt. Insbesondere auch in der Anwendung auf Organisations- und Teamberatung hat sich geradezu ein Boom entwickelt, wobei aber stringente und konsistente Modelle für die systemische Arbeit mit Teams noch relativ selten sind.
In die Entwicklung der systemischen Konzepte sind viele Anleihen aus unterschiedlichen Wissenschaftszweigen eingeflossen, z. B. aus der Biologie und Medizin (von Bertalanffy, Cannon), der Kybernetik, der Physik, der Synergetik (Haken) u. a. Wichtige Theorien für die modernen systemischen und hypnotherapeutisch-lösungsorientierten Konzeptionen sind die Theorie der Selbstorganisation lebender Systeme (Autopoiese) (Maturana, Varela), der Radikale Konstruktivismus (von Glasersfeld) und der Soziale Konstruktionismus (Gergen 1996). Letzterer beschäftigt sich damit, wie jeweils Realitäten in wechselseitigem Austausch, im gemeinsamen Aushandeln der Beteiligten konstruiert werden.
Systemische Prämissen
Menschliche Erlebnis- und Verhaltensweisen erfolgen immer in Zusammenhang mit und in Bezug auf andere Menschen und andere Umweltkräfte. Die relevante Grundeinheit, die es zu betrachten gilt, ist, über den individuellen Organismus hinausgehend, das ganze Ökosystem, in das er eingebettet ist. Das Ökosystem umfasst zumindest den Organismus und die ganze biosoziale und physikalische Umgebung, d. h. Menschen, Tiere, Pflanzen, geografische Faktoren usw. (Guntern 1984). Ohne diese ökosystemischen Umgebungsbedingungen ist ein Organismus nicht verstehbar, sein individuelles Sein nicht denkbar.
Vom ursprünglichen Wortsinn her bedeutet „System“ etwas, was zusammen- (syn) -steht (stamein) oder -liegt (histamein). Eine gängige Definition lautet: „ein Satz von Elementen und Objekten zusammen mit den Beziehungen zwischen diesen Objekten und ihren Merkmalen“ (Hall u. Fagen 1956). Hiermit wird intensiv auf Wechselwirkungen fokussiert und nicht auf den Elementen inhärente „Eigenschaften“. Es sind diese Wechselwirkungen, die den Zusammenhalt des Systems gewährleisten. Diese Organisation der Wechselwirkungsmuster sind genauso wesentlich wie die einzelnen Elemente des Systems. Diese Wechselwirkungen (oder auch Beziehungen) laufen nicht planlos und zufällig ab, sondern folgen bestimmten Regeln. Für lebende Systeme wird angenommen, dass die Regeln darauf ausgerichtet sind, das System dazu fähig zu machen und sein Bestehen auch ganz darauf auszurichten, dass es sich in sich selbst organisierender Weise selbst reproduziert (Autopoiese, siehe Maturana 1982). Leben reproduziert sich selbst, die wichtigste Aufgabe des Lebens scheint das (nach der Thermodynamik unwahrscheinliche) Produzieren von Leben zu sein. Dies wird durch den Aufbau von Negentropie-Ordnungsprozessen gewährleistet – so „trotzen Organismen gerade dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz und produzieren Ordnung statt Entropie“ (Willke 1991, S. 98 f.). So schaffen lebende Systeme gegen die Wirkung starker Außenkräfte „über hyperzyklische, metabolische und schließlich Sinn konstituierende Prozesse … unwahrscheinliche Zustände und organisierte Komplexität“, die „Gesetzmäßigkeiten aufweist, welche sich nicht auf die Gesetz der Physik reduzieren lassen“ (ebd.).
Damit also ein lebendes System sein Leben sichern und sein Leben reproduzieren kann, entwickelt es selbstrückbezüglich Regeln, die seinen Aufbau auch erst wieder ermöglichen und die u. a. auch wieder dafür sorgen sollen, dass die Regeln weiter aufrechterhalten werden. Da dies aber wieder in Auseinandersetzung mit einer sich ständig fluktuierend ändernden Umwelt geschieht, reicht es nicht aus, die bisherigen Regeln alle starr zu belassen (Homöostase), sondern einen Teil der Regelungen muss das System auch immer wieder in Abstimmung mit der Umgebung verändern (Morphogenese), um gerade zu sichern, dass seine Stabilität weiter ermöglicht wird: „Wer eini-germaßen der Gleiche bleiben will, muss sich ständig verändern …“ Es geht also immer um die optimale Balance zwischen Homöostase- und Morphogenesetendenzen im Austausch mit der Umwelt.
Im sozialen Bereich weisen diese Fähigkeiten z. B. alle jene gewordenen Gruppen auf, die sich als funktionale Einheiten mit Zielen entwickelt haben und sich an darauf abgestimmten Regeln orientieren. Familien, aber auch andere Gruppen, ebenso z. B. Therapeut-Patient-Beziehungen können so als lebende soziale Systeme verstanden werden. Auch diese Systeme sind natürlich wieder in größeren Systemen vernetzt. Allerdings kann es bei sozialen Systemen auch häufig solche geben, die von vornherein darauf ausgelegt sind, für bestimmte Ziele zu wirken und sich dann auch gerade als Teil ihrer sinnvollen Organisation selbst wieder aufzulösen, z. B. Projektorganisationen, Hilfsorganisationen, die nur für die Abwicklung einer bestimmten Notsituation gegründet wurden, oder eben auch Therapeuten-Patienten-Systeme etc. Der Zweck des „Lebens“ solcher Systeme ist eben dann nicht der Selbstzweck, ihr Überleben auf Dauer zu sichern, genau das würde vielleicht eher Probleme schaffen. Dies stellt einen wichtigen Unterschied zu biologischen lebenden Systemen dar, sowohl im Hinblick auf das Verständnis der Organisation und Dynamik solcher Systeme als auch auf die Bildung eventueller Interventionen. Deshalb sollten biologische Systemmodelle (z. B. Homöostasemodelle aus der Medizin) nicht platt übertragen werden auf die Betrachtung sozialer Systeme.
Individuelle Erlebens- und Verhaltensprozesse werden also auch aufgefasst als Phänomene, die sich in Interaktionsnetzwerken ereignen und auf die solche Regelungen einwirken. Sie können nicht mehr nur aus Betrachtungen des „Ich“, „Selbst“ usw. beschrieben werden. Dabei üben alle an einer Interaktion Beteiligten wechselseitig (oft synchron) Einfluss aufeinander aus, sie bestimmen auch immer wechselseitig die jeweiligen Bedingungen der anderen im Interaktionsfeld. Sie wirken mit all ihren Beiträgen ständig als intensives Feedback füreinander. Linear-kausale Zuschreibungen im Sinne vom „Dies war die Ursache, dies die Wirkung“ (z. B. eines Verhaltens) stellen eine willkürliche und verzerrende Interpunktion dar (Watzlawick, Beavin u. Backson 1967), die sofort auch wieder rückbezüglich das Geschehen beeinflusst (z. B. eine Schuldzuweisung). Bei Prozessen, in denen die „Wirkungen“ auf die „Ursachen“ zurückwirken und so aus den „Ursachen“ wieder „Folgen“ werden und umgekehrt, spricht man von zirkulären Prozessen (Bateson 1982).
Noch einmal zusammengefasst, sind für systemisch orientiertes Arbeiten in Therapie und Beratung wichtige Aspekte:
Zirkularität: Nicht nur der individuelle Zustand einzelner Mitglieder ist wichtig, sondern besonders die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen ihnen sind es. Jedes Verhalten jedes Beteiligten ist gleichzeitig Ursache und Wirkung des Verhaltens der anderen Beteiligten (Zirkularität). So ist es auch wenig sinnvoll, bestimmte „Charaktereigenschaften“ zu definieren, zu sagen, eine Person „sei“ so, sondern ihr „Sosein“ wird verstanden als Teil eines Wechselwirkungsprozesses, einer Interaktion in ihrem systemischen Sinnzusammenhang.
Kommunikation: Eine wichtige Betrachtungs- und Gestaltungsebene ist die Art, wie Kommunikation wechselseitig geregelt wird, ebenso die Art, wie diese Kommunikation psychische und biologische Abläufe beeinflusst und wie diese wiederum die Kommunikation beeinflussen (Feedbackschleifen). Hierbei muss besonders berücksichtigt werden, wer wie wann mit wem als zum relevanten System gehörend oder nicht dazugehörend betrachtet wird (System-Umwelt-Grenzen).
Kontext: Alles gewinnt seine Bedeutung, seinen Sinn und seine Wirkung erst in seinem Situationszusammenhang, seinem (ökosystemischen) Kontext. Werden verallgemeinernde, aus den jeweiligen Kontexten gerissene Beschreibungen vorgenommen, etwa bei psychopathologischen oder Organisationsdiagnosen, erscheinen viele Phänomene in ihrem Sinn als nicht mehr verstehbar.
Dies hat gravierende Folgen für die Beteiligten selbst, aber auch für Berater, die Aufträge erhalten, die auf der Basis solcher aus dem Kontext gerissenen Verallgemeinerungen und Individualisierungen erteilt werden. Ob zum Beispiel etwas als Kompetenz, als verstehbarer, womöglich wertschätzbarer Lösungsversuch oder gar als adäquate Lösung für bestimmte Ziele unter bestimmten Situationsbedingungen verstanden werden kann oder ob genau das gleiche Phänomen eher als Inkompetenz, Krankheit, Versagen gesehen wird, hängt ausschließlich vom Kontextrahmen ab, in den man es stellt und in dem man es sieht. Erlebte (oder erlebt zu unserer Zeit) beispielsweise jemand als Mitglied einer Kultur mit dionysischen Ritualen, in der zum Zweck religiöser, „höherer“ Ziele (ekstatische Erfahrungen) intensivster Alkoholkonsum (oder der Konsum anderer Hilfsmittel zum Erreichen von Ekstase, z. B. Peyote, Ayahuasca etc.) praktiziert wird, einen enormen Kontrollverlust, so gilt dies als beglückende und bereichernde Erfahrung, die den Erlebenden ehrt und ihm in seiner Gemeinschaft eine bedeutsame Position sichert. Praktiziert jemand in unserer Gesellschaft einen physiologisch völlig identischen Kontrollverlust aber in einer Kneipe (also in einem anderen Kontext), die offensichtlich nicht einen gleichwertigen rituellen Sinnzusammenhang repräsentiert wie ein tief in der Tradition eines sozialen Systems verwurzeltes religiöses Ritual, dann gilt dies eher als ekelhafte, beschämende, ja kranke Verhaltensweise, die den Erlebenden tendenziell sogar aus der Gemeinschaft der als gleichwertig Geltenden ausgrenzt.
Deshalb ist es für kompetenzorientiertes systemisches Arbeiten von überragender Bedeutung, dass die relevanten Beobachter alle Phänomene so beschreiben und so mit Zielaspekten und Kontextbedingungen in Zusammenhang stellen, dass sichtbar werden kann, wofür (z. B. für welche Ziele, für welche Situationen) ein bestimmtes Verhalten überhaupt als Kompetenz verstanden werden könnte (Prinzip der Kontextualisierung und der Utilisation).
„Krankheit“ wird, insbesondere auch psychische und psychosomatische, dies folgt aus solchem Verständnis, nicht als „wirklich wahres“ Phänomen angesehen, sondern ebenfalls als Konstrukt. Aber: Gerade das Konstrukt „Krankheit“ kann eminent wichtiges Organisationselement eines Systems werden, deshalb sollte aus dieser konstruktivistischen Sicht keineswegs zwangsläufig geschlossen werden, man solle z. B. in einer Therapie das Konstrukt „Krankheit“ zielgerichtet auflösen, um so die Menschen zu unterstützen, aus dem Erleben herauszukommen, ausgelieferte Opfer zu sein (wie dies heute noch häufig in der systemischen Therapie praktiziert wird – übrigens gerade von unserer Heidelberger Gruppe vorgeschlagen, siehe z. B. Retzer 1991). Darüber wird später noch mehr zu reden sein (siehe die Kapitel über Sucht bzw. Depression).
Konstruierte „Wirklichkeit“ (= wirksames Erleben): Wirklichkeit wird durch die Art konstruiert, wie etwas von etwas anderem unterschieden wird, wie es bezeichnet, wie es erklärt und wie es bewertet wird (Spencer-Brown 1969). Wird etwas zum Beispiel als Defizit bewertet und wird in erster Linie darauf geschaut, was fehlt, was sich an Unerwünschtem abspielt, ohne dass auf Ausnahmen davon hingewiesen würde (z. B. auf Fälle, in denen etwas Gewünschtes, „Erfolgreiches“ ablief), oder wird es mit vielen Verallgemeinerungen versehen („immer“, „nie“ etc.), wird damit das Bewusstsein aller Beteiligten auf diese Sichtweisen hin eingeengt, quasi „hypnotisch gefärbt“, auch das der Berater. Dann können vorhandene Kompetenzen und erfolgreiche Lösungsversuche nicht mehr gesehen oder viel undeutlicher werden; dies bewirkt dann auch ein Erleben von weniger Kompetenz und Selbstvertrauen.
Muster und Regeln: Werden in einem System solche Wirklichkeitskonstruktionen gestaltet durch miteinander verkoppelte Beiträge, die sich regelhaft wiederholen, wird die Beschreibung dieser Verkoppelungen von Beiträgen in Wechselwirkung „Muster“ genannt. Typische „Bausteine“ solcher Muster sind z. B. die Art, wie ein Phänomen beschrieben wird, wie ihm Bedeutung gegeben wird, z. B durch Erklärungen, Bewertungen, Schlussfolgerungen, welche Lösungsversuche daraus abgeleitet werden und welche Reaktionen darauf wieder gewählt werden, welches Verhalten, welche emotionale Reaktion usw. Dies sind Ebenen der Musterbildung, die auch in den interaktionellen Austausch einfließen. Ich nenne sie „Makromuster“.
Gleichzeitig läuft aber immer im internalen Erlebnissystem der Beteiligten eine Vielzahl von Prozessen ab, auch in regelhafter Weise. Diese sind für die Wahrnehmung und Verarbeitung all dieser Außenreize zentral, ich nenne sie „Mikromuster“. In der Diskussion der hypnotischen Prozesse erlangen gerade diese „Mikromuster“ größte Bedeutung.
Jedes System zeigt Tendenzen, Muster stabil zu halten (Homöostase), da dies Orientierung und offensichtlich auch Sicherheit gibt. Jedes System braucht aber auch in einer sich ständig ändernden Umwelt Musteränderungen (Morphogenese), da es sonst nicht überleben kann. Die Regelungen in sozialen Systemen wirken auf das Erleben der Beteiligten, und dies wirkt wieder auf die Regelungen zurück.
Typische Regelungsbereiche, die wir in lebenden individuellen und sozialen Systemen immer wieder finden, sind z. B. Definition und Auswahl der Beteiligten (wer gehört dazu, wer nicht?); Zielentwicklungsprozesse; die Art, wie Ziele kommuniziert werden; Entwicklung der Schritte zum Ziel; wie und worüber wird kommuniziert bzw. darf kommuniziert werden? Grenzbildungen innen, zwischen den Teilbereichen des Systems; Nahtstellen – Koordination intern, wie verbinden sich die abgegrenzten Innenbereiche wieder? Aspekte der Wertschätzung, Förderung, Motivation der Beteiligten; Abspracheregelungen; Rollenverteilung; Entscheidungsregeln bzw. Hierarchieprozesse; Feedbackregelungen; Konfliktregelungen; informelle Begegnungsrituale; Grenzbildung nach außen; Nahtstellen – Koordination nach außen (z. B. Nachbarn, Freunde, Kunden, andere Teams).
Der Weg durch wichtige Spielarten der Praxis von systemischer Therapie und Beratung
Die hier aufgeführten Grundprämissen systemischer Konzepte sagen noch nicht, quasi sich selbst erklärend, was sie nun für die therapeutische Praxis heißen. Die komplexen systemtheoretischen Konstrukte müssen übersetzt werden auf praktisches Handeln in Therapie und Beratung. In diesen Kontexten geht es in aller Regel eben nicht darum, schöne akademische Metabeschreibungen zu entwerfen in Bezug darauf, wie man die Dynamik von Systemen verstehen könnte. So etwas wäre in Therapie oder Beratung allenfalls einmal ein Mittel zum Zweck. Vielmehr sind dies immer Kontexte, in denen Menschen in aller Regel mit spezifischen Anliegen kommen und eine professionelle Dienstleistung in Auftrag geben. Diese Kunden und Kundinnen (in manchen Kontexten wie z. B. dem „Gesundheitswesen“ – welches wohl besser „Krankheitswesen“ genannt würde – werden sie immer noch z. B. „Patienten“ und „Patientinnen“ genannt) kommen mit der berechtigten Erwartung, dass dann auch von den Auftragnehmern (Therapeuten und Therapeutinnen, Berater und Beraterinnen) spezifisch etwas geleistet wird, das ihren Anliegen dient. Alle Maßnahmen und Angebote an die Kunden sollten konsequent daraufhin geprüft werden, ob sie diesen Anliegen effektiv dienen, die Güte eventueller Interventionen sollte auch daran abgelesen werden. Wir brauchen also eine auftragseffektive Umsetzung systemischer Theorie in die Praxis.
In den meisten Fällen werden an Therapeuten bzw. Berater Aufträge mit Veränderungserwartungen herangetragen. Wie dann damit umgegangen wird, hängt wieder davon ab, wie man sich a) die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemen und Symptomen und b) die Entwicklung von Veränderung und, daraus folgernd, c) die Rolle und Aufgaben von Therapeuten bzw. Beratern vorstellt.
In den diversen „traditionelleren“ Therapieverfahren gibt es typischerweise bestimmte Annahmen darüber, was für eine hilfreiche, gesundheitsförderliche Entwicklung in der Therapie nötig sei. Diese heben je nach Konzept auch sehr unterschiedliche, teilweise sich auch widersprechende Aspekte hervor, z. B. die Idee, man müsse zunächst im therapeutischen Prozess die „Übertragung“ sich entwickeln lassen, die man dann zu analysieren habe, um die Genese der Probleme im geschichtlichen Kontext zu „verstehen“ und „durchzuarbeiten“, emotionale Prozesse müssten aktiviert, eventuelle emotionale „Blockaden“ aufgelöst, Lerndefizite aufgefüllt werden etc.
In der systemischen Arbeit aber geht man davon aus, da ja jede Realität ohnehin als jeweils konstruiert verstanden wird, dass ein Problem Ausdruck von ungünstig wirkenden Realitätskonstruktionen (individuell und interaktionell) in bestimmten Kontexten ist. Hinzu kommt als wichtiges Kriterium, wie man sich aus systemischer Perspektive das Erzeugen von Information vorstellt. Information entsteht aus dieser Sicht jeweils durch das Bilden von Unterschieden, Information ist der Prozess und das Ergebnis von Unterschiedsproduktion. Deshalb versucht alle Therapie, „im weitesten Sinne die Beschreibungen zu verändern, über die Wirklichkeit erfahren wird“. Sie erscheint als „ein gemeinsames Ringen um Wirklichkeitsdefinitionen. Alle psychologischen Maßnahmen verändern, wenn sie erfolgreich sein sollen, die Art und Weise, wie in der Familie übereinander, über Probleme, über psychische Störungen, Krankheit und die damit zusammenhängenden Optionen gesprochen wird. Sie verändert also die den Betroffenen gemeinsamen Sinnstrukturen im Kontext eines jeweiligen Systems“ (von Schlippe 1995, S. 23 f.). Dies sollte nicht nur kognitiv, sondern auch durch konkrete leibliche Erfahrungen geschehen.
Dieses Grundverständnis nun lässt wieder viel Raum dafür, wie man Veränderungen anregen könnte. Die Entwicklungsgeschichte der Familientherapie allgemein und der systemischen Therapie im Besonderen weist da viele teilweise übereinstimmende, teilweise recht weitgehend voneinander abweichende Konzeptionen auf, die auf Anwender (wie ich durch viele entsprechende Kommentare bei vielen Weiterbildungen und Supervisionen weiß) häufig nicht hilfreich, sondern eher verwirrend wirken. Ich selbst hatte die Gelegenheit (und das Glück?), seit Mitte der 1970er-Jahre praktisch alle relevante Entwicklungen der Familientherapie und der systemischen Therapie und Beratung ganz hautnah in Theorie, vor allem aber in gelebter Praxis mitmachen zu dürfen. Zunächst durch die weltweit intensive Vernetzung, betrieben von Helm Stierlin, und später dann durch unsere gemeinsamen Aktivitäten als Heidelberger Gruppe hatten wir die in dieser Zeit einmalige Situation, dass praktisch alle international wichtigen und führenden Vertreter und Vertreterinnen der Familientherapie und der systemischen Konzeptionen zu uns nach Heidelberg kamen und wir voneinander lernen konnten. Ich selbst, ursprünglich Diplomvolkswirt, hatte meinen Beruf gewechselt und noch Medizin studiert, ausschließlich deshalb, weil mich die Ansätze, Probleme nicht mehr nur aus einem „gestörten“ individuellen Prozess heraus zu erklären, sondern in einen kontextuellen Sinnzusammenhang zu stellen, ungemein faszinierten, insbesondere im Bereich der Therapie von Psychosen.
Die, geschichtlich gesehen, zeitlich aufeinander folgenden Modellvorstellungen leben nämlich mit durchaus noch recht kraftvollem Eigenleben wie verwandte, aber mutierte Spezies im Reich von Fauna und Flora unverdrossen nebeneinanderher.
Die mehr geschichtlich orientierten Mehrgenerationen-Familientherapiemodelle wie die von M. Bowen, I. Boszormenyi-Nagy, die frühen Bindungs-/Ausstoßungs-/Delegationskonzepte von Helm Stierlin oder die Vorstellungen von N. Paul (hinsichtlich unbewältigter Trauerprozesse in Familien, die zu Symptomen führen können) fordern wieder mehr die Beachtung des Kontenausgleichs der Schuld- und Verdienstkonten und die Beachtung der familiären „Vermächtnisse“ etc. Gerade diese Sichtweisen finden sich dann übrigens wieder in den Konzepten der „richtigen Ordnung“ von Bert Hellinger – allerdings oft, ohne dass dies auch genügend transparent gemacht würde, was gerade der dort so hochgehaltenen Idee, die jeweiligen Vorgänger zu würdigen, ja gar nicht entspricht.
In den Anfangsjahren unserer Heidelberger Gruppe orientierten wir uns vorrangig an diesen Mehrgenerationenkonzepten. Dementsprechend war unsere Arbeit geprägt von den Bemühungen, die ganze Familie mit mehreren Generationen in einen Diskurs des Verstehens der Familiengeschichte, der Würdigung und des Ausgleichs von Verdiensten und der Versöhnung einzuladen. Dies erfolgte in oft vielen, in relativ kurzen Abständen (ca. zwei bis drei Wochen) aufeinander folgenden Sitzungen. Die Erfolge waren teilweise beeindruckend, nicht selten bewegte sich aber auch wenig.
Dann gewannen, teilweise auch bei uns, die mehr von normativen Funktionsvorstellungen durchdrungenen Modelle mehr Einfluss, wie z. B. die der strukturalistischen Familientherapie (Minuchin), der direktiven strategischen Therapie (Haley, Madanes), die davon ausgehen, dass es grundsätzlich funktionalere Organisationsformen in Familien gibt (klare Generationsgrenzen, Vermeiden von Triangulationen etc.), für deren Umsetzung sich die Therapeuten auch engagieren sollten. Diesen Vorstellungen folgend, versuchten wir, die Familien dazu zu bewegen, wieder klare familiäre Hierarchien aufzubauen, die Kinder aus Konfliktdreiecken herauszuhalten, Generationsgrenzen zu stärken und die Eltern anzuhalten, sich auf eine gemeinsame Linie den Kindern gegenüber zu einigen. In „family lunches“ (Minuchin) mit Familien von anorektischen Mädchen z. B. versuchten wir, die Eltern dazu zu bewegen, sich so lange gemeinsam zu engagieren, bis sie die Indexpatientinnen wieder zum Essen gebracht hatten.
Die Therapeuten gerieten dadurch aber sehr stark in die Rolle der Vertreter bestimmter Normvorstellungen. Ich erlebte dies immer wieder als Gestaltung von ungleichen Beziehungen, in denen die Therapeuten auch beanspruchten, die „Wissenden“, die Experten zu sein, die besser als die Familien selbst wussten, was für diese gut sei und was sie deshalb auch gefälligst zu machen hätten. Mit dieser Rolle fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Immer hatte ich den Eindruck, dass ein solches Vorgehen der Einzigartigkeit und den (kontextbezogen sehr unterschiedlichen) Bedürfnissen und Aufträgen der jeweiligen Familien einfach nicht genug dient. Die Maxime, an der ich mein Handeln ausrichten wollte (dies gilt, noch viel konsequenter als damals, auch heute) war: „Gehe mit Menschen so um, wie du selbst gerne hättest, dass man mit dir umgeht, insbesondere dann, wenn du auf das Wohlwollen anderer angewiesen bist.“ Unseren Umgang mit den Klienten und ihren Familien erlebte ich, obwohl sehr gut gemeint, häufig aufgrund dieser Expertenposition ihnen gegenüber als nicht dieser Maxime entsprechend.
In den systemisch-konstruktivistischen Therapie- und Beratungsmodellen, die wir seit ca. 1977 in engem Austausch mit der Mailänder Gruppe (Selvini, Boscolo, Cecchin, Prata) zum zentralen Modell unserer Arbeit machten (die als der Ansatz der Neuen Heidelberger Gruppe bekannt wurde), wurde dann immer konsequenter davon ausgegangen, dass man keineswegs unbedingt z. B. die Geschichte (weder die individuelle noch die familiäre) ganz „verstehen“ oder „aufarbeiten“ müsse oder in so massiver Form wie z. B. bei Minuchin von einer übergreifend „richtigen oder funktionalen“ Organisation des Systems ausgehen könne. Dennoch waren die Vorstellungen klarer Grenzen zwischen den Generationen, klarer Kommunikation etc. wichtige Orientierungspunkte. Auch die späteren Entwicklungen in der Arbeit von Mara Selvini Palazzoli weisen noch in diese Richtung, wenn sie konsequent immer wieder die „ubiquitäre Verschreibung“ anbot, mit der z. B. Eltern dazu gebracht werden sollten, eine klare Grenze zu anderen Subsystemen in der Familie aufzubauen.
Zentrale Basis der Arbeit war aber die Sicht (da alles Erleben, auch Probleme, als Ausdruck von Mustern angesehen wird), dass allgemein Veränderung jeweils dadurch passiert, dass Unterschiede in bisherige Muster (Vernetzungen) eingeführt werden. Wo und wie diese Unterschiede gebildet und in die Organisation des Systems implementiert werden können, ist dabei noch nicht spezifisch eingegrenzt, die Unterschiede sollten nur bedeutsam sein („Unterschiede, die einen Unterschied machen“), könnten sich aber z. B. darauf beziehen, dass ein bestimmtes Verhalten geändert wird, Bewertungen oder Beschreibungen von Phänomenen (wie z. B. von „Krankheiten“) verändert werden, Abläufe zeitlich oder örtlich verändert werden etc.
Auch in diesem Vorgehen war die Art, wie die Gespräche gestaltet und Interventionen gebildet wurden, dabei natürlich sehr geprägt davon, wie man sich die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Symptomen vorstellte. Als vorrangig wurde damals angesehen, dass lebende Systeme, um ihr Überleben zu sichern, vor allem versuchen, ihre Homöostase aufrechtzuerhalten und alle Abweichungen davon durch (negatives) Feedback wieder auf den Ausgangswert zu bringen (der Aspekt der Morphogenese war noch nicht genug als bedeutsam berücksichtigt). Und: Wenn diese Homöostase durch irgendwelche Ereignisse stark gestört wird, kann dies bei Beteiligten im System massiven Stress auslösen, der z. B. auch zu Symptomen führen kann. Diese Symptome wiederum wirken aber wie ein Feedback im System auf seine Organisation ein, sehr oft sogar so, dass sie zur alten Homöostase zurückführen. Wenn z. B. in einer Familie die Eltern auseinander streben und von Familienmitgliedern die Gefahr einer Trennung empfunden wird und gerade in dieser Phase eine adoleszente Tochter mit einem Hungerstreik beginnt, der dann als Anorexie diagnostiziert wird, kann dies als so gefährliche Notsituation in der Familie erlebt werden, dass alle zentripetalen Bewegungen gebremst werden, die den Familienbestand gefährden könnten. Um der Gefahr zu begegnen, kann die Familie als „Notgemeinschaft“ wieder zu mehr Kohäsion finden, können die alten Bindungskräfte wieder aktiviert werden, kann das System sich wieder stabilisieren, nun aber mit Einbau des Problems „Anorexie“.
Diese Sicht führte uns dazu, dem Symptom intensiv zuzuschreiben, es habe jeweils eine homöostatische Funktion in der und für die Familie. Daraus wieder wurde geschlossen, dass dann die Aufträge, welche uns die Familien gaben, mit großer Wahrscheinlichkeit äußerst widersprüchlich, ja paradox seien, z. B. in der Art: „Helft uns schnell, die Symptome zu ändern und aufzulösen, wagt es aber ja nicht, dies zu tun, denn dies würde unsere Homöostase gefährden.“ Die Aufträge wurden als Doublebind (Zwickmühle) empfunden, das nur dadurch wieder aufgelöst werden konnte, dass die Therapeuten selbst noch geschickter als die Familien paradox vorgingen (dementsprechend lautete auch der Titel des damals als Pionierwerk angesehenen Buches der Mailänder Gruppe: Paradoxon und Gegenparadoxon). „Paradoxe Interventionen“ waren z. B. Vorschläge an die Klienten, gezielt das für eine umschriebene Zeit zu machen, was sie als Ziel der Therapie gerade auflösen wollten (z. B.: „Wir finden, dass es noch zu früh ist, die Symptome jetzt schon abzulösen. Damit Sie die Zusammenhänge besser verstehen können, die bisher zu diesen qualvollen Depressionen beigetragen haben, möchten wir Sie bitten, jeden Abend von 18 bis 19 Uhr sich darauf zu konzentrieren, in dieser Zeit besonders depressiv zu sein und dabei alle Gedanken und sonstigen Prozesse, die dazu beitragen können, genau zu registrieren“). Diese auch als „Symptomverschreibung“ bekannten Interventionen sollten die bisherige Organisation des Systems unterbrechen, bisherige Lösungsversuche bremsen und neue Strategien anregen, oft auch um den Widerstand der Klienten und ihrer Familien gegen Veränderung zu unterlaufen und zum Gegenteil zu provozieren.
Diese Perspektive führte fast zwangsläufig dazu, dass wir systemischen Therapeuten aus meiner Sicht praktisch alle in eine milde paranoide Haltung den Familien gegenüber gerieten. Die Interviews und Interventionen wurden aus einer strategisch-distanzierten Haltung zum Teil mit elaborierter Raffinesse gestaltet. Wir führten die Interviews strikt nach unseren Vorstellungen. Die Gespräche waren wie ein Ritual aufgebaut: a) Zunächst wurden schon vor der Sitzung von den Therapeutenteams Hypothesen darüber gebildet, welche Muster in den Familien wahrscheinlich das Problem aufrechterhalten könnten (bei uns waren es üblicherweise vier Therapeuten, zwei, die das Interview führten, und zwei Beobachter hinter der Einwegscheibe); dann folgte b) das Interview selbst (ca. 90 Minuten), in dem die Therapeuten, abgeleitet aus diesen Hypothesen, viele zirkuläre Fragen stellten als Instrument dafür, möglichst viele Informationen über die problemerhaltenden Muster zu gewinnen; daran schloss sich c) die Beratung zusammen mit den Beobachtern an. Hierbei wurden die gewonnenen Informationen als Grundlage genutzt für die Beschreibung von Mustern, die wir als problemstabilisierend ansahen. Daraus wurden dann die Interventionen abgeleitet, die (z. B. als positive Umdeutungen von bisher als „krankhaft“ angesehenen Phänomenen oder als „paradoxe Intervention“) bewirken sollten, dass die Familien sich in hilfreicher Weise neu organisierten. Diese Interventionen wurden dann d) durch die Interviewer als Schlusskommentar an die Familien übermittelt. Dabei wurde sehr darauf geachtet, nur diesen Kommentar zu geben und dann keinesfalls noch weiter mit den Familien zu reden, aus der Befürchtung heraus, dies könne die Wirkung der Interventionen behindern.
Den Familien wurde nicht transparent erläutert, welche Hypothesen wir jeweils hatten und welche Absichten wir mit den Interventionen verbanden. Das wurde schon deshalb als sehr wichtig angesehen, weil wir ja davon ausgingen, die Familien würden jede transparente Information über unser Vorgehen und überhaupt jede ausführlicher Konversation über die zirkuläre Befragung und den Schlussinterventionskommentar hinaus sofort mit Gegenregulation zur Wiederherstellung der alten Homöostase (und damit zur Restabilisierung der Symptome) beantworten.
Ich erinnere mich an eine mich sehr beeindruckende Situation, als Mara Selvini Palazzoli wieder einmal in Heidelberg bei uns zu Besuch war (in der Abteilung für Familientherapie, deren Leitung Helm Stierlin innehatte). Sie beklagte sich dabei einmal, es sei in den letzten Jahren immer schwieriger geworden mit ihrer Arbeit, da sie so bekannt und erfolgreich geworden sei. Es käme jetzt öfter vor, dass Familien schon ganz gelassen kommentieren würden: „Aha, Sie machen jetzt wohl eine paradoxe Intervention mit uns, so wie Sie das in ihrem Buch beschreiben …“ Ich fragte mich dabei, was es eigentlich für eine merkwürdige Konzeption ist, wenn Menschen Angebote für die Gestaltung ihres Lebens bekommen und man dabei davon ausgeht, sie dürften nicht vollständig eingeweiht sein in das, worum es da geht, die Anbieter der Intervention aber sehr wohl. Diese Aspekte von asymmetrischer Beziehungsgestaltung kamen mir überheblich und letztlich die Klienten abwertend vor. Für mich war zweifelsfrei klar, dass ich selbst so nicht behandelt werden wollte und sicher auch mit großem Widerstand auf solche Angebote reagiert hätte. Und auch wenn wir damit oft erstaunliche, ja spektakulär anmutende Erfolge (i. S. von Symptomverbesserungen oder -auflösungen) erzielen konnten, hatte ich den Eindruck, dass wir weit unter den Möglichkeiten blieben, die ich in dem Grundmodell einer systemisch-konstruktivistischen Konzeption angelegt sah.
Ein aus meiner Sicht schwer wiegendes Manko unserer (damals meist noch so häufig als möglich die Familie von Indexklienten einbeziehender) Arbeit war auch, dass entgegen unserer Absicht sehr häufig die Kooperation mit uns von den beteiligten Klientensystemen als ein deutlicher Hinweis darauf erlebt wurde, dass die Familie wahrscheinlich doch in erheblichem Maß ein wichtiger Problemkontext sei, dass quasi die Familie ein „Herd der Störung“ sei (entsprechend der Idee „Patient Familie“ von H. E. Richter). So wurden viele Therapien von den Beteiligten im Familiensystem eher als Tribunal denn als wertschätzende Hilfe erlebt. Das wollten wir zwar nicht, aber gemäß unserer eigenen Konzepte mussten wir zerknirscht einräumen, dass die Bedeutung einer Botschaft eben immer die Empfänger und nicht die Sender der Botschaft bestimmen. Ebenso sehr missfiel mir, dass aufgrund der Prämissen, an denen wir uns orientierten, letztlich die Familien als sehr defizitär beschrieben wurden. Gleichzeitig gingen wir ja aber davon aus, dass unsere Interventionen die Familien anregen könnten, in Selbstorganisation hilfreiche Entwicklungen zu gestalten. Ohne diese Annahme wären unsere Interventionen weder logisch noch ethisch haltbar gewesen. Wenn Familien, Paare oder einzelne Klienten aber zu solchen selbst organisierten Entwicklungen fähig sein konnten (was uns ja in vielen Therapien klar demonstriert wurde), dann konnte aus meiner Sicht diese Einschätzung der Klienten und ihrer Familien als defizitär nicht stimmen.
Die Entwicklungen im Feld der systemischen Ansätze seit Mitte der 1980er-Jahre haben schon viele dieser für mich problematischen Annahmen und Haltungen relativiert oder aufgelöst. Immer deutlicher wurde uns, gerade auch durch viele Reaktionen von Klienten, dass wir die Bedeutung, die sie unseren Angeboten gaben, mehr berücksichtigen mussten. Manchmal reagierten Klienten und ihre Familien recht irritiert und mit Widerstand darauf, wenn wir von Anfang der Zusammenarbeit an zügig viele Fragen zu ihrem Familiensystem stellten. Dies machte uns immer klarer, dass wir unsere eigenen Angebote kritischer beleuchten mussten. Die Idee, eine Familientherapie zu machen, war z. B. in vielen Familien durchaus umstritten. Wenn wir dann von Beginn an familientherapeutisch vorgingen, wirkte sich das aus, als ob wir Partei für die Mitglieder ergreifen würden, die für Familientherapie waren, und damit aber auch parteiisch gegen andere in der Familie würden. Dies führte eher zu mehr Konflikten in der Familie, unsere Beiträge veränderten also die familiäre Dynamik. Die Annahme, dass wir durch unsere Fragen herausarbeiten könnten, „wie die Familie ist“, erwies sich als völliger Trugschluss. So wurde immer deutlicher, dass wir niemals herausfinden konnten, „wie die Familie ist“. Indem wir ihnen begegneten und auch durch die Art, wie wir ihnen begegneten, trugen wir unentrinnbar zu Veränderungen bei, sodass die Familie, die wir sahen, niemals die gleiche Familie war, die sich bei sich zu Hause organisierte. Wir als „Beobachter“ des Systems bewirkten Veränderungen des zu beobachtenden Systems durch unsere Beobachtungen. Die Theorie des Beobachters oder die Kybernetik der Kybernetik (Kybernetik 2. Ordnung) wurde zentrale Basis unserer Arbeit (von Foerster 1981, 1993; Schiepek 1991; Tomm 1994). Familiendiagnosen und Systemdiagnosen generell erschienen nun als immer zweifelhafter, denn der diagnostische Prozess veränderte ja schon an sich wieder das, was man diagnostizieren wollte. Wir legten nun viel mehr Wert darauf, mit den Familien achtungsvoll ihre Ansichten dazu ernst zu nehmen, ob Therapie überhaupt sinnvoll sei, und auch dazu, was eventuell dort besprochen, was aber auch nicht besprochen werden sollte. Ein wichtiger Teil der Arbeit wurde es, mit den Familien zusammen die Therapiekooperation gemeinsam auszuhandeln und zu planen.
Dabei stellte es sich z. B. oft heraus, dass es für die Familien viel hilfreicher war und unsere Kooperation viel konstruktiver wurde, wenn wir unsere Angebote nicht mehr „Familientherapie“ nannten, ja oft sogar gar nicht mehr „Therapie“, sondern mit den Betroffenen für sie passendere Etikettierungen entwickelten. Wir erkannten es also als relevanter an, die autonomen Weltmodelle der Betroffenen zu beachten.
Definition „Therapie“ und „Beratung“
Ich verwende deshalb in diesem Buch auch immer die Begriffe „Therapie“ und „Beratung“ nebeneinander. Die jeweiligen Bezeichnungen für eine entsprechende Kooperation stellen aus systemischkonstruktivistischer Sicht immer nur Realitätskonstruktionen dar, keine Wahrheiten. Es ergibt deshalb auch keinen Sinn, sie genau abgrenzen zu wollen mit Beschreibungen aus sich selbst heraus (z. B. „Im Gegensatz zu Beratung ist Therapie …“). Geprüft werden sollte immer, welche Etikettierung („Therapie“, „Beratung“, „Coaching“, „begleitende Supervision“, „unterstützende Familiengespräche“ oder was auch immer) die Kooperation optimal unterstützen würde. Die Begriffe sind also zieldienlich zu gebrauchen. Deshalb werde ich in dieser Einführung der Einfachheit halber nur noch von „Therapeuten“ und „Therapeutinnen“ reden.
Der Begriff „Therapie“ z. B. müsste dann aber, wie die hier ausführlich zu diskutierenden Ideen der Aufmerksamkeitsfokussierung zeigen, jeweils sehr kritisch behandelt werden. Denn üblicherweise assoziieren die meisten Menschen in unserer Kultur damit auch, dass jemand, der in Therapie geht, irgendwie durch Defizite oder Pathologie gekennzeichnet ist. Dies stellt aus der hier vertretenen Sicht natürlich keine Wahrheit, wohl aber eine sehr wirksame Realitätskonstruktion dar, die solche Realitäten mit schafft, welche sie dann wieder auflösen will.
Bei der jeweiligen Begriffswahl sind natürlich auch wichtige Kontextfaktoren zu beachten; soll z. B. die Krankenkasse eine jeweilige Kooperation als bezahlungspflichtig akzeptieren, muss sie „Psychotherapie“ genannt werden, und deren Kontraktbedingungen sind zu beachten. Die möglicherweise inhaltlich gleichen Interaktionen der Kooperationspartner würden in einem beruflichen Kontext vielleicht eher als „Coaching“ bezeichnet. Gemeint ist hier in allen Fällen, mit denen wir uns beschäftigen, die Kooperation zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern (unter Berücksichtigung der für beide Seiten relevanten Kontextbedingungen). Diese sollte sich orientieren an den Aufträgen und Zielvorstellungen, welche die Auftraggeber einbringen, aber auch andere eventuell wichtige Auftraggeber (wie z. B. Gesetzgeber, Rentenversicherer) und ihre Ziele müssen beachtet werden, ebenso die eigenen ethischen Werte der Therapeuten. Dann sollte mit den direkten Auftraggebern differenziert ausgehandelt werden, welche Ziele und Schritte dahin in einer Kooperation sinnvoll sein könnten. Zentral dabei sollte sein, dass man sich gemeinsam nur an Zielen orientiert, die mit der erlebbaren Eigenkompetenz der Beteiligten realisierbar sind (sonst trägt die Kooperation zum Erleben von Insuffizienz und Versagen bei). Jeder Schritt in dieser Kooperation sollte wieder auf seine Wechselwirkungen hin mit allen von den direkt Beteiligten als relevant angesehenen Kontextfaktoren geprüft werden, und von dort aus sollten wieder die nächsten Schritte gemeinsam abgestimmt werden.
Auch die immer einflussreicher werdenden Konzepte der Autopoiese (Maturana 1982; Maturana u. Varela 1987) verstärkten die beschriebenen Haltungsänderungen intensiv. Die Erkenntnisse aus der biologischen Erforschung von Wahrnehmungsprozessen und der Selbstorganisation lebender Systeme zeigen, dass lebende Systeme ihre Wahrnehmung als innere, autonom selbst organisierte Prozesse gestalten, also von außen zu keinem Erleben gezwungen werden können. Ebenso machen sie deutlich, dass jede Beschreibung, die z. B. ein Mensch macht, nicht abbildet, wie es „da draußen wirklich ist“, sondern seine Entwürfe des „da draußen“ abbildet. („Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt.“) Auch dies weist auf die Problematik von Diagnosen hin, die besonders dann keinen Sinn mehr haben, wenn sie behaupten, sie würden beschreiben, wie das Beobachtete „ist“. Sie beschreiben vielmehr die Prozesse des Beobachters.
Eine weitere wichtige Konsequenz der Autopoiesekonzepte war für uns, dass die Vorstellungen der frühen systemischen Arbeit, nämlich dass der Kontext so zentral sei, dass er praktisch das Erleben der Beteiligten darin bestimme, deutlich relativiert werden mussten. Wenn es keine „instruktiven Interaktionen“ gibt (also Interaktionen, die Beteiligte zu einem bestimmten Erleben oder Verhalten zwingen können), ist der Kontext als einladende Umwelt zwar wichtig, aber es bleibt viel Raum für die autonome Antwort des Individuums darauf. Die Autopoiese brachte also das Individuum wieder viel mehr in den Fokus unserer Aufmerksamkeit. Folgerichtig wurden unsere Angebote wieder viel flexibler, es musste nicht mehr die ganze Familie kommen, systemisch orientierte Einzeltherapie wurde ein immer häufiger als sehr sinnvoll angesehenes Instrument. In dieser Phase unserer Arbeit – und aus meiner Sicht ist das bis heute in vielen Anwendungsfeldern systemischer Arbeit so – wurden zentrale Implikationen der Autopoiesetheorie nicht genügend genutzt, z. B. die systematische Betrachtung und Beeinflussung der autopoietisch produzierten Wahrnehmungsprozesse (sowohl der zu Problemen beitragenden als auch der lösungsförderlichen). Diese Implikationen konsequent zu beachten und daraus Interventionshilfen herzuleiten stellt sich, wie ich weiter unten zeigen will, der hypnosystemische Ansatz als eine zentrale Aufgabe.
Ebenfalls sehr hilfreich war dafür z. B. die Idee des „problemdeterminierten Systems“ (Anderson a. Goolishian 1988). Die Goolishian-Gruppe schlug damit vor, die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemen nicht mehr als Hinweis auf grundsätzliche Dysfunktionalitäten der Familien anzusehen. Vielmehr könne man auch sagen, dass Phänomene, die später „Problem“ genannt werden, einfach auftreten können, manchmal vielleicht sogar durch Zufall (oder durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen, die etwa zu einem Unfall führen, etc.). Als Reaktion darauf bilden sich dann Interaktionen um das Phänomen herum, es werden Kommunikationsakte gebildet, die das Phänomen sogar zu lösen versuchen, aber (sogar ungewollt) bewirken, dass das Phänomen aufrechterhalten oder gar verstärkt wird. So gesehen, bildet sich quasi um das Problemphänomen herum ein System (System hier verstanden als Geflecht von Wechselwirkungen in Beziehungen, nicht unbedingt als die Familie), redundante Muster führen immer wieder den Prozessen, die als „Problem“ erlebt werden, Energie zu.
Mit dieser Sicht vom „problemdeterminierten System“ konnte nun diese quasi detektivische, teilweise Misstrauen auslösende Sicht auf Familien aufgegeben werden. Man musste nicht mehr befürchten, dass die Familien mit vehementer Kraft versuchen wollten, ihre dysfunktionalen, die Symptome funktionalisierenden Homöostasemuster aufrechtzuerhalten. Pragmatisch gelassen konnte man nun zusammen mit den Beteiligten schauen, welche Muster eventuell, sogar ungewollt, als Beiträge zur Aufrechterhaltung des Unerwünschten (des „Problems“) wirkten, und gemeinsam überlegen, welche Unterschiede im Verhalten, in der Beschreibung und Bewertung etc. das Problem auflösen könnten. Dieses Vorgehen ermöglichte viel mehr praktizierte Wertschätzung der Klientensysteme, als uns das früher möglich war. Auch konnte endlich wieder den am Problem Leidenden viel mehr Empathie entgegengebracht werden, ein Umstand, der mir in unserer früheren Arbeit sehr gefehlt hatte. Allerdings empfand ich auch diese Entwicklung als noch viel zu sehr fokussierend auf die Erlebnisbereiche der „Problemwelt“. Solche Fokussierungen können aber wieder eventuell genau eine Organisation der Wahrnehmung bewirken, die dem Problemerleben Energie zuführt. Ich werde diese Bedenken in meinen weiteren Überlegungen ausführlicher begründen.
Auch weitere Entwicklungen im systemischen Feld, wie z. B. das Konzept des „Reflektierenden Teams“ (Andersen 1990) und die „narrativen Verfahren“ brachten aus meiner Sicht wichtige Fortschritte hin zu einer mehr gleichrangig-achtungsvollen Gestaltung der Beziehung zwischen Klientensystemen und Therapeuten. Beim Reflektierenden Team wurde mehr und mehr auf die Schlussinterventionen im Sinne des Mailänder Modells verzichtet, die Beobachter werden am Ende der Sitzung von den Klientensystemen dabei beobachtet, wenn sie ihre Beobachtungen und Kommentare dazu austauschen. Diese Angebote werden dann ganz in Selbstorganisation von den Klientensystemen „weiterverarbeitet“. So wird ihre Autonomie und ihre Eigenkompetenz von vornherein mehr rituell geachtet, die Interventionen der Therapeuten werden nicht mehr quasi „von oben herab“ an sie übermittelt, die Klientensysteme selbst werden mehr als Experten für ihr Leben gewürdigt. Allerdings erlebte ich viele Sitzungen nach dem Modell des Reflektierenden Teams als sehr komplexitätserhöhend für die Beteiligten, die Vielfalt der Angebote bewirkte eine sehr breite „Streuwirkung“, die aus meiner Sicht viele Chancen für eine kraftvolle, lösungsförderliche Fokussierung ungenutzt lässt.
Die 1990er-Jahre brachten eine intensive Auseinandersetzung mit narrativen Verfahren und ihre Nutzung in der systemischen Therapie. Jetzt wurde mit ihnen der Blick nicht mehr so sehr auf die strukturelle Organisation der Beziehungssysteme gerichtet, sondern darauf, welche „Geschichten“ die Menschen über sich, ihr Leben, die Welt im Allgemeinen, über ihre Möglichkeiten etc. entwerfen und sich dann mit ihnen so identifizieren und sich an ihnen so intensiv orientieren, dass sie zu ihrer subjektiven „Wahrheit“ (also zur wirksamen Wirklichkeitskonstruktion) werden. Probleme und Symptome werden damit gesehen als Ergebnis von Geschichten, die den Betroffenen den Blick auf andere, grundsätzlich mögliche, hilfreichere Geschichten und Entwicklungen verstellen. Die Arbeit in der Therapie oder Beratung konzentriert sich dann darauf, zusammen mit den „Autoren“ durch den Blick auf Lebensereignisse, die andere, hilfreichere „Geschichten“ unterstützen würden, die Geschichten entsprechend umzuschreiben.
Mit den narrativen Verfahren rückte aus meiner Sicht in sehr günstiger Weise noch mehr in den Blick, wie Menschen in autonomer Selbstorganisation (aus hypnosystemischer Sicht würde ich sagen: „in selbsthypnotischer Weise“) ihr Erleben konstruieren und aufrechterhalten. Auch kann mit ihnen intensiv die autonome Autorenkompetenz der Klientensysteme gewürdigt und so eine gleichrangigere Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten weiter ausgebaut werden. Wichtige Vertreter dieses Ansatzes wie z. B. H. Goolishian führten ihn aber zu Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rolle der Therapeuten, die aus meiner Sicht in ungünstiger Weise das alte Modell der professionellen Experten, die strategisch und sehr raffiniert Interventionen konstruieren, welche die dysfunktionalen Muster „knacken“ sollen, in Schwarz-Weiß bzw. Entweder-oder-Manier einfach nur umdrehten, auf den Kopf stellten. Sie wollten nun nur noch mit „grenzenloser Neugier“ aus einer Haltung des „Nichtwissens“ heraus die Geschichtsentwürfe der Klienten staunend kennen lernen und die eigentlichen Autorenexperten zur Entwicklung neuer Geschichten anregen (Anderson u. Goolishian 1992a). Diese Haltung drückt meines Erachtens viele wertvolle Aspekte aus, z. B. eine gewisse achtungsvolle Demut den autonomen Klienten gegenüber, auch ausgeprägte Toleranz gegenüber anderer als den eigenen „Geschichten“. Aus meiner Sicht spielt sie aber die Kompetenz und die Bedeutungsmöglichkeiten der Therapeuten so herunter, dass ihre Kompetenz, Erfahrung und auch Expertenwissen im Dienste der Klienten oft zu wenig genutzt wird. Ich erinnere mich gut daran, wie Goolishian als Gastreferent bei uns Anfang der 1990er-Jahre in Heidelberg Familien auf der Basis dieses Ansatzes interviewte. Ich und andere Kollegen erlebten dies als eher dahinplätschernden Smalltalk mit den Familien, eher als Gespräche mit Bekannten im Café, ohne klare Fokussierung auf die Anliegen der Familien (die ja immerhin derentwegen gekommen waren, und nicht, um sich gemütlich mal so zu unterhalten). Die Wirkungen, die wir danach von den Familien berichtet bekamen, waren auch eher vernachlässigbar. Meiner Meinung nach wurde so eine sehr bedeutsame und sehr hilfreiche Grundidee für therapeutische Kontexte viel weniger genutzt, als es möglich gewesen wäre.
Der hypnosystemische Ansatz
Mit „hypnosystemisch“ wird hier das Modell bezeichnet, welches sich im Laufe der letzten 25 Jahre als Ergebnis meiner Bemühungen herausgebildet hat, systemische Konzepte für Psychotherapie und Beratung (Coaching, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung) mit den Modellen der kompetenzaktivierenden ericksonschen Hypno- und Psychotherapie und anderen dazu passenden Konzepten (z. B. aus Psychodrama, Körpertherapien u. a.) zu einem konsistenten Integrationsmodell zu verbinden und weiterzuentwickeln. Sowohl meine eigenen Erfahrungen als auch die vieler Kollegen, die dieses Modell für ambulante oder stationäre Kontexte übernommen haben, zeigen, dass man damit noch wesentlich flexibler, wirksamer und quasi mehr maßgeschneidert auf die einzigartigen Kulturen der jeweiligen Klientensysteme eingehen kann, als dies mit den traditionelleren Verfahren oder den „üblichen“ systemischen oder auch hypnotherapeutischen Ansätzen gelingt.
Für mich erschien es geradezu fast zwangsläufig logisch, die systemischen und die ericksonschen Hypnotherapiekonzepte miteinander zu verbinden. Beide gehen von der Idee aus, alle Lebensprozesse mit dem Blick auf eine mögliche Beschreibung von Mustern zu betrachten. Beide verstehen lebende Systeme als sich selbst organisierende, autopoietische Systeme. Erickson kannte zwar diesen Begriff noch nicht, in allen seinen Arbeiten seit den 1930er-Jahren hat er die Autopoiesetheorien aber in Theorie und vor allem in seiner Praxis konsequenter vorweggenommen, als sie bis heute oft sogar in systemischer Arbeit umgesetzt werden. Beide Hypnotherapiekonzepte gehen von fast identischem Verständnis aus, wie Veränderung geschehen kann (nämlich durch die Bildung von Unterschieden in bisher vorherrschenden Mustern). So ist es dann ja auch kein Wunder, dass die wichtigsten Interventionen der systemischen Arbeit über lange Jahre fast alle aus der ericksonschen Hypnotherapie entliehen wurden (Weakland 1983).
Ein wichtiger Vorteil der hypnosystemischen Konzeption ist z. B., dass mit ihr systematisches Arbeiten mit interaktionellen Mustern möglich ist, wie es uns der systemische Ansatz bietet. Gerade die Erkenntnisse der Autopoieseforschung und der modernen Hirnphysiologie zeigen ja, dass die Einflüsse von Kontextbedingungen im System zwar sehr wichtig sind, ein individuelles lebendes System dadurch aber niemals zu einem bestimmten Erleben gezwungen werden kann, sondern sein Erleben in seiner inneren, strukturdeterminierten Selbstorganisation bestimmt wird (Maturana: „Es gibt keine instruktiven Interaktionen“). Damit fordern sie von uns a) die konzentrierte Arbeit mit dem inneren System der Selbstorganisation lebender Systeme und b) die systematische Beachtung und Nutzung aller Prozesse der Wechselwirkung zwischen der Organisation der Innenwelt und den Einflüssen der jeweiligen Umwelten, also der Prozesse der Kopplung zwischen individuellen lebenden Systemen und ihren Umgebungskontexten.
Aus dem Wissen der Hypnotherapie (z. B. darüber, wie dort Erlebnisphänomene beschrieben werden) und durch Anleihen bei diversen Körpertherapiemethoden, Psychodrama, Transaktionsanalyse und Gestalt-, aber auch Verhaltenstherapie (immer mit dem Ziel, diese auf ihre Wirkung hinsichtlich der Gestaltung von Aufmerksamkeitsfokussierung optimal zu nutzen) konnte ich viele äußerst hilfreiche Strategien für die Beschreibung von internalen psychophysiologischen Mustern und die Intervention in sie ableiten und weiterentwickeln. Integriert man systemische und ericksonsche Hypnotherapiekonzepte, verändert das aber auch manche lieb gewordenen, fast schon als Wahrheit angesehenen Annahmen und Vorgehensweisen in beiden Konzepten.
Mit hypnosystemischen Interventionen kann ein System nun sowohl intrapsychisch als auch interaktionell schnell und nachhaltig verändert werden. Mit ihnen können selbst bei als sehr schwer wiegend, „hartnäckig“ und chronifiziert geltenden Problemen zufrieden stellende Entwicklungen schnell, kostengünstig und nachhaltig angeregt werden. Dies zeigen in ermutigender Weise die Ergebnisstudien, die wir seit 1997 an der Fachklinik am Hardberg in Siedelsbrunn (wo die Modelle auch stationär umgesetzt werden) durchgeführt haben (vgl. Spilker 1999, 2002, Schauer 2000, Herr 2002, Zwack 2003, Harfst et al. 2004).
Der hypnosystemische Ansatz verbindet, wie ich jetzt begründen will, die zentralen Vorteile dieser Konzepte und vermeidet dabei gleichzeitig die Nachteile.