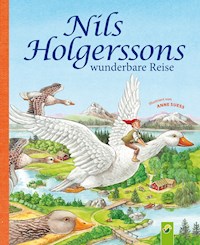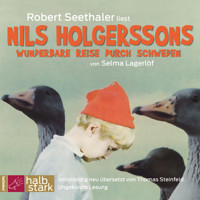Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Selma Lagerlöf versteht es meisterhaft, in ihrer Erzählkunst die unterschiedlichsten Register zu ziehen, und vermag so bis heute ihre Leser zu begeistern. Mit dem ihr eigenen psychologischen Geschick und in gewaltiger Bildsprache erzählt die Nobelpreisträgerin von unterschiedlichsten Aspekten der Liebe: vom Glück der Verliebtheit, von Hoffnung, Sehnsucht, stiller Reife und tiefstem Kummer. Doch auch in Bezug auf die Zeit, in der die Handlungen angesiedelt sind, weisen diese Liebesgeschichten eine außerordentliche Bandbreite auf - vom Mythischen übers Mittelalter bis zum 19./20. Jahrhundert -, oder in Bezug auf unterschiedliche soziale Schichten - von Häuslern und Bauern über Bürger und Pfarrer bis hin zu Königen. Das Nachwort von Holger Wolandt geht auf jede einzelne Erzählung dieser Sammlung ein und setzt sie in Beziehung zueinander sowie zur Biografie der Nobelpreisträgerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch / Rückentext
Vom Glück der Verliebtheit, von Hoffnung, Sehnsucht, stiller Reife und tiefstem Kummer – Selma Lagerlöf erzählt in gewaltiger Bildsprache und mit großem psychologischem Geschick von verschiedenen Aspekten der Liebe. Auch in Bezug auf die Zeit und das soziale Milieu, in denen die Erzählungen angesiedelt sind, weisen sie eine außerordentliche Bandbreite auf: vom Mythischen über das Mittelalter bis zum 19./20. Jahrhundert – und von Häuslern und Bauern über Bürger und Pfarrer bis hin zu Königen.
Die Nobelpreisträgerin versteht es meisterhaft, in ihrer Erzählkunst die unterschiedlichsten Register zu ziehen, und vermag so bis heute ihre Leser zu begeistern.
»Mit Selma Lagerlöfs epischer Urbegabung verbindet sich eine Reinheit der menschlichen Gesinnung, einer geistigen Güte, die in meinen Augen ihr natürliches Genie doppelt verehrungswürdig macht.«
Thomas Mann
Selma Lagerlöf
Liebesgeschichten
Aus dem Schwedischen von Marie FranzosMit einem Nachwort von Holger Wolandt
Urachhaus
Inhalt
Cover
Titel
Das Flaumvögelchen
Der Roman einer Fischersfrau
Reors Geschichte
Die Geisterhand
Die Grabschrift
Astrid
Wie der Adjunkt die Pfarrerstochter freite
Das Mädchen vom Moorhof
Der Stein im See
Nachwort
Quellennachweis
Impressum
Weitere Bücher
Das Flaumvögelchen
I.
Ich glaube, ich sehe sie vor mir, wie sie wegfuhren. Ganz deutlich sehe ich seinen steifen Zylinder mit der großen geschwungenen Krempe, so wie man sie in den Vierzigerjahren trug, seine helle Weste und seine Halsbinde. Ich sehe auch sein schönes, glatt rasiertes Gesicht, seinen hohen steifen Kragen und die anmutige Würde in jeder seiner Bewegungen. Er sitzt rechts in der Kutsche und fasst gerade die Zügel zusammen, und neben ihm sitzt das kleine Frauenzimmerchen. Gott segne sie! Sie sehe ich noch deutlicher. Wie auf einem Bild habe ich das schmale kleine Gesichtchen vor mir und den Hut, der es umschließt und der unter dem Kinn geknüpft ist, das dunkelbraune glatt gekämmte Haar und den großen Schal mit den gestickten Seidenblumen. Aber die Kutsche, in der sie fahren, hat natürlich einen Sitz mit grünen gedrechselten Stäbchen, und natürlich ist es das Pferd des Gastwirts, das sie die erste Meile ziehen soll, eins von den kleinen, fetten Braunen.
In sie bin ich vom ersten Augenblick an verliebt gewesen. Es ist keine Vernunft darin, denn sie ist das unbedeutendste kleine flatternde Dingelchen, aber alle die Blicke zu sehen, die ihr folgen, als sie fortfährt, das hat mich gefangen. Fürs Erste sehe ich, wie Vater und Mutter ihr nachschauen, wie sie da in der Tür des Bäckerladens stehen, Vater hat sogar Tränen in den Augen, aber Mutter hat jetzt keine Zeit zum Weinen. Mutter muss ihre Augen benützen, um ihrem Töchterchen nachzusehen, solange sie ihr noch winken kann. Und dann gibt es natürlich fröhliche Grüße von den Kindern des Hintergässchens und schelmische Blicke von allen den niedlichen Handwerkertöchtern hinter Fenstern und Türspalten und träumerische Blicke von ein paar jungen Gesellen und Lehrlingen. Aber alle nicken ihr Glückauf und Auf Wiedersehen zu. Und dann kommen unruhige Blicke von armen alten Mütterchen, die herauskommen und knicksen und die Brillen abnehmen, um zu sehen, wie sie in ihrem Staat vorbeifährt. Aber ich kann nicht sehen, dass ihr ein einziger unfreundlicher Blick folgt, nein, nicht so lang die Straße ist. Als sie nicht mehr zu sehen ist, wischt sich Vater rasch mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen.
»Sei nur nicht traurig, Mutter!«, sagt er. »Du wirst sehen, dass sie sich zu helfen weiß. Das Flaumvögelchen, Mutter, weiß sich zu helfen, so klein es ist.«
»Vater«, sagt Mutter mit starker Betonung, »du sprichst so seltsam. Warum sollte Anne-Marie sich nicht zu helfen wissen? Sie ist so gut wie irgendeine.«
»Das ist sie freilich, Mutter, aber dennoch, Mutter, dennoch. Nein, wahrhaftig, ich wollte nicht an ihrer Stelle sein und dorthin fahren, wohin sie jetzt fährt! Nein, wahrhaftig nicht!«
»Ei was, wohin solltest du wohl fahren, du hässlicher alter Bäckermeister«, sagt Mutter, die sieht, dass Vater so besorgt um sein Mädchen ist, dass man ihn mit einem kleinen Scherz aufmuntern muss. Und Vater lacht, denn das kommt ihm ebenso leicht an wie das Weinen. Und dann gehen die Alten wieder in den Laden.
Indessen ist das Flaumvögelchen, das kleine Flöckchen, das Seidenblütchen, recht guten Muts, wie es da über den Weg fährt. Ein bisschen bange vor dem Bräutigam ist sie freilich noch; aber eigentlich ist dem Flaumvögelchen vor allen Menschen ein bisschen bange, und das kommt ihr zugute, denn darum sind alle Menschen nur bestrebt, ihr zu zeigen, dass sie nicht so gefährlich sind.
Nie hat sie solchen Respekt vor Maurits gehabt wie heute. Als sie das Hintergässchen und alle ihre Freunde hinter sich gelassen haben, findet sie, dass Maurits förmlich zu etwas Großem anschwillt. Der Hut, der Kragen und die Favoris werden ganz steif, und die Krawatte bläht sich. Die Stimme wird ihm gleichsam dick im Hals und kommt nur schwer hervor. Sie fühlt sich dabei ein klein wenig beklommen, aber es ist doch eine Pracht, Maurits so großartig zu sehen.
Maurits ist so klug, er hat so viel zu ermahnen – es ist kaum zu glauben –, aber Maurits spricht ihr den ganzen Weg nur Vernunft zu. Aber seht ihr, so ist Maurits. Er fragt das Flaumvögelchen, ob sie auch recht versteht, was diese Reise für ihn bedeutet, ob sie glaubt, dass es sich nur um eine Lustfahrt über die Landstraße handle? Eine sechs Meilen lange Reise in der guten Kutsche, mit dem Bräutigam daneben, das konnte freilich wie eine richtige Lustpartie aussehen. Und man fuhr ja auf einen prächtigen Landsitz, sollte bei einem reichen Onkel zu Gast sein. Sie glaubte wohl, dass das alles nur ein Spaß war, wie?
Ach, wenn er wüsste, dass sie sich gestern auf diese Fahrt in langen Gesprächen mit Mutter vorbereitet hatte, bevor sie sich niederlegten, und mit einer langen Reihe ängstlicher Träume bei Nacht und mit Gebeten und Tränen. Aber sie stellt sich ganz dumm, nur um es desto mehr zu genießen, wie weise Maurits ist. Er liebt es, dies zu zeigen, und sie gönnt es ihm gern, ach wie gern.
»Es ist eigentlich ganz schrecklich, dass du so reizend bist«, sagt Maurits. Denn darum hatte er sie ja liebgewonnen, und das war doch, bei Licht besehen, sehr dumm von ihm. Sein Vater war durchaus nicht damit einverstanden. Und seine Mutter, er durfte gar nicht daran denken, was für Lärm sie geschlagen hatte, als er ihr mitteilte, dass er sich mit einem armen Mädchen aus dem Hintergässchen verlobt hatte, einem Mädchen, das keine Erziehung und keine Talente hatte und das nicht einmal schön war, nur reizend. – In Maurits’ Augen war natürlich die Tochter eines Bäckermeisters ebenso gut wie der Sohn des Bürgermeisters, aber nicht alle hatten so freie Anschauungen wie er. Und wenn Maurits nicht seinen reichen Onkel gehabt hätte, dann hätte wohl gar nichts aus der ganzen Sache werden können, denn er, der nur Student war, hatte ja nichts, aufgrund dessen er heiraten konnte. Aber wenn sie nun den Onkel für sich gewinnen konnten, dann war alles gut.
Ich sehe sie so deutlich, wie sie über die Landstraße fahren. Sie macht eine unglückliche kleine Miene, während sie seiner Weisheit lauscht. Aber wie vergnügt sie ist in ihren Gedanken. Wie verständig Maurits ist! Und wenn er davon spricht, welche Opfer er für sie bringt, dann ist das nur seine Art zu sagen, wie lieb er sie hat.
Und wenn sie vielleicht auch erwartet hatte, dass er an einem solchen Tag zu zweien vielleicht ein bisschen anders sein würde, als wenn sie daheim bei Mutter saßen – aber das wäre nicht recht von Maurits gewesen –, sie ist doch stolz auf ihn.
Er erzählte ihr gerade, was Onkel für ein Mensch ist. Ein so mächtiger Mann ist er, dass, wenn er sie nur beschützen will, sie alsogleich im Hafen des Glücks landen. Onkel Teodor ist so unglaublich reich. Elf Hochöfen hat er und außerdem Güter und Höfe und Grubenanteile. Und von all dem ist Maurits der direkte Erbe. Aber ein bisschen schwer ist Onkel zu behandeln, wenn es jemand ist, der ihm nicht gefällt. Wenn er mit Maurits’ Frau nicht einverstanden ist, kann er alles einem anderen hinterlassen.
Das kleine Gesichtchen wird immer farbloser und schmäler, Maurits aber wird immer steifer und schwillt förmlich an. Es ist ja nicht viel Aussicht, dass Anne-Marie Onkel den Kopf so verdrehen kann wie Maurits. Onkel ist ein ganz anderer Mann. Sein Geschmack, ja Maurits hat keine besondere Meinung von seinem Geschmack, aber er glaubt, so irgendetwas recht Lebhaftes, etwas blitzend Rotbäckiges, das müsste Onkel gefallen. Außerdem ist er solch ein eingefleischter Junggeselle – findet, dass Frauenzimmer nur lästig sind. Aber das Einzige, was nötig ist, ist ja nur, dass sie Onkel nicht zu sehr missfällt. Für das Übrige will Maurits schon sorgen. Aber sie darf kein Gänschen sein. Weint sie –! Ach, wenn sie nicht mutiger aussieht, wenn sie ankommen, dann wird Onkel ihnen beiden schnurstracks den Laufpass geben. Sie ist in ihrem eigenen Interesse froh, dass Onkel nicht so klug ist wie Maurits. Es kann doch wohl kein Unrecht gegen Maurits sein, zu denken, dass es gut ist, dass Onkel ein ganz anderer Mensch ist als er. Denn man denke, wenn Maurits Onkel wäre und zwei arme junge Leutchen kämen zu ihm gefahren, um ihren Lebensunterhalt zu erbitten, dann würde ihnen Maurits, der so verständig ist, sicherlich raten, jeder zu sich nach Hause zu fahren und mit dem Heiraten so lange zu warten, bis sie etwas hätten, wovon sie leben könnten. Obgleich Onkel gewiss in seiner Weise schrecklich war. Er trank so viel und gab so große Feste, bei denen es ganz wild herging. Und er verstand es gar nicht, hauszuhalten. Er konnte glauben, dass alle Menschen ihn betrogen, und ließ sich darüber kein graues Haar wachsen. Und leichtsinnig –! Der Bürgermeister hatte ihm durch Maurits ein paar Aktien einer Unternehmung geschickt, die nicht recht gehen wollten, aber Onkel kaufte sie ihm sicherlich ab, hatte Maurits gesagt. Onkel fragte nicht danach, wofür er sein Geld verschleuderte. Er hatte schon auf dem Markt in der Stadt gestanden und den Gassenjungen Silbermünzen hingestreut. Und in einer Nacht ein paar tausend Reichstaler zu verspielen und seine Pfeife mit Zehnreichstalerbanknoten anzuzünden, das gehörte zu dem Alltäglichsten, was Onkel tat.
So fuhren sie, und so plauderten sie, während sie fuhren.
Gegen Abend kamen sie an. Onkels »Residenz«, wie er zu sagen pflegte, war keine Fabrik. Sie lag fern von allem Kohlenrauch und allen Hammerschlägen auf dem Abhang einer großen Anhöhe, mit einer weiten Aussicht über Seen und lang gestreckte Berge. Sie war stattlich angelegt, mit Waldwiesen und Birkenhainen ringsherum, aber es gab so gut wie gar keine Felder, denn die Besitzung war eben kein Landgut, sondern ein Lustschloss.
Das junge Paar fuhr eine Allee aus Birken und Ulmen hinauf. Sie fuhren zuletzt durch ein paar niedrige dichte Tannenhecken, und dann sollten sie in den Hof einschwenken.
Aber gerade da, wo der Weg eine Biegung macht, war eine Triumphpforte errichtet, und da stand Onkel mit seinen Untergebenen und grüßte. Seht, das hätte das Flaumvögelchen niemals von Maurits geglaubt, dass er ihr einen solchen Empfang bereiten würde. Es wurde ihr gleich ganz leicht ums Herz. Und sie fasste seine Hand und drückte sie zum Dank. Mehr konnte sie im Augenblick nicht tun, denn sie waren mitten unter der Triumphpforte.
Und da stand er, der allbekannte Mann, der Gutsherr Teodor Fristedt, groß und schwarzbärtig und strahlend vor Wohlwollen. Er schwenkte den Hut und rief Hurra, und die ganze Volksschar rief Hurra, und Anne-Marie traten die Tränen in die Augen, und zugleich lächelte sie. Und natürlich mussten ihr alle vom ersten Augenblick an gut sein, allein schon wegen der Art, wie sie Maurits ansah. Denn sie dachte ja, dass sie alle seinetwegen da seien, und sie musste ihre Blicke von dem ganzen Staat abwenden, nur um ihn anzusehen, wie er mit einer großen Geste den Hut abnahm und so schön und königlich grüßte. Ach, was für einen Blick sie ihm da zuwarf! Onkel Teodor blieb fast im Hurra stecken und geriet in einen Fluch, als er ihn sah. Nein, das Flaumvögelchen wünschte gewiss keinem Menschen auf Erden etwas Böses, aber wenn es wirklich so gewesen wäre, dass das Ganze Maurits gehört hätte, so würde es wirklich gut gepasst haben. Es war weihevoll zu sehen, wie er da auf der Schwelle stand und sich zu den Leuten wendete, um zu danken. Onkel Teodor war ja auch stattlich, aber was hatte er für ein Auftreten gegen Maurits. Er half ihr nur aus dem Wagen und nahm ihren Schal und ihren Hut wie ein Bedienter, während Maurits den Hut von seiner weißen Stirn lüftete und sagte: »Habt Dank, meine Kinder!« Nein, Onkel Teodor hatte wirklich gar kein Benehmen, denn als er jetzt von seinen Onkelrechten Gebrauch machte und sie in die Arme nahm und küsste und merkte, dass sie mitten im Kuss Maurits ansah, da fluchte er wirklich, fluchte sehr hässlich. Das Flaumvögelchen war es nicht gewohnt, jemanden abstoßend zu finden, aber es würde sicherlich kein leichtes Stück Arbeit sein, Onkel Teodor zu gefallen.
»Morgen«, sagte Onkel, »gibt es hier große Abendgesellschaft und Ball, aber heute sollen sich die jungen Herrschaften von der Reise ausruhen. Jetzt essen wir nur zu Abend, und dann gehen wir zu Bett.«
Sie werden in einen Salon geführt und dann allein gelassen. Onkel Teodor schießt hinaus wie ein Pfeil. Fünf Minuten später fährt er in seinem großen Wagen die Allee hinab, und der Kutscher fährt so schnell, dass die Pferde wie gespannte Riemen dem Boden entlang liegen. Es vergehen noch fünf Minuten, aber dann ist Onkel wieder da, und jetzt sitzt eine alte Frau neben ihm im Wagen.
Und herein kommt er, am Arm eine freundliche, gesprächige Dame führend, die er »Frau Bergrätin« nennt. Und diese schließt Anne-Marie gleich in die Arme, aber Maurits begrüßt sie etwas steifer. Und das muss sie ja. Niemand kann sich mit Maurits Freiheiten erlauben.
Auf jeden Fall ist Anne-Marie sehr froh, dass diese gesprächige alte Dame gekommen ist. Sie und Onkel haben eine so lustige Art, miteinander zu scherzen. Sie fühlt sich bald ganz wie daheim in dem fremden Haus. Aber dann, als sie sich gegenseitig Gute Nacht gesagt haben und Anne-Marie in ihr kleines Stübchen gekommen ist, geschieht etwas so Peinliches und Ärgerliches.
Onkel und Maurits gehen unten im Garten auf und ab, und das Flaumvögelchen merkt, dass Maurits seine Zukunftspläne auseinandersetzt. Onkel scheint gar nichts zu sagen, er geht nur und köpft mit seinem Stock Grashalme. Aber Maurits wird ihn schon bald zu überzeugen wissen, dass er nichts Besseres tun kann, als Maurits eine Verwalterstelle auf einem seiner Hammerwerke zu geben, wenn er ihm nicht gleich ein ganzes Hammerwerk geben will. Maurits hat so viel Sinn fürs Praktische, seit er sich verliebt hat. Er pflegt oft zu sagen: »Ist es nicht am besten, wenn ich, da ich doch einmal ein großer Gutsbesitzer werden soll, gleich damit anfange, mich in die Dinge einzuarbeiten? Welchen Zweck hat es für mich, das Hofgerichtsexamen zu machen?«
Sie gehen gerade unter ihrem Fenster, und nichts hindert sie, zu sehen, dass sie dort sitzt, aber da sie sich nicht darum kümmern, kann niemand verlangen, dass sie nicht hören soll, was sie sagen. Es ist wirklich ebenso sehr ihre Angelegenheit wie die Maurits’.
Da bleibt Onkel Teodor plötzlich stehen, und er sieht böse aus. Er sieht ganz wütend aus, findet sie, und sie ist nahe daran, Maurits zuzurufen, er möge sich in Acht nehmen. Aber es ist zu spät, denn schon hat Onkel Teodor Maurits an der Brust gepackt, sein Jabot zerknittert und schüttelt ihn so, dass er sich windet wie ein Aal. Dann schleudert er ihn mit solcher Kraft von sich, dass Maurits nach rückwärts stolpert und gefallen wäre, wenn er sich nicht an einen Baum gestützt hätte. Und da bleibt nun Maurits stehen und sagt: »Wie?« Ja, was sollte er wohl sonst sagen?
Ah, nie hat sie Maurits’ Selbstbeherrschung so bewundert. Er stürzt sich nicht auf Onkel Teodor, um mit ihm zu kämpfen. Er sieht nur ruhig überlegen aus, nur unschuldig erstaunt. Sie versteht, dass er sich beherrscht, damit die ganze Reise nicht fruchtlos ist. Er denkt an sie und beherrscht sich.
Armer Maurits, es stellt sich heraus, dass Onkel um ihretwillen auf ihn böse ist. Er fragt, ob Maurits nicht weiß, dass sein Onkel Junggeselle ist und sein Haus ein Junggesellenhaus, dass er seine Braut hergebracht hat, ohne ihre Mutter mitzunehmen. Ihre Mutter – das Flaumvögelchen ist für Maurits beleidigt. Mutter hat es sich doch selbst verbeten und gesagt, dass sie die Bäckerei nicht verlassen könne. Das antwortet auch Maurits, aber sein Onkel lässt keine Entschuldigungen gelten. – Na, und die Bürgermeisterin, die hätte ihrem Sohn wohl den Gefallen tun können. Ja, wenn sie zu hochmütig war, dann hätten sie lieber dableiben können, wo sie waren. Was würden sie denn jetzt angefangen haben, wenn die Bergrätin nicht hätte kommen können? Und wie konnten denn überhaupt Bräutigam und Braut so zu zweien durchs Land ziehen! – So, so, Maurits sei nicht gefährlich. Nein, das hatte er auch nie geglaubt, aber die Zungen der Leute sind gefährlich. – Na, und dann schließlich noch die Kutsche, dieser alte Rumpelkasten. Hatte Maurits nicht das lächerlichste Vehikel in der ganzen Stadt aufgestöbert? Das Kind sechs Meilen in einer alten Kutsche zu rütteln, und ihn, Onkel Teodor, eine Triumphpforte für solch einen Leiterwagen errichten zu lassen! – Wahrhaftig, er hatte nicht übel Lust, ihn ordentlich bei den Ohren zu nehmen! Onkel Teodor für solch einen alten Karren Hurra rufen zu lassen! Er dort unten treibt es gar zu bunt, sie bewundert Maurits, der allem so ruhig standhält. Sie hätte eigentlich nicht übel Lust, sich einzumischen und Maurits zu verteidigen, aber sie glaubt nicht, dass es ihm recht wäre.
Und bevor sie einschläft, liegt sie da und rechnet sich vor, was sie alles hätte sagen wollen, um Maurits zu verteidigen. Dann schläft sie ein und fährt wieder auf, und im Ohr klingt ihr ein altes Rätsel:
Es steht ein Hund auf einem Stein
und bellt wohl in das Land hinein.
Er hieß wie du,
wie er, wie sie.
Wie hieß er doch,
so sag doch wie!
Wie hieß der Hund?
Der Hund hieß Wie.
Das Rätsel hatte sie als Kind oft geärgert, solch dummer Hund. Aber jetzt im Halbschlummer vermengt sie den Hund »Wie« mit Maurits, und es kommt ihr vor, als habe der Hund seine weiße Stirn. Dann lacht sie. Das Lachen kommt ihr ebenso leicht an wie das Weinen. Das hat sie von Vater geerbt.
II.
Wie ist »das« gekommen? Das, was sie nicht beim Namen zu nennen wagt.
»Das« ist wohl gekommen wie der Tau ins Gras, wie die Farbe in die Rose, wie die Süßigkeit in die Beere, unmerklich und zart, ohne sich vorher anzukündigen. Es ist ja auch gleichgültig, wie »das« gekommen ist und was »das« ist. Gut oder böse, schön oder hässlich, »das« ist das Verbotene, das es gar nicht geben sollte. »Das« macht sie ängstlich, sündhaft, unglücklich.
An »das« will sie nie mehr denken. »Das« muss ausgerissen und fortgeschleudert werden, und doch ist es nichts, was sich greifen und fangen lässt. Sie verschließt sich davor, und »das« kommt doch herein. »Das« treibt das Blut aus ihren Adern und fließt selbst darin, es treibt die Gedanken aus dem Hirn und regiert dort, es tanzt durch die Nerven und zittert bis in die Fingerspitzen. Es ist überall in ihr. Wenn sie alles fortnehmen könnte, woraus ihr Körper sonst besteht, und nur »das« übrig ließe, würde es einen vollen Abdruck von ihr geben. Und dennoch war »das« nichts. Nie will sie an »das« denken, und stets muss sie an »das« denken. Wie ist sie so schlecht geworden? Und dann forscht sie und grübelt, wie »das« gekommen ist. Ach, Flaumvögelchen! Wie weich ist unser Sinn und wie leicht geweckt unser Herz!
Sie war sicher, dass »das« nicht beim Frühstück gekommen war, nein, ganz gewiss nicht beim Frühstück. Da war sie nur ängstlich und scheu gewesen. Es hatte sie so sehr erschüttert, als sie zum Frühstück hinabkam und Maurits nicht vorfand, nur Onkel Teodor und die Bergrätin.
Es war ja nur klug von Maurits gewesen, dass er auf die Jagd gegangen war, obgleich unmöglich herauszufinden war, was er jetzt zur Mittsommerzeit jagte, wie auch die Bergrätin bemerkte. Aber er wusste natürlich, dass er am besten tat, wenn er sich ein paar Stunden von Onkel fernhielt, bis der wieder gut wurde. Er konnte sich ja gewiss gar nicht denken, dass sie so schüchtern war, dass sie beinahe ohnmächtig wurde, als sie ihn nicht vorfand und sich mit Onkel und der Bergrätin allein sah. Maurits war nie schüchtern gewesen. Er wusste nicht, was für eine Qual das war.
Dieses Frühstück, dieses Frühstück! Onkel hatte gleich damit angefangen, die Bergrätin zu fragen, ob sie die Geschichte von Sigrid der Schönen gehört habe. Er fragte nicht das Flaumvögelchen, und sie wäre auch nicht imstande gewesen zu antworten. Die Bergrätin kannte die Geschichte gut, aber er erzählte sie dennoch. Da erinnerte sich Anne-Marie, dass Maurits Onkel ausgelacht hatte, weil er in seinem ganzen Haus nur zwei Bücher habe, und das waren die Sagen von Afzelius und Nösselts Allgemeine Weltgeschichte für Frauenzimmer. »Aber die kennt er auch«, hatte Maurits gesagt.
Anne-Marie hatte die Geschichte schön gefunden. Es gefiel ihr, dass Bengt Magnusson Perlen auf seine Friese nähen ließ. Sie sah Maurits vor sich, wie königlich stolz er ausgesehen haben würde, wenn er befohlen hätte, die Perlen anzunähen. Das war gerade etwas, was Maurits gut zu Gesicht gestanden hätte.
Aber als Onkel in der Geschichte dahin kam, wo erzählt wird, wie Bengt Magnusson in den Wald ritt, um der Begegnung mit seinem erzürnten Bruder Birger Jarl auszuweichen und stattdessen seine junge Frau dem Sturm überließ, da wurde es ganz deutlich, dass Onkel verstand, dass Maurits nur auf die Jagd gegangen war, um seinem Zorn auszuweichen, und dass er wusste, wie sie dasaß und daran dachte, ihn zu gewinnen. – Ja, gestern, da hatten sie freilich Pläne schmieden können, Maurits und sie, wie sie mit Onkel kokettieren sollte, aber heute war kein Gedanke daran, sie auszuführen. Ah, nie hatte sie sich so dumm benommen! Das ganze Blut schoss ihr ins Gesicht, und Messer und Gabel fielen mit gewaltigem Geklapper aus ihren Händen auf den Teller.
Doch Onkel Teodor hatte kein Erbarmen gezeigt, sondern die Geschichte fortgesetzt, bis er zu dem guten Jarl-Wort kam: »Hätte mein Bruder dies nicht getan, wahrlich, ich tät es selber.« Das hatte er mit so lustigem Tonfall gesagt, dass sie aufsehen und dem Blick seiner lachenden braunen Augen begegnen musste.
Und als er da die Angst in ihren Augen sah, da hatte er zu lachen angefangen wie ein richtiger Junge. »Was glauben Sie, Frau Bergrätin«, hatte er gerufen, »was Bengt Magnusson sich dachte, als er heimkam und das hörte: ›Hätte mein Bruder …‹, ich denke, das nächste Mal ist er daheim geblieben.«
Dem Flaumvögelchen traten die Tränen in die Augen, und als Onkel dies sah, begann er immer heftiger zu lachen. »Ja, das ist eine schöne Mittlerin, die mein Brudersohn sich da ausgesucht hat«, schien er sagen zu wollen. »Du bist ganz aus der Rolle gefallen, mein kleines Mädchen.« Und jedes Mal, wenn sie ihn ansah, hatten die braunen Augen wiederholt: »Hätte mein Bruder dies nicht getan, wahrlich, ich tät es selber.« Eigentlich war das Flaumvögelchen nicht ganz sicher, ob die Augen nicht Brudersohn sagten. Und nun denke man, wie sie sich betragen hatte. Sie hatte laut zu weinen angefangen und war aus dem Zimmer gestürzt. Aber nicht damals war »das« gekommen, auch nicht auf dem Vormittagsspaziergang.
Da handelte es sich um etwas ganz anderes. Da war sie ganz hingerissen vor Freude über die schöne Besitzung und darüber, der Natur so nahe zu sein. Es war, als hätte sie etwas wiedergefunden, was sie vor langer, langer Zeit verloren hatte.
Bäckermamsell, Stadtmädchen, ja dafür hielt man sie. Aber als sie den Fuß auf den Kiesweg gesetzt hatte, war sie auf einmal ein Landkind geworden. Sie hatte sogleich erkannt, dass sie aufs Land gehörte.
Als sie sich nur ein wenig beruhigt hatte, hatte sie sich auf eigene Faust herausgewagt, um das Gut zu besichtigen. Sie hatte sich unten auf dem Kiesplatz vor dem Eingang umgesehen. Und ganz von selbst war der Hut auf den Arm gewandert, den Schal warf sie ab und begann sich hin und her zu wiegen. Dann stemmte sie die Hand in die Hüfte und zog Luft in die Lungen ein, dass sich die Nasenflügel zusammenzogen.
Ach, wie beherzt hatte sie sich doch gefühlt!
Sie hatte ein paar Versuche gemacht, ruhig und sittlich unten im Garten herumzugehen, aber das hatte sie nicht gelockt. Mit einer raschen Wendung hatte sie sich zu den großen angebauten Wirtschaftsgebäuden begeben. Sie war einer Stallmagd begegnet und hatte ein paar Worte mit ihr gesprochen. Sie war erstaunt zu hören, wie frisch ihre eigne Stimme klang. Und sie fühlte, wie flott es sich ausnahm, wie sie, den Kopf stolz erhoben und zur Seite gewandt, mit raschen nachlässigen Bewegungen, eine kleine sausende Gerte in der Hand, in den Stall trat.
Der war jedoch nicht so, wie sie ihn sich gedacht hatte. Keine langen Reihen gehörnter Wesen gab es da, denen sie imponieren konnte, denn die waren alle draußen auf der Weide. Ein einsames Kälbchen stand da und sah ihr erwartungsvoll entgegen. Sie ging auf das Tierchen zu, stellte sich auf die Zehenspitzen, hielt das Kleid mit der einen Hand gerafft und berührte mit der äußersten Spitze der andern die Stirn des Kalbes.
Da das Kalb aber nicht der Ansicht zu sein schien, dass es damit genug sei, sondern seine lange Zunge herausstreckte, überließ sie ihm gnädigst ihren kleinen Finger zum Ablecken. Aber dabei hatte sie denn doch nicht umhinkönnen, sich umzusehen, gleichsam einen Bewunderer dieser Heldentat suchend, und da hatte sie Onkel Teodor lachend in der Stalltüre stehen sehen.
Dann hatte er sie auf ihrem Spaziergang begleitet. Aber da war »das« gewiss nicht gekommen. Da war nur das höchst Merkwürdige und Seltsame eingetroffen, dass sie vor Onkel Teodor keine Angst mehr hatte. Es war mit ihm wie mit Mutter, er schien alle ihre Fehler und Schwächen zu kennen, und das war ein so beruhigendes Gefühl. Da brauchte man sich nicht besser zu zeigen, als man war.
Onkel Teodor hatte sie in den Garten führen wollen und zu den Terrassen am Teich, aber das war nicht nach ihrem Geschmack. Sie wollte wissen, was in allen diesen großen Gebäuden war.
Da ging er geduldig mit ihr in die Milchkammer und in den Eiskeller, in den Weinkeller und in den Kartoffelkeller. Er nahm alles der Reihe nach durch und zeigte ihr die Speisekammer und die Holzkammer und den Wagenschuppen und die Rollkammer. Dann führte er sie durch den Stall der Arbeitspferde und durch den der Wagenpferde, er ließ sie die Sattelkammer und das Bedientenzimmer sehen und die Knechtestube und die Werkstatt. Sie war ein wenig verwirrt von allen diesen Räumen, die Onkel Teodor nötig gefunden hatte, in seinem Hause einzurichten, aber ihr Herz glühte vor Entzücken bei dem Gedanken, wie herrlich es sein musste, über dies alles zu walten und zu schalten, sodass sie gar nicht müde wurde, obgleich sie auch die Schafställe und die Schweineställe durchwanderten und zu den Hühnern und den Kaninchen hineinguckten. Sie untersuchte gewissenhaft die Webkammer und die Molkerei, die Räucherkammer und die Schmiede, alles in wachsender Begeisterung. Dann gingen sie über große Dachböden, Trockenböden für Wäsche und Trockenböden für Holz, Heuböden und Böden für trocknes Laub, das die Schafe zu fressen bekommen. Die schlummernde Hausmutter in ihr erwachte beim Anblick dieser Vollkommenheit zu Leben und Bewusstsein. Aber den tiefsten Eindruck machten ihr das große Bräuhaus und die zwei niedlichen Backstuben mit dem weiten Ofen und den großen Tischen.
»Das sollte Mutter sehen«, sagte sie.
Dort in der Backstube hatten sie gesessen und sich ausgeruht, und sie hatte von daheim erzählt. Das konnte sie Onkel gegenüber so leicht. Er war schon wie ein Freund, obwohl seine braunen Augen über alles lachten, was sie sagte.
Daheim war es so still, kein Leben, keine Abwechslung. Sie war als Kind kränklich gewesen, und darum behüteten die Eltern sie so und ließen sie gar nichts tun. Nur zum Spaß durfte sie mit in der Backstube oder im Laden sein … Und wie sie so erzählte, war es ihr auch herausgerutscht, dass Vater sie sein Flaumvögelchen nannte. In diesem Zusammenhang hatte sie auch gesagt: »Zu Hause verwöhnen sie mich alle, außer Maurits, darum habe ich ihn so lieb. Er geht so klug mit mir um, er nennt mich auch nie Flaumvögelchen, nur Anne-Marie. Maurits ist so vortrefflich.« Ach, wie es in Onkels Augen tanzt und lacht. Sie hätte ihn mit der Gerte schlagen können. Und sie wiederholte noch einmal mit tränenerstickter Stimme: »Maurits ist so vortrefflich.«
»Ja, ich weiß, ich weiß«, hatte Onkel da geantwortet. »Er soll ja mein Erbe sein.« Worauf sie ausgerufen hatte: »Ach, Onkel Teodor, warum heiraten Sie nicht? Denken Sie doch, wie glücklich das Mädchen sein müsste, das Frau in einem solchen Schloss wird?«
»Wie stände es dann mit Maurits’ Erbe?«, hatte Onkel ganz gleichmütig gefragt.
Da war sie für lange Zeit verstummt, denn sie konnte Onkel nicht sagen, dass sie und Maurits nicht nach dem Erbe fragten, denn das taten sie doch gerade. Sie grübelte, ob es sehr hässlich war, dass sie es taten. Sie hatte plötzlich das Gefühl, als müsste sie Onkel um Verzeihung bitten für irgendein großes Unrecht, das sie ihm angetan habe. Aber das konnte sie auch nicht.
Als sie wieder ins Haus kamen, lief ihnen Onkels Hund entgegen. Das war ein kleines, kleines Dingelchen auf den allerschmalsten Beinen, mit wedelnden Ohrläppchen und Gazellenaugen, ein Nichts mit einem kleinen gellenden Stimmchen.
»Du wunderst dich wohl, dass ich einen so kleinen Hund habe«, hatte Onkel Teodor gesagt.
»Ja, wirklich«, hatte sie da geantwortet.
»Aber siehst du, nicht ich habe mir Jenny zum Hund gewählt, sondern Jenny hat mich zum Herrn genommen. Willst du die Geschichte hören, Flaumvögelchen?« Von dem Wort hatte er gleich Besitz ergriffen. Ja, das hatte sie gewollt, obgleich sie sich denken konnte, dass wieder irgendeine Neckerei dahintersteckte.
»Ja, siehst du, als Jenny zum ersten Mal herkam, lag sie einer feinen Frau aus der Stadt auf dem Schoß und hatte ein Deckchen auf dem Rücken und ein Tüchlein um den Kopf. Pst, Jenny, es ist wahr, das hattest du! Und ich dachte mir, das ist doch ein wahres Jammertierchen. Aber siehst du, als das Hundeviehchen hier auf den Landboden kam, da müssen irgendwelche Kindheitserinnerungen in ihm erwacht sein. Es kratzte und schlug um sich und wollte durchaus die Decke herunterzerren. Und dann betrug sich Jenny ganz wie die großen Hunde hier, sodass wir sagten, sie müsse ganz gewiss auf dem Land aufgewachsen sein.
Sie legte sich draußen auf die Schwelle und warf nicht einmal einen Blick auf das Salonsofa, und sie jagte die Hühner und stahl der Katze die Milch und kläffte die Bettler an und fuhr den Pferden an die Beine, als Besuch kam. Wir hatten unsere Lust und Freude daran zu sehen, wie sie sich benahm. Denke dir doch, solch ein kleines Ding, das nur in einem Korb gelegen hat und auf dem Arm getragen wurde. Es war ja wunderlich. – Und dann, weißt du, als sie fortfahren sollten, wollte Jenny nicht mit. Sie stand auf der Treppe und winselte so jämmerlich und sprang an mir hinauf und bettelte förmlich, denke dir nur, bleiben zu dürfen. So wussten wir uns keinen anderen Rat, als sie da zu lassen. Wir waren ganz gerührt über dies Hündchen, das so klein war und doch ein richtiger Landhund sein wollte. Aber das hätte ich doch nie geglaubt, dass ich mir noch einmal einen Schoßhund halten würde, vielleicht bekomme ich auch noch bald eine Frau.«
Oh, wie schrecklich ist es doch, wenn man so schüchtern, so unerzogen ist. Sie hätte wohl gerne wissen mögen, ob Onkel sehr erstaunt gewesen war, als sie so ungestüm fortstürzte. Aber es war ganz, als hätte er sie gemeint, als er von Jenny sprach. Und das hatte er vielleicht gar nicht. Aber immerhin – ja, ja, sie war so verlegen gewesen. Sie hatte nicht bleiben können. Aber nicht damals war »das« gekommen, nicht damals.
So war es wohl am Abend, bei dem Ball. Noch nie hatte sie sich so gut auf einem Ball unterhalten! Aber wenn jemand gefragt hätte, ob sie viel getanzt habe, dann hätte sie sich wohl besinnen und sagen müssen, das habe sie nicht. Aber das war eben das beste Zeichen, wie gut sie sich unterhalten hatte, dass sie es gar nicht merkte, dass sie vernachlässigt worden war.
Es war für sie schon eine solche Unterhaltung gewesen, Maurits anzusehen. Gerade weil sie beim Frühstück ein kleines, kleines bisschen streng gegen ihn gewesen war und gestern Abend über ihn gelacht hatte, war es ihr eine solche Freude gewesen, ihn auf dem Ball zu sehen. Nie war er ihr so schön und so überlegen vorgekommen. Er hatte gewiss das Gefühl gehabt, dass sie sich zurückgesetzt fühlte, weil er nicht nur mit ihr gesprochen und getanzt hatte. Aber es hatte ihr genug Vergnügen gemacht, zu sehen, wie beliebt Maurits bei allen war. Als ob sie ihre Liebe zur allgemeinen Betrachtung hätte ausstellen wollen! Ah, so dumm war das Flaumvögelchen nicht!
Maurits tanzte viele Tänze mit der schönen Elisabeth Westling. Aber das hatte sie gar nicht beunruhigt, denn Maurits war immer wieder auf sie zugekommen und hatte geflüstert: »Du siehst, ich kann da nicht Nein sagen, wir sind Kindheitsfreunde. Und sie sind es hier auf dem Land so gar nicht gewöhnt, einen Kavalier zu haben, der in der großen Welt gewesen ist und tanzen und konversieren kann. Du musst mich heute Abend schon den Gutsbesitzertöchtern leihen, Anne-Marie.«
Aber Onkel ging Maurits gewissermaßen aus dem Weg. »Sei du heut Abend Hausherr«, sagte er zu ihm, und das war Maurits. Er kam zu allen, er führte den Tanz an, führte das Trinken an und hielt Reden auf die schöne Gegend und auf die Damen. Er war großartig. Onkel sowohl wie sie hatten die Blicke auf Maurits geheftet, und so hatten sich ihre Blicke getroffen. Da hatte Onkel gelächelt und ihr zugenickt. Onkel war sicherlich stolz auf Maurits. Es hatte sie vorher ein wenig bedrückt, dass Onkel seinen Neffen nicht recht zu schätzen wusste. Gegen Morgen war Onkel recht laut und lärmend geworden. Da hatte er sich am Tanze beteiligen wollen, aber die Mädchen wichen ihm aus, wenn er zu ihnen kam, und taten, als wären sie schon engagiert.
»Tanze mit Anne-Marie«, hatte Maurits zu Onkel Teodor gesagt, und das hatte natürlich ein wenig protegierend geklungen. Sie erschrak so sehr, dass sie förmlich zusammenfuhr. Onkel war auch verletzt, drehte sich um und ging ins Raucherzimmer. Aber da war Maurits auf sie zugetreten und hatte mit harter, harter Stimme gesagt:
»Du verdirbst mir aber auch alles, Anne-Marie. Musst du so ein Gesicht machen, wenn Onkel mit dir tanzen will. Wenn du nur wüsstest, was er mir gestern über dich sagte. Du musst auch etwas tun, Anne-Marie. Glaubst du, dass es recht ist, alles mir zu überlassen?«
»Was willst du denn, dass ich tun soll, Maurits?«
»Ach, jetzt nichts, jetzt ist der Karren schon verfahren. Denke, was ich heute Abend alles gewonnen habe! Aber jetzt ist es verloren.«
»Ich bitte Onkel gern um Entschuldigung, wenn du es willst, Maurits.« Und sie meinte es auch. Es tat ihr wirklich leid, Onkel verstimmt zu haben.
»Es wäre natürlich das einzig Richtige, aber von jemandem, der so lächerlich schüchtern ist wie du, kann man ja nichts verlangen.«
Da hatte sie nichts geantwortet, sondern war geradewegs in das Raucherzimmer gegangen, das jetzt beinahe leer war. Onkel hatte sich in einen Lehnstuhl geworfen.
»Warum wollen Sie nicht mit mir tanzen, Onkel?«, hatte sie gefragt.
Onkel Teodors Augen waren zugefallen. Er schlug sie auf und sah sie lange an. Es war der schmerzvollste Blick, den sie je gesehen hatte. Sie ahnte nun, wie einem Gefangenen zumute sein mag, wenn er an seine Fesseln denkt. Es sah aus, als sei Onkel sehr, sehr traurig. Als brauchte er sie viel nötiger als Maurits, denn Maurits brauchte niemanden. Er war so prächtig, wie er war. Da legte sie ihre Hand ganz leicht und liebkosend auf Onkel Teodors Arm.
Mit einem Male hatte er frisches Leben in den Augen. Er begann mit seiner großen Hand ihr Haar zu streicheln. »Mütterchen«, sagte er.
Da kam »das« über sie, während er ihr Haar streichelte. Es kam geschlichen, es kam gekrochen, es kam gehuscht und geraschelt, so wie die Heinzelmännchen durch den dunklen Wald ziehen.
III.
Eines Abends liegen feine, weiche Wölkchen am Himmel, eines Abends ist es still und lau, eines Abends schweben kleine weiße Fläumchen von Espen und Pappeln durch die Luft.
Es ist schon spät, und niemand ist mehr auf, nur Onkel Teodor, der draußen im Garten umhergeht und überlegt, wie er den jungen Mann und das junge Mädchen voneinander trennen könnte.
Denn nie, nie, in alle Ewigkeit soll es geschehen, dass Maurits an ihrer Seite vom Hof wegfährt, während Onkel Teodor auf der Schwelle steht und ihnen glückliche Reise wünscht.
Ist es denn überhaupt möglich, sie ziehen zu lassen, nachdem sie drei Tage hindurch das Haus mit zwitschernder Fröhlichkeit erfüllt, nachdem sie ihn in ihrer stillen Weise daran gewöhnt hat, dass sie für alle denkt und sorgt, nachdem er sich daran gewöhnt hat, dies weiche geschmeidige kleine Wesen überall umherstreifen zu sehen. Onkel Teodor sagt zu sich selbst, dass das nicht möglich ist. Er kann sie nicht mehr entbehren.
In demselben Augenblick stößt er an einen abgeblühten Löwenzahn, und wie die Entschlüsse der Menschen und die Versprechungen der Menschen zerstreut sich das weiße Flaumbällchen, und die weißen Federchen fliegen eilig davon und verschwinden.
Die Nacht ist nicht kalt, wie die Nächte in dieser Gegend zu sein pflegen. Die Wärme wird unter der grauen Wolkendecke zurückgehalten. Die Winde zeigen ein seltenes Mal Erbarmen und verhalten sich still. Onkel Teodor sieht sie, das Flaumvögelchen. Sie weint, weil Maurits sie verlassen hat. Aber er zieht sie an sich und küsst die Tränen fort.
Weich und fein fliegen die weißen Fläumchen von den großen reifen Kätzchen der Bäume. So leicht, dass die Luft sie kaum fallen lassen will, so klein und zart, dass sie kaum auf dem Boden sichtbar werden. Onkel Teodor lacht sich ins Fäustchen, als er an Maurits denkt. In Gedanken tritt er am nächsten Morgen in sein Zimmer, als dieser noch im Bett liegt. »Höre, Maurits«, will er ihm sagen. »Ich möchte dir keine falschen Hoffnungen machen. Wenn du dieses Mädchen heiratest, so hast du keinen Pfennig von mir zu erwarten. Ich will nicht mit dazu helfen, deine Zukunft zu vernichten.«
»Missfällt sie Ihnen so sehr, Onkel?«, wird Maurits dann fragen.
»Nein, du, im Gegenteil, es ist ein nettes Mädchen, aber doch nichts für dich. Du musst ein Prachtweib haben wie Elisabeth Westling. Sei nun verständig, Maurits, was wird aus dir, wenn du um dieses Kindes willen deine Studien abbrichst und auf ein Gut gehst. Dazu taugst du nicht, mein Junge. Dazu ist etwas anderes nötig, als den Hut schön zu schwingen und zu sagen: ›Habt Dank, meine Kinder!‹, Du bist ja zum Beamten wie geschaffen. Du kannst Minister werden.«
»Wenn Sie eine so gute Meinung von mir haben, Onkel«, antwortet dann Maurits, »so helfen Sie mir doch, mein Examen zu machen, und lassen Sie uns dann heiraten!«
»Nein, das nicht, du, das ganz gewiss nicht. Was, glaubst du, würde aus deiner Karriere werden, wenn du einen solchen Ballast mitschleppen müsstest, wie es eine Frau ist. Das Pferd, das den Brotwagen ziehen muss, galoppiert nicht. Denke dir nun die Bäckermamsell als Ministerfrau! Nein, du darfst dich nicht vor zehn Jahren verloben, nicht bevor du avanciert bist. Was wäre die Folge, wenn ich es euch ermögliche, zu heiraten. Jedes Jahr würdet ihr zu mir kommen und um Geld betteln. Und das würden wir alle bald satt kriegen.«
»Aber Onkel, ich bin doch ein Ehrenmann. Schließlich habe ich mich doch verlobt.«