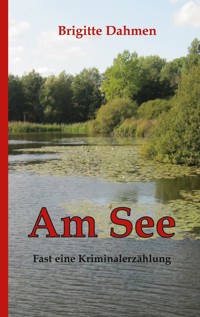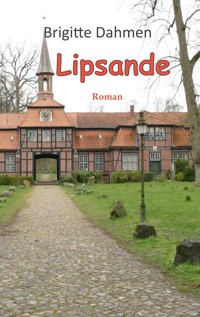
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lipsande, ein fiktives Gut in Ostholstein zum Ende des 18. Jahrhunderts. Im Gut leben Freie und Leibeigene. Unter ihnen die landlose Familie Böhlau. Sie alle sind Untertanen des Gutsherrn Graf von Lindenau. Jochim, ältester Sohn der Böhlauer, ist verliebt in die Milchmagd Dörthe Lillen. Doch, ob sie eine Heiratserlaubnis bekommen ist ungewiss, denn die Verhältnisse im Gut werden für die Leibeigenen immer schlechter. Auch Jochim bekommt das zu spüren, denn der Verwalter des Gutes, Matthiesen, steht ihm feindlich gegenüber. Deshalb fassen Jochim und Dörthe eine Flucht ins Auge. Bald aber müssen sie erkennen, dass ein Entweichen aus der Leibeigenschaft gefährlich ist. Sie wagen es trotzdem. Von Seiten der Adeligen Schleswig-Holsteins wird ein Ersuchen an den Dänischen König gestellt, die Leibeigenschaft aufzuheben. Von Lindenau unterstützt dieses Anliegen allerdings nicht. Die strenge Gutsherrschaft, die durch harte Strafen und Landwegnahme gekennzeichnet ist, veranlasst die Untertanen zum offenen Widerstand. Eine Rebellion wird durch das Versprechen des Grafen, ein Gutsgericht abzuhalten, beendet. Doch der Gutsherr fühlt sich nicht an sein Versprechen gebunden. Als Jochim wegen einer Familienangelegenheit heimlich zurück ins Gut kommt, kommt es zu einer unvorhergesehenen Begegnung mit Matthiesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BRIGITTE DAHMEN, 1951 in Gladbeck geboren, studierte in Bochum und Münster Geschichte und Archäologie. Vor und während ihres Studiums war sie in den verschiedensten Berufen tätig. Als Archäologin leitete sie zahlreiche Ausgrabungen und schrieb ihre ersten Texte. Nach dem Eintritt in die Rente widmete sie sich ausschließlich dem Schreiben. Angefangen mit Kurzgeschichten folgten bald das Kinderbuch: "Die schlauen Käthe und ihre Freunde" und die Erzählung "Am See" sowie der Roman "Lipsande". Sie lebt in Schleswig-Holstein und arbeitet zurzeit an einer weiteren Geschichte über die Familie Böhlau.
Für Dieter mit seiner unendlichen Geduld
Inhaltsverzeichnis
1793
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
1794
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
1795
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
1797
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
1798
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Glossar
Eine kleine Einführung
Die Handlung der folgenden Erzählung spielt in einem fiktiven Gut in Ostholstein zum Ende des 18. Jahrhunderts, dem Gut Lipsande.
Zur damaligen Zeit bestand ein Gut nicht nur aus dem Gutshof mit angeschlossenen Wirtschafts- und Wohnhäusern sowie dem sogenannten Herrenhaus, so ein Ensemble bezeichnen wir heute als Gut. Damals war es ein Bezirk, zu dem mehrere Dörfer gehörten. Hinzu kamen nötige Gewerken zur Erfüllung der gutswirtschaftlichen Aufgaben (Mühle, Schmiede etc.).
Oben in der Hierarchie eines Gutes stand unangefochten der Gutsherr beziehungsweise Gutsbesitzer. Er hatte die Gerichtsbarkeit und die Polizeigewalt über seine Gutsuntertanen. Die Judikative, Exekutive und bis zu einem gewissen Grad auch die Legislative lagen allein in seiner Hand.
In der Regel wurde das Gut von einem Verwalter bewirtschaftet. Vögte, die aus den Reihen der Dorfbauernschaft bestimmt wurden, nahmen seine Befehle und Anordnungen entgegen und leiteten sie an die Bauern und das Gesinde in den Dörfern weiter. Innerhalb der Hierarchie eines Gutsdorfes folgten auf dem Vogt die Bauern, danach die Knechte, Mägde und Tagelöhner, die sogenannten Insten. Am Ende standen die Armen und nicht arbeitsfähigen Menschen. Sie alle waren samt ihren Familien Leibeigene und hatten Frondienste zu leisten. Neben den Leibeigenen waren auch freie Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen im Gut tätig.
Alle Leibeigenen hatten Hand- und Spanndienste für das Gut zu leisten. In der „strengen Leibeigenschaft“ hatten die Bauern, auch Hufner genannt, täglich zwei Gespanne mit jeweils vier Pferden pro Gespann, zwei sogenannten Bauknechten, einen Knecht, eine Magd und einen Lüttjungen zu stellen. Die Kätner, das waren die Bauern mit weniger Land, entsprechend weniger. Die landlosen Insten leisteten nur Handdienste. Der Dienst begann um sechs Uhr in der Früh und endete abends um sieben, in der Erntezeit oft auch später. Im Winter von sieben Uhr bis zur hereinbrechenden Dunkelheit.
Die Knechte und Mägde, die Hofdienste leisten musste – die Hufner gingen selten oder nur im äußersten Notfall selbst zum Dienst – waren in den Häusern der Hufner untergebracht und erhielten von ihnen einen geringen Lohn für die Arbeit, die sie zusätzlich zum Dienst auf dem Gut bei ihrem Hauswirt zu leisten hatten.
Leibeigenen wurde ein geringes Ehrgefühl unterstellt. Ihnen und anderen nicht angesehenen Bevölkerungsschichten war die Prügelstrafe „vorbehalten“. Schon aufgrund eines nichtigen Anlasses wie Unbotmäßigkeit oder Widerworte geben, konnte jeder Höhergestellte diese Menschen ungestraft schlagen. Die Gerichte, natürlich auch die Gerichte auf den Gütern, sprachen nicht selten Prügelstrafen zusätzlich zu Gefängnisstrafen aus.
Zur damaligen Zeit haben die Menschen in Norddeutschland sicher Plattdeutsch gesprochen. Es schien mir jedoch nicht ratsam, alle Reden in Plattdeutsch wiederzugeben. Lediglich den Schweinehirten Hans habe ich Platt reden lassen, wobei in Fußnoten schwer verständliche Stellen in hochdeutscher Übersetzung stehen. Für die Wiedergabe dieser Textstellen ins Plattdeutsche bin ich Frau Brigit Zwirlein zum Dank verpflichtet.
Einige nicht mehr gebräuchliche Bezeichnungen, die zum damaligen Alltag gehörten, sind im anhängenden Glossar erklärt.
1793
„So ist es!“
1
Vom Meer kommend frischte in der Nacht der Ostwind auf. Zuerst erfasste er die breiten blattlosen Kronen der Bäume, tippte an die kahlen Zweige der Büsche und fuhr schließlich mit voller Wucht in die zarten Spitzen der aufkeimenden Wintersaat. Den nebelnassen Dunst, der seit Wochen das Land überzog, trieb er vor sich her und legte an seiner statt den Frost in den Boden.
Die Bauern in ihren Alkoven ahnten, dass dies der Wind war, auf den sie so lange gewartet hatten. Nun endlich würde der Winter kommen und das Wetter seinen gewohnten Ablauf nehmen. Ihre stillen Gebete waren erhört worden.
Auf Gut Lipsande hatte es lediglich Anfang Dezember etwas geschneit. Dicke, luftige Flocken waren vom Himmel gefallen und hatten alles mit einem weißen Flaum überdeckt. Doch schon einen Tag später war die Pracht in der fahlen Mittagssonne dahingeschmolzen. Bis weit in den Herbst hinein waren die Weiden grün, und keiner im Gut konnte sich erinnern, das Vieh so lange auf die Koppeln getrieben zu haben. Auch die alte Elsche, die ständig behauptet, dass ihr der alte König Friedrich begegnet sei, hatte so einen Winter noch nicht erlebt. Der Frost stellte endlich die bekannte Ordnung wieder her und gab Hoffnung auf einen guten Jahresverlauf.
Obwohl? Rechnen mussten die Bauern mit allem. Das Auf und Ab im Leben, das Gute und Schlechte im Jahresrhythmus, das nie Vorhersehbare hatte sie vorsichtig werden lassen. Eine jahrhundertelange Erfahrung mit Sturm und Regen, mit Hitze und Sonne hatte diesem Landstrich einen misstrauischen Menschenschlag beschert.
Von Generation zu Generation wurde Argwohn als Erfahrungsschatz des Lebens weitergegeben. Auf der Hut zu sein bedeutete, einen Schutzschild zu besitzen. Sei es gegen das Wetter, gegen den Nachbarn oder gegen die Obrigkeit. Und wenn das Schicksal wieder zu hart zugeschlagen hatte, verfluchte der eine oder andere auch schon einmal Gott. Er solle sich nicht versündigen, bemerkte dann der Pastor und legte dem Frevler zur Buße drei Vaterunser auf.
Sicher war es ratsam, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Vielleicht half es, einen Besen verkehrt herum vor die Tür zu stellen? Oder am Freitag eine schwarze Kerze anzuzünden? Man durfte sich nur nicht vom Vogt erwischen lassen. Der hatte Anweisungen, solchen Aberglauben zur Meldung zu bringen. Es war schon vorgekommen, dass man einen ganzen Reichstaler Strafe zahlen musste. Dabei ließe man doch nur Vorsicht walten, sagten die Bauern. Doch die Herrschaft war der Ansicht, dass so ein Hokuspokus zu unterbinden sei. Ein aufgeklärter Mensch habe Aberglaube abzulehnen, Aberglaube untergrabe ihre Autorität. Nach ihrem Selbst-verständnis hatten die Untertanen nur zwei Herren zu dienen, zum einen Gott und zum anderen ihnen.
Dennoch, Gehorsam gegenüber dem Gutsherrn fiel den Leibeigenen oft schwer. Aber saßen sie nicht immer am kürzeren Hebel und beschworen nur Strafen herauf, wenn sie sich widerständig zeigten?
2
In aller Herrgottsfrühe hatte der Rathbeker Dorfvogt seinen Knecht losgeschickt, hatte ihm die Glocke in die Hand gedrückt, ihm eingeschärft, ja laut genug zu läuten und ihn dann hinaus in die Dunkelheit geschickt. Trotz des eisigen Windes, der in der Nacht aufgekommen war, versah der Bursche sein Amt mit eifriger Wichtigkeit und schüttelte kräftig das Blech.
Das lautstarke Gebimmel konnte keiner im Dorf überhören. Bald waren alle Leibeigenen auf dem Anger versammelt und machten sich, angeführt von ihrem Vogt, auf den Weg, um der Gutsübergabe beizuwohnen und ihrem neuen Herrn den Treueeid zu schwören. Am Ende des Dorfes reihte sich der Inste Peter Böhlau mit seiner Familie in die Schar.
Vor etlichen Jahren war er als freier Mann in das Gut gekommen. Geblieben war er, um die leibeigene Magd Christine heiraten zu können. Dadurch wurde er zwar selbst zum Leibeigenen, doch die von der Herrschaft auferlegten Dienste schienen ihm erträglich, und das Versprechen der Konservation war auch nicht zu verachten. Er durfte nebenbei sogar sein Handwerk, das Flickschustern ausüben und sich dadurch etwas hinzuverdienen. Daran, dass ihn die Bauern im Dorf mit einer gewissen Herablassung begegneten, hatte er sich gewöhnt. So behandelten sie alle Landlosen. Peter hielt sich zurück und beschränkte seine dörflichen Kontakte auf das Nötigste. Seine Familie war ihm sowieso das Wichtigste. Von sechs Geburten waren ihm und seiner Frau ein Sohn und drei Töchter geblieben. Vielleicht konnte er bald auf einen weiteren Jungen hoffen, denn Christine war im vierten Monat schwanger.
Wenige Schritte hinter Peter ging an diesem Februarmorgen sein Erstgeborener, Jochim. An der Gestik seines Vaters erkannte der Junge, dass Peter Böhlau seiner ältesten Tochter Weisungen mit auf den Weg gab. Neben den beiden lief seine Frau mit den zwei Jüngsten, die an der Hand der Mutter Mühe hatten, dem Tempo, das der Dorfvogt vorne anschlug, zu folgen.
Gedankenversunken trottete Jochim hinterher. Ihm ging Dörthe nicht aus dem Kopf. Oft hatte er sie bisher nicht gesehen, immer nur an den Sonntagen nach der Kirche. Krogmann, der Holländer, hatte ständig ein wachsames Auge auf seine Milchmädchen und passte auf, dass sie nach dem Kirchgang zusammenblieben. Aber Dörthe hatte Jochim jedes Mal den schelmisch-herausfordernden Blick ihrer ersten Begegnung zugeworfen. Ein Treffen mit ihr hat es all die Wochen nicht gegeben. Doch vielleicht eröffnete sich heute bei der Eidesleistung eine Gelegenheit.
Krogmann war der Milchhofpächter des Gutes. Seit einigen Jahren betrieb er die Holländerei, wie die Meierei auch genannt wurde. Zwar war er ein Freier und brauchte keinen Eid leisten, dennoch, so hatte Jochim gestern gehört, wollte er persönlich dafür sorgen, dass seine ihm zugewiesenen Unfreien geschlossen zur Eidesleistung erscheinen.
„Moin, mien Jung. Hest du wedder dien Deern in ´n Kopp?“
Das fast zahnlose Gesicht des alten Schweinehirten tauchte neben Jochim auf und grinste ihn wohlwollend an.
Seitdem der Gutsverwalter vor sieben Jahren Jochim fürs Schweinehüten eingeteilt hatte, war kein Tag vergangen, an dem Hans und er nicht zusammen waren. Das anfängliche Bedenken des Hirten, mit einem Kind die fünfzig Schweine des Gutes hüten zu müssen, verflüchtigte sich, als er merkte, dass der Junge sehr schnell lernte und einen Blick dafür bekam, wenn eines der Schweine ausbüxte und zurückgetrieben werden musste. Zwischen ihm und Jochim entwickelte sich eine Verbundenheit, die beide nicht näher bezeichnen konnten, derer sie sich aber instinktiv bewusst waren.
„Vater will heute anfragen, ob ich Bauknecht auf den Hof werden kann“, teilte Jochim dem Alten mit.
„Jo“, war Hans´ eintöniger Kommentar.
„Dann werden unsere schönen Tage bald vorbei sein.“
„Hest du glövt, se warden di vergeten?“
Ja, zumindest gehofft hatte es Jochim. Es war schon außergewöhnlich, dass er mit fast siebzehn Jahren immer noch die Schweine hütete. Die Herrschaft schien ihn vergessen zu haben. Aber der Vater wollte ein Fortkommen für seinen Sohn.
Schweigend setzten Hans und Jochim den Weg fort und waren bald die Letzten im Zug. Als sie am Torhaus des Gutes angekommen waren, schlug die Turmuhr gerade das erste Viertel der neunten Stunde. Im Osten begann der Himmel hell zu werden. Der Wind schwächte ab und einzelne Wolken, die der nächtliche Sturm noch nicht vertrieben hatte, strahlte die aufgehende Sonne von unten rosarot an.
Die Rathbeker waren nicht die ersten Ankömmlinge. In der Gesindestube des Torhauses, in der auch Gericht gehalten wurde, fanden sie keinen Platz mehr und mussten nun im zugigen Tordurchgang warten.
Immer noch trafen Leibeigene ein. Die Letzten drängelten die schon Angekommenen auf den Wirtschaftshof, dem freien Platz zwischen Scheune und Viehstall. Gutsvogt Henningsen mahnte die Nachzügler zur Eile und befahl den vorne Stehenden voran auf den Ehrenhof zu gehen. Nur zögernd gehorchten die Bauern. Eigentlich war ihnen nicht erlaubt, den Ehrenhof zu betreten, weshalb sie nun eine gewisse Scheu an den Tag legten.
Im aufkommenden Tageslicht beobachtete Jochim das Treiben vor dem Herrenhaus. Dort traf das Gesinde letzte Vorkehrungen. Das Geländer der großen Freitreppe, die mit zwei geschwungenen Aufgängen zum Eingang des Herrenhauses hinaufführte, war mit Tannengirlanden geschmückt. In ihnen steckten bunte Papierblüten in den Farben der Herrschaftsfamilie der Grafen von Lindenau. Auf dem Podest vor der zweiflügeligen Eingangstür war ein Baldachin aus weißem Leinen aufgestellt. Darunter standen drei mit Pelzen ausgekleidete bequeme Sessel, vor denen kleine gusseiserne Fußbänkchen platziert waren. Sie würden zum Wärmen der Füße später mit glühenden Kohlen bestückt werden. Neben den herrschaftlichen Sesseln befanden sich die Sitzgelegenheiten für den Notar und den Honoratioren, die als Zeugen der Eidesleistungen unumgänglich waren. Alles war bereit für den großen Akt der Gutsübergabe.
Jochim, der seine Altersgenossen um fast einen Kopf überragte, suchte Dörthes Gesicht in der Menge, konnte sie aber unter den Umstehenden nicht entdecken. Die Turmuhr schlug die neunte Stunde, als Krogmann mit Frau, seinen Kindern, den Kuhknechten und den Milchmädchen erschien und sich durch die Wartenden eine Gasse bahnte, um mitsamt seinen Leuten ganz vorne vor der Treppe zum Stehen zu kommen.
Das war der Augenblick, auf den Jochim gewartet hatte. Wenn er es jetzt geschickt anstellte, fand er sicher Gelegenheit, ein paar Worte mit Dörthe zu wechseln. Langsam schob er sich an den anderen vorbei in den Ehrenhof.
Je älter ich werde, umso öfter kommen mir Erinnerungen an Lipsande in den Sinn. Fast fünf Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Doch, als wäre es gestern gewesen, steht mir der Tag der Übergabe noch klar vor Augen. Warum kommt mir, wenn ich daran zurückdenke, zuerst immer Krogmann in den Sinn? Wahrscheinlich, weil sein Verhalten so gar nichts von einem Freien hatte. Alleine, wie er mit seinen Leuten in den Ehrenhof einmarschierte? Immer dienerte er sich der Herrschaft an, ständig kratzbuckelte er. Hatte er Angst, den nächsten Vertrag für die Meierei nicht zu bekommen?
Von Hans, mit dem ich damals die Schweine des Gutes in den Wald trieb, wusste ich, dass der Holländer aus dem Dithmarschen stammte. Das seien die freiesten Menschen in unserem Land, hatte Hans mir erklärt. Sie hätten vor Jahrhunderten sogar gegen den König gekämpft, nur um ihre Freiheit zu behalten. Gutsherren seien dort nie zum Zuge gekommen. Der Alte war weit herumgekommen, bevor er sich in Lipsande niederließ. Er musste es wissen.
Damals meinte ich schon zu wissen, wie sich ein freier Mensch aufzuführen hat. So wie Krogmann sicher nicht. Wo blieb da das Ehrgefühl? Der Holländer jedenfalls ließ keine Gelegenheit aus, sich bei der Herrschaft anzubiedern. Es hatte mich angewidert. Doch eigentlich hatte ich am Tag der Übergabe nur Augen für Dörthe. Sie hatte ich Wochen vorher das erste Mal erblickt und mich gleich in sie verliebt.
Im Herbst, ein paar Tage nach Martini war es gewesen. Es war die Zeit der jährlichen Jagd, zu der der alte Graf immer wichtige Persönlichkeiten des Landes einlud. Für alle im Gut bedeuteten diese Tage eine zusätzliche Plackerei. Eine Woche mussten an die hundert Menschen herrschaftlich versorgt werden. Jeden Tag ging es in den Forst, der für seinen Wildreichtum bekannt war. Für die Jagd war ich damals als Lappenjunge eingeteilt worden.
Noch letzten Sonntag musste ich meinen Enkeln davon erzählen. Die Stunde nach dem Kaffeetrinken ist immer ihre Besuchszeit. Sie stürmen dann in meine Stube, setzen sich auf das Sofa und fordern mich auf zu erzählen. Minchen, die Größere liebt es, wenn ich von der ersten Begegnung mit ihrer Großmutter berichte. John Henry hat es lieber, wenn ich Geschichten von einem schrecklichen Ereignis oder irgendeinem Unglück erzähle. Dann empört er sich in seiner kindlichen Art, dankt Gott, dass er dieses nicht erleben muss und schwört, wenn er groß ist, werde er so etwas niemals zuzulassen.
Ach Dörthe! Es war am letzten Tag der Jagd. Der Weg zurück zum Gut führte diesmal alle Teilnehmer an der Meierei vorbei. Dort standen die Milchmädchen und schauten der ankommenden Jagdgesellschaft entgegen. Dörthe erzählte mir später, dass Krogmann seinen Melkerinnen befohlen habe, am Weg zu stehen, der Herrschaft zuzuwinken und laut „Hurra“ zu rufen. Ich sah den Holländer ebenfalls dort stehen und die hohen Gäste mit einem kleinen Umtrunk willkommen heißen. Er zischelte und raunte den Mädchen etwas zu. Doch die Mägde taten, als würden sie nicht hören und schauten wie abwesend auf die Vorbeiziehenden. Natürlich war es den hohen Herren egal, ob die Mädchen ihnen Beachtung schenkten. Umso mehr erhielten sie von uns Lappenjungen und Treibern am Ende des Zuges Aufmerksamkeit.
Und da sah ich sie. Schon etliche Meter vorher fiel mir ihr Lockenkopf auf. Mit jedem Schritt, den ich näherkam, gewahrte ich mehr: Pechschwarze Haare, die sich nur unwillig unter dem Kopftuch bändigen ließen, eine porzellanweiße Haut und tiefblaue Augen. Für mich hatte ihre Erscheinung etwas Madonnenhaftes. Auch die schmale Nase und die eher blutarmen Lippen verliehen ihr ein edles Aussehen. Dass es eigentlich Überarbeitung und Müdigkeit war, die sich in ihrem Gesicht bemerkbar machten, kam mir damals nicht in den Sinn. Ich war gebannt von ihrem Anblick. Da störte mich auch nicht das wirre Haar, das eigentlich nur ohne Pflege war. Gedanken, die mir in dem Augenblick sowieso fremd waren. Ich versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und ging zwei, drei Schritte neben den anderen einher.
Doch, oh Schreck! Nachdem die hohen Herren vorbeigezogen waren, scheuchte Krogmann seine Milchmädchen zusammen und trieb sie wieder zur Arbeit. Das Ende des Zuges wurde gar nicht abgewartet, sodass ich schon befürchtete, Dörthe könnte gehen, ohne mich bemerkt zu haben.
Aber noch bevor die Mädchen um die Hausecke verschwanden, warf sie mir über die Schulter einen Blick zu. Ein Blick, der mich mein Leben lang festhielt. Nie werde ich das Tiefgründig-Schelmische und zugleich Auffordernde dieses Blickes vergessen. Nur einen Wimpernschlag hatte es gedauert. Ein Blick, der nur mir galt, das wusste ich genau.
3
„Sind alle da?“
„Ja, gnädiger Herr, bis auf zehn Krankmeldungen“, antwortete Gutsvogt Henningsen auf die Frage von Tönnies.
Tönnies war Syndikus der Kieler Universität und überwachte heute in seiner Eigenschaft als Justiziar den Besitzerwechsel des Gutes Lipsande.
Henningsens Antwort war auch für die Männer an dem großen Tisch in der Mitte des Raumes bestimmt. Halbvolle Krüge mit Milch, Kannen mit Kaffee und Tee, Platten mit Resten von Wurst, Braten, Käse und Butter, Körbe voll Brot und Kuchen sowie eine große Schale mit Obst zeugten von einem ausgiebigen Frühstück. Urkunden und andere Papiere auf dem Tisch zeigten, dass die Männer nicht nur für das Essen hier zusammengekommen waren.
Neben dem Tisch, um den sicher zwanzig Personen Platz finden konnten, war der saalgroße Raum eher kärglich ausgestattet. Ein offenstehender riesiger Eichenschrank gab den Blick frei auf alte Schriftrollen und Dokumente. Rechts des Schranks führte eine Tür in den Dienstbotenbereich. Hinter einer weiteren Tür auf der linken Seite versteckte sich ein kleines Kabinett. An der gegenüberliegenden Wand strahlte ein Feuer im Kamin eine wohltuende Wärme aus. Rechts und links davon hingen große Portraits gewichtig aussehender Herren. Weiterer Zierrat war nicht vorhanden.
Der hallenartige Raum gehörte noch zum alten Haus, welches vor undenklichen Zeiten errichtet worden war. Als vor fünfzig Jahren das alte Herrenhaus für einen Neubau abgerissen wurde, blieb nur diese große Halle erhalten. Hier waren im Zusammenhang mit dem Gut schon immer alle Geschäfte abgewickelt und alle Kontrakte unterschrieben worden. Ein Ereignis, der Friede von Lipsande im Jahr 1393, wird besonders erwähnt: In dieser Halle war die Urkunde besiegelt worden, die eine jahrelange Fehde beendete. Sechzehn Ritter hatten damals durch die Vermittlung des Grafen von Lindenau ihre Unterschrift unter das Abkommen gesetzt und mit ihren Siegeln bestätigt. Damit ging Lipsande in die Geschichte des Landes ein. Seitdem wurde die Halle Friedenssaal genannt.
Die Männer am Tisch waren früh zusammengekommen, hatten gemeinsam letzte Fragen geklärt und noch einmal das Prozedere durchgesprochen. Neben dem alten Grafen von Lindenau und seinem Sohn Johann Heinrich, dem das Gut heute übertragen werden soll, waren lokale Honoratioren als Zeugen anwesend. Und dann wohnte noch Sellmann, der Pastor des Kirchspiels Lipsande, dem Besitzerwechsel bei.
Auf die Nachricht des Vogts, dass alle versammelt seien, erhob sich nun der alte Gutsherr.
„Dann wollen wir mal zur Tat schreiten“, forderte er die Anwesenden auf. Und zu einem der Diener, die mehr oder weniger aufmerksam an der Wand standen, um auf jeden Wink zu reagieren, sagte er: „Gib der Frau Gräfin Bescheid, sie möge kommen.“
Zwei andere Lakaien beeilten sich, Überröcke und Mäntel aus dem Seitenkabinett zu holen, um daraufhin den Männern beim Ankleiden zu helfen. Auf ein weiteres Zeichen des Grafen nahm ein vierter Diener vom nebenstehenden Tischchen eine Platte mit allerlei Dingen auf und trug diese hinter der kleinen Gesellschaft her nach draußen.
Vor der Tür erwartete die Männer ein strahlend frostiger Tag, den die blasse Sonne nur zögerlich erwärmte. Während die Zeugen und der Notar zu ihren Plätzen gingen, traten der Graf und sein Sohn bis zum Geländer der Freitreppe vor und schauten auf die im Hof versammelten Männer, Frauen und Kinder.
Neugierig musterten die vorne stehenden den neuen Herrn. Sie sahen einen großgewachsenen, schlanken Mann von Mitte zwanzig, dessen braunes Haar altmodisch mit einer schwarzen Schleife im Nacken zusammengebunden war. Auch Rock und Hose schienen nicht der neuesten Mode zu entsprechen. Allerdings wusste keiner der Bauern unten im Hof, nach welcher Mode ein Herr heutzutage gekleidet sein musste.
Am Hof in Kopenhagen dagegen war die Kleidung des jungen Grafen sofort als passer de mode bemerkt und sein Träger hinter vorgehaltener Hand als rückständig belächelt worden. Aber der junge von Lindenau scherte sich nicht um das Gerede der Hofgesellschaft. Er war vor fünfundzwanzig Jahren auf Lipsande zur Welt gekommen, doch aufgewachsen war er in Kopenhagen, weil sein Vater kurz nach der Geburt des Sohns dänischer Generaladjutant wurde. Das machte eine dauernde Anwesenheit in der Hauptstadt nötig. Lediglich zur Jagdsaison war die Familie auf Lipsande.
Elisabeth Katharina, die zweite Frau des alten Grafen und Stiefmutter Johann Heinrichs, erschien nun auf dem Treppenabsatz. Wie einstudiert reagierte die Menge im Hof mit einer gemeinsamen Kopfbewegung in ihre Richtung, und die Männer auf dem Podest erhoben sich von den Stühlen und drückten mit einer Verbeugung ihre Ehrerbietung aus.
Der alte von Lindenau hob seine Hand. Augenblicklich verstummte das Gemurmel im Hof.
„Leute! Meine lieben Untertanen“, begann er. „Ich habe euch heute hier zusammenkommen lassen, damit ihr, wie es seit alters her üblich ist, euern neuen Herrn begrüßt und der Übergabe des Gutes beiwohnt.“
„Vor vier Jahrzehnten“, fuhr er fort, „habe ich von meinem Vater Graf Bertram, die Alten unter euch werden ihn noch kennen, die Haushaltung übernommen. Mit Gottes Hilfe kann ich heute mit warmer Hand und im Besitz aller meiner Kräfte meinem einzigen Sohn Johann Heinrich, seines Zeichens Kammerherr unseres lieben und hochverehrten Königs Christian, Haus und Hof übergeben.“
Mit den letzten Worten hatte er sich aufmunternd seinem Sohn zugewandt. Dieser blickte ernst und scheinbar ungerührt an seinem Vater vorbei auf die Leute unten im Hof.
„Herr Justiziar Tönnies wird die Amtshandlung eurer Eidabnahme vornehmen“, setzte der alte Graf seine Rede fort, „und wird euch den Ablauf erklären.“
Sohn und Vater nahmen in den Sesseln an Elisabeth Katharinas Seite Platz. Tönnies trat ans Geländer, räusperte sich und mit einer Verbeugung den drei Lindenaus zugewandt, begann er im salbungsvollen Ton:
„Mein Dank gilt dem hochedlen und hochwohlgeborenen Herrn Generaladjutanten Graf Detlev von Lindenau sowie seiner Gemahlin, der hochverehrten Frau Gräfin Elisabeth Katharina von Lindenau und dem hochedlen und hochwohlgeborenen Herrn Kammerherr Johann Heinrich von Lindenau dafür, die Amtshandlung der Gutsübergabe von Lipsande zu überwachen und leiten zu dürfen. Dieses Amt werde ich nach besten Wissen und Gewissen ausführen, zum Nutzen der Herrschaft und des Gutes sowie der Untertanen. Ich werde nun die Vollmacht vorlesen, die es mir gestattet, diese Amtshandlung vorzunehmen.“
Die Leibeigenen im Hof versuchten gar nicht erst, der Rede des Syndikus zu folgen. Die Worte hörten sie wohl, doch ihren Sinn verstanden sie kaum. Ihre Sprache war einfach und direkt, und die in ihren Ohren geschraubte Sprechweise wirkte einschläfernd auf sie.
Dessen ungeachtet fuhr Tönnies fort: „Als Zeugen der nun zu vollziehenden Handlungen haben wir folgende Personen für vertrauenswürdig befunden.“
Es folgte die Aufzählung aller Zeugen. Jedes Mal, wenn ein Name gesagt wurde, stand der Betreffende auf und verbeugte sich gegenüber der Herrschaft.
Nachdem der Justiziar geendet hatte, erhob sich der alte von Lindenau und nahm dem hinter ihm stehenden Burschen das Tablett ab. Darauf lagen ein Schlüssel, eine kleine Erdscholle, ein ebenso kleines Stück Holz und ein kleiner Fisch, der in einer Glasschale mit Wasser schwamm. Dies alles präsentierte der Graf zuerst der auf dem Hof stehenden Menge und dann seinem Sohn mit den Worten:
„Hier übergebe ich den Besitz des Gutes Lipsande mit allen Äckern, Wiesen, Wassern, Weiden, Holzungen und Häusern, den lebenden und den festen Inventarien an meinen Sohn Johann Heinrich von Lindenau.“
Der junge Graf nahm das Tablett und sprach so laut, dass auch die hinten stehenden ihn hören konnten.
„Diesen Teller nehme ich zum Beweis und Anerkennung der wirklich geschehenen Übertragung des Guts Lipsande mit allem Zubehör. Euch, meine lieben neuen Untertanen, gelobe ich, ein gerechter Herr zu sein, wie auch ihr mir immer treu und redlich zu dienen habt.“
Nach dieser symbolischen Übergabe erklärte Tönnies, dass die Leibeigenen nun ihres Eides gegenüber dem bisherigen Herrn entbunden seien und fügte weiter an:
„Ich zweifle nicht, dass ihr der neuen Obrigkeit genauso gehorsam seid wie der alten. Ich wünsche dem neuen Herrn mit Gottes Beistand eine lange und beglückende Regierung bei stets währender Gesundheit.“
Er machte eine kleine Pause, in der er sich geräuschvoll räusperte, und fuhr dann fort: „Ich verlese nun für alle die Formel, auf die der Eid geleistet wird. Dann werdet ihr nach Spezifizierung der Dörfer aufgerufen und erscheint hier oben, sprecht den Eid auf die Bibel und bestätigt ihn mit eurer Unterschrift. Für alle diejenigen, die nicht schreiben können, werden die Zeugen die Eidesleistung attestieren.“
Schon wollte er die Formel vorlesen, als Johann Heinrich ihn zurückhielt und sich an die im Hof stehenden wandte.
„Liebe Untertanen!“, hob er an. „Als euer neuer Herr möchte ich den Tag gebührend würdigen. Auf besonderen Wunsch meiner hochverehrten Frau Mutter, Gräfin Elisabeth Katharina, werde ich zukünftig einen Lehrer beordern, der alle Kinder ab dem siebten Jahre bis zu ihrem zwölften in Lesen, Schreiben und Rechnen unterweisen soll. Dies wird immer von Martini bis zum Tag des heiligen Markus geschehen. Ich werde veranlassen, dass ein Schulhaus gebaut wird. Für die Ausstattung der Stelle erhält der zukünftige Schulmeister ausreichendes Gartenland und jährlich vierzig Reichstaler sowie ein Deputat an Holz und Brotmehl. Außerdem wird zusätzlich aus der Privatschatulle meiner hochverehrten Frau Mutter jedem Schulkind ein Paar Holzschuhe gespendet.“
Vor ein paar Wochen war Elisabeth Katharina mit dem Wunsch nach einer Schule an ihren Stiefsohn herangetreten. Anders als er war sie überzeugt, dass allen Menschen ein Mindestmaß an Bildung zustehe. Zumindest war sie der Ansicht, dass sich dadurch so schreckliche Ereignisse, wie sie in Frankreich geschehen waren und noch geschehen, abwenden lassen. Sie hatte eine Weile gebraucht, um Johann Heinrich von der Notwendigkeit zu überzeugen. Ihr pietistischer Sohn hatte erst zugestimmt, als sie ihm vor Augen führte, dass seine Untertanen dadurch Gottes Wort selbst der Bibel entnehmen könnten und ihr christlicher Glaube dadurch gestärkt werde. Elisabeth Katharina wusste genau, mit welchen Argumenten sie bei ihm etwas erreichen konnte.
Johann Heinrich war nicht wirklich altmodisch. Er fand, dass er in einigen Punkten dem Neuen gegenüber sogar aufgeschlossen war. Die Auflösung der herrschenden Ordnung, die er all überall sah, bekräftigte ihn allerdings eher in seiner Überzeugung, das Althergebrachte zu schützen. Dazu war Gottes Wort wichtig und nicht das, was ein Rousseau oder ein Voltaire verkündeten oder gar ein Schiller, der Theaterstücke schrieb, die zur Rebellion aufriefen.
Oben auf der Freitreppe hielt Johann Heinrich jetzt inne. Auf seine Ankündigung, eine Schule einzurichten, hatte er Zustimmung erwartet. Zwar bemerkte er eine gewisse Unruh unter den Leuten, doch Sätze wie: „Die sollen besser bei den Diensten helfen“, oder, „Das macht nur hochnäsig“, drangen nicht bis an sein Ohr.
„Der Religionsunterricht wird weiterhin vom Pastor Sellmann erteilt“, setzte er fort, als er merkte, dass der Beifall ausblieb. „Und damit die Schule für alle Schüler gut erreichbar ist, wird sie in der Mitte des Gutes, vis á vis der Meierei ihren Platz finden.“
Als Einziger fing nun Krogmann an zu klatschen. Zustimmung heischend blickte er um sich. Einige wenige Hufner klatschten ebenfalls.
„Außerdem“, fuhr der junge Graf fort, „sind heute alle von den Diensten befreit, bis auf die, die für das Vieh zuständig sind, danach können auch sie in der großen Scheune zum Tanz und Fest zusammenkommen. Drei Fässer Bier und Speise für alle werden von mir gestiftet. Außerdem sollen die Armen zwei Scheffel Brotkorn zusätzlich bekommen. Und nun, mein lieber Syndikus, beginnt mit der Eidesformel.“
Er trat vom Geländer zurück. Beifall war wohl nicht mehr zu erwarten. Doch er kannte seine Untertanen noch nicht, denn der Applaus erscholl nun ohne Verzögerung, begleitet von einzelnen zustimmenden Bravorufen und Pfiffen. Ein bisschen zu viel und zu lange, wie Elisabeth Katharina im Stillen meinte. Aufmunternd lächelte sie ihrem Stiefsohn zu und drückte seine Hand, nachdem er sich neben sie gesetzt hatte.
Nun endlich konnte Tönnies die Eidesformel verlesen. Daraufhin begaben sich die alte und neue Herrschaft sowie die Zeugen in den Friedenssaal, um dort von jedem Untertanen den Eid zu fordern, man wollte schließlich nicht den ganzen Tag draußen in der Kälte verbringen.
Ich weiß noch, wie einige Leute im Hof geredet hatten, als von Lindenau die Schulmeisterstelle ankündigte. Vielleicht erwartete er laute Zustimmung von uns. Doch die Leute murrten: Die Gören sollen besser arbeiten, statt Lesen zu lernen. Wofür sollte das gut sein? Das Einverständnis hielt sich sichtlich in Grenzen. Damit es für die Herrschaft nicht gar zu peinlich wurde, trat Krogmann in Aktion. Typisch! Er klatschte in die Hände und rief laut: „Ein Hoch auf unseren guten Herrn und unserer guten Herrin!“
Zufällig trafen sich unsere Blicke. Gott, war der beseelt von dem Gedanken der Herrschaft zu gefallen. Der Beifall war spärlich.
Detlev neben mir konnte sich nicht zurückhalten. Wie es seine Art war, sagte er laut und deutlich: „Den Eid braucht er nicht sprechen, aber gut in den Mors kriechen, das kann er.“ Er meinte den Holländer.
Einige der Umstehenden stimmten ihm zu. Max Maas Hufner aus seinem Dorf sagte, Detlev solle das nicht den Vogt hören lassen, der müsse solche Reden weitergeben.
„Schiss?“, hatte Detlev zurückgefragt. „Dann stell´ dich doch vorn zum Holländer. Und wenn du nichts sagst, vom wem soll´s der Vogt denn wissen, he?“
Detlevs Schwester Greetje war mit Maas verheiratet, weshalb sich Detlev, obwohl er Knecht war, solche Reden einem Hufner gegenüber leistete. Allerdings war Detlev auch sonst nicht fürs Muckertum bekannt.
Ich selbst fand die Idee mit der Schule nicht schlecht. Doch ich hätte den Teufel getan, Krogmann zuzustimmen. Ich konnte damals schon schreiben und rechnen. Vater hatte es uns Kindern beigebracht, und auch Mutter lernte es. Immer am Sonntagnachmittag war eine Übung fällig. Was für einen Spaß hatten wir, wenn Vater uns die nächsten Buchstaben beibrachte. Weil wir natürlich das Geld für Papier und Tinte nicht hatten, hat er sich was Besonderes ausgedacht. Zur ersten Stunde erschien er mit einem Holzkasten, flach wie ein Tablett. „Das ist unsere Tafel“, erklärte er und streute aus einem Säckchen feinen Sand hinein, den er gleichmäßig verteilte und glattstrich. „Meine Kinder“ waren die ersten Worte, die wir lernten und die er mit einem Holzstäbchen in seiner typischen schnörkellosen Schrift in den Sand schrieb.
Ich bin mir sicher, dass er diese Worte mit Bedacht gewählt hatte. Dass Mutter und wir Kinder ihm das Liebste auf der Welt waren, habe ich sein ganzes Leben hindurch gespürt.
Heute weiß ich, dass seine Art, uns zu erziehen, geprägt war von einer allgemeinen Menschenliebe und von dem Glauben an das Gute im Menschen. Doch da war noch etwas anderes. Ich kam erst dahinter, als ich Jahrzehnte später in Vaters Nachlass einen Briefwechsel gefunden habe, den er mit einem Freund noch vor seiner Heirat begonnen und später, als er ein freier Mann war, fortgeführt hatte. Darin waren Gedanken niedergeschrieben, in denen ich sein Handeln wiedererkannt habe. Namen wie Rousseau, Voltaire und Leibnitz tauchten in den Briefen auf. Wenn ich in dem Zusammenhang heute an Schule und Erziehung denke, kommt es mir vor, als habe er sich von den dreien nur das ihm Genehme herausgepickt und zu seiner Handlungsmaxime gemacht.
Von Lindenaus Erklärung an jenem Tag im Februar, eine Schule im Gut einzurichten, war für mich ein gutes Zeichen. Es schien, als hätte er in dieser Hinsicht eine ähnliche Einstellung wie mein Vater, was natürlich ein vermessener Gedanke war.
Meine Kindheit war trotz der Leibeigenschaft nicht freudlos. Vater war immer bestrebt, uns Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Schreiben und Rechnen gehörten wie selbstverständlich dazu. Manchmal hatte ich trotzdem das Gefühl, dass er sich an unserem Dasein als Insten schuldig fühlte. Mutter und wir Kinder kannten nur ein Leben als Leibeigene, aber er war ein freier Mann gewesen. Der Vergleich muss ihn in manchen Stunden schmerzhaft in den Sinn gekommen sein. Deshalb wohl das Bestreben, unsere Lage zu verbessern, wo es ihm möglich war.
Bis zur Gutsübergabe hatten ich und die meisten anderen Leibeigenen im Gut ein erträgliches Dasein. Zwar waren die Dienste zu absolvieren, die beileibe nicht immer leicht waren, doch es wurde kaum geprügelt und Vergehen wurden mit mäßigen Strafen belegt. Das sich unter der Herrschaft des jungen Lindenaus die Verhältnisse verschlechtern würden, kam nur den wenigsten von uns an diesem Tag in den Sinn.
4
Auf dem Gut hatte die Torhausuhr mittlerweile die elfte Stunde geschlagen. Noch immer hatten nicht alle Leibeigenen den Eid geleistet. Die Rathbeker Untertanen standen nun halb auf der Treppe, halb auf dem Ehrenhof.
„Jung zu mir!“, rief Peter Böhlau seinen Sohn herbei, der gedankenverloren etwas abseits stand und in Richtung Torhaus starrte. Dort verschwand der Holländer gerade mit seinen Leuten. Jochim hatte Dörthe nicht sprechen können Krogmann ließ seine Mägde nicht einen Moment aus den Augen.
„Du weißt, was du tun musst?“, fragte der Vater.
„Was?“
Einen Augenblick stockte Jochim, besann sich aber und begann dann sein Sprüchlein aufzusagen: „Ja, ich weiß. Ich soll die Herrin nicht unverschämt anstarren, ich soll meine Kappe abnehmen, ich soll nicht stottern, ich soll laut sprechen, ich soll nur was sagen, wenn ich gefragt werde, ich soll nicht vergessen, mich zu bedanken, ich soll …“
„Gut“, unterbrach ihn der Vater. „Denk daran, Junge. Ich werde sie fragen. Das ist die Gelegenheit. Oder willst du immer Schweine hüten? Ein Dienst auf dem Hof bringt mehr Ansehen. Denk daran, Junge“, wiederholte er.
Peter Böhlau hoffte inständig, dass sein Wunsch, die Gelegenheit, wie er es bezeichnete, bei der Herrschaft Gehör finden würde.
Eines Sonntags nach der Messe, es waren zwei oder drei Wochen vor der Gutsübergabe, hatte Vater mir von einer Gelegenheit erzählt, die sich uns und im Besonderen mir bieten würde. Er habe mit Hans gesprochen und ihn gefragt, was der über meine Arbeit als Hütejunge der Schweine sagen könne.
„Mol wat tüddelig, aver en gode Arbeider“, war Hans´ Antwort.
So war im Kopf des Vaters die Idee gereift, ich könne nun als Jungknecht auf dem Haupthof arbeiten.
„Und was hat Henningsen dazu gesagt?“, fragte Mutter, als er ihr seine Gedanken mitteilte. Sie kannte das angespannte Verhältnis zwischen Vater und dem Gutsvogt. Vater musste zugeben, dass der Vogt dies Verlangen nicht an den Verwalter weitergeben würde.
„Ich werde die Herrschaft selbst fragen“, erklärte er bestimmt.
„Du bist doch nicht ganz gescheit, Mann! Du kommst nicht einmal in die Nähe des Hauses.“ Mutter tippte sich an die Schläfe.
Es kam selten vor, dass sie sich Vater gegenüber unfreundlich zeigte. Doch in Fragen der Gutsordnung meinte sie, die Fachkundigere zu sein.
„Frau, du hältst dich da raus. Ich weiß, was ich tu. Zu Lichtmess ist die Gelegenheit gut, wenn wir alle zum Eid auf den Hof müssen. Hans sagte, dass die Herrschaft auch da sein muss. Und dann werde ich sie fragen.“
„Ja, die wollen bestimmt hören, was der Inste Peter Böhlau für Wünsche hat. Die stecken den Jungen dahin, wo sie es für richtig halten“, erwiderte die Mutter mit einem Anflug von Spott. Woraufhin der Vater die Mutter zurechtwies, sie solle jetzt still sein, es würde so gemacht, wie er es gesagt habe.