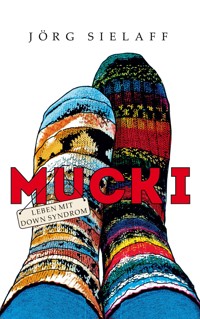Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Aufschreiben von "Lisbeth - Mein Weg", versetzte ich mich in ihr Leben 1916 bis 1990. Ihre Umsiedlung, bzw. die Vertreibung aus Poppow, haben mich sehr beschäftigt. Ihr Schicksal, als Flüchtling aus den Ostgebieten und nicht gerne aufgenommen, teilten vielen Menschen. Hoffnungsvoll komme ich als junge Frau nach Berlin und hoffe, dass ich in der Millionenstadt gut zurechtkomme. Ich verliebe mich und heirate im Krieg. Durch die beginnenden Kriegswirren soll ich in einer Munitionsfabrik arbeiten, kann es aber verhindern und komme zum Luftwaffenkommando. Die beginnenden Luftangriffe ließen mich wieder in meine Heimat gehen. Dort erlebte ich das Elend der großen Flüchtlingstrecks und die Besatzungen durch Polen und Russen nach dem Ende des Krieges. Verlor meinen Sohn und begann im September 1945 mit der Umsiedlung in den Westen. Hierbei erlebte ich Hunger, Willkür, Gewalt und auch großzügige Hilfe. Bei Salzgitter im Dorf Barbecke in Niedersachsen konnte ich mir langsam eine neue Existenz aufbauen. Nach der Rückkehr meines Mannes Leo aus amerikanischer Gefangenschaft war meine Ehe eher eine Zweckgemeinschaft unter der ich stark litt. Schließlich zog ich mit meiner Familie sogar in ein kleines Reihenhaus. Leos Bestreben war ein Leben in der Großstadt und nicht auf dem Lande. Unser Verhältnis wurde immer angespannter, wir lebten nur noch nebeneinander und er war oft sehr böse zu mir. Leo ging beichten, ließ mich aber mit meinem Kummer allein. Mein Trost waren meine Tochter und meine Schwester.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Sielaff, geboren 1940 in Eutin, Schleswig Holstein, verbrachte die ersten Lebensjahre in Kiel. Nachdem das Wohnhaus der Familie zerbombt worden war, zog seine Mutter mit ihm und seinem Bruder nach Brückenberg in Schlesien. Von dort mussten sie im Februar 1945 durch die Kriegswirren fliehen und kamen nach Deggendorf am Bayerischen Wald in Niederbayern. Hier wurde er eingeschult. 1948 Umzug nach Berlin. Nach dem Schulabschluss, 12. Klasse, zweijähriges Baupraktikum und Studium Fachrichtung Hochbau an der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen in Berlin-Neukölln. Bis 1974 als Architekt und Stadtplaner in Frankfurt/Main, von 1974 bis 2001 im Land Hessen als angestellter Kommunalberater tätig, danach selbständiger Kommunalberater.
Jörg Sielaff wohnt seit 1981 in Schlüchtern, Main-Kinzig Kreis, Hessen. Er ist das zweite mal verheiratet und hat drei Töchter. In den Jahren 1986 bis 1989 initiierte er den Nordhessischen Kultursommer und gründete mit Kulturschaffenden 2010 das KulturWerk Bergwinkel e.V. in Schlüchtern, in dem er noch heute aktiv ist. Als Autor hat er bisher veröffentlicht: „Gespräch mit meinem vermissten Vater, was ich dem U-Boot-Offizier gerne erzählt hätte“ und „Geschichten aus der Provinz, Episoden aus meinem Berufsleben“.
1916 bis 1990
Herausgegeben von Jörg Sielaff
Inhalt
Vorbemerkung
Meine Kindheit in Poppow
Alleine in Berlin
Habe mich verliebt
Treppenhausverlobung
Heirat im Januar 1940
Überleben in Berlin
Poppow und Kriegsende
Fremde in Poppow
Verlassen der Heimat
Auf dem Weg nach Berlin
Zwischenstation
Weiter gen Westen
Ein neues Zuhause
Nachbetrachtungen
Meine Aufzeichnung
Vorbemerkung
Mit dem Aufschreiben von Lisbeths Weg aus Poppow nach Berlin, im Krieg zurück nach Popowo, wie es heute heißt, weiter nach Barbecke, mache ich den Versuch, mich in das Leben von Lisbeth hinein zu versetzen. Sie starb 1990, fünf Jahre nachdem ich ihre Tochter Margitta, genannt Gitti, kennenlernte.
Der Wunsch, Lisbeths Leben wieder lebendig werden zu lassen, wurde durch Besuche in dem heutigen Popowo immer stärker.
Bei einem Besuch im Jahr 2005 in Popowo konnten sich Lisbeths Tochter und ihr Mann von der kleinen Dorfschule ein Bild machen. Sie wird inzwischen als Wohnhaus genutzt. Am Ortsausgang steht für die heutigen Schüler und Schülerinnen eine größere neue Schule. Lisbeths Tochter fiel in der Umgebung von Poppow die sanfte und hügelige Landschaft auf, die sie sehr an Schleswig Holstein und die Holsteinische Schweiz erinnerte. Die Felder um das Dorf herum waren alle sehr ordentlich bestellt. Sie spazierten über einige Feldwege, um einen weiteren Blick auf das Dorf zu erhalten und viele Erinnerungen aus den Erzählungen von Lisbeth in Poppow aufzuspüren.
Lisbeths Tochter und ihr Mann suchten nach den Teichen aus Lisbeths Kindheit, von denen sie manchmal erzählte. Aber sie fanden sie nicht, wahrscheinlich wurden sie in den letzten Kriegstagen durch die durchfahrenden Panzer einfach zugefahren. Weiter war der Friedhof, auf dem Lisbeths Sohn Wilfried begraben wurde, nicht zu finden. Er musste in der Nähe des Waldes gelegen haben. Ein Anruf bei Gerd, Cousin von Lisbeths Tochter, der sich noch gut erinnern konnte, er war 1945 im Herbst 12 Jahre alt, als er mit der Familiengruppe von Poppow wegging. Er bestätigte, dass die Polen nach dem Ende des Krieges mit den Panzern den ganzen Friedhof, der in der Nähe zum Wald lag, eingeebnet hatten.
Wir konnten auch keine Bäume, die meistens sehr alt waren, finden, die möglicherweise einmal einen Friedhof begrenzt haben könnten. Wir erinnerten uns an Dörfer in Schleswig Holstein und auch in Hessen, wo man häufig den Friedhof außerhalb des Dorfes angelegt hatte und meistens mit Eichen oder anderen großen Bäumen an den Ecken und Längsseiten bepflanzt hatte.
Da wir kein polnisch konnten, war es eine etwas umständliche mit Händen und Kopfbewegungen versuchte Unterhaltung mit den Bewohnern in der Nähe des ehemaligen Schulhauses und dem Hof, auf dem Lisbeth aufwuchs. Wir wurden natürlich bei unserem Suchen und Schauen aus den Häusern beobachtet. Schließlich kam eine Frau aus ihrem Garten auf uns zu und bat uns freundlich in ihr Haus. Sie bot uns Kaffee und Kekse an. Die Frau konnte einige Brocken deutsch und wir konnten ihr klarmachen, dass bis 1945 Lisbeth im Dorf wohnte.
Der Nachbarort Labun interessierte uns natürlich ebenfalls, zumal dort die evangelische Kirche stand. In dieser Kirche besuchten die Mitglieder der Familie sonntags den Gottesdienst. Außerdem wurden dort alle kirchlichen Feiertage mit besonderen Festgottesdiensten wahrgenommen. So hatte es uns Lisbeth immer berichtet. Wir näherten uns der Kirche in Labun und sahen, dass sie total eingerüstet war. Besonders auffällig war das Gerüst um den Turm. Wir gingen vorsichtig durch die offene Tür in den Innenraum der Kirche und sahen, dass sie auch innen eingerüstet war. Zwei Handwerker arbeiteten dort. Nachdem sie uns entdeckt hatten, winkten sie uns, wir sollten kommen. Einer der Handwerker sprach gebrochen Deutsch. Er erklärte uns, dass diese ehemalige evangelische Kirche nach dem Ende des Krieges ein Katholisches Gotteshaus wurde und jetzt umfänglich renoviert würde. Wenn wir möchten, könnten wir über das Gerüst außen in den Turm klettern, wir müssten nur aufpassen, dass wir uns nicht den Kopf anstoßen. Von dort oben hätte man nämlich einen schönen weiten Blick. Wir folgten seiner Einladung, nur vergaßen wir seine Warnung und stießen uns kräftig unsere Köpfe an der tief sitzenden Gerüststange. Doch der herrliche Blick ließ uns unseren Schmerz am Kopf sofort vergessen. Da es ein sonniger Tag war, konnten wir bei dem weiten Blick in die sanfte pommersche Landschaft in Gedanken die Kindheit von Lisbeth erahnen.
Vor allem aber ihre Umsiedlung, bzw. die Vertreibung aus Poppow, haben mich mehr und mehr beschäftigt. Daraus ist eine kleine Lebensgeschichte geworden, in der ich mich in das Leben von Lisbeth hineinversetzte. In der Nachkriegszeit ist es vielen Menschen ähnlich wie Lisbeth ergangen, die als Flüchtlinge aus den Ostgebieten kamen und nicht gerne aufgenommen wurden. Sie mussten sich in einer für sie unbekannten Umgebung eine neue Existenz aufbauen. Was dem einen besser und manch einem schwer gelang. Mir hat das Schreiben als Lisbeth eine Bereicherung gebracht.
Meine Kindheit in Poppow
Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in Poppow in Hinterpommern in der Nähe des „Polnischen Korridors“. Dieser wurde nach dem ersten Weltkrieg geschaffen und bildete die Verbindung, die den Polen den wichtigen Zugang zur Ostsee ermöglichte. Dadurch besaß Polen den wertvollen Hafen Gdingen und eben auch Danzig. Jetzt muss ich erst einmal erklären, wo Poppow überhaupt liegt. In einem Atlas kann man es kaum finden. Nicht weit weg von diesem Korridor liegt das Dörfchen Poppow. Die nächste Kreisstadt ist Lauenburg in Hinterpommern. Hier bin ich auf die Welt gekommen. Es war ungewöhnlich, dass ich nicht in meinem Elternhaus geboren wurde aber meine Mutter hatte während der Schwangerschaft mit mir überraschenderweise Probleme bekommen und so empfahl die Hebamme, doch lieber eine Geburt im Kreiskrankenhaus. Ich war die jüngste von sechs Geschwistern. Vor mir kamen auf die Welt drei Schwestern und zwei Brüder. Die älteste von uns Mädchen war genau zehn Jahre älter als ich.
An meine ersten Jahre in Poppow kann ich mich eigentlich nur an unser Wohnhaus mit der gegenüberliegenden Scheune und den drum herum stehenden Obstbäumen erinnern, weil ich mit meinen Geschwistern oft Verstecken und Fangen gespielt habe. Den Reim, den man sagen musste, wenn sich die anderen versteckten, höre ich immer noch: „Eins, Zwei, Drei, Vier Eckstein alles muss versteckt sein, hinter mir und vor … mir, gibt es nichts, ich komme!“ Einmal konnte ich mich in der Scheune so verstecken, dass mich meine Mutter und meine älteste Schwester Frieda einen halben Tag nicht finden konnten. Erst mein Hunger ließ mich aus meinem Versteck heraus krabbeln.
Das Schulgebäude lag etwas am Rande des Dorfes aber trotzdem in der Mitte an der Straße nach Ockerlitz. Dort gab es nur einen Klassenraum, in dem wurden die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse unterrichtet, wobei es eigentlich jeweils nur zwei bis drei Kinder eines Jahrgangs waren, die gemeinsam, wie in einer Dorfschule üblich, unterrichtet wurden. Zu meinem ersten Schultag wurde mir von meiner Oma ein neues Kleid genäht, welches ich später auch sonntags zur Kirche trug, bis ich herausgewachsen war. An diese Besonderheit erinnere ich mich, da ich ja sonst immer nur die Kleider meiner älteren Schwestern auftragen musste. Außerdem bekam ich eine kleine Zuckertüte mit süßen Leckereien. Das kann man nicht mit heutigen Schultüten vergleichen, aber ich war im Jahr 1923 glücklich, eine Kleinigkeit nur für mich alleine bekommen zu haben. Eine Einschulung im Dorf in Hinterpommern war trotzdem eine feierliche Angelegenheit, die Feldarbeit ruhte an diesem Tag. Alle Kinder wurden fein angezogen und das ganze Dorf war auf den Beinen. Ich weiß heute nicht mehr, ob die älteren Dorfbewohner zu diesem Anlass dem Alkohol reichlich zuprosteten. Jedenfalls wurde bis in den Abend noch gefeiert.
In dem Klassenraum wurden 14 bis 16 Schüler oder Schülerinnen unterrichtet. Unser Lehrer hieß Herr Sell, wir nannten ihn nur Sell, das durfte er aber nicht hören. Wir mussten immer sehr ordentlich sagen: „Guten Morgen Herr Sell oder auf Wiedersehen Herr Sell!“ Er unterrichtete mich bis zum Verlassen der Volksschule. Die älteren Schüler haben sich oft über die „Kleinen“ lustig gemacht und sie besonders geärgert. Da musste der Lehrer Sell, der im Obergeschoss des Schulhauses seine Wohnung hatte, häufig vermitteln und die Streithähne beruhigen. Übrigens der Lehrer war unverheiratet und wir Kinder sahen ab und zu, dass eine junge Frau aus einem Nachbarort im Obergeschoss verschwand. Wir kicherten immer, wenn wir sie sahen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es noch weitere Lehrer oder eine Lehrerin gab? Nur den Religionsunterricht erteilte uns der evangelische Pfarrer. Nach der vierten Klasse besuchte ich die Volksschule im Nachbardorf Ockerlitz. Dieses Dorf war ungefähr drei Kilometer weiter entfernt. Dorthin fuhr ich mit dem Fahrrad, in den Wintermonaten mussten alle Schüler aus Poppow zu Fuß auf der Landstraße bei Wind und Wetter gehen. Nach acht Schuljahren endete meine Schulzeit. Natürlich auch die aller anderen Schüler aus meinem Jahrgang.
Es war das Jahr 1932. Meine Eltern hatten insgesamt sieben Kinder und es war üblich, dass sie hofften, dass ihre Mädchen einen jungen Mann fänden, der sie später heiratete, um versorgt zu sein. Eine weiterführende Schule in der Kreisstadt Lauenburg kam aus finanziellen Gründen weder für die Jungen und schon gar nicht für die Töchter in Frage. So blieb eigentlich allen nur die Möglichkeit einer Handwerkslehre oder in dem kleinen elterlichen ländlichen Betrieb mitzuarbeiten. Für mich blieb nur im kleinen ländlichen Betrieb zu helfen und abzuwarten, bis ich einen Mann finde, der mich heiraten möchte. So machte ich das, was ich auch schon während der Schulzeit tat. Ich hütete die Gänse und die zwei Ziegen auf den umliegenden Weiden unseres Dorfes, was ich auch sehr gerne tat. Mir gefiel die sanfte Landschaft mit der Mischung aus Wiesen, Büschen und Bäumen, die meistens nur kleine Baumgruppierungen waren. Besonders das Frühjahr mochte ich, wenn es nach dem strengen Winter mit starkem Frost und viel Schnee wieder alles grünte und blühte.
Als kleines Mädchen entdeckte ich an zwei Stellen in der Nähe von Bäumen und Sträuchern kleine Teiche. Sie waren von uns Kindern besonders, eigentlich das ganze Jahr über, sehr beliebt. Im Frühjahr, meistens schon im März, nur wenn der Winter sehr lange kalt war, erst im April, beobachten wir in den Teichen die Kaulquappen. Manches Jahr konnten wir auch die Frösche entdecken und wunderten uns erst, dass die männlichen Frösche auf dem Rücken der weiblichen Tiere hockten. Bis uns die Älteren sagten, dass dies der Begattungsakt ist. Danach gibt es die Kaulquappen und daraus werden wieder kleine Frösche. In dem größeren Teich begannen wir im Sommer mit unseren ersten Plantsch- und Schwimmversuchen. Dabei war es fast egal, wie warm oder kalt das Wasser war. Wir bibberten und zitterten zwar bei den niedrigen Wassertemperaturen und sahen manchmal richtig blau aus, aber das machte uns nichts aus. Jedenfalls hatten wir immer eine große Freude im und am Wasser. Eingehüllt in ein Handtuch gingen wir bei kaltem Wetter nach Hause in unseren kleinen Hof.
Im Winter versuchten wir auf dem zugefrorenen Teich zu schliddern. Schlittschuhe kannten und hatten wir nicht. Dabei passierte es fast in jedem Winter, dass einer von uns Kindern im Eis einbrach, weil es noch nicht dick genug war. Aber es reizte einfach, auf das Eis zu gehen, wenn es so unheimlich knackte. Wir wurden natürlich von den Eltern und Tanten immer gewarnt. Doch wenn einer von uns nass in das Haus kam, wurden wir zwar geschimpft aber auch liebevoll trocken gerieben. Als wir älter wurden, trafen wir uns mit den etwas älteren Jungen abends an dem einen Teich, der ziemlich versteckt und vom Dorf nicht einsehbar war. Dort konnten wir ungestört schmusen und so langsam die Vorahnungen der zärtlichen Liebe genießen.
Meine Eltern waren beide in Hinterpommern seit mehreren Generationen beheimatet. Mein Vater Friedrich Kalff arbeitete beim Zoll im West-Ostpreußischen Grenzgebiet im Landkreis Lauenburg. Er war auch für den Abschnitt des sogenannten „Polnischen Korridors“, die Verbindung von Polen zur Ostsee bei Danzig, zuständig. Nachdem meine Mutter Auguste krank und pflegebedürftig wurde, gab mein Vater seine Tätigkeit beim Zoll auf. Er betrieb dann unsere kleine Landwirtschaft, die vor der Krankheit meiner Mutter vor allem von ihr am Laufen gehalten wurde. Von ihr habe ich meine Fähigkeiten und mein Wissen über die umfangreichen Aufgaben in der Landwirtschaft gelernt. Meine Mutter Auguste starb schließlich an einer Lungenentzündung leider schon mit 57 Jahren im Jahr 1935. Mein Vater bezog eine kleine Rente, die aber nicht ausreichte, unsere Familie zu ernähren, so nahm er noch eine Arbeit als Gespannführer bei einem Bauern in Poppow an. Nach dem Tod meiner Mutter zog er in das Haus meiner Schwägerin, seiner Schwiegertochter Anna, sie schloss vor meinem Vater manchmal aber das Brot weg. Mit ihrem Mann, meinem Bruder Otto, hatte sie zwei Kinder, Günter und Dieter. Dort wohnte er mein Vater bis zu seinem unfreiwilligen Wegzug, es war ungefähr nur 200 Meter vom Haus meiner Schwester Frieda entfernt, in dem ich später auch in Poppow lebte. So wohnte unsere Familiensippe in unmittelbarer Nachbarschaft. Das ließ uns natürlich bei der großen Anzahl von Familienmitgliedern häufig schöne Feste, meist zu Geburtstagen sowie zu Weihnachten und zu Ostern feiern.
Der Tod meiner Mutter machte mich sehr unglücklich, sie war die Frau, die mir sehr viel zutraute und ich habe von ihr die gute positive Grundhaltung mitbekommen. Wir konnten herzhaft miteinander lachen. Vielleicht lag es daran, dass ich ihr Nesthäkchen gewesen war, als letztgeborene Tochter. Meine vier Schwestern sowie meine zwei Brüder waren alle älter als ich. Meinen jüngeren Bruder Reinhold habe ich nur kurz kennlernen können aber keine direkte Erinnerung mehr an ihn. Er wurde von einem tollwütigen Hund gebissen und die Verletzungen waren so stark, dass er daran schon mit vier Jahren gestorben ist. Meine Schwester Anna war nur ein Jahr älter als ich. Mit sieben Jahren hatte sie sich unbemerkt das Jagdgewehr unseres Vaters aus dem Schlafzimmer geholt. Keiner der Eltern und älteren Geschwister bekam es mit. Sie waren alle auf dem Acker bei der Kartoffelernte. Da mussten alle „Hände“ mit auflesen. Anna hantierte mit dem Jagd-Gewehr und dabei löste sich versehentlich ein Schuss, der sie in den Hals traf und daran ist sie verblutet. Meinem Vater Friedrich tat dies besonders weh, da er sonst immer die scharfe Munition aus seinem Jagdgewehr entfernt hatte. So waren wir nun nur noch fünf Geschwister als ich aus der Schule entlassen wurde.
Meine Schwester Ida traf sich oft mit Jungens aus dem Dorf und den Nachbardörfern. Sie war, wie man schon damals sagte, ein flotter Feger. Den Jungen war bekannt, sie sei leicht rumzukriegen und sie hatte mit einigen von ihnen heiße Liebeserlebnisse. Das konnte auf die Dauer nicht gutgehen, zumal sie sich inzwischen zu einem reiferen jungen Mann hingezogen fühlte. Sie bekam mit 16 Jahren unerwünschten vorehelichen Nachwuchs. Die Familie konnte ihre Schwangerschaft und Geburt ihres Sohnes, meines Neffen Gerd, in Poppow aber geheim halten. Das lag hauptsächlich an meinem Vater. Er kümmerte sich liebevoll neben seiner Arbeit um seinen ersten Enkel. Gerd wurde liebevoll von seinem Großvater großgezogen. Später ging in Poppow sogar das Gerücht um, mein Vater Friedrich Kalff, hätte ein uneheliches Kind. Mein Vater sah aber keine andere Möglichkeit, dem Gerd zu helfen, indem er ihn als Kind unter seine Fittiche nahm. Der kleine Mann konnte ja nichts dafür, dass er so eine junge Mutter hatte.
Ich führte in Hinterpommern ein echtes Landleben. Und war damit sogar recht zufrieden. Ich lernte bei einer Dorftanzveranstaltung, so wie eine Kirmes, in Okerlitz Jürgen kennen. Wir tanzten öfters zusammen und trafen uns auch manchmal an dem besagten Teich. Jürgen war mit seinen 20 Jahren beim, in Okerlitz stationierten, Reichsarbeitsdienst für die Straßeninstandhaltung eingesetzt. Er stammte aus Berlin und wohnte dort mit seiner Mutter alleine. Von seinem Vater erzählte er nichts. So erfuhr ich nicht, ob er noch lebte oder sich nicht mehr um seine Mutter kümmerte oder sonstiges. Der Reichsarbeitsdienst (RAD) war eine Organisation im nationalsozialistischen Deutschen Reich. Das Gesetz wurde im Sommer 1935 erlassen. Es verpflichtete alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts dem deutschen Volk im RAD zu dienen. Zunächst wurden nur junge Männer vor ihrem Wehrdienst für sechs Monate verpflichtet. Ich hatte mich mit Jürgen inzwischen so angefreundet, dass wir eher schon Verliebte waren. Es blieb natürlich nicht aus, dass wir uns richtig zärtlich näher kamen. Wir fanden eine Stelle auf einer Wiese, die von dichten Büschen umgeben war, wo uns keiner entdecken konnte. Es war meine erste Liebeserfahrung mit Jungens. Eines Tages fragte ich ihn, ob er sich vorstellen könnte, nach seiner Zeit beim RAD, mich mit nach Berlin zu nehmen. Ich hatte schon so viel über Berlin gehört und die jungen Menschen schwärmten eben von der Hauptstadt. Dort ist viel los und man kann auch gutes Geld verdienen.
So wuchs eben bei mir der Wunsch, meine dörfliche Gemeinschaft zu verlassen. Ich wollte nicht als junger Mensch in Poppow auf dem Land versauern. Mein Wille war es, nach Berlin zu kommen und dort mein Zukunftsglück zu suchen. Ich erinnerte mich an meinen Onkel Hans. Ihm schrieb ich meinen Wunsch, nach Berlin zu kommen, in einem Brief. In seiner Antwort bot er mir sogar an, bei ihm zu wohnen, bis ich eine andere Unterkunft gefunden hätte. Nachdem nun meine Mutter nicht mehr lebte, fühlte ich mich ungebunden und war der endgültigen Meinung: „Mein Glück muss ich nun in der Hauptstadt suchen!“ Ich war 19 Jahre alt und in mir erwachten der Unruhegeist und die Neugier nach Unbekanntem und Neuem. Durch Jürgen ergab sich sogar die Gelegenheit, dass ich bei ihm und seiner Mutter wohnen konnte. Er sah meinen Wunsch sogar als eine besondere Zuneigung zu ihm und war begeistert. Wir träumten von gemeinsamen Sonntagen bei den verschiedenen Festen im nächsten Jahr im Frühling.
Nun musste ich meine Absicht nach Berlin zu gehen, mit meinem Vater besprechen. Ein bisschen hatte ich „Bammel“, dass möglicherweise eine Ablehnung von ihm meine Träume platzen lassen könnten. Um es meinem Vater leichter zu machen, nahm ich Jürgen mit und wir erzählten von gemeinsamen Plänen in Berlin. Mein Vater sagte, dass er uns nicht im Wege stünde und er wünschte uns beiden Glück. Aber er fragte, wovon wollt ihr denn Leben? „Berlin ist so groß und da werden immer Leute zum Arbeiten benötigt“. Jürgen wollte ohnehin durch seine Arbeit bei der Straßeninstandhaltung bei einer Tiefbaufirma eine Anstellung suchen und möglicherweise eine Technikerausbildung beginnen.
Im November 1935 machte ich mich mit einem kleinen Gepäck auf zur Reichsbahn nach Lauenburg, um einige-Stunden später in Berlin anzukommen. Ich hatte Glück, denn Jürgen konnte seine Rückfahrt auf den gleichen Tag legen. So fuhren wir beide gemeinsam mit den Zügen von Lauenburg bis nach Berlin. Ich war damals mit meinen neunzehn Jahren sehr naiv und gutgläubig und hatte keine Vorstellungen, wie ich mein Leben finanzieren und meistern würde. Außerdem freute es mich, dass ich nicht alleine fahren musste. Richtige Gedanken, wie ich dort leben und arbeiten sollte, machte ich mir nicht. Ich war voller Vorfreude und ließ alles auf mich zukommen. Einige Zugreisende hielten uns für ein glückliches Liebespaar, was mich besonders freute aber direkt erröten ließ. Jürgen hatte seiner Mutter geschrieben, dass er nicht alleine zurück nach Berlin kommen wird. Er bringt eine kleine Freundin aus dem Dorf Poppow mit und die könnte doch bei ihnen wohnen; denn in der dreieinhalb Zimmerwohnung wäre doch auch noch genügend Platz. Sobald sie eine Anstellung habe, würde sie auch für das halbe möblierte Zimmer als Untermieterin zahlen.
Ich kam voller Erwartung am Stettiner Bahnhof in Berlin an. Erst mal musste ich die Großstadtgeräusche „verdauen“. Es klang alles viel hektischer und lauter als in meinem Dorf Poppow. Ich hörte Autogeräusche und Hupsignale, dazu noch Bus- und Straßenbahngeräusche, lautes Anpreisen von Straßenverkäufern für ihre Zeitungen und Zigaretten sowie Menschen mit umgehängten Pappschildern auf beiden Seiten, die für irgendwelche Geschäfte Werbung machten. Meinem Onkel Hans hatte ich schon vorher schriftlich mittgeteilt, dass ich sein Angebot, in den ersten Wochen bei ihm zu wohnen, nicht benötige. Ich würde bei einem Freund in Berlin-Neukölln wohnen können. Als ich aber in der Wohnung auf Jürgens Mutter traf, merkte ich sofort, dass sie mit dem Wunsch von Jürgen, bei ihnen zu wohnen, nicht wirklich einverstanden war. Sie ließ mich zwar für die ersten Tage bei sich wohnen. Machte mir aber deutlich, dies könne nur vorübergehend sein. Schließlich sind Jürgen und ich nicht verheiratet und sie möchte keinen Ärger mit dem Kuppelparagraphen bekommen. Danach werden erwachsene Menschen bestraft, wenn sie dulden, dass minderjährige und nicht verheiratete Menschen in ihrer Wohnung eheähnliche Beziehungen pflegen. Es könnte ja sein, dass einer der Nachbarn sie deswegen anzeigen würde.
Alleine in Berlin
So wurde mein erster Traum und Wunsch in Berlin durch die Mutter von Jürgen jäh getrübt. Jürgen hatte wohl auch nicht den Mut, sich vor mich zu stellen. Er hielt halt doch stärker zu seiner Mutter. Später erfuhr ich von ihm, dass er seinen gesamten Verdienst seines Praktikums bei der Straßenbaufirma bei der er jetzt arbeitete, bis auf ein Taschengeld seiner Mutter abgeben musste. Die Praktikumstätigkeit war für ihn eine Übergangslösung bis er seine Einberufung zum Wehrdienst bekam. Zu der Zeit gab es in Deutschland eine allgemeine Wehrpflicht für alle jungen Männer. Die Verbindung mit Jürgen bekam durch seine Mutter einen starken Dämpfer. Wir konnten nicht mehr ungetrübt miteinander umgehen. Meine Beziehung zu Jürgen wurde sehr viel zurückhaltender und schließlich kamen wir überein, uns nicht mehr zu treffen, was mich aber anfangs doch sehr schmerzte. Schließlich erinnert er mich an mein Dorf in Hinterpommern. So wohnte ich gerade mal zwei Wochen bei Jürgens Mutter und dann brach ich dort die Zelte ab.
Nun musste ich klein beigeben und erinnerte mich an meinen Onkel Hans, den Bruder meiner Mutter. An ihn wendete ich mich in meiner Verzweiflung und mit meinen Beziehungs- und Wohnsorgen. Er wiederholte sein briefliches Angebot, bei ihm die erste Zeit zu wohnen. Was ich ja anfangs zu meinem Start in Berlin direkt ausschlug. Onkel Hans half mir aber aus der Patsche. Als erstes ermunterte er mich, die Beziehung zu Jürgen gänzlich aufzugeben, was mir trotz der Enttäuschung sehr schwer fiel. Weiterhin half er mir die erforderliche Zuzugsgenehmigung zu bekommen. Er ging mit mir zu dem entsprechenden Bezirksamt. Diese Genehmigung bekamen nicht in Berlin Lebende nur, wenn sie einen Wohnungsnachweis vorlegen konnten. Onkel Hans gab mir selbstlos diesen Nachweis. Er würde mich außerdem dazu berechtigten, mich um eine Beschäftigung kümmern zu können. Ich war bereit, jede erdenkliche Arbeit anzunehmen. Nach unserem Besuch im Amt Friedrichshain erhielt ich dort die notwendige Zuzugsgenehmigung.
Nun wurde mir sehr deutlich bewusst, dass ich erst einmal sehen muss, wie ich zu Geld komme. Dies war etwas, womit ich mich in Poppow so gut wie gar nicht befasst hatte. Ich musste eine Lösung finden. Aber nach Poppow zurück wollte ich auf gar keinen Fall - eine Blöße, dass ich es nicht schaffen würde, in der Großstadt zu leben, wollte ich mir nicht geben. Die heimatlichen Geräusche, die ich mit den Großstadtgeräuschen getauscht hatte, hörte ich in meinem Inneren. Es war das Bellen der Hunde, das Kikeriki der Hähne, das Gänsegeschnatter und das Blöken der Schafe, das Meckern der Ziegen und das Muhen der Kühe. Alle Geräusche zusammen ließen mein Poppow vor mir lebendig werden und halfen über meine Einsamkeit und Enttäuschung hinweg, dass es in Berlin doch nicht so klappte, wie vorher in meinen Träumen und Wunschvorstellungen gedacht.
Meine Schwierigkeit war aber, dass ich zwar einige Kenntnisse in der Hauswirtschaft bei meiner zehn Jahre älterer Schwester Frieda in Poppow erworben hatte, aber keinerlei Zeugnisse vorlegen konnte. Was blieb mir übrig, ich konnte nur als Unterstützung in einem Haushalt arbeiten. Schließlich fand ich mit Hilfe von Onkel Hans eine Hauswirtschafts-Stelle in Neukölln, in der ich für die Hauswirtschaft und die Kinderbetreuung zweier Klein-Kinder zuständig sein sollte. Diese Stelle war sogar mit Kost und Logis. Das bedeutete, dass ich bei Onkel Hans nach einigen Wochen wieder ausziehen konnte. Vorausgesetzt, diese Haushaltsstelle sagte mir und ich den Auftraggebern zu. Schließlich kamen wir mit der Familie überein, dass ich zum nächsten Ersten des Monats, es war der Februar, dort anfangen sollte, im Haushalt zu arbeiten. Ich zog bei der Familie ein. In vier Monaten war dies mein dritter Umzug in Berlin. Nun hatte ich gehört, dass es zu der Zeit für Berliner üblich war, mehrmals im Leben umzuziehen. Durch diese Umzüge fühlte ich mich fast schon als richtige Berlinerin. Meine Arbeit in der Hauswirtschaft wurde sehr schlecht bezahlt. Mir wurden ausgewachsene Kleider oder Kindersachen angeboten, die ich in Päckchen verpackte und nach Poppow schickte. Später wurden mir diese Dinge aber vom sowieso kargen Lohn auch noch abgezogen. Desgleichen passierte mir mit Naturalien, wie Drogeriesachen, Süßigkeiten und Backwaren, die mir von meinem Verdienst abgezogen wurden. Das Unangenehme dabei war, dass mir die Präsente anfänglich alle als Geschenk angeboten wurden.
Diese Tatsachen betrübten meine Freude an der Arbeit im Haushalt und den eigentlich sehr freundlichen Kindern, der Junge sieben und das Mädchen neun Jahre alt. Meine Aufgaben waren, darauf zu achten, dass die Kinder morgens gewaschen nach einem Frühstück sauber in die Schule gingen. Abends war es meine Aufgabe die Kinder zu waschen und in das Bett zu begleiten. Tagsüber musste ich mich um die Sauberkeit der Wohnung kümmern und der Köchin, die außer mir noch im Haushalt beschäftigt war, zur Seite stehen und ihre Anordnungen befolgen. Die Eltern waren fast den ganzen Tag in ihrer Drogerie beschäftigt und kaum in der Wohnung. Die Hausherrin entdeckte eines Tages, dass von ihrem Silberbesteck einige Teile fehlten. Ich wurde als Jüngste und erst seit kurzem Beschäftigte sofort des Diebstahls verdächtigt. Meinen Beteuerungen, dass ich nichts gestohlen hätte, wurde nicht geglaubt. Mir wurde sofort zum nächsten Monatsende gekündigt.
Ich ging wieder zu meinem Onkel Hans und bat ihn, mir zu helfen. Dabei hatte ich Sorge, dass er mich nach Poppow zurückschicken würde. Außerdem war für mich wichtig, um nicht aus Berlin wieder ausgewiesen zu werden, dass ich noch polizeilich in dem Bezirk Neukölln der alten Haushaltswirtschaftsstelle gemeldet blieb. Bis acht Tage nach der Kündigung ging dies noch. Er aber hatte Verständnis für seine Nichte und machte mir Mut, „es ist ja nicht aller Tage Abend und du wirst schon noch eine Stelle finden!“. Onkel Hans gab mir erneut den so wichtigen Wohnungsnachweis und so wohnte ich wieder bei ihm. Aber einfach, eine neue Arbeitsstelle im Haushalt zu finden, war es für mich nicht. Ich kaufte mir das Abendblatt, in dem immer Anzeigen über Stellen enthalten waren. Es war wie verhext, ich fand keine Stelle.
Onkel Hans meinte, versuch es doch mal als „Kellnerin“, in den speziellen und typischen Berliner Gartenrestaurants. Du bist jung und siehst gut aus. Da hast du bestimmt eine bessere Chance und wirst wahrscheinlich auch besser bezahlt. Vom Trinkgeld ganz zu schweigen. So half er mir, in der Berliner Zeitung nach Angeboten zu suchen. Ich fand eine Anzeige: „Für die Außen-Saison werden junge Frauen als Bedienung und als Küchenhilfe in der Ausflugsgaststätte in Rummelsburg am See gesucht.“ Am nächsten Morgen fuhr ich mit der S-Bahn vom Bezirk Friedrichshain, wo Onkel Hans wohnte, nach Rummelsburg, um mich als Arbeitskraft zu empfehlen. Doch im Service-Bereich fand sich leider keine offene Stelle mehr. Meine Freude war groß, als ich am nächsten Tag über das Telefon von Onkel Hans erfuhr, dass ich als Küchenhilfe genommen werde. Ich könnte sofort mit der Arbeit beginnen. Am nächsten Tag fuhr ich wieder mit der S-Bahn nach Rummelsburg und begann um 10:00 Uhr mit meiner Arbeit in der Küche in dem Gartenrestaurant am Rummelsburger See.
Das Lokal war ein gut gehendes Ausflugslokal, schon im Frühjahr bei sonnigem Wetter kamen viele Gäste. Außerdem gehörten direkt am See ein Bootsverleih und eine Liegewiese dazu. Damals konnte man in der Rummelsburger Bucht noch baden. Wenn die Sonne schien und es entsprechend warm war, kamen in den Nachmittagsstunden und am Wochenende viele badelustige Menschen an die Bucht zum Schwimmen und Baden.
Heute wird dies wegen der Verschmutzung und der vielen Umweltschäden nicht empfohlen. Die Stadt Berlin erarbeitet eine Revitalisierung der über einen Kilometer langen Spreebucht, dem eigentlichen Rummelsburger See.
Die meisten Menschen fanden sich aber sonntags dort ein. In der Zeit damals war es ja üblich, dass die Menschen samstags sogar noch voll arbeiten mussten. Die Wochenarbeitszeit lag oft über 50 Stunden. Meistens wurden sogar noch Übersunden gefordert bzw. erwartet, die aber nicht bezahlt oder als Ausgleich freigenommen werden konnten.
In der Küche ging mir die Arbeit schnell von der Hand. Ich musste für die Essen alle Vorbereitungen treffen, von Gemüse schnippeln bis zum Kartoffeln schälen. Manchmal musste ich auch beim Geschirrwaschen aushelfen. Meine Küchenchefin, Frau Kurten, war mit meiner Arbeit sehr zufrieden, ich wurde sogar von ihr gelobt, weil mir alles so schnell gelang. Ich mochte sie auch und spürte, dass Frau Kurten immer mehr Vertrauen zu mir fasste. Dies hatte aber zur Folge, dass ich schon manchmal bei Veranstaltungen bis zur Polizeistunde arbeiten musste. Im Gegensatz zu heute, wo es keine Polizeistunden mehr gibt, war es damals üblich, dass Lokale um 01:00 Uhr nachts zu schließen hatten. Es gab nur für einige Lokale eine sogenannte Nachtkonzession, die ihre Inhaber aber mit einer hohen Gebühr „erkaufen“ mussten. Heute darf in fast allen Bundesländern der Wirt seine Öffnungszeiten selber festlegen. Diese späten Arbeitsstunden wurden mir aber entweder in Freizeit oder in Geld vergütet. Mir bereitete die neue und sogar abwechslungsreiche Arbeit Freude. Ich habe von der Küchenchefin viel für mein weiteres Leben gelernt.
Nach meiner Probezeit im Gartenlokal Rummelsburg, vier Wochen waren vereinbart, wurde mir angeboten, über dem Gartenlokal mit der 15 jährigen Tochter Emilie der Küchenchefin in einem Zimmer zu schlafen. Ich nahm dieses Angebot dankbar an. Dadurch konnte ich bei Onkel Hans wieder ausziehen. Es sollte der letzte Auszug bei ihm sein. Ich ging am darauf folgenden Tag wieder zu dem zuständigen Bezirksamt Friedrichshain, um mich jetzt hier wohnhaft zu melden. In Berlin war es damals sehr wichtig, dass man sich zügig im entsprechenden Bezirksamt wohnhaft anmeldete. Dies galt natürlich genauso für Menschen wie mich, die immer nur zur Untermiete wohnte. Ich glaube, dass es sogar eine Frist von zwei Wochen gab. Kam man später erst dazu, sich polizeilich anzumelden, musste man eine Strafgebühr entrichten. Den obligatorischen Wohnungsnachweis, diesmal von Frau Kurten, legte ich der Beamtin vor. Sie erkannte mich wieder, denn es war das gleiche Bezirksamt Friedrichshain. Sie erfasste sofort, dass ich wohl jetzt selbstständiger und mit mehr Zukunft in Berlin bleiben könne. Die von ihr abgestempelte polizeiliche Anmeldung machte mich froh und die Zuzugsgenehmigung wurde von ihr wohlwollend ergänzt. Ich begann mich langsam wie eine Berlinerin zu fühlen. Allmählich hatte ich Routine im Umgang mit diesem Bezirksamt.
Mit Emilie habe ich mich sofort gut verstanden. Sie ging noch in die Realschule und musste eifrig für ihre Abschlussprüfung lernen. Da ich oft spät nach meiner Arbeit in das gemeinsame Zimmer kam und hundemüde schnell in das Bett ging, haben wir uns manchmal wenig gesehen und gesprochen. Trotzdem halfen mir ihre Gegenwart und die neue Arbeit in der Küche über meine Traurigkeit, Jürgen nicht mehr zu treffen und zu sehen, hinweg. Für mich war es so wirklich besser. Ich begann, Berlin an meinen freien Tagen langsam selber zu erkunden. So ging ich manchmal in den gegenüberliegenden Treptower Park. Es war Frühling und ich fand es herrlich zu sehen, wie die Bäume und Büsche immer grüner wurden. Die dazwischen liegenden Wiesen bekamen ebenfalls ein immer kräftigeres und sattes Grün. Ich ging manchmal auch in den angrenzenden Bezirk Lichtenberg.
Seit meinem Einzug in Rummelsburg habe ich die Mahlzeiten mit den Gastwirtsleuten Kurten gemeinsam eingenommen. Manchmal aß Emilie mit uns, meine Zimmer-Mitbewohnerin. Sehr häufig kam zum Essen noch Max hinzu, er war für den Bootsbetrieb am See zuständig. Die Ruderboote mussten immer in Ordnung gehalten sein, damit sie gut vermietet werden konnten. Dafür hatte Max eine richtige Werkstatt, um manchmal das eine oder andere an den Ruderbooten zu reparieren. Er war sehr freundlich zu mir und half mir, wenn ich etwas benötigte oder etwas zu reparieren war. Ich glaube, er hatte sogar gehofft, dass ich mal mit ihm ausgehen könnte. Vielleicht kam es daher, weil er seine Ruderboote viel an junge Paare vermietete. Diese flirteten und schmusten natürlich besonders, wenn sie weit auf dem Rummelsburger See draußen waren. Max machte und erzählte außerdem ständig irgendwelche Witze, die uns alle beim Essen zum Lachen brachten, er war unser Faktotum.