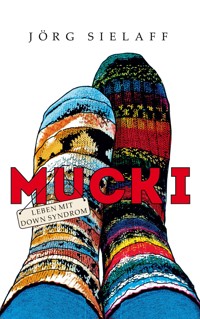
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Mucki ist der Versuch das Leben meiner in der Mitte des Lebens stehender Down-Syndrom Tochter zu erzählen. Sie ist bereits 45 Jahre durch das Leben gegangen, hatte vieles gelernt und gekonnt, was sie leider jetzt nicht mehr so macht. Sie ist im Laufe ihres Lebens langsamer geworden. Meine Tochter ist im Grunde ein fröhlicher Mensch. Sie wird von manchen Menschen in ihrer Umgebung sogar als Sonnenschein bezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Ein schwerer Schlag
Wie alles begann
Mucki wird eingeschult
Besuche bei uns im Haus
Urlaube mit Mucki
Mucki in der Gemeinschaft
Aus ihrem Leben
Mein Umgang mit Mucki
Bücher von Jörg Sielaff
Vorbemerkung
Die Geschichte von Mucki ist der Versuch, das Leben meiner in der Mitte des Lebens stehenden Down-Syndrom-Tochter zu erzählen. Sie ist bereits 45 Jahre durch das Leben gegangen, hat vieles gelernt und gekonnt, was sie leider jetzt nicht mehr so macht. Sie ist im Laufe ihres Lebens langsamer geworden. Meine Tochter ist im Grunde ein fröhlicher Mensch. Sie wird von manchen Menschen in ihrer Umgebung sogar als »Sonnenschein« bezeichnet.
Sie wohnt seit mehr als 25 Jahren in einer Lebensgemeinschaft in einem Haus mit zehn weiteren Menschen, die ebenfalls dort betreut werden. In der Gemeinschaft sind auch Werkstätten für die Menschen mit Hilfebedarf angegliedert. Dort arbeitet sie jetzt in der Kerzenwerkstatt mit anderen und wird von hilfsbereiten Betreuern unterstützt.
Ein schwerer Schlag hat sie vor Kurzem getroffen. Ihre Mutter, die sie sehr liebevoll begleitet hatte, ist gestorben. Normal ist es für eine Mutter mit einem »Sorgenkind«, dieses auch besonders zu verwöhnen. Nun muss Mucki mit dem Tod ihrer Mutter, die nun nicht mehr für sie da ist, irgendwie klarkommen, was ihr eigentlich gut gelingt. Es geht immer wellenförmig, mal ist sie traurig und dann lacht sie wieder und kann fröhlich sein. Die Zeit mit den Coronaeinschränkungen macht ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich zu schaffen. »Scheiß Corona!«, ist von ihr öfters zu hören. Nach dem harten »Look Down« können wir sie jetzt wieder dort besuchen oder sie zu Arztterminen und Urlaubstagen abholen. Allerdings müssen wir trotz unserer Coronaimpfung jeweils einen negativen Schnelltest vorlegen. Diese Anordnung trifft ebenfalls Mucki. Deshalb hat sie schon einige Tests über sich ergehen lassen müssen. Bei dem ersten Test hatte sie den Testenden noch gefragt: »Und den Rachen auch noch?« Nach kurzem Zögern nahm er sich einen Holzspatel und drückte ihre Zunge herunter: »Alles in Ordnung!« Mucki war zufrieden. Inzwischen ist es Routine für sie. Nur jetzt werden ihre Worte häufiger: »Scheiß Corona, aber das ist das letzte Mal!« Beim Impftermin für die Auffrischungsimpfung hatte sie mitfühlend zu der Assistentin gesagt: »Für Sie ist das doch auch doof mit dem Corona. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist.« Aber inzwischen ist sie an das Tragen einer Maske gewöhnt. Sie erinnert mich immer, wenn ich in das Auto steige: »Hast du auch die Masken dabei?«
Die Menschen im Haus, in dem sie lebt, haben jetzt auch so nach und nach mit Corona zu kämpfen. Die meisten Menschen, so auch Mucki, sind nur leicht erkrankt und müssen in die Siebentagesquarantäne. Das bedeutet keine Werkstatt und länger schlafen, was Mucki natürlich sehr gefällt. Aber mit mir wollte sie diesbezüglich nicht telefonieren: »Wir haben ja am Montag lange telefoniert und heute will ich nicht, weil ich Corona habe!«
Inzwischen haben wir die Coronazeit wohl alle gut überstanden. Wenn man von dieser Zeit spricht, kommt regelmäßig Muckis Satz: »Corona ist doch vorbei!«
In dem Buch schreibe ich über die vielen Erlebnisse mit Mucki während der Urlaube mit ihr und über ihre Zeit in der Gemeinschaft. Im letzten Kapitel beleuchte ich auch die Schwierigkeiten, die ich mit ihr habe. Meine Dankbarkeit, dass sie gut in der Gemeinschaft lebt und von vielen Helfern liebevoll begleitet wird, kommt ebenfalls zum Ausdruck. So lebendig und fröhlich manchmal auch unser »Sonnenschein« ist, es bleibt eine große Aufgabe.
Ein schwerer Schlag
Um Mucki ein wenig »aufzufangen«, bevor wir ihr von dem unerwarteten Verlust, dem Tode ihrer Mutter, erzählen wollten, holten wir sie zu uns nach Hause. Ihre beiden Schwestern und meine Frau waren ebenfalls anwesend. Auf der Fahrt von ihrem Wohnhaus löcherte sie mich mehrmals nach dem Grund, warum ich sie aus der Gemeinschaft abholen würde. Sie vermutete, eine 94-jährige Verwandte sei gestorben. Wir saßen beim Nachmittagskaffee alle zusammen und begannen damit, dass wir ihr eine Traurigkeit erzählen müssten. Sie gleich: »Die Tante ist gestorben!« »Nein, deine Mama ist es!« – »Nein, nicht die Uschi!« – »Doch!!!« Sie wollte es nicht glauben und sagte sogar, dass es nicht stimme. Es ist nicht wahr! Trotzdem schien sie noch einigermaßen gefasst zu sein. Aber so nach und nach wurde ihr die ganze Tragweite unserer Worte deutlich. »Nein, ich will meine Mama wiederhaben! Ich will meine Uschi wiederhaben!« Dann fing sie an zu weinen und zu schluchzen. Nun war die Situation auch für ihre Schwester nicht leicht, sie hatte ihre Mama in der Wohnung gefunden. Die von ihr durchgeführten Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.
Da die Wohnung, in der ihre Mama und Mucki jahrelang gelebt hatten, eine Mietwohnung war, mussten nun ihre Kleidung und die Möbel aus ihrem Zimmer geräumt werden. Die Wohnung wurde gekündigt. Ihre Schwestern nahmen Mucki mehrmals mit in die Wohnung, damit sie leichter Abschied nehmen konnte. Was eigentlich auch ohne Probleme möglich war. Mucki neigt dazu, ihre »lieben Geister« auf Fahrten oder im Nebenzimmer mit dabei zu haben. Sie sagte jetzt betont deutlich: »Solveig, Marianne, Brigitte und Barbara müssen jetzt nicht mehr in die Wohnstraße, da ist jetzt tote Hose.« Dabei lachte sie sogar.
Andererseits bildete sie in ihrer Traurigkeit neue Worte. Sie ist jetzt in der »Schrecktrauer« und »Schocktränen« kommen aus ihren Augen. Mucki fühlte sich im »Tränenschock« und »Trauerschmerz«. Zwischendurch konnte sie sogar ihr gewinnendes Lachen zeigen. Ihre Trauer verläuft so richtig wellenartig, mal ist wenig zu spüren und mal lässt sie sich kaum trösten.
Sie hatte sich ein Foto ihrer Mutter ausgesucht, wo sie von der Seite zu sehen war. Dieses Foto haben wir ihr in einen Rahmen gestellt, etwas kleiner als DIN A4. Von nun an begleitet sie dieses Foto überallhin, es muss immer mit in das Restaurant oder zu den Arztterminen. Sie steckt es in einen Pappumschlag in ihre »Ingwer-Tasche« oder in ihren Rucksack. Manchmal, gerade bei uns angekommen, erinnert sie an das Foto. »Uschi bekommt ja keine Luft, sie muss aus dem Rucksack!« Manchmal ist ihre Aussage genau andersherum: »Sie muss im Rucksack bleiben. Sonst ist ihr kalt.« Oder, wenn das Bild noch nicht ausgepackt ist: »Die bekommt schon noch Luft!«
Manchmal wischt sie mit WC-Papier auf Uschis Bild. »Sie hat was mit den Augen, damit sie ihr nicht mehr wehtun!«, eine andere Aussage. »Die Uschi ist heute ganz traurig, aber jetzt lächelt sie mich wieder an.« Zum einjährigen Todestag berichtete sie mir am Telefon: »Ich habe die Kalenderseite vom 26. Februar, Uschis Todestag, einfach rausgerissen!« Allerdings achten ihre Betreuer in dem Haus, in dem sie jetzt lebt, darauf, dass sie sich nicht zu sehr zurückzieht. Es tut ihr besser, wenn sie mit Aufgaben betraut ist, damit sie nicht vor sich hin grübelt. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, wie sie von den Betreuern liebevoll begleitet wird. Sie achten sehr darauf, dass sie immer in der Gemeinschaft eingebunden ist. Sogar manchmal mit kleinen Kämpfen, aber wichtig ist dabei deren konsequente Haltung. So ist sie zügiger und macht sich besser im Bad fertig. Auch muss sie vorübergehend Stunden nacharbeiten, als Antwort auf ihr tägliches Zu-spät-in-die-Werkstatt-Kommen. Als ich ihr erzählte, dass ich nach dem Buch über Margittas Mutter, »Lisbeth – Mein Weg«, welches jetzt erschienen ist, an einem Buch über sie als Mucki schreibe, und sie fragte: »Wie findest du es?«, lachte sie nur und sagte: »Wirklich? Schön!«, fragte aber gleich weiter: »Schreibst du auch ein Buch über Uschi?«
Wie alles begann
Für mich begann ihr Leben mit einer Enttäuschung bei ihrer Geburt. Der Tag ihrer Geburt schien ein wunderbarer Spätsommertag zu werden. Mit meiner schwangeren Frau kamen wir kurz vor acht Uhr in das Krankenhaus. Die dortige Stationsschwester sagte mir nur: »Es dauert bei ihrer Frau noch. Gehen sie erst einmal wieder nach unten zur Anmeldung.« Nun war der Schalter aber erst nach acht Uhr besetzt. Also musste ich warten, bis alle Formalitäten erfüllt waren und ich wieder in die Geburtsstation gehen konnte. Es war nun mehr als eine halbe Stunde vergangen. Ich kam in die Station, von der Schwester und von meiner Frau keine Spur. Alle Räume standen offen und nur die eigentliche Geburtsstation war gesperrt. Nach einigen Minuten kam Schwester Maria heraus und beglückwünschte mich zur dritten Tochter. »Nehmen Sie es nicht so schwer, die Jungens bringen die Töchter später mit!« Darum ging es mir aber gar nicht.
Ich wollte einfach bei der Geburt dabei sein und hätte der Schwester Maria einfach vor das Schienbein treten können. Bei der Geburt der ersten Tochter war es noch überhaupt nicht üblich, dass ein Vater bei der Geburt dabei sein durfte. Die zweite Tochter kam in einem strengkatholischen Krankenhaus zur Welt. Dort waren die Schwestern entsetzt, als ich meinen Wunsch, bei der Geburt dabei zu sein, äußerte. »Hier im Krankenhaus geht das überhaupt nicht«, die damalige Aussage der Stationsschwester. So kam Mucki an diesem schönen Herbstsonntag ohne mein Dabeisein auf die Welt. Wenn es ein Mädchen werden sollte, hatten wir uns den Namen Miriam überlegt, aber ihre Schwestern nannten sie gleich »Mucki«. Die Geburt verlief ohne Komplikationen, ich umarmte meine Frau Uschi und wir Eltern waren zufrieden. Als ich am Montagabend nach der Arbeit in das Krankenhaus kam, um Uschi und Mucki zu besuchen, sprach mich mein Bruder, der bereits früher zum Besuchen kam, an. »Die haben mich mit dir verwechselt, du sollst unbedingt gleich zum Arzt kommen.«
Ich ging also hin. Da druckste der Arzt so komisch herum: »Wir wollten ganz sicher gehen und haben erst gewartet, bis der Kinderarzt sich ihre Tochter angesehen hat. Sie hat anders stehende Augen und ihre kleinen äußeren Finger sind krumm. Sie hat Idiotie.« Ich wusste damit nichts anzufangen. Man sagt auch Mongolismus dazu oder Trisomie 21. Hatte ich auch noch nie gehört. »Was bedeutet das denn?« »Sie ist behindert und wird nicht normal aufwachsen. Aber im Taunus gibt es ein Heim. Dort können Sie sie abgeben. Die nehmen auch Säuglinge.« Ich war geplättet, so genau konnte ich Mucki mir noch gar nicht betrachten. Zu der Zeit war es noch nicht üblich, dass die Neugeborenen mit der Mutter im Zimmer liegen. Die Säuglinge konnten nur durch eine Scheibe betrachtet werden. Selbst zur Stillzeit durften die Väter nicht im Zimmer sein. Wir hatten zwei gesunde Töchter, die elf und zehn Jahre alt waren. Wieso das nun? Ich hörte nur noch, wie mich der Arzt fragte: »Wollen Sie es Ihrer Frau sagen, oder soll ich es tun?« Mit meiner Antwort, dass ich die unangenehmen Dinge schon meiner Frau selber sagen werde, verließ ich das Arztzimmer.
Als ich wieder zu Uschi in das Zimmer kam, war mein Bruder bereits wieder zurückgefahren. Ich berichtete ihr von dem Arztgespräch. Uschi war ebenso überrascht und sagte nur, dass die Schwestern beim Anlegen zum Stillen von Mucki so komisch gesagt hätten: »Na, die wird wohl nicht richtig trinken können.« Wie kann das sein. Wir haben zwei gesunde Töchter und man sagte damals, mongoloide Menschen würden manchmal ältere Gebärende bekommen. Uschi war damals gerade 34 Jahre. Der Vorschlag des Arztes, Mucki in ein Heim zu geben, kam für uns überhaupt nicht in Betracht. Je mehr wir uns mit der Trisomie beschäftigten, wussten wir, dass das Chromosom 21 nicht nur doppelt bei Mucki angelegt war, sondern dass es sich in der Befruchtungsphase geteilt hatte und dadurch gab es drei Chromosomen 21. Die Tage nach der Geburt im Krankenhaus vergingen ohne Auffälligkeiten. Mucki erschien uns aber trotzdem als Säugling irgendwie anders als die anderen Töchter. Damals war es üblich, dass Mütter nach der Geburt ihres Kindes immer mindestens eine Woche im Krankenhaus blieben, bevor sie nach Hause durften. So kam der Tag, an dem Uschi und ich Mucki abholten. Damals war es üblich, dafür ein großes Kopfkissen mitzubringen, welches nach innen gefaltet wurde, damit ein »Schiffchen« entstand. Darin wurde der Säugling gelegt und in das Auto getragen.





























