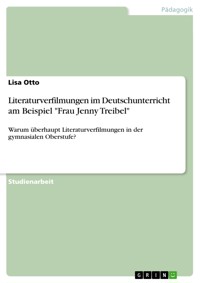
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: 14, Universität Kassel (Institut für Germanistik), Veranstaltung: Literaturverfilmungen im Deutschunterricht, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit steht die Analyse von Literaturverfilmungen, ganz genau am Beispiel von Frau Jenny Treibel, im Vordergrund. Hierbei werden Printmedium und das Medium des Films miteinander verbunden. Schülerinnen und Schülern fällt ein Einstieg in das Thema Film oft so leicht, da die Analyse von Texten der Analyse von Filmen ähnelt. Um der steigenden Relevanz des Themas für die Schule gerecht zu werden, wird an passenden Stellen am Ende der Teilkapitel ein Schulbezug hergestellt. Das in dieser Arbeit beschriebene Praxisbeispiel geht aus ersten eigenen Unterrichtsversuchen während der schulpraktischen Studien im Fach Deutsch hervor. Orientiert wird sich in dieser Arbeit an den Literaturverfilmungstypen nach Poppe sowie der Film- und Fernsehanalyse nach Hickethier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
„Pauschal die Nichtprintmedien als Fressfeinde der Buchliteratur zu verdammen, steht einer vernünftigen schulischen Medienpädagogik im Weg.“ -Ulf Abraham[1]
Inhaltsverzeichnis
1. Literaturverfilmungen im Deutschunterricht – warum?
2. Typen der Literaturverfilmung nach Poppe
2.1 Stofforientierte Transformation
2.2 Handlungsorientierte Transformation
2.3 Interpretierende Transformation
2.4 Freie Transformation
3. Film- und Fernsehanalyse nach Hickethier
3.1 Von der Story zum Plot
3.2 Literaturinterpretation/ Filmanalyse
3.3 Zur Analyse des Visuellen
4. Beispiel: Qualifikationsphase II: Frau Jenny Treibel
5. Fazit
6. Anlagen
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Literaturverfilmungen im Deutschunterricht – warum?
Kinder wachsen heute von Beginn an mit dem Medium Fernsehen auf. Ob es zum Abend das „Sandmännchen“ oder am Sonntagmittag „Die Sendung mit der Maus“ ist, Kinder werden in der heutigen Zeit viel früher mit dem Medium Film und Fernsehen konfrontiert, als es noch vor 25 Jahren der Fall war. Dagegen kann sich auch die Einrichtung Schule nicht wehren. Film und Fernsehen treten immer mehr in den Mittelpunkt der Kinder und Jugendlichen, das klassische Buch hingegen ist im Moment zwar noch keine Ausnahme, aber liegt in der Gunst der Heranwachsenden hinter dem Medium Film und Fernsehen.[2] Daher liegt es nahe, Kindern und Jugendlichen möglichst früh den Umgang mit diesen Medien beizubringen. Jugendsoziologen sprechen von fernsehsozialisierten Generationen, die seit den 1960er Jahren herangewachsen sind und die sich von den durch das Buch sozialisierten Generationen ihrer Eltern und Großeltern unterscheiden[3]. Dass Kinder und Jugendliche Filme schauen und mit dem Medium Fernsehen umgehen können, ist heute eine Selbstverständlichkeit.
Deutsche Universitäten beschäftigen sich mit der analytischen Auseinandersetzung mit Filmen bereits seit den 1960er Jahren, seit den 1970er Jahren auch mit Fernsehsendungen[4]. Die Auseinandersetzung mit diesem Medium ist ganz unterschiedlicher Natur, zum einen haben sie einen Anlaufpunkt in der Soziologie und in der Publizistikwissenschaft, zum anderen auch in der Literaturwissenschaft und in der in den Geisteswissenschaften entstandenen Medienwissenschaft. Die Medienwissenschaft hat sich methodologisch Fragen der Analyse von film- und fernsehwissenschaftlichen Produktionen zugewandt, die im Vordergrund die Analyse von Filmsprache betrachtet[5].
Über die Notwendigkeit der Film- und Fernsehanalyse bestehen somit kaum noch Kontroversen. Knut Hickethier fasst den Nutzen der Film- und Fernsehanalyse wie folgt zusammen:
Film- und Fernsehanalyse dient
der Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung;
der Vollkommnung der ästhetischen Geschmacksbildung;
der Steigerung des ästhetischen Genusses;
der Gewinnung von Kenntnissen über die audiovisuellen Medien;
der genaueren Beschreibung und besseren Beurteilung von medialen Prozessen.
vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 5. Auflage, Weimar 2012, S.3.
Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Medieninterpretation abiturrelevant sein und somit das Medium Film eine tragende Rolle im Deutschunterricht spielen. Kenntnisse über Literaturverfilmungen werden erstmals explizit im Jahr 2014 im hessischen Abiturerlass erwähnt. So wird beispielsweise die Interpretation und Analyse Süskinds Parfum als Buch und als Film vorausgesetzt[6].
In dieser Arbeit steht die Analyse von Literaturverfilmungen im Vordergrund. Hierbei werden Printmedium und das Medium des Films miteinander verbunden. Schülerinnen und Schülern[7] fällt ein Einstieg in das Thema Film oft so leicht, da die Analyse von Texten der Analyse von Filmen ähnelt. Um der steigenden Relevanz des Themas für die Schule gerecht zu werden, wird an passenden Stellen am Ende der Teilkapitel ein Schulbezug hergestellt.
Das in dieser Arbeit beschriebene Praxisbeispiel geht aus ersten eigenen Unterrichtsversuchen während der schulpraktischen Studien im Fach Deutsch hervor.





























