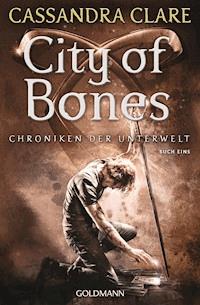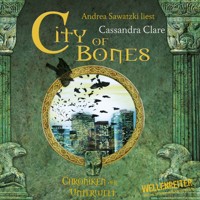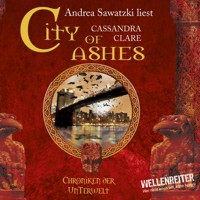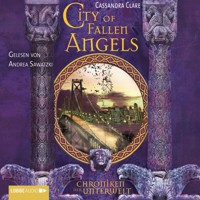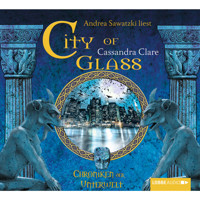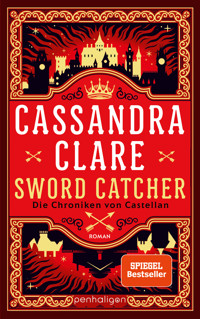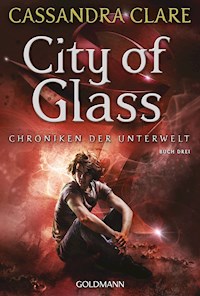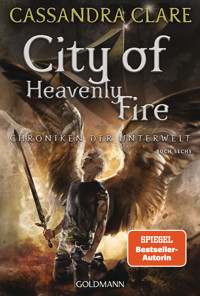9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dunklen Mächte
- Sprache: Deutsch
Die junge Schattenjägerin Emma Carstairs hat ihre Eltern gerächt, doch sie findet keinen Frieden. Denn aus der Freundschaft zu ihrem Parabatai Julian ist Liebe geworden – und nach den Gesetzen der Schattenjäger hat eine Beziehung zwischen zwei Parabatai tödliche Konsequenzen. Um Julian und sich zu schützen, lässt sich Emma daher ausgerechnet auf Julians Bruder Mark ein. Mark, der fünf Jahre bei den Feenwesen lebte und dessen Loyalität nicht wirklich geklärt ist.
Zumal Unruhe herrscht in der Unterwelt. Die Feenwesen mussten sich nach dem Dunklen Krieg harten Bedingungen beugen und begehren auf. Aufgerieben zwischen den Intrigen des Feenkönigs und der unerbittlichen Härte jahrtausendealter Gesetze müssen Emma, Julian und Mark ihre privaten Sorgen vergessen und gemeinsam für all das kämpfen, was sie lieben – bevor es zu spät ist und ein neuer Krieg ausbricht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1239
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Ein Schattenjäger lebt im Zeichen der Pflicht, er folgt dem ehernen Wort des Gesetzes, sein Eid ist heilig. Und kein Eid ist mächtiger als der zweier Parabatei. Er bindet sie auf ewig, macht sie zu Waffengefährten und Seelenverwandten – die sich auf keinen Fall ineinander verlieben dürfen. Emma Carstairs wusste von diesem Verbot, und doch ist sie den Gefühlen für ihren Parabatai Julian Blackthorn hilflos ausgeliefert. Der einzige Ausweg scheint, Julian dauerhaft zu meiden. Aber wie soll sie ihn verlassen, wenn er und seine Familie von allen Seiten bedroht werden?
Denn die gesamte Unterwelt ist in Aufruhr: Während die Feenwesen gegen die harten Bedingungen des Dunklen Krieges aufbegehren, tobt unter den Schattenjägern ein gefährlicher Machtkampf, in den Emma, Julian und ihre Freunde mitten hineingezogen werden. Um das Schlimmste zu verhindern, schmieden sie einen riskanten Plan – nicht ahnend, welch hohen Preis sie dafür am Ende bezahlen werden …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
LORD OFSHADOWS
Die Dunklen Mächte
BUCH ZWEI
H
ROMAN
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Lord of Shadows«
bei Margaret McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster
Children’s Publishing Division, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © 2017 by Cliff Nielsen
Karte von Alicante: Drew Willis
TH · Herstellung: han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-18626-5V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Jim Hill
Ich sprach: Schmerz und Leid. Er sprach: Gehe hin damit. Die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich eindringt.
Rumi
TEIL EINS
H
Traumland
Traumland.
Jenseits des Raums, jenseits der Zeit
Dehnet sich wild, dehnet sich weit
Ein dunkles Land.
Auf schwarzem Thron
Regiert ein Dämon,
Die Nacht genannt.
Auf einem Wege traurig und einsam,
Mit bösen Engelscharen gemeinsam,
Erreicht’ ich dies Thule
Erst neuerdings.
Durch Heiden ging’s
Durch Sümpf’ und Pfuhle –
Da lag es verzaubert, das Land des Traums,
Jenseits der Zeit, jenseits des Raums.
Stürzende Berge, gähnende Schlünde,
Titanenwälder, gespenstische Gründe,
Wallende Meere ohne Küsten,
Felsen mit zerrissenen Brüsten,
Wogen, die sich ewiglich bäumen,
In lodernde Feuerhimmel schäumen,
Seen, die sich dehnen und recken,
Ihre stillen Wasser ins Endlose strecken,
Ihre stillen Wasser, still und schaurig,
Mit den schläfrigen Lilien bleich und traurig.
An den Seen, die sich so dehnen und recken,
Ihre stillen Wasser ins Endlose strecken,
Ihre stillen Wasser, still und schaurig,
Mit den schläfrigen Lilien bleich und traurig –
An den Felsen neben den düstern,
Unheimlichen Wellen, die ewig flüstern,
An den Wäldern neben den Teichen,
Wo die eklen Gezüchte schleichen,
In jedem Winkel, dunkel, unselig,
An allen Sümpfen und Pfuhlen unzählig,
Wo die Geister hausen –
Trifft der Wandrer mit Grausen
Verhülltes Volk aus dem Totenlande,
Erinnerungen im Leichengewande,
Weiße Gestalten der Schatteninseln,
Bleiche Schemen aus toten Zeiten,
Die verzweiflungsvoll stöhnen und winseln,
Wie sie am Wandrer vorübergleiten.
Für das Herz, dessen Schmerzen Legionen,
Sind dies friedvolle, milde Regionen;
Für den umnachteten, dunklen Geist
Sind es himmlische, selige Auen.
Doch der Pilger, der es durchreist,
Darf es nicht unverhüllt erschauen.
Unergründlich bleibt es für jeden,
Dieses geheimnisvolle Eden –
Das ist des finstern Königs Willen –
Und der Wandrer, von ungefähr
Dorthin verschlagen, erblickt es daher
Nur durch verdunkelte, matte Brillen.
Auf einem Wege traurig und einsam,
Mit bösen Engelscharen gemeinsam,
Schritt ich jüngst heim durch Sümpfe und Pfuhle
Aus diesem öden, entlegenen Thule.
Edgar Allan Poe: Traumland
1
H
Stille Wasser
Kit hatte erst vor Kurzem herausgefunden, was ein Streitflegel war, aber jetzt hing ein ganzes Gestell mit diesen Schlagwaffen über seinem Kopf – glänzend, scharf und gefährlich.
Nie zuvor hatte er etwas gesehen, das mit der Waffenkammer im Institut von Los Angeles vergleichbar gewesen wäre. Die Wände und Böden bestanden aus silberweißem Granit, und in der Mitte des Raums ragten mehrere rechteckige Granitblöcke aus dem Boden auf, wodurch das Ganze an den Rüstungen- und Waffensaal eines Museums erinnerte. Kit entdeckte Kampfstäbe und Streitkolben, raffinierte Stockdegen, Halsketten, Stiefel, gut gepolsterte Steppjacken mit verborgenen Taschen für schmale, flache Stich- und Wurfmesser, dazu Morgensterne mit schrecklichen Dornen sowie Armbrüste in allen denkbaren Größen und Formen.
Auf den Granitblöcken lagen schimmernde Waffen aus Adamant, jener quarzartigen Substanz, die die Schattenjäger aus den Tiefen der Erde hervorholten und die nur sie allein zu Schwertern, Klingen und Stelen verarbeiten konnten. Aber Kit zog es eher zu einem Regal mit Dolchen.
Dabei verspürte er gar nicht den drängenden Wunsch, den Umgang mit einem Dolch zu erlernen – jedenfalls kein Interesse, das über das normale Interesse herkömmlicher Teenager an gefährlichen Waffen hinausging. Und selbst wenn, hätte er ein Maschinengewehr oder einen Flammenwerfer vorgezogen. Aber diese Dolche waren wahre Meisterwerke, verziert mit Gold, Silber und kostbaren Edelsteinen: blaue Saphire, Rubine mit Cabochonschliff, glänzende Dornenmuster aus Platin und schwarzen Diamanten.
Ihm fielen auf Anhieb mindestens drei Personen auf dem Schattenmarkt ein, die ihm dafür ein hübsches Sümmchen hinblättern würden, ohne lästige Fragen zu stellen.
Vielleicht sogar vier.
Kit zog seine Jeansjacke aus. Er hatte keine Ahnung, welchem der Blackthorn-Geschwister sie ursprünglich gehört hatte: Als er am Morgen nach seiner Ankunft im Institut aufgewacht war, hatte er einen Stapel frischgewaschener Kleidungsstücke am Fußende seines Betts vorgefunden. Dann streifte er eine der Steppjacken über. Aus dem Augenwinkel fing er in einem Spiegel am Ende des Raums seine eigene Reflexion auf: zottlige blonde Haare und fast verblasste Blutergüsse auf der bleichen Haut. Er öffnete den Reißverschluss der Innentasche und stopfte mehrere Dolche mitsamt ihrer Lederscheiden hinein, wobei er bewusst nur Exemplare mit besonders kostbaren Verzierungen aussuchte.
Plötzlich schwang die Tür zur Waffenkammer auf. Kit ließ den Dolch in seiner Hand wieder auf das Regalbrett fallen und drehte sich hastig um. Er hatte gedacht, er wäre unbemerkt aus seinem Zimmer geschlüpft. Aber wenn es irgendetwas gab, das ihm in den wenigen Tagen seit seiner Ankunft bewusst geworden war, dann die Tatsache, dass Julian Blackthorn nichts entging – und seine Geschwister standen ihm darin kaum nach.
Doch es handelte sich gar nicht um Julian, sondern um einen jungen Mann, den Kit noch nie gesehen hatte – auch wenn er ihm irgendwie bekannt vorkam. Er war groß, hatte zerzauste blonde Haare und die typische Schattenjägerstatur: breite Schultern, muskulöse Arme und diese schwarzen Linien der Runenmale, mit denen die Nephilim sich schützten. Sie schauten aus seinem Kragen und unter seinen Ärmeln hervor.
Seine Augen leuchteten in einem ungewöhnlich dunklen Goldton. An einem seiner Finger trug er einen schweren Silberring, wie viele Schattenjäger. Als er Kit bemerkte, zog er eine Augenbraue hoch.
»Du kennst dich mit Waffen aus?«, fragte er.
»Na ja, geht so.« Kit wich in Richtung der Granittische zurück und hoffte, dass die Dolche in seiner Innentasche nicht klirrten.
Der Mann ging zu dem Regal, das Kit durchstöbert hatte, und nahm den Dolch, den Kit hatte fallen lassen. »Ein guter Dolch, den du da ausgewählt hattest«, sagte er. »Siehst du die Inschrift auf dem Griff?«
Kit konnte nichts erkennen.
»Er wurde von einem Nachfahren von Wayland dem Schmied gefertigt, der Durendal und Cortana geschmiedet hat.« Der Mann wirbelte den Dolch zwischen den Fingern und legte ihn dann zurück ins Regal. »Zwar ist er nicht so außergewöhnlich wie Cortana, aber Dolche wie dieser kehren nach einem Wurf immer in die Hand des Werfers zurück. Sehr praktisch.«
Kit räusperte sich. »Muss ziemlich viel wert sein«, sagte er.
»Ich bezweifle, dass die Blackthorns an einem Verkauf interessiert sind«, erwiderte der Mann trocken. »Ich heiße übrigens Jace. Jace Herondale.«
Er schwieg einen Moment. Offenbar wartete er auf eine Reaktion, die Kit aber auf keinen Fall zeigen wollte. Natürlich kannte er den Namen Herondale. Er hatte das Gefühl, als wäre es das einzige Wort, das er in den vergangenen zwei Wochen zu hören bekommen hatte. Aber das bedeutete nicht, dass er dem Mann, diesem Jace, die Genugtuung schenken wollte, auf die er eindeutig wartete.
Jace schien Kits Schweigen kaum zu bemerken. »Und du bist Christopher Herondale.«
»Woher weißt du das?«, fragte Kit in einem gleichgültigen, uninteressierten Tonfall. Er hasste den Namen Herondale. Er hasste das Wort.
»Familienähnlichkeit«, sagte Jace. »Wir sehen uns ähnlich. Genau genommen wirkst du wie ein Abziehbild der meisten Herondales, die ich bisher auf Zeichnungen und Gemälden gesehen habe.« Er schwieg erneut. »Außerdem hat mir Emma ein Handyfoto von dir geschickt«, fügte er schließlich hinzu.
Emma. Emma Carstairs hatte Kit das Leben gerettet. Allerdings hatten sie seitdem nicht viel Zeit zum Reden gehabt. Nach dem Tod von Malcolm Fade, dem Obersten Hexenmeister von Los Angeles, hatte totales Chaos geherrscht. Kit hatte nicht unbedingt an oberster Stelle irgendeiner Prioritätenliste gestanden; außerdem hatte er das Gefühl, dass Emma ihn für einen kleinen Jungen hielt. »Okay, ich bin Kit Herondale. Aber obwohl mich alle ständig mit diesem Namen anreden, bedeutet er mir nicht das Geringste.« Kit hob trotzig das Kinn. »Ich bin ein Rook. Kit Rook.«
»Ich weiß, was dir dein Vater erzählt hat. Aber du bist ein Herondale. Und das hat durchaus etwas zu bedeuten.«
»Was denn? Was soll es denn bedeuten?«, fragte Kit herausfordernd.
Jace lehnte sich an eine der Wände der Waffenkammer, direkt unter einem Gestell mit schweren Claymores. Kit hoffte, dass ihm eines dieser Langschwerter auf den Kopf fallen würde. »Ich weiß, dass du von der Existenz der Schattenjäger weißt«, sagte Jace. »Das gilt für viele Leute, vor allem für Schattenweltler und Irdische mit dem Zweiten Gesicht. Wofür auch du dich gehalten hast, stimmt’s?«
»Ich hab mich nie für einen Irdischen gehalten«, entgegnete Kit. Kapierten die Schattenjäger denn nicht, wie dieses Wort aus ihrem Mund klang?
Doch Jace ignorierte ihn. »Gesellschaft und Geschichte der Nephilim … von diesen Dingen wissen allerdings nur die wenigsten. Die Welt der Schattenjäger besteht aus verschiedenen Familien, die allesamt einen Namen haben, den sie in Ehren halten. Jede dieser Familien hat ihre eigene Geschichte, die sie an die nachfolgenden Generationen weitergibt. Unser ganzes Leben lang tragen wir den Ruhm und die Bürde unseres Namens – das Gute und das Schlechte, das unsere Vorfahren getan haben. Und wir versuchen, unserem Namen gerecht zu werden, damit diejenigen, die nach uns kommen, eine etwas leichtere Last zu tragen haben.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Handgelenke waren mit Runenmalen übersät; eines auf seinem linken Handrücken erinnerte an ein weit geöffnetes Auge. Kit hatte bemerkt, dass scheinbar alle Nephilim ein solches Mal hatten. »Unter den Schattenjägern ist dein Nachname von besonderer Bedeutung. Die Herondales waren schon immer eine Familie, die das Schicksal zahlreicher Nephilimgenerationen geprägt hat. Allerdings sind nicht mehr viele von uns übrig. Genau genommen haben alle gedacht, ich sei der Letzte. Nur Jem und Tessa haben nie an deiner Existenz gezweifelt. Sie haben sehr lange nach dir gesucht.«
Jem und Tessa. Zusammen mit Emma hatten sie Kit bei der Flucht vor den Dämonen geholfen, die seinen Vater getötet hatten. Und sie hatten ihm eine Geschichte erzählt: die Geschichte von einem Herondale, der seine Freunde betrogen hatte und geflohen war, um ein neues Leben fernab anderer Nephilim zu beginnen. Ein neues Leben und einen neuen Familienzweig.
»Ich hab von Tobias Herondale gehört«, sagte Kit. »Also bin ich der Nachfahr von einem gewaltigen Feigling.«
»Kein Mensch ist ohne Fehler«, erwiderte Jace. »Nicht jedes Mitglied deiner Familie wird dich vor Begeisterung umhauen. Aber wenn du Tessa das nächste Mal siehst, und du wirst ihr wieder begegnen, dann bitte sie, dir von Will Herondale zu erzählen. Und von James Herondale. Und natürlich von mir«, fügte er bescheiden hinzu. »Was Schattenjäger betrifft, bin ich eine ziemlich große Nummer. Nicht dass ich dich jetzt einschüchtern will.«
»Ich fühl mich nicht eingeschüchtert«, antwortete Kit und fragte sich, ob der Kerl wirklich echt war. Ein Glitzern in Jace’ Augen deutete darauf hin, dass er möglicherweise nicht jedes Wort todernst meinte, aber Kit war sich nicht sicher. »Ich möchte nur endlich in Ruhe gelassen werden.«
»Ich weiß, das sind eine Menge Informationen, die du erst mal verdauen musst«, sagte Jace. Er streckte die Hand aus, um Kit auf den Rücken zu klopfen. »Aber Clary und ich werden für dich da sein, solange du uns brauchst, um …«
Der Klaps auf den Rücken hatte einen der Dolche aus Kits Tasche katapultiert. Klirrend landete er auf dem Granitboden zwischen Kit und Jace und funkelte im Licht – wie ein Auge, das ihm einen vorwurfsvollen Blick zuwarf.
»Verstehe«, sagte Jace in der darauf folgenden Stille. »Du stiehlst also Waffen.«
Kit schwieg – er wusste, wie zwecklos es war, das Offensichtliche zu leugnen.
»Okay, hör zu, ich weiß, dass dein Dad ein Gauner war, aber du bist jetzt ein Schattenjäger, und … Moment mal, was hast du da noch alles in deiner Tasche?«, fragte Jace fordernd. Er machte eine komplizierte Bewegung mit seinem linken Fuß, worauf der Dolch durch die Luft flog und mühelos in seiner Hand landete, während die Rubine im Griff das Licht in alle Richtungen streuten. »Zieh die Jacke aus.«
Stumm ließ Kit die Jacke von seinen Schultern rutschen und warf sie auf den Tisch. Jace drehte sie um und öffnete die Innentasche. Schweigend betrachteten er und Kit die glänzenden Klingen und kostbaren Edelsteine.
»Okay …«, setzte Jace an, »… wenn ich das richtig verstehe, hattest du vor wegzulaufen, oder?«
»Warum sollte ich hierbleiben?«, platzte Kit heraus. Er wusste, dass er eigentlich nicht so reagieren sollte, aber er konnte nichts dagegen machen. Das Ganze war einfach zu viel: der Verlust seines Vaters, sein Hass auf das Institut, die Selbstgefälligkeit der Nephilim, ihre Forderung, dass er einen Familiennamen akzeptierte, der ihn nicht interessierte und für den er sich auch nicht interessieren wollte. »Ich gehöre nicht hierher. Du kannst mir zwar all diesen Quatsch über meinen Namen erzählen, aber das Ganze geht mich nichts an. Ich bin Johnny Rooks Sohn. Ich hab mein ganzes Leben so sein wollen wie mein Dad, und nicht wie du. Ich brauch dich nicht. Ich brauch keinen von euch. Ich brauche nur etwas Startkapital, damit ich meinen eigenen Stand auf dem Schattenmarkt eröffnen kann.«
Jace’ goldene Augen verengten sich zu Schlitzen, und Kit sah, wie unter der arroganten, launigen Fassade die messerscharfe Intelligenz des Schattenjägers aufblitzte. »Und was willst du dort verkaufen? Dein Vater hat mit Informationen gehandelt. Er hat Jahre gebraucht und eine Menge Schwarzer Magie, um diese Beziehungen aufzubauen. Willst du deine Seele auf die gleiche Weise verkaufen, nur um dich am Rande der Schattenwelt gerade so über Wasser zu halten? Und was ist mit den Mördern deines Vaters? Du hast doch gesehen, wie er gestorben ist, oder?«
»Dämonen …«
»Ja, aber irgendjemand hat sie geschickt. Der Wächter mag zwar tot sein, aber das bedeutet nicht, dass niemand mehr nach dir Ausschau hält. Du bist fünfzehn Jahre alt. Du magst vielleicht glauben, dass du sterben willst, aber vertrau mir: Das willst du nicht wirklich.«
Kit schluckte. Er versuchte sich vorzustellen, wie er hinter einem Verkaufsstand auf dem Schattenmarkt stand, so wie früher. Aber die Wahrheit war nun einmal, dass es für ihn dort nur wegen seines Dads sicher gewesen war. Weil sich die Leute vor Johnny Rook gefürchtet hatten. Was würde mit ihm passieren, wenn er dort ohne den Schutz seines Vaters auftauchte?
»Aber ich bin kein Schattenjäger«, wandte Kit ein und warf einen Blick auf die Waffenkammer mit ihren zigtausend Waffen aus verschiedenen Metallen und Adamant, den Rüstungen, Kampfmonturen und Waffengürteln. Das Ganze war einfach lachhaft. Er war kein Ninja. »Ich wüsste ja nicht mal, wie ich einer werden sollte.«
»Gib dir noch eine Woche«, sagte Jace. »Eine weitere Woche hier am Institut. Gib dir selbst eine Chance. Emma hat mir erzählt, wie du gegen die Dämonen gekämpft hast, die deinen Dad getötet haben. Nur ein Schattenjäger ist dazu in der Lage.«
Kit erinnerte sich nur vage an den Kampf mit den Dämonen in seinem Elternhaus, aber er wusste, dass er sie abgewehrt hatte. Sein Körper hatte die Regie übernommen, und er hatte gekämpft – und den Moment auf eine seltsame, uneingestandene Weise sogar genossen.
»Denn das bist du«, fuhr Jace fort. »Du bist ein Schattenjäger. Du stammst von Engeln ab. Ihr Blut fließt durch deine Adern. Du bist ein Herondale. Was, nebenbei bemerkt, bedeutet, dass du nicht nur Mitglied einer erstaunlich gutaussehenden Sippschaft bist, sondern auch Teil einer Familie, der eine Menge wertvoller Immobilien gehören, unter anderem ein Haus in London und ein Herrensitz in Idris – von denen dir wahrscheinlich ein Teil zusteht. Aber das interessiert dich ja scheinbar nicht.«
Kit schaute auf den Ring an Jace’ linker Hand. Er war aus schwerem Silber gefertigt und wirkte antik. Und wertvoll. »Ich höre.«
»Ich sage ja nur, dass du dem Ganzen eine Woche geben sollst. Schließlich …« – Jace grinste – »können wir Herondales einer Herausforderung einfach nicht widerstehen.«
»Ein Teuthida-Dämon?«, fragte Julian ins Telefon und runzelte die Stirn. »Das ist im Grunde ein Tintenfisch, oder?«
Die Antwort war kaum zu hören: Emma erkannte zwar Tys Stimme, konnte seine Worte aber nicht verstehen.
»Ja, wir sind am Pier«, fuhr Julian fort. »Bisher haben wir noch nichts gesehen, aber wir sind auch gerade erst angekommen. Zu blöd, dass es hier keine reservierten Parkplätze für Schattenjäger gibt …«
Während Emma Julian mit halbem Ohr zuhörte, schaute sie sich um. Die Sonne war gerade untergegangen. Emma liebte den Santa Monica Pier schon seit ihrer Kindheit, als ihre Eltern mit ihr hierhergekommen waren, um Air-Hockey zu spielen oder auf dem altmodischen Karussell zu fahren. Und sie liebte das ganze Junkfood – Burger und Milkshakes, frittierte Muscheln und riesige bunte Lutscher – und natürlich den Pacific Park, den heruntergekommenen Rummelplatz am Ende des Piers, mit Blick über den Pazifik.
Im Laufe der Jahre hatten die Irdischen Millionen von Dollar in die Sanierung des Piers gesteckt, um ihn für Touristen attraktiver zu machen. Jetzt drängten sich im Pacific Park zahlreiche neue glitzernde Fahrgeschäfte. Und die alten Imbisswagen waren verschwunden und durch Stände mit handwerklich hergestelltem Eis und Meeresfrüchten ersetzt worden. Aber die Bohlen unter Emmas Füßen waren noch immer von Sonne und Salz verzogen und verwittert. In der Luft lag noch immer der Geruch von Zucker und Seetang. Das Karussell spielte noch immer seine Leierkastenmusik. Es gab immer noch verschiedene Münzwurfspiele, bei denen man einen riesigen Stoffpanda gewinnen konnte. Und unter dem Pier befanden sich noch immer dunkle Orte, an denen sich Irdische ohne rechtes Ziel trafen … und manchmal auch üblere Gestalten.
Und genau das war das Problem mit dem Dasein als Nephilim, überlegte Emma und blickte in Richtung des hohen Riesenrads mit seinen tausenden leuchtenden LED-Lichtern. Vor der Kasse hatte sich eine Schlange aus ungeduldig wartenden Fahrgästen gebildet; dahinter konnte sie das dunkelblaue Meer und die sich brechenden weißen Wellen erkennen. Schattenjäger erkannten die Schönheit in den Dingen, die die Irdischen erschaffen hatten – die Lichter des Riesenrads spiegelten sich so hell im Ozean, als hätte jemand unter Wasser ein Feuerwerk in Rot, Blau, Grün, Violett und Gold gezündet –, aber die Nephilim sahen auch die Gefahren und den Verfall.
»Stimmt was nicht?«, fragte Julian. Er hatte sein Handy wieder in die Tasche seiner Monturjacke geschoben. Der Wind – auf dem Pier herrschte immer Wind, der unablässig vom Meer heranwehte und nach Salz und fernen Ländern roch – hob sein sanft gewelltes braunes Haar an, sodass die Spitzen seine Wangen und Schläfen küssten.
Düstere Gedanken, hätte Emma am liebsten geantwortet. Doch das konnte sie nicht. Einst war Julian der Mensch gewesen, dem sie alles hatte erzählen können. Aber jetzt war er der einzige Mensch, dem sie nichts mehr erzählen durfte.
Statt einer Antwort versuchte sie, seinem Blick auszuweichen, und fragte: »Wo sind Mark und Cristina?«
»Da drüben.« Julian zeigte auf die beiden. »Beim Ringwurfspiel.«
Emma folgte seinem Blick zu einem bunten Stand, an dem die Besucher versuchen mussten, einen Plastikring so zu werfen, dass er auf dem Hals einer Flasche landete, welche mit einem Dutzend weiterer Flaschen in einer Reihe stand. Emma bemühte sich, keine Überlegenheitsgefühle zu entwickeln, weil die Irdischen diese Aufgabe offenbar für ziemlich schwierig hielten.
Julians Halbbruder Mark wog drei Plastikringe in der Hand. Cristina, deren dunkles Haar zu einem ordentlichen Knoten hochgesteckt war, stand neben ihm, aß Karamellpopcorn und lachte. Und dann warf Mark die Ringe, alle drei gleichzeitig. Jeder der Ringe flog in eine andere Richtung und legte sich um den Hals einer Flasche.
Julian seufzte. »So viel zum Thema ›unauffälliges Verhalten‹.«
Eine Mischung aus Jubel und ungläubigem Stöhnen ging durch die Zuschauer am Ringwurfstand. Glücklicherweise waren es nicht viele Irdische, und Mark gelang es, ohne allzu großes Aufsehen seinen Preis abzuholen – irgendetwas in einem Plastikbeutel – und sich aus dem Staub zu machen.
Mit Cristina an seiner Seite kam er direkt auf Emma und Julian zu. Die oberen Ränder seiner spitzen Ohren ragten zwischen seinen hellblonden Haaren hervor, aber er hatte sich durch Zauberglanz getarnt, sodass die Irdischen sie nicht sehen konnten. Mark war ein Halb-Elbe, und sein Schattenweltlerblut zeigte sich in seinen feinen Zügen, der Form seiner Ohren und seinen kantigen Wangenknochen.
»Dann geht es also um einen Krakendämon?«, sagte Emma, hauptsächlich, um die Stille zwischen ihr und Julian mit irgendwelchen Worten zu füllen. In letzter Zeit hatte ziemlich oft eine betretene Stille zwischen ihnen beiden geherrscht. Seit dem Moment, an dem sich alles verändert hatte, waren gerade einmal zwei Wochen vergangen, aber Emma fühlte den Unterschied deutlich, in allen Gliedern. Sie spürte Julians Distanziertheit, auch wenn er sich ihr gegenüber immer äußerst höflich und zuvorkommend gezeigt hatte, nachdem sie ihm von Mark und sich erzählt hatte.
»Offenbar«, sagte Julian jetzt. Inzwischen waren Mark und Cristina in Hörweite; Cristina aß ihr letztes Karamellpopcorn und schaute wehmütig in die Tüte, als hoffte sie darauf, dass dort weiteres Popcorn auftauchen würde. Eine Hoffnung, die Emma nachvollziehen konnte. Mark begutachtete dagegen seinen Preis. »Der Dämon klettert an den Pfeilern des Piers hoch und schnappt sich irgendwelche Irdische. Meistens Kinder oder jeden anderen, der sich über die Brüstung beugt, um ein Nachtfoto zu schießen. Allerdings wurde er in letzter Zeit immer dreister. Anscheinend hat ihn jemand im Spieleareal gesehen, in der Nähe des Air-Hockey-Tischs … Ist das etwa ein Goldfisch?«
Mark hielt den Plastikbeutel hoch. Darin schwamm ein kleiner orangefarbener Fisch im Kreis. »Das ist der beste Patrouillengang, den wir je gemacht haben«, sagte er. »Mir wurde noch nie zuvor ein Fisch überreicht.«
Emma seufzte innerlich. Mark hatte die vergangenen Jahre bei der Wilden Jagd verbracht, dem wildesten und zügellosesten Zweig der Feenwelt. Die Jäger ritten auf allen möglichen verzauberten Wesen über den Himmel – Motorräder, Pferde, Hirsche, gewaltige knurrende Hunde – und durchstöberten Schlachtfelder, um den Toten alle wertvollen Dinge zu rauben und diese als Tributzahlungen an die Feenhöfe auszuhändigen.
Mark hatte sich inzwischen wieder ganz gut in seine Schattenjägerfamilie eingewöhnt, aber es gab immer noch Momente, in denen der Alltag ihn zu überraschen schien. Jetzt bemerkte er, dass die anderen ihn mit hochgezogenen Augenbrauen anschauten. Er zog eine beunruhigte Miene, legte zögerlich einen Arm um Emmas Schultern und streckte ihr den Plastikbeutel entgegen.
»Ich habe einen Fisch für dich gewonnen, meine Schöne«, sagte er und küsste sie auf die Wange.
Es handelte sich um einen zarten Kuss, sanft und lieb, und Mark roch wie immer: nach kühler, frischer Luft und Grünpflanzen. Und natürlich war es völlig logisch, überlegte Emma, dass Mark sich so verhielt: Er nahm an, dass die anderen ihn deswegen so perplex ansahen, weil sie darauf gewartet hatten, dass er ihr seinen Gewinn überreichte. Schließlich war sie seine Freundin.
Sie tauschte einen besorgten Blick mit Cristina, deren dunkle Augen sehr groß geworden waren. Julian machte den Eindruck, als müsste er sich gleich übergeben. Aber es dauerte nur einen Augenblick, bis er seine Gesichtszüge wieder im Griff hatte und eine neutrale Miene zog. Trotzdem löste Emma sich von Mark und schenkte ihm ein entschuldigendes Lächeln.
»Ich könnte keinen Fisch am Leben erhalten«, sagte sie. »Ein Blick von mir reicht schon, um Pflanzen verdorren zu lassen.«
»Vermutlich hätte ich das gleiche Problem«, räumte Mark ein und betrachtete den Fisch. »Zu schade – ich wollte ihn Magnus nennen, weil er so glitzernde Schuppen hat.«
Bei dieser Bemerkung musste Cristina kichern. Magnus Bane war der Oberste Hexenmeister von Brooklyn und hatte eine Vorliebe für Glitter.
»Dann sollte ich ihn wohl besser in die Freiheit entlassen«, sagte Mark, und bevor irgendjemand etwas sagen konnte, ging er zur Brüstung des Piers und entleerte den Plastikbeutel mitsamt Fisch ins Meer.
»Möchte ihm jemand erklären, dass Goldfische Süßwasserfische sind und im Ozean nicht überleben können?«, fragte Julian leise.
»Nicht wirklich«, erwiderte Cristina.
»Hat er gerade Magnus getötet?«, fragte Emma, aber bevor Julian antworten konnte, wirbelte Mark zu ihnen herum.
Sein Gesicht wirkte todernst. »Ich habe gerade gesehen, wie etwas einen der Pierpfeiler hinaufgekrochen ist. Etwas, das definitiv kein Mensch war.«
Emma spürte, wie ihr ein leichter Schauer über den Rücken fuhr. Im Meer hausende Dämonen ließen sich nur selten an Land blicken. Manchmal hatte Emma Albträume, in denen sich der Ozean umstülpte und seinen Inhalt auf den Strand spie: stachlige, schleimige, schwarze Wesen mit Tentakeln, die vom Gewicht des Wassers halb zerdrückt waren.
Innerhalb von Sekunden hatte jeder der Schattenjäger eine Waffe in der Hand: Emma umklammerte ihr Schwert Cortana, eine goldene Klinge, die ihre Eltern ihr geschenkt hatten. Julian hob eine Seraphklinge hoch, und Cristina zückte ihr Butterflymesser.
»In welche Richtung ist das Wesen gekrochen?«, fragte Julian.
»Zum Ende des Piers«, sagte Mark. Er war der Einzige, der nicht nach seiner Waffe gegriffen hatte, aber Emma wusste, wie schnell er war. In der Wilden Jagd hatte man ihm den Spitznamen Elbenschuss verliehen, wegen seiner Schnelligkeit und Präzision im Umgang mit Pfeil und Bogen und Wurfmessern. »In Richtung des Rummelplatzes.«
»Ich mache mich sofort auf den Weg dorthin und werde versuchen, dieses Wesen über die Kante des Piers zu treiben«, sagte Emma. »Mark, Cristina, ihr beide klettert unter den Pier und fangt es ab, falls es ins Wasser zurückkriechen will.«
Beiden blieb kaum Zeit zu nicken, als Emma auch schon lossprintete. Der Wind zerrte an ihren Zöpfen, während sie sich durch die Menge schlängelte, die in Richtung des hell erleuchteten Rummelplatzes am Ende des Piers strömte. Cortana lag warm und beruhigend in ihrer Hand, und ihre Füße flogen über die vom Seewasser verzogenen Holzbohlen. Sie fühlte sich frei und sorglos – ihr gesamter Körper und ihr Geist waren vollkommen auf die bevorstehende Aufgabe konzentriert.
Dann hörte sie Schritte neben sich. Aber sie brauchte ihren Kopf nicht zu drehen: Sie wusste auch so, dass Jules an ihrer Seite war. Seine Schritte hatten sie während ihres gesamten aktiven Schattenjägerdaseins begleitet. Sein Blut war zusammen mit ihrem vergossen worden. Er hatte ihr das Leben gerettet und sie ihm. Er war Teil ihres Krieger-Ichs.
»Da«, hörte sie ihn rufen, aber sie hatte das Wesen bereits selbst entdeckt: eine dunkle, bucklige Gestalt, die die Stützstreben des Riesenrads hinaufkroch. Die Gondeln drehten sich weiter im Kreis, mit vor Vergnügen kreischenden Passagieren, die nichts von der Gefahr ahnten.
Emma erreichte die Schlange vor dem Riesenrad und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Julian und sie hatten vor ihrer Ankunft am Pier Zauberglanzrunen aufgetragen, wodurch sie für die Augen der Irdischen unsichtbar waren. Aber das bedeutete nicht, dass diese Emmas Anwesenheit nicht spüren konnten. Verschiedene Irdische fluchten und brüllten auf, während Emma auf Füße trat und sich mit den Ellbogen bis zum Einstieg vorkämpfte.
Eine Gondel schwang herab, und ein junges Paar – ein Mädchen mit violetter Zuckerwatte in der Hand und ihrem schwarz gekleideten, schlaksigen Freund an der Seite – wollte gerade einsteigen. Emma schaute kurz nach oben und erhaschte einen Blick auf den Teuthida-Dämon, der sich um den oberen Bereich der Stützstreben schlängelte. Fluchend schob sie sich an dem Paar vorbei, stieß die beiden fast aus dem Weg und sprang in die achteckige Gondel – mit einer Bank entlang der Seitenwände und in der Mitte genügend Platz zum Stehen. Emma hörte überraschte Rufe hinter sich, als die Gondel in die Höhe schwebte und sie von dem Chaos wegbeförderte, das sie erzeugt hatte: Das Paar, das gerade hatte einsteigen wollen, schrie den Kartenabreißer an, und die Leute in der Schlange dahinter beschimpften sich gegenseitig.
Dann ruckelte die Gondel unter Emmas Füßen, als Julian neben ihr landete und die Gondel damit zum Schwingen brachte. Er reckte den Kopf. »Kannst du ihn sehen?«
Emma verengte die Augen zu Schlitzen. Sie hatte den Dämon gesehen, da war sie sich ziemlich sicher. Aber jetzt schien er verschwunden zu sein. Von ihrem Blickwinkel aus war das Riesenrad ein einziges Wirrwarr aus hellen Lichtern, sich drehenden Speichen und weißlackierten Eisenstreben. Die beiden Gondeln unter Julian und ihr waren leer; offenbar hatte sich die Schlange der Wartenden noch nicht wieder sortiert.
Gut, dachte Emma. Je weniger Personen sich auf dem Riesenrad befanden, desto besser.
»Stopp.« Emma spürte Julians Hand an ihrem Arm, als er ihn umdrehte. Ihr gesamter Körper versteifte sich. »Runenmale«, sagte er kurz angebunden, und Emma erkannte, dass er seine Stele in der anderen Hand hielt.
Ihre Gondel schwebte immer höher. Emma konnte den Strand unter ihnen sehen, die dunklen Fluten, die sich auf den Sand ergossen, die Hügel von Palisades Park, die hinter dem Highway fast senkrecht anstiegen und von Bäumen und Sträuchern gesäumt wurden. Über ihnen waren die Sterne gegen die hellen Lichter des Piers gerade noch zu erkennen.
Julian hielt ihren Arm weder grob noch sanft, sondern einfach mit einer Art klinischer Distanz. Er drehte ihn um, dann fuhr seine Stele mit raschen Bewegungen über ihr Handgelenk und hinterließ tintenschwarze Runen für Schutz, Schnelligkeit und Beweglichkeit sowie eine Rune für gesteigertes Hörvermögen.
Seit zwei Wochen war Emma Jules nicht mehr so nahe gewesen wie in diesem Moment. Die Nähe machte sie benommen, als wäre sie leicht beschwipst. Er hatte den Kopf gesenkt und den Blick auf seine Aufgabe geheftet – und Emma ergriff die Gelegenheit, ihn verstohlen zu betrachten.
Die LED-Lampen des Riesenrads leuchteten inzwischen orange und gelb und tauchten seine gebräunte Haut in ein goldenes Licht. Seine sanft gewellten Haare fielen ihm in die Stirn. Emma wusste, wie weich die Haut an seinen Mundwinkeln war und wie sich seine Schultern unter ihren Händen anfühlten: stark und hart und lebendig. Seine langen, dichten Wimpern waren so dunkel, dass sie beinahe wie getuscht aussahen; Emma erwartete fast, dass sie nach jedem Wimpernschlag eine Spur schwarzen Puders auf seinen Wangenknochen hinterlassen würden.
Er war wunderschön. Das war er schon immer gewesen, aber sie hatte es zu spät erkannt. Und jetzt stand sie mit geballten Fäusten da, und ihr ganzer Körper schmerzte, weil sie ihn nicht berühren durfte. Sie durfte ihn nie wieder berühren.
Julian beendete seine Aufgabe und wirbelte die Stele herum, sodass der Griff in Emmas Richtung zeigte. Wortlos nahm sie sie entgegen, während Julian den Kragen seines T-Shirts unter der Monturjacke beiseitezog. Diese Stelle war einen Hauch heller als die gebräunte Haut seines Gesichts und seiner Hände und außerdem mit einem Gitterwerk aus verblassten Runenmalen übersät.
Emma musste einen Schritt nähertreten, um ihn mit einer Rune zu versehen. Die Male blühten unter der Spitze der Stele auf: Runen für Beweglichkeit und Nachtsehvermögen. Emmas Kopf reichte gerade bis zu Julians Kinn; sie starrte direkt auf seinen Kehlkopf und sah, dass er schlucken musste.
»Verrat mir nur eines«, setzte er an. »Sag mir, ob er dich glücklich macht. Ob Mark dich glücklich macht.«
Ruckartig hob Emma den Kopf. Sie hatte die Runen fertiggestellt, und Julian nahm ihr die Stele aus der reglosen Hand. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit blickte er sie direkt an; seine Augen wirkten dunkelblau im Schein des Nachthimmels und des Meers, das sie von allen Seiten umgab, während sie sich dem höchsten Punkt des Riesenrads näherten.
»Ich bin glücklich, Jules«, sagte sie. Was machte schon eine weitere Lüge aus, nach so vielen anderen? Früher war es ihr nicht leichtgefallen zu lügen, aber inzwischen gewöhnte sie sich daran. Wenn die Sicherheit der Menschen, die sie liebte, davon abhing, dann war sie durchaus in der Lage zu lügen. »So … ist es einfach klüger, sicherer für uns beide.«
Er presste seine weichen Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. »Das hatte ich dich nicht …«
Emma keuchte auf. Eine sich windende Gestalt tauchte hinter ihm auf: Das wie ein Ölteppich schimmernde Wesen schlang seine ausgefransten Tentakel um eine der Speichen des Riesenrads und riss sein Maul weit auf. Ein perfekter, mit scharfen Zähnen besetzter Kreis.
»Jules!«, brüllte Emma, schwang sich aus der Gondel und hielt sich mit einer Hand an einer der dünnen Eisenstreben fest, die zwischen den Speichen verliefen. Dann schlug sie mit Cortana zu und traf den Teuthida, als er sich gerade aufbäumen wollte. Der Dämon heulte, und sein Wundsekret sprühte in alle Richtungen; Emma schrie auf, als es auf ihren Hals spritzte und ihre Haut verätzte.
Ein Messer bohrte sich in den plumpen, gerippten Körper des Dämons. Während Emma sich auf eine Speiche hinaufzog, blickte sie kurz nach unten und entdeckte Julian auf dem Rand der Gondel, ein weiteres Messer wurfbereit in der Hand. Er zielte und ließ die Klinge durch die Luft segeln …
Aber sie prallte vom Boden einer leeren Gondel ab. Mit unglaublicher Geschwindigkeit entzog sich der Teuthida ihren Blicken. Emma konnte hören, dass er nach unten krabbelte, entlang der Metallträger, die das Innere des Riesenrads bildeten.
Sofort schob Emma ihr Schwert in die Scheide und kroch über ihre Speiche in Richtung Erdboden. Um sie herum blitzten LED-Lichter in grellen Violett- und Goldtönen auf.
Das Wundsekret und das Blut an ihren Händen machten den Abstieg zu einer Rutschpartie. Trotzdem war der Blick vom Riesenrad über die Gegend atemberaubend: Meer und Strand, so weit das Auge reichte – als würde sie vom Rand der Welt baumeln.
Emma schmeckte Blut in ihrem Mund … und Salz. Unter sich sah sie Julian, der die Gondel verlassen hatte und über eine der unteren Speichen balancierte. Er schaute kurz zu ihr hoch und zeigte dann auf etwas. Emma folgte seinem Blick und entdeckte den Teuthida: Er hatte die Mitte des Rads fast erreicht.
Seine Tentakel peitschten um seinen Körper und schlugen gegen die Nabe. Emma konnte die Erschütterungen in ihren Knochen spüren. Sie reckte den Kopf, um sich einen Eindruck zu verschaffen, was der Dämon da tat … und erstarrte: In der Mitte des Fahrgeschäfts befand sich ein massiver Bolzen, der das Riesenrad mit den Stützstreben verband, und der Teuthida zerrte an dieser Verbindung, um den Bolzen herauszuziehen. Falls ihm das gelang, würde sich die gesamte Konstruktion aus ihrer Verankerung lösen und über den Pier rollen wie der ausgespannte Vorderreifen eines Fahrrads.
Emma gab sich keinen Illusionen hin, dass irgendeiner der Fahrgäste in den Gondeln oder jemand aus der wartenden Menge das überleben würde. Das Rad würde zusammenbrechen und alles und jeden unter sich begraben. Dämonen liebten Zerstörung; sie zehrten von der Energie des Todes, und dieser Teuthida würde sich an den Toten laben.
Das Riesenrad bebte. Der Dämon hatte seine Tentakel fest um den Metallbolzen geschlungen und zerrte daran. Emma verdoppelte ihre Kriechgeschwindigkeit, aber sie war noch immer zu weit oberhalb der Nabe. Julian war näher dran, doch sie wusste, welche Waffen er bei sich hatte: zwei Messer, die er bereits geworfen hatte, und mehrere Seraphklingen, die allerdings nicht lang genug waren, um an den Dämon heranzukommen.
Julian blickte erneut zu ihr hoch; dann legte er sich auf den Eisenträger, schlang den linken Arm um das Metall, um sich festen Halt zu geben, und streckte den anderen Arm aus, die Hand weit geöffnet.
Ohne auch nur eine Sekunde nachdenken zu müssen, wusste Emma sofort, was er vorhatte. Sie holte tief Luft und löste ihre Hand von der Speiche.
Und dann fiel sie in Julians Richtung und streckte ihre Finger aus, um nach seinen zu greifen. Ihre Hände bekamen einander zu fassen und umschlossen sich, und Emma hörte, wie Julian ächzte, als er ihr Gewicht auffing. Sie schwang abwärts – ihre linke Hand fest in seiner rechten – und zog mit der anderen Hand Cortana aus der Scheide. Der Schwung ihres Falls trug sie vorwärts, in Richtung der Radnabe.
Der Teuthida-Dämon hob den Kopf, als sie auf ihn zuschwang, und Emma konnte zum ersten Mal seine Augen sehen – ovale Gebilde mit einer glänzenden, spiegelartigen Schutzschicht. Sie schienen sich fast wie menschliche Augen zu weiten, als sie Cortana vorwärtsstieß und dem Dämon die Klinge durch den Kopf ins Gehirn rammte.
Seine Tentakel peitschten um sich – ein letztes Aufbäumen, während der Dämon zurückzuckte, sich von der Klinge löste und über eine der abwärtsgerichteten Speichen von der Nabe rutschte. An deren Ende angekommen, verlor er den Halt und stürzte in die Tiefe.
Wie aus weiter Ferne glaubte Emma ein lautes Platschen zu hören. Aber ihr blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Julians Hand hatte sich noch fester um ihre geschlossen, und er zog sie zu sich hinauf. Emma schob Cortana zurück in die Scheide, während er sie hochhievte, höher und höher, bis auf die Speiche, auf der er lag, sodass Emma unbeholfen halb auf ihm landete.
Er umklammerte noch immer ihre Hand, und sein Atem ging schwer. Für einen Sekundenbruchteil trafen sich ihre Blicke. Um sie herum drehte sich das Rad und senkte sie in Richtung Boden hinab. Emma konnte die vielen Irdischen am Strand erkennen, das schimmernde Wasser entlang der Flutlinie und sogar einen dunklen Kopf und einen hellen Schopf, bei denen es sich möglicherweise um Mark und Cristina handelte.
»Gute Teamarbeit«, sagte Julian schließlich.
»Ich weiß«, antwortete Emma – und meinte es auch so. Das war der schlimmste Aspekt an dieser ganzen Geschichte: die Tatsache, dass er recht hatte; die Tatsache, dass sie als Parabatai noch immer perfekt funktionierten. Als Kampfpartner. Als zwei durch einen Eid verbundene Krieger, die durch nichts voneinander getrennt werden konnten.
Mark und Cristina erwarteten sie bereits unter dem Pier. Mark hatte seine Schuhe ausgezogen und watete durch die kniehohen Wellen. Cristina steckte gerade ihr Butterflymesser wieder ein. Vor ihren Füßen befand sich ein schleimiger Sandabschnitt, der langsam trocknete.
»Habt ihr dieses Kraken-Ding gesehen, als es vom Riesenrad heruntergefallen ist?«, fragte Emma, während Julian und sie auf die beiden zuliefen.
Cristina nickte. »Der Dämon ist auf dem seichten Bereich neben dem Pier aufgeschlagen. Er war noch nicht ganz tot, deshalb hat Mark ihn auf den Strand geschleift, und wir haben ihn gemeinsam erledigt.« Sie trat mit dem Fuß in den Sand vor ihr. »Total eklig. Und Mark ist von Kopf bis Fuß mit Sekret bespritzt.«
»Ja, ich hab ebenfalls Wundsekret abbekommen«, sagte Emma und blickte an ihrer fleckigen Montur herab. »Das war ein verdammt schleimiger Dämon.«
»Aber du bist noch immer wunderschön«, sagte Mark mit einem galanten Lächeln.
Emma erwiderte sein Lächeln, so gut sie konnte. Sie war Mark unglaublich dankbar, dass er ohne Murren seine Rolle in dieser Geschichte spielte, obwohl ihm das Ganze bestimmt merkwürdig vorkommen musste. Nach Cristinas Meinung profitierte auch er in irgendeiner Form von diesem Arrangement, aber Emma konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, worum es dabei gehen mochte. Schließlich war es nicht so, als ob Mark gern log. Er hatte so viele Jahre bei den Feenwesen verbracht – die gar nicht in der Lage waren, die Unwahrheit zu sagen –, dass ihm jede Lüge unnatürlich erschien.
Julian war ein paar Schritte beiseitegetreten und sprach leise in sein Handy. Mark stapfte platschend aus dem Wasser und stieg mit nassen Füßen in seine Stiefel. Weder er noch Cristina waren vollständig durch Zauberglanz getarnt, und Emma bemerkte die Blicke der irdischen Passanten, als er auf sie zukam – denn er war groß und wunderschön und seine Augen leuchteten stärker als die Lichter des Riesenrads. Außerdem war eines seiner Augen blaugrün und das andere bernsteinfarben.
Und er hatte etwas Besonderes an sich, eine undefinierbare Fremdartigkeit, einen Hauch der Wildheit des Feenreichs, der Emma unwillkürlich an weite, endlose Ebenen denken ließ, an Freiheit und Ungezähmtheit. Ich bin ein verlorener Junge, schienen seine Augen zu sagen. Finde mich.
Als er vor Emma stand, hob er die Hand und strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht. Eine Woge von Gefühlen rauschte durch ihren Körper – Trauer und Freude, dazu eine unbestimmte Sehnsucht, die sie nicht genauer benennen konnte.
»Diana hat gerade angerufen«, sagte Julian, und obwohl Emma ihn nicht anschaute, wusste sie genau, wie sein Gesicht in diesem Moment aussah – ernst, nachdenklich und sorgfältig die Situation abwägend. »Jace und Clary sind mit einer Nachricht von der Konsulin zum Institut gekommen. Sie haben eine Besprechung anberaumt; wir sollen sofort zurückkehren.«
2
H
Gähnende Schlünde
Emma, Mark, Cristina und Julian marschierten direkt durch das Institut zur Bibliothek, ohne vorher ihre Montur zu wechseln. Erst als sie in den Raum platzten und Emma bewusst wurde, dass sie alle mit klebrigem Dämonensekret besudelt waren, fragte sie sich, ob sie nicht vielleicht doch erst einmal hätten duschen sollen.
Das Dach der Bibliothek war zwei Wochen zuvor beschädigt worden und inzwischen notdürftig repariert: Statt des Rundfensters ragte ein schlichtes, durch Runen geschütztes Oberlicht über dem Raum auf, und die kunstvolle Deckenbemalung lag unter einer Verkleidung aus Ebereschenholz, die ebenfalls mit Schutzrunen versehen war.
Das Holz der Eberesche bot besonderen Schutz: Es sorgte dafür, dass keinerlei schwarze Magie hindurchdringen konnte. Darüber hinaus wirkte es sich aber auch negativ auf Feenwesen aus. Beim Betreten des Raums sah Emma, wie Mark zusammenzuckte und den Blick abwandte. Er hatte ihr erzählt, dass sich seine Haut in der Nähe von Ebereschenholz so anfühlte, als würde sie mit winzigen Funken bepudert. Jetzt fragte Emma sich, wie ein Vollblutfeenwesen wohl auf die Bibliothek reagieren würde.
»Gut, dass ihr zurück seid«, sagte Diana. Sie saß am Kopfende eines der langen Lesetische, die Haare zu einem eleganten Knoten hochgesteckt. Eine schwere Goldkette hob sich schimmernd von ihrer dunklen Haut ab, und ihr schwarzweißes Kleid war wie immer makellos sauber und ohne jede Knitterfalte.
Neben ihr thronte Diego Rocio Rosales, dem Rat als extrem gut ausgebildeter Zenturio bekannt – was ihm bei den Blackthorns den Spitznamen »der Perfekte Diego« eingebracht hatte. Und er war tatsächlich fast schon widerwärtig perfekt – unglaublich attraktiv, ein sensationeller Krieger, clever und stets höflich. Aber er hatte auch Cristina das Herz gebrochen, bevor sie aus Mexiko nach Los Angeles gekommen war – was bedeutete, dass Emma normalerweise Pläne für seinen Tod schmieden würde. Doch das konnte sie jetzt nicht mehr, weil er und Cristina sich versöhnt hatten und seit zwei Wochen wieder ein Paar waren.
Als Cristina die Bibliothek betrat, schenkte er ihr ein Lächeln, das seine ebenmäßigen weißen Zähne kurz aufblitzen ließ. Ein silbernes Zenturioabzeichen mit der Inschrift Primi Ordines glitzerte an seiner Schulter. Denn er war nicht einfach nur ein Zenturio – er war Mitglied der Ersten Kompanie, der besten Absolventen der Scholomance. Eben weil er perfekt war.
Gegenüber von Diana und Diego saßen zwei Personen, die Emma sehr gut kannte: Jace Herondale und Clary Fairchild, die heutigen Leiter des New Yorker Instituts – und das, obwohl sie bei ihrer ersten Begegnung mit Emma noch Teenager gewesen waren, ungefähr so alt wie Emma jetzt. Mit seinen zerzausten goldenen Haaren war Jace wie immer umwerfend gutaussehend, aber er schien inzwischen viel mehr in sich selbst zu ruhen. Und Clary war eine Mischung aus roten Haaren, störrischen grünen Augen und einem täuschend zarten Gesicht – sie besaß einen eisernen Willen, wie Emma nur allzu gut wusste.
Jetzt sprang Clary auf und strahlte über das ganze Gesicht, während Jace sich lächelnd auf seinem Stuhl zurücklehnte. »Da seid ihr ja!«, rief sie und lief zu Emma. Sie trug Jeans und ein fadenscheiniges T-Shirt mit dem Aufdruck MADE IN BROOKLYN, das vermutlich einst ihrem besten Freund Simon gehört hatte. Das Shirt wirkte abgetragen und weich, genau wie die Sorte von T-Shirts, die Emma oft aus Julians Kleiderschrank stibitzt und nicht mehr herausgerückt hatte. »Wie ist es mit dem Krakendämon gelaufen?«
Aber da Clary sie im nächsten Moment fest an sich drückte, konnte Emma ihre Frage nicht beantworten.
»Gut«, sagte Mark. »Wirklich gut. Diese Tintenfische stecken voller Flüssigkeiten.«
Der Gedanke schien ihm tatsächlich zu gefallen.
Clary gab Emma frei und betrachtete stirnrunzelnd die Mischung aus Dämonensekret, Salzwasser und unidentifizierbarem Schleim, die sich auf ihr T-Shirt übertragen hatte. »Ich verstehe.«
»Ich begrüße euch lieber von hier aus«, sagte Jace und winkte ihnen zu. »Aus eurer Richtung wabert ein beunruhigender Calamaresgeruch herüber.«
Emma hörte ein Kichern, das sofort unterdrückt wurde. Als sie hochschaute, entdeckte sie mehrere Beine, die zwischen dem Geländer der oberen Galerie herabbaumelten. Belustigt erkannte sie Tys lange Gliedmaßen und Livvys gemusterte Strümpfe. Das Obergeschoss der Bibliothek bot zahlreiche Nischen, die sich perfekt zum Lauschen eigneten. Emma konnte die Male im Nachhinein gar nicht mehr zählen, bei denen Julian und sie als Kinder heimlich die von Andrew Blackthorn geleiteten Besprechungen belauscht hatten – und dabei das Wissen und das Gefühl der Bedeutungsschwere, das jede Divisionssitzung umgab, förmlich in sich aufgesogen hatten.
Jetzt warf sie Julian einen Seitenblick zu und sah, dass er Tys und Livvys Anwesenheit ebenfalls bemerkt und dann – genau wie sie selbst – beschlossen hatte, nichts dazu zu sagen. Sein gesamter Denkprozess zeigte sich ihr in seinem amüsierten Lächeln. Es war seltsam, wie durchschaubar er für sie in diesen ungeschützten Momenten war, aber wie wenig sie über seine Gedanken sagen konnte, wenn er sie bewusst vor ihr verbarg.
Cristina ging zu Diego und knuffte ihn leicht gegen die Schulter, woraufhin er ihr einen Kuss auf das Handgelenk drückte. Emma sah, wie Mark den beiden einen Blick zuwarf. Aber seine Miene blieb undurchdringlich. Mark hatte mit ihr während der vergangenen zwei Wochen über viele Dinge geredet, aber nicht über Cristina. Kein einziges Mal über Cristina.
»Also, wie viele Meerdämonen waren das jetzt?«, fragte Diana. »Insgesamt?« Sie bedeutete den anderen, sich an den Tisch zu setzen. Mit einem leicht quatschenden Geräusch ließ Emma sich neben Mark nieder, direkt gegenüber von Julian. Er beantwortete Dianas Frage so ruhig, als würde er kein Dämonensekret auf das polierte Parkett tropfen.
»In dieser Woche mehrere kleine«, erklärte er, »aber das ist normal. Sobald es stürmt, werden sie an Land gespült. Wir sind hier oben Patrouille gegangen und die Ashdowns weiter südlich. Ich denke, dass wir sie alle erwischt haben.«
»Dieser hier war der erste wirklich große Meerdämon«, fügte Emma hinzu. »Ich meine, ich habe bisher nur wenige so große Exemplare gesehen. Normalerweise steigen sie nicht aus den Tiefen des Meeres bis an die Oberfläche und kriechen an Land.«
Jace und Clary warfen sich einen Blick zu.
»Gibt es da irgendetwas, das wir wissen sollten?«, fragte Emma. »Sammelt ihr richtig große Meerdämonen, um damit euer Institut zu dekorieren oder so?«
Jace beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Er hatte ein ruhiges, raubkatzenartiges Gesicht und unergründliche bernsteingoldene Augen. Clary hatte Emma einmal erzählt, dass sie bei ihrer ersten Begegnung mit Jace gedacht hatte, er würde aussehen wie ein Löwe. Und genau das konnte Emma jetzt auch erkennen: Löwen schienen immer so gelassen und fast schon träge, bis sie plötzlich und beinahe explosionsartig in Aktion traten.
»Vielleicht sollten wir euch erzählen, warum wir hier sind«, sagte er.
»Ich dachte, ihr wärt wegen Kit hier«, wandte Julian ein. »Weil er ein Herondale ist.«
Aus dem oberen Stockwerk ertönte Geraschel und ein leises Murmeln. Ty hatte während der vergangenen Nächte vor Kits Zimmertür geschlafen, ein seltsames Verhalten, das aber niemand kommentiert hatte. Emma nahm an, dass Ty den Jungen ungewöhnlich und interessant fand – auf die gleiche Weise, wie er Bienen und Echsen ungewöhnlich und interessant fand.
»Zum Teil«, antwortete Jace. »Wir sind gerade erst von einer Ratsversammlung in Idris zurückgekehrt, weshalb wir so lange gebraucht haben, um hierherzukommen – obwohl ich eigentlich gern sofort angereist wäre, nachdem ich von Kit gehört hatte.« Er lehnte sich zurück und legte einen Arm über seine Stuhllehne. »Bestimmt überrascht es euch nicht, wenn ich euch erzähle, dass über diese Malcolm-Geschichte intensiv debattiert wurde.«
»Du meinst die Geschichte, bei der sich der Oberste Hexenmeister von Los Angeles als Serienmörder und Totenbeschwörer entpuppt hat?«, fragte Julian. In seiner Stimme schwangen gleich mehrere Vorwürfe mit: Der Rat hatte Malcolm nicht verdächtigt; er hatte keinen Einspruch gegen dessen Ernennung zum Obersten Hexenmeister erhoben, und er hatte nichts unternommen, um Malcolms Mordserie zu stoppen. All das hatten die Blackthorns selbst tun müssen.
Von der Galerie ertönte erneutes Gekicher. Diana hüstelte, um ein Lächeln zu verbergen. »Tut mir leid«, wandte sie sich an Jace und Clary, »aber ich glaube, wir haben Mäuse.«
»Ich habe nichts gehört«, sagte Jace.
»Wir sind einfach nur überrascht, dass die Ratsversammlung so schnell vorbei war«, sagte Emma. »Wir haben gedacht, dass wir vielleicht eine Zeugenaussage machen müssen. Zu Malcolm und allem, was passiert ist.«
Emma und die Blackthorns hatten schon einmal vor dem Rat aussagen müssen, vor Jahren, kurz nach dem Dunklen Krieg. Eine Erfahrung, die sie nicht unbedingt wiederholen wollte. Aber dann hätten sie wenigstens die Gelegenheit gehabt, ihre Sicht der Ereignisse darzulegen. Und zu erklären, warum sie mit den Feenwesen zusammengearbeitet hatten, entgegen der Vorschriften des Kalten Friedens. Warum sie Ermittlungen zum Obersten Hexenmeister von Los Angeles durchgeführt hatten, ohne den Rat darüber zu informieren. Und was sie getan hatten, nachdem ihnen klar geworden war, dass Malcolm Fade all diese abscheulichen Verbrechen begangen hatte.
Warum Emma ihn getötet hatte.
»All das habt ihr ja bereits Robert erzählt … dem Inquisitor«, sagte Clary. »Und er glaubt euch. Er hat den Rat in eurem Namen informiert.«
Julian zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Robert Lightwood, der Inquisitor des Rats, war kein herzlicher und umgänglicher Mann. Sie hatten ihm alles erzählt, weil sie dazu gezwungen gewesen waren, aber er gehörte nicht zu der Sorte Mensch, von der man sich irgendeinen Gefallen erhoffen durfte.
»Robert ist gar nicht so übel«, sagte Jace. »Wirklich. Seitdem er Großvater geworden ist, ist er deutlich milder gestimmt. Und genau genommen war der Rat weniger an euch interessiert als am Schwarzen Buch der Toten.«
»Offenbar war niemandem bewusst, dass es sich hier in dieser Bibliothek befunden hatte«, sagte Clary. »Das Institut in Cornwall ist berühmt für seine umfangreiche Sammlung von Werken zum Thema schwarze Magie – darunter auch die Originalausgabe des Hexenhammers und der Daemonatia. Alle haben gedacht, das Schwarze Buch der Toten wäre dort, hinter Schloss und Riegel.«
»Wir Blackthorns haben das Institut in Cornwall früher mal geleitet«, sagte Julian. »Vielleicht hat mein Vater es mitgenommen, als man ihn zum Leiter dieses Instituts hier ernannt hat.« Er zog eine nachdenkliche Miene. »Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, warum er das getan haben sollte.«
»Vielleicht hat Arthur das Buch mitgebracht«, mutmaßte Cristina. »Antike Bücher haben ihn schon immer fasziniert.«
Emma schüttelte den Kopf. »Nein, das kann nicht sein. Das Buch muss schon hier gewesen sein, als Sebastian das Institut überfallen hat – lange bevor Arthur hierherkam.«
»Hing die Tatsache, dass der Rat keine Zeugenaussage von uns wollte, nicht auch damit zusammen, dass die Mitglieder ungestört darüber diskutieren wollten, ob ich hierbleiben darf?«, wandte Mark ein.
»Ja, das auch«, antwortete Clary und sah ihm ruhig in die Augen. »Aber wir hätten niemals zugelassen, Mark, dass sie dich wieder zur Wilden Jagd zurückschicken. Dagegen hätte wirklich jeder protestiert.«
Diego nickte. »Die Ratsmitglieder haben sich beratschlagt, und sie sind damit einverstanden, dass Mark hier bei seiner Familie bleibt. Der ursprüngliche Befehl untersagte den Schattenjägern ja nur, nach ihm zu suchen. Aber er ist zu euch zurückgekehrt, also wurde dem Befehl nicht zuwidergehandelt.«
Mark nickte steif. Er hatte den Perfekten Diego noch nie richtig gemocht, dachte Emma.
»Und glaubt mir«, fügte Clary hinzu, »die Ratsmitglieder sind über dieses Schlupfloch sehr froh. Ich denke, dass selbst die größten Feenhasser unter ihnen Mitgefühl für das empfinden, was Mark durchgemacht hat.«
»Aber nicht für das, was Helen durchmacht?«, fragte Julian. »Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über ihre Rückkehr?«
»Nein«, sagte Jace. »Es tut mir sehr leid, aber der Rat wollte nichts davon hören.«
Marks Miene spannte sich an. Und in diesem Moment konnte Emma den Krieger in ihm erkennen, den wilden Jäger auf den Schlachtfeldern, den Wanderer zwischen den Leichen.
»Wir werden dem Rat weiterhin schreiben«, sagte Diana. »Die Tatsache, dass du wieder hier bei uns bist, ist ein wichtiger Schritt, Mark, und wir werden nicht aufhören, auf Helens Freilassung zu drängen. Aber im Moment …«
»Was passiert denn im Moment?«, fragte Mark herausfordernd. »Ist die Krise etwa nicht überstanden?«
»Wir sind Schattenjäger«, sagte Jace. »Du wirst feststellen, dass die Krise nie überstanden ist.«
»Im Moment«, fuhr Diana fort, »hat der Rat lediglich die Diskussion über die Tatsache abgeschlossen, dass entlang der gesamten kalifornischen Küste große Meerdämonen gesichtet wurden. Rekordverdächtige Mengen. Allein in der vergangenen Woche wurden mehr entdeckt als im gesamten Jahrzehnt davor. Dieser Teuthida, gegen den ihr gekämpft habt, war kein Ausnahmefall.«
»Wir denken, das hängt damit zusammen, dass Malcolms Leichnam und das Schwarze Buch der Toten noch immer irgendwo da draußen auf dem Meeresgrund liegen«, erklärte Clary. »Und vielleicht hängt es auch mit den Beschwörungsformeln zusammen, die Malcolm zu Lebzeiten gesprochen hat.«
»Aber die Zauberformeln der Hexenwesen verschwinden, wenn sie sterben«, protestierte Emma. Sie musste an Kit denken. Die Schutzzauber, die Malcolm um Rooks Haus platziert hatte, hatten sich im Moment seines Todes aufgelöst, und innerhalb weniger Stunden hatten Dämonen das Haus angegriffen. »Wir sind nach Malcolms Tod zu seiner Villa gefahren, um nach Beweisen für seine Taten zu suchen. Das gesamte Gebäude war zusammengefallen und ist nur noch ein Schutthaufen.«
Jace war unter dem Tisch verschwunden. Als er einen Moment später wieder zum Vorschein kam, hielt er Church, den Teilzeitkater des Instituts auf dem Arm. Church hatte alle Pfoten von sich gestreckt und wirkte sehr zufrieden. »Wir haben das Gleiche angenommen«, sagte Jace und setzte den Kater auf seinen Schoß. »Aber laut Magnus gibt es anscheinend Beschwörungsformeln, die so konstruiert sind, dass sie durch den Tod eines Hexenwesens aktiviert werden.«
Emma musterte Church finster. Sie wusste, dass der Kater einst im New Yorker Institut gelebt hatte, aber es erschien ihr sehr unhöflich, dass er seine Vorlieben so unverhohlen zeigte. Doch Church lag schnurrend auf dem Rücken und ignorierte Emma.
»Wie ein Alarm, der ausgelöst wird, wenn man eine Tür öffnet?«, fragte Julian.
»Ja, aber in diesem Fall ist der Tod die geöffnete Tür«, bestätigte Diana.
»Und wie sieht dann die Lösung aus?«, hakte Emma nach.
»Wahrscheinlich brauchen wir seinen Leichnam, um die Beschwörungsformel sozusagen abzustellen«, antwortete Jace. »Außerdem wäre auch ein Hinweis darauf nützlich, wie er das Ganze arrangiert hat.«
»Die Ruinen am Ley-Linien-Knotenpunkt wurden sorgfältig durchsucht«, sagte Clary. »Aber morgen werden wir Malcolms Villa noch einmal überprüfen, nur um sicherzugehen.«
»Da liegt nur noch Schutt«, warnte Julian.
»Schutt, der bald geräumt werden muss, bevor die Irdischen irgendetwas bemerken«, sagte Diana. »Im Moment ist das Gelände durch Zauberglanz getarnt, aber der hält nicht ewig. Und das bedeutet, dass das Areal nur noch wenige Tage ungestört durchsucht werden kann.«
»Außerdem kann es nicht schaden, nochmal einen Blick darauf zu werfen«, meinte Jace. »Zumal Magnus uns einen Hinweis gegeben hat, wonach wir suchen müssen.« Er kraulte Church hinter dem Ohr, verzichtete aber auf eine weitere Erläuterung.
»Das Schwarze Buch der Toten ist ein mächtiges Nekromantieobjekt«, sagte der Perfekte Diego. »Es könnte für Unruhen und Störungen sorgen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Wenn es die Tiefsee-Meerdämonen dazu bringt, an unsere Küsten zu kriechen, bedeutet das, dass die Irdischen in Gefahr sind – ein paar sind bereits spurlos vom Pier verschwunden.«
»Also wird morgen ein Team von Zenturionen hier eintreffen«, sagte Jace.
»Zenturionen?« Panik blitzte in Julians Augen auf. Ein Ausdruck der Angst und Verwundbarkeit, den vermutlich nur sie sehen konnte, überlegte Emma. Und der im nächsten Moment wieder verschwunden war. »Warum?«
Zenturionen. Eliteschattenjäger, die an der Scholomance ausgebildet wurden – einer Schule hoch oben im Felsgestein der Karpaten, umgeben von einem zugefrorenen See. Die Zenturionen beschäftigten sich mit Geheimwissenschaften und waren Experten in Fragen der Feenwesen und des Kalten Friedens.
Und allem Anschein nach auch in Fragen der Meerdämonen.
»Das sind hervorragende Neuigkeiten«, meinte der Perfekte Diego. Natürlich musste er so etwas sagen, dachte Emma. Selbstgefällig berührte er die Anstecknadel an seiner Schulter. »Die Zenturionen werden in der Lage sein, den Leichnam und das Buch zu finden.«
»Hoffentlich«, sagte Clary.
»Aber ihr seid doch jetzt schon hier, Clary«, wandte Julian in trügerisch sanftem Ton ein. »Du und Jace … wenn ihr Simon, Isabelle, Alec und Magnus herholt, würde ich wetten, dass ihr den Leichnam sofort findet.«
Er will keine Fremden im Institut haben, dachte Emma. Leute, die sich in die Angelegenheiten der Blackthorns einmischen und mit Onkel Arthur würden reden wollen. Julian war es gelungen, die Geheimnisse des Instituts zu bewahren – trotz allem, was mit Malcolm passiert war. Und jetzt wurde das alles wieder von irgendwelchen Zenturionen bedroht.
»Clary und ich sind nur auf der Durchreise«, sagte Jace. »Wir können leider nicht bleiben und mit euch suchen, auch wenn wir das sehr gerne täten. Die Kongregation hat uns mit einer Mission beauftragt.«
»Was für eine Art von Mission?«, fragte Emma. Welcher Einsatz konnte wichtiger sein als die Suche nach dem Schwarzen Buch und die endgültige Beseitigung des Chaos, das Malcolm hinterlassen hatte?
Aber sie konnte an dem Blick, den Jace und Clary tauschten, erkennen, dass es eine Unmenge wichtigerer Dinge gab – Dinge, die sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte. Emma spürte Bitterkeit in sich aufsteigen; sie wünschte, sie wäre nur etwas älter, damit sie mit Jace und Clary auf einer Stufe stehen und ihre Geheimnisse und die der Kongregation erfahren konnte.
»Es tut mir sehr leid, aber das dürfen wir euch nicht verraten«, antwortete Clary.
»Das heißt also, dass ihr nicht einmal hier sein werdet?«, fragte Emma aufgebracht. »Während all das hier passiert und Fremde sich in unserem Institut breitmachen …«
»Emma …«, setzte Jace an, »wir wissen, dass ihr daran gewöhnt seid, hier allein und ungestört zu leben. Und dass ihr nur gegenüber Arthur Rechenschaft ablegen müsst.«
Wenn er nur wüsste. Aber das war nicht möglich.
»Der Zweck eines Instituts besteht aber nicht nur darin, die Aktivitäten des Rats zu zentralisieren«, fuhr Jace fort, »sondern auch darin, Schattenjägern in einer fremden Stadt eine Bleibe zu bieten. Dieses Institut hat fünfzig ungenutzte Zimmer. Wenn es also keinen triftigen Grund gibt, warum man die Zenturionen nicht hier unterbringen sollte …«
Die Worte hingen in der Luft. Diego blickte auf seine Hände. Obwohl er die volle Wahrheit über Arthur nicht kannte, vermutete Emma, dass er zumindest einen Verdacht hatte.
»Du kannst es uns sagen«, sagte Clary. »Wir werden die Sache streng vertraulich behandeln.«
Aber es stand Emma nicht zu, dieses Geheimnis zu lüften. Sie zwang sich, nicht zu Mark, Cristina, Diana oder Julian zu schauen, den einzigen anderen am Tisch, die wussten, wer das Institut in Wahrheit leitete. Eine Tatsache, die vor den Zenturionen verborgen bleiben musste, weil sie dazu verpflichtet wären, den Rat zu informieren.
»Onkel Arthur geht es nicht besonders gut, wie ihr vermutlich alle wisst«, sagte Julian und deutete auf den leeren Stuhl am Kopf des Tisches, wo der Institutsleiter normalerweise saß. »Ich hatte nur Sorge, dass die Zenturionen seinen Zustand verschlimmern könnten. Aber angesichts der Bedeutung ihrer Mission werden wir ihnen den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten.«
»Seit dem Dunklen Krieg hat Arthur immer wieder Phasen mit starken Kopfschmerzen und anderen Problemen, die von seinen alten Verletzungen verursacht werden«, fügte Diana hinzu. »Ich werde ihm den Rücken freihalten und zwischen ihm und den Zenturionen vermitteln, bis er sich wieder besser fühlt.«
»Es besteht wirklich kein Grund zur Sorge«, sagte Diego. »Das sind Zenturionen – disziplinierte, ordentliche Soldaten. Sie werden hier keine wilden Partys veranstalten oder unangemessene Forderungen stellen.« Er legte einen Arm um Cristina. »Ich freue mich darauf, dass du dann einige meiner Freunde kennenlernen kannst.«
Cristina erwiderte sein Lächeln. Emma schaute unwillkürlich zu Mark … ob er Cristina und Diego wieder auf diese besondere Weise ansah. Auf diese Art und Weise, bei der sie sich verwundert fragte, wie Julian es übersehen konnte. Eines Tages würde er den Blick bemerken, und das würde eine Menge unangenehmer Fragen auslösen.
Aber nicht heute: Irgendwann während der vergangenen Minuten war Mark geräuschlos aus der Bibliothek geschlüpft. Er war verschwunden.