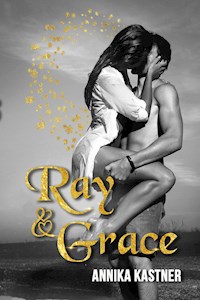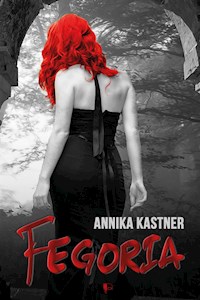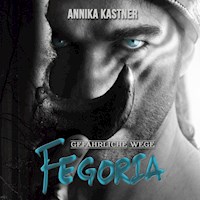Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Booklounge Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Du und ich - das ist für immer." Als die Medizinstudentin Hazel Zeugin eines Mordes wird, verändert das ihr Leben radikal, von jetzt auf gleich. Sie muss fliehen, alles und jeden hinter sich lassen. Nur wem soll sie vertrauen, wenn selbst die Polizei mit den Tätern unter einer Decke steckt? Nach langer Flucht findet sie auf einer kleinen Insel einen Unterschlupf und will nur eins: Einsamkeit, Ruhe und Abgeschiedenheit - um zu überleben. Nick genießt sein Dasein in vollen Zügen. Er liebt seinen Job als Polizist auf der kleinen Insel mitten im Meer, wo die Uhren langsamer laufen und ein ganz eigener Rhythmus waltet. Jeder kennt jeden, vor allem weiß jeder über alles Bescheid. Doch wer ist die mysteriöse Frau, die plötzlich das Haus auf den Klippen bezieht? Wie kann es sein, dass sie im Sturm sein Herz erobert, wo sie ihn doch ständig abweist? Wird er es schaffen, Hazels Vertrauen zu gewinnen? Kann sie vor ihrer Vergangenheit davonlaufen oder werden sie die Albträume, die sie jede Nacht quälen, einholen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lost Island
Ich finde dich
Roman
Annika Kastner
Booklounge Verlag
Erstausgabe im November 2020
Alle Rechte liegen beim Verlag
Copyright © November 2020
Booklounge Verlag
Johann-Boye-Str. 5
23923 Schönberg
Coverbild: @ Korionov - Can Stock Photo Inc.
978-3-947115-20-4
Inhalt
Widmung
Kapitel 1 - Hazel
Kapitel 2 - Hazel
Kapitel 3 - Nick
Kapitel 4 - Hazel
Kapitel 5 - Nick
Kapitel 6 - Hazel
Kapitel 7 - Nick
Kapitel 8 - Hazel
Kapitel 9 - Nick
Kapitel 10 - Hazel
Kapitel 11 - Nick
Kapitel 12 - Hazel
Kapitel 13 - Nick
Kapitel 14 - Hazel
Kapitel 15 - Nick
Kapitel 16 - Hazel
Kapitel 17 - Nick
Kapitel 18 - Hazel
Kapitel 19 - Nick
Kapitel 20 - Hazel
Kapitel 21 - Nick
Kapitel 22 - Hazel
Kapitel 23 - Nick
Kapitel 24 - Hazel
Kapitel 25 - Nick
Kapitel 26 - Hazel
Kapitel 27 - Nick
Kapitel 28 - Hazel
Kapitel 29 - Nick
Kapitel 30 - Hazel
Kapitel 31 - Nick
Kapitel 32 - Hazel
Kapitel 33 - Nick
Kapitel 34 - Hazel
Kapitel 35 - Nick
Kapitel 36 - Hazel
Kapitel 37 - Nick
Kapitel 38 - Hazel
Kapitel 39 - Nick
Kapitel 40 - Hazel
Nachwort
Hazel und Nick
Playlist
Die Autorin
Weitere Bücher der Autorin
Widmung
Die Geschichte von Hazel und Nick geistert schon lange in meinem Kopf herum und ich freue mich, dass sie endlich die Chance haben, euch ihre Geschichte zu erzählen.
Wie immer sind die Figuren frei erfunden. Auch die Orte und Geschehnisse, doch macht es sie nicht weniger lebendig für mich. Immer wenn ich ein Buch beende, ist es so, als würde ich guten Freunden Lebewohl sagen. Es macht mich glücklich und traurig zugleich.
An dieser Stelle ein Dankeschön an jeden einzelnen meiner Leser. Danke, dass du meine Geschichten liest, den Figuren Leben einhauchst, rezensierst und mich verlinkst – das bedeutet mir sehr viel. Ich widme dir dieses Buch, denn ohne dich würde es meine Bücher nicht geben! Außerdem meinem Mann, Philipp, und meinem Sohn, Joshua. Ich liebe euch beide sehr, Jungs. Ich glaube, es ist nicht immer einfach mit mir, wenn ich in einer Schreibphase bin, in meiner eigenen Welt herum tigere, oder von unterwegs anrufe, dass du, Philipp, mal eben schnell ein Post-it an meinen PC hängen sollst – mit Stichworten, die du eigentlich überhaupt nicht verstehst. Aber du lachst mit mir darüber und dafür liebe ich dich noch mehr.
Deine Annika
Kapitel 1 - Hazel
1 Jahr vorher
Ich lache herzhaft über Dr. Conners Witz. Er ist mit Abstand mein Lieblingskollege, denn ich mag seine freundliche, humorvolle und väterliche Art. Wobei, Kollege ist gut, eigentlich ist er mein direkter Vorgesetzter, das vergesse ich nur oft, weil es eher freundschaftlich zwischen uns zugeht. Gut gelaunt laufe ich neben ihm über den kargen Krankenhausgang, wobei unsere Schritte von den Wänden widerhallen und unsere Sohlen quietschende Geräusche verursachen.
»Haben Sie sich schon überlegt, wo Sie nach Ihrem Studium arbeiten möchten? Nicht mehr lange und Sie haben es gemeistert – mit Bravour, wie ich vermute.« Er schiebt seine leicht schief hängende Nickelbrille auf dem Nasenrücken hoch. Eine Geste, die mir ziemlich vertraut ist, weil er dies alle paar Minuten wiederholt. Seine grauen Augen, die von Lachfalten umgeben sind, schauen mich ebenso neugierig wie erwartungsvoll an. Er wartet auf eine Antwort. Das ist etwas, was ich wirklich an ihm schätze – er ist an mir als Mensch interessiert, hört gespannt zu. Etwas, was viele vor lauter Stress verlernt haben. Bei ihm fühle ich mich ernst genommen.
»Nein, ich habe noch keine Idee«, gebe ich zu, reibe mir dabei verlegen über den Nacken. Das ist nicht die Antwort, die er gerne gehabt hätte, denn er fragt mich schon zum zweiten Mal nach meinen Plänen. Ich weiß, dass ich die Antwort nicht ewig hinausschieben kann, aber was will ich überhaupt? Wo will ich mich niederlassen? Hier? Oder möchte ich noch mehr von der Welt sehen? Ich habe immer viel reisen wollen, die Erde entdecken, stattdessen bin ich seit Jahren nicht im Urlaub gewesen. Das Studium ist hart und fordert überdurchschnittlichen Einsatz, mit Unmengen an Überstunden. Irgendwie ist dadurch alles andere auf der Strecke geblieben. Bin ich bereit, gleich in die Vollen zu gehen, oder nehme ich mir eine kleine Reiseauszeit?
»Nun, es ist kein Geheimnis, dass wir hier alle sehr angetan von Ihrer Arbeit sind. Wenn Sie sich vorstellen können, zu unserem Team zu gehören, würde ich ein gutes Wort für Sie einlegen. Hazel, Sie können hier viel erreichen. Ich werde nicht jünger und Sie könnten eines Tages meine Nachfolgerin sein, wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen. Die Fähigkeiten haben Sie, was wir beide wissen.« Ich spüre, dass ich erröte. Väterlich legt Dr. Conner mir die Hand auf den Arm, nickt aufmunternd. »Nun, mein Kind, Sie werden ja ganz rot. Nehmen Sie das Lob an, Sie haben es sich verdient. Sie sind fleißig, die Kollegen und Patienten schätzen Sie sehr, auch ich schätze Sie, aber das wissen Sie.«
»Danke, Dr. Connor«, stammle ich deutlich verlegen. Ich kann einfach nicht mit Komplimenten umgehen.
Unsere Schuhe verursachen erneut ein lautes Quietschgeräusch, während wir in den nächsten Korridor einbiegen. Nachdenklich runzle ich die Stirn, als ich den leeren Gang vor uns erblicke. »Sollte der Patient nicht von einem Polizisten rund um die Uhr bewacht werden?« Dr. Conner spricht meine Gedanken aus, ehe ich selbst Gelegenheit dazu habe.
Ich blättere in meinen Unterlagen, checke die vorhandenen Notizen. »Ja, Personenbewachung. Es hat sich nichts an der Situation geändert, deswegen liegt er von den anderen Patienten isoliert. So ist es der Wunsch der Staatsanwaltschaft gewesen«, lese ich vor. Merkwürdig. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich eine Patientenbewachung durch die Polizei erlebe. Irgendwie aufregend und beängstigend zugleich. »Vielleicht ist er in einer Untersuchung, die kurzfristig angeordnet worden ist?« Ich zucke mit den Schultern, es wird schon seine Gründe haben, hat es immer. Hier werden so oft Untersuchungen festgelegt, die erst im Anschluss vermerkt werden. »Immerhin sind wir eine Stunde zu früh dran«, werfe ich noch hinterher. Es ist also nicht unmöglich.
»Oh, das wäre wirklich ärgerlich. Mary freut sich so auf unseren Hochzeitstag und dass ich etwas eher komme. Wir wollen zum Essen gehen, so richtig schick«, seufzt der Mann neben mir. Ich weiß genau, was er meint. Er macht so viele Doppelschichten, dass Mary sich sicher nach etwas extra Zeit sehnt. Der Gedanke, dass sie nach all den Jahren noch romantisch essen gehen, einander so wichtig sind, erwärmt mein Herz. Sowas wünsche ich mir auch. Jemanden, der mich liebt – in guten und schlechten Zeiten, bis ich alt, grau und faltig bin. Leider gibt es solche Verbindungen heutzutage äußerst selten, und bei der vielen Arbeit werde ich vermutlich nie jemanden kennenlernen. Noch ein Grund mehr, der fürs Reisen spricht.
Ich schiebe diese Gedanken beiseite, schaue mich um. Der Flur ist leer und still. Die Patienten sind auf andere Etagen aufgeteilt worden, damit die Polizei Übersicht über das Kommen und Gehen behält, aber jetzt gerade wirkt es gruselig, wie in einem dieser Zombie-Horrorfilme, als bricht jede Sekunde das Chaos aus. Okay, meine Fantasie geht mit mir durch, hier wird sicherlich keine Zombie-Armee durchrennen. Auf dieser Station liegt ein ehemaliges Gangmitglied eines großen Drogenringes. Er ist angeschossen und wegen Besitz illegaler Substanzen verhaftet worden. Er hat einen Deal mit der Polizei ausgehandelt, wird gegen seine Leute aussagen, um nicht ins Gefängnis zu müssen, und in den Zeugenschutz überführt. Das macht ihn allerdings zu einer Zielscheibe für seine alten Kollegen und zu einem wichtigen Zeugen für die Staatsanwaltschaft, die seit Ewigkeiten nach solch einem Glücksfall gesucht hat, um den Ring endlich zerschlagen zu können – wie im Fernsehen, wirklich verrückt. Ich bewundere seinen Mut, denn so wie ich gehört habe, ist diese Vereinigung gefährlich und skrupellos. Wie kann man sich nur auf so etwas einlassen? Es ist letztlich seine eigene Dummheit gewesen, die ihm das hier eingebrockt hat.
»Nun, dann sehen wir doch einfach nach.« Dr. Connor drückt die Türklinke hinunter und tritt vor mir ins Zimmer ein. Ich stolpere über meine eigenen Füße, wobei mein Kugelschreiber vom Klemmbrett rutscht, anschließend klimpernd zu Boden fällt. Während ich mich bücke, höre ich den Oberarzt überrascht rufen: »Was ist hier …«, doch weiter kommt er nicht, verstummt plötzlich. Ich vernehme ein leises Zischen, etwas Feuchtes benetzt mein Gesicht. Ich richte mich automatisch auf, starre ins Zimmer unseres Patienten. Ein weiteres Zischen erklingt, wonach mein väterlicher Kollege vor mir zu Boden geht. Seine Augen blicken mir leer entgegen, in seiner Stirn prangt ein Loch, aus dem Blut auf den Boden rinnt. Mein Herz bleibt gefühlt stehen, als ich den Krater in seinem Kopf sehe. Ich verstehe nicht, was ich da gerade erblicke oder was passiert ist. Warum …? Was …? Ich wische mir über das Gesicht, schaue meine Finger an. Sie sind rot – von seinem Blut, welches mir ins Gesicht gespritzt ist. Kälte und Angst breitet sich in Wellen in mir aus, als langsam durchsickert, dass Dr. Connor mit einer Kugel im Kopf vor mir liegt. Er ist tot, versuche ich das Bild, welches sich mir bietet, zu verstehen, wische mir abermals über die Wangen und reibe mein Gesicht. Blut, sein Blut. Mein Herz schlägt wieder, hämmert nun wild gegen meine Brust. Es sind erst wenige Sekunden vergangen, seit er vor mir zusammengesackt ist, für mich fühlt es sich jedoch wie Stunden an. Die Zeit scheint langsamer zu laufen. Ich schaue schleppend hoch, sehe nun den Polizisten, der den Zeugen bewachen sollte, an dessen Kopfende verharren, mit der Waffenmündung auf mich gerichtet. Mein Gehirn steht unter Schock, kann die Situation nicht richtig erfassen, aber weiß, hier läuft etwas falsch. Unsere Blicke treffen sich für eine Sekunde, seine Visage brennt sich in meinen Schädel ein. Das blutige Bild dessen, was er angerichtet hat, ebenfalls.
Dunkles Rot besudelt das ehemals weiße Laken, der Zeuge blickt mich aus ebenso leeren Augen an, wie der gutmütige Dr. Connor, dessen Lachen ich nie wieder hören werde und dessen Frau heute vergeblich auf ihn warten wird. Ich versuche, all das zu begreifen, doch mein Kopf spielt nicht mit – ich verliere dadurch wertvolle Sekunden. Der Polizist visiert mich an, lächelt leicht, was nicht zu dem Drumherum, welches sich mir offenbart, passt. Ich folge seinen Bewegungen mit den Augen. Dann setzt mein Verstand endlich wieder ein, Adrenalin durchflutet meinen Körper. Nein, ich werde hier nicht sterben. Niemals. Überlebenswille packt mich: Ich schleudere ihm mein Klemmbrett mit Schwung entgegen, denn es ist das Einzige, was ich gerade habe, um mich zu schützen. Er hebt den Arm, will es abwenden, und drückt gleichzeitig ab. Die Kugel streift meinen linken Oberarm. Ich schreie heiser auf, merke den Schmerz aber kaum, zu sehr bin ich mit Adrenalin vollgepumpt. Das Klemmbrett landet polternd auf dem Boden, woraufhin ich die Gunst der Stunde nutze, herumwirbele und meine Beine in die Hand nehme, denn ich muss hier raus – und zwar sofort. Wenn ich leben will, was ich definitiv möchte, sollte ich hier weg. So schnell es geht.
Meine Füße setzen sich wie von selbst in Bewegung, fliegen förmlich über den Boden, Schmerzen spüre ich noch immer keine. Mein Körper hat die Kontrolle übernommen, hilft mir, alles zu geben. Ich höre Schritte hinter mir, und ein leises Fluchen, doch ich bin schneller, nutze den Vorsprung, den ich mir erarbeitet habe. Schon immer bin ich eine gute Läuferin gewesen, eine sehr gute sogar. Auch wenn ich lange nicht mehr beim Training gewesen bin, meine Muskeln haben es nicht vergessen. Ich reiße einen Medikamentenwagen, der verlassen im Gang steht, um. Scheppernd verteilen sich die kleinen Dosen und Flaschen hinter mir auf dem Boden, wodurch ich ihm für einige Sekunden den Weg versperre und mir mehr Puffer verschaffe.
Eine weitere Kugel fliegt an mir vorbei. Ich schreie auf, als sie die Wand links neben mir trifft und sich dort in den Putz bohrt. Ich schlage einen Haken wie ein Hase, versuche dabei, ihm kein gutes Ziel zu sein. Der Mann hinter mir flucht nun laut und ungehalten, tritt obendrein den Medikamentenwagen aus dem Weg. Schlitternd bliebe ich an einer Tür zu einem der verlassenen Patientenzimmer stehen, renne hinein und werfe sie mit einem lauten Knall hinter mir zu. Erst mal aus dem Schussfeld sein, das ist gut.
»Oh Gott«, flüstere ich schluchzend, sperre mit zitternden Fingern die Tür ab. Jeder von uns hat einen Generalschlüssel, den ich zuvor nie benutzt habe, aber es gibt schließlich für alles ein erstes Mal. Konzentriere dich, herrsche ich mich selbst an und endlich dreht sich der verdammte Schlüssel im Schloss. Langsam entferne ich mich von der Tür, mein Brustkorb hebt und senkt sich hektisch, mein Herz hüpft mir fast aus der Brust.
Nur wenige Sekunden später trommelt es laut gegen die Tür, lässt sie in den Angeln erzittern, woraufhin ich einen weiteren Satz nach hinten mache. Die Klinke wird hoch und runter gedrückt, Tränen vernebeln mir die Sicht. Das kann nicht wahr sein. Das ist ein Albtraum! Bitte, flehe ich, lass mich aufwachen, doch leider ist es kein Traum. Es ist bittere Realität und ich sitze fest. Ich muss einen Ausweg finden. Meine Taschen sind leer, mein Handy steckt zum Aufladen im Schwesternzimmer an der Steckdose. Die Telefone im Zimmer sind abgestellt. »Bitte nicht«, flüstere ich erstickt, trete weiter nach hinten, bis mein Rücken die kalte Wand trifft. Ich sinke daran hinab, begebe mich in die Hocke, fahre mir mit beiden Händen über das Gesicht. Warum kommt denn niemand? Jemand wird meine Schreie gehört haben. Es muss mir doch jemand helfen. Dr. Conner, er …
»Mach diese beschissene Tür auf«, flucht mein Verfolger auf der anderen Seite. »Dir wird niemand glauben, Miststück. Niemand, hörst du? Wir machen dich fertig. Ich bin Polizist. Wir haben überall Männer. Ich werde dich töten oder ihnen weismachen, dass du mit uns unter einer Decke steckst. Hörst du? Dein Wort gegen meins. Du bist so oder so tot«, zischt er. Ich höre die Wut in seiner Stimme, glaube ihm jedes Wort. Sie alle sind gefährlich, er gehört zu der Gang. Sie haben die Polizei unterwandert und wer weiß, wen noch. Ich werde schneller tot sein, als ich aussagen kann – da hat er recht. Wenn nicht er, wird jemand anderes dafür sorgen, sollte ich hier rauskommen. Wenn jemand wie er hilft, wem soll ich dann trauen? Wem kann ich überhaupt trauen? Das erschüttert mich bis in die tiefsten Winkel meines Verstandes. Ich will keineswegs sterben.
Blut rauscht durch meine Ohren. Ich habe das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen, zerre an meinem Kragen, um mir Platz zu erzwingen. Eine Panikattacke, ich kenne jedes Symptom, nur hilft mir dieses Wissen gerade nicht. Mein Versuch, ruhig und gleichmäßig zu atmen, gelingt mehr schlecht als recht. Du musst nachdenken, ermahne ich mich selbst, während ich mich hochstemme und mich, auf der Suche nach einem Ausweg, im Kreis drehe. Mein panischer Blick bleibt am Fenster hängen, als er sich abermals gegen die Tür wirft. Lange wird sie nicht mehr halten, das Holz splittert bereits.
Mit wild klopfendem Herzen und zittrigen Fingern öffne ich das Fenster, schaue hinab zu Boden. Alles läuft wie in einem Film ab – handeln oder kampflos aufgeben. Ich muss wählen. Erste Etage, das kann ich packen. Die Zimmer auf dieser Seite liegen mit den Fenstern zum Wald. Ich muss es nur bis dahin schaffen. Springen und laufen, dabei hoffen, dass mir beim Sturz nichts passiert. Das klingt nach einem akzeptablen Plan. Was habe ich auch für eine Alternative? Hierbleiben und resignieren? Lieber breche ich mir, bei dem Versuch mein Leben zu retten, den Hals, als es ihm so leicht zu machen.
Während die Tür hinter mir langsam nachgibt, steige ich aufs Fensterbrett, wobei meine Beine sich wie Pudding anfühlen. Ich schaffe das, ich werde es schaffen, feure ich mich wie in einem Mantra an. Ich schiebe meine Beine über das Fensterbrett, hangle mich vorsichtig hinab. Als ich mich hängenlasse, rutschen meine Hände plötzlich ab. Meine Muskeln sind nicht stark genug, um mich lange zu halten – ich zittere wie verrückt. Mit einem erstickten Schrei falle ich in die Tiefe, ehe ich bereit gewesen bin. Der Aufprall dringt schmerzhaft durch meinen ganzen Körper, meine Beine knicken unter mir weg, sodass ich komplett im Rosenbusch lande. Verdammt, es tut so unglaublich weh. Äste sowie kleine Dornen stechen mir in die Haut, reißen an mir, erschweren mir zusätzlich die Flucht, doch Adrenalin durchflutet mich erneut, pusht meinen Körper. Also rapple ich mich stöhnend auf, befreie mich aus dem Gestrüpp, renne dann – so schnell ich kann – in den Schutz der Bäume. Ich ignoriere meinen pochenden Körper, die schmerzenden Beine und meine Lunge, die höllisch brennt. Mein Leben wird nie wieder das gleiche sein. Tränen vernebeln mir die Sicht, als ich in die Tiefen des Blätterwerks eintauche und es mich vor Blicken verbirgt.
Er hat sie erschossen. Sie beide. Er wird mich töten, wenn er mich in die Hände bekommt. Er darf mich nicht finden, niemand darf das, denn keiner wird mir glauben – ich kann ja selbst kaum begreifen, dass das wirklich passiert ist. Oh mein Gott. Er sollte ihn beschützen. Beschützen! Er ist Polizist und dafür da, Menschen vor den Bösen zu bewahren. Nun sind sie alle tot, ich werde die Nächste auf seiner Liste sein.
Kapitel 2 - Hazel
Müde schenke ich mir ein Glas Weißwein ein, trete damit hinaus in den Garten, der vom Licht der untergehenden Sonne in sanftes Rot getaucht worden ist. Wind spielt mit meinen Haaren und ich schaue mich um. Mein Garten, meiner. Das Gefühl, dass dieses Fleckchen mir gehört, ist unbeschreiblich. Ich lasse mir das Wort auf der Zunge zergehen. Meins! Etwas, das mir gehört, nach so langer Zeit – das gefällt mir. Es klingt so normal, wobei normal etwas ist, was mir seit einem Jahr fremd erscheint. Also genieße ich den Augenblick, bleibe stehen, mustere alles genau. Ich schaue, ob irgendwas, was zu meiner normalen Routine gehört, ungewöhnlich ist. Ich bin immer auf der Hut. Mir fällt nichts auf. Alles ist genauso, wie es sein muss, doch das Gefühl der Furcht ist allgegenwärtig. Wie eine zweite Haut ist es ein Teil von mir geworden, welche sich nicht abstreifen lässt, was auch gut ist, denn es macht mich vorsichtiger. Misstrauen und Achtsamkeit bestimmen mein Leben, mein Fortdauern, um genau zu sein. Im Überleben bin ich mittlerweile eine Meisterin. Alles ist ruhig, demnach atme ich erleichtert ein, lasse mich auf einem der Holzstühle nieder, die ich im Onlinehandel unter einem falschen Namen bestellt habe, denn mein altes Ich ist an jenem Tag mit Dr. Conner gestorben. Meine Beine lege ich auf dem Stuhl ab, der mir gegenübersteht, woraufhin ein zufriedenes Seufzen meinem Mund entfährt. Meins! Wann habe ich mir zuletzt solchen Luxus gegönnt, etwas wirklich meins zu nennen oder an eine richtige Zukunft zu denken? Ein waghalsiger Gedanke.
Ein Jahr auf der Flucht hat vieles verändert, aus mir eine andere Person gemacht. Kaum sitze ich tiefenentspannt da, legt Storm ihren großen Kopf auf meinen Schoß. Meine Mundwinkel heben sich zu einem Lächeln. Sachte streiche ich meinem Hund über das weiche Fell, genieße die Nähe, jenes Wissens, dass ich trotz allem nicht alleine bin. Nicht mehr. Seit ich sie vor elf Monaten in mein Leben gelassen habe, gibt Storm mir ein Gefühl der Sicherheit. Sie ist eine Kämpferin und genau wie ich eine Überlebende. Exakt einen Monat, nachdem ich mein altes Leben hinter mir lassen hab müssen, haben wir uns getroffen.
Ich presse die Lippen zusammen. Ungern denke ich darüber nach, was ich verloren habe. Noch viel weniger an diesen speziellen Tag, der Auslöser für all das gewesen ist. Die furchtbarsten Stunden meines Daseins. Der Tag, an dem ich meine Freunde, meine Existenz und mein Leben verloren habe, nur weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen bin. Was ich hingegen seit zwölf Monaten nicht verloren habe, ist die Angst. Sie sitzt wie ein Schatten in meinem Nacken, verhöhnt und ermahnt mich zu gleichen Teilen. Aber ist es nicht besser, in Angst zu leben, als tot zu sein wie Dr. Connor? Manchmal weiß ich die Antwort nicht. Je nachdem, wie der Tag gewesen ist, oder in welchem schäbigen Motel ich gerade aufgewacht bin. Es hat Tage in diesem Jahr gegeben, an denen ist es definitiv verlockender gewesen, tot zu sein. Ich bin nie der ängstliche Typ gewesen – und jetzt? Der kleinste Schatten jagt mir schreckliche Furcht ein, ich hasse es. Hilflos … So kenne ich mich nicht. Im Gegenteil. Ich bin immer stolz darauf gewesen, so eigenständig zu sein. Ich habe alles im Griff gehabt, bin dabei gewesen, erfolgreich durchzustarten. Würden meine Freunde mich überhaupt wiedererkennen? Ich, die einst für jeden Spaß zu haben gewesen ist, versteckt sich nun am liebsten in ihrem Haus. Türen und Fenster fest verschlossen. Es widerstrebt mir ja selbst, aber was soll ich tun, wenn die Furcht größer ist? Ich weiß, dass ich mich in einem Trauma befinde, doch der Schuldige ist auf freiem Fuß und ich bin nicht bereit, zu sterben. Ich kann kaum zu einem Arzt gehen, ohne zu viel preiszugeben. Wie soll ich das also verarbeiten? Nein, er würde mich finden, denn ich weiß nicht, wer noch alles auf der Gehaltsliste dieser Organisation steht. Früher bin ich auf die Menschen zugegangen, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Ich bin gesellig gewesen, kommunikativ, und habe Spaß am Leben gehabt, es genossen. Heute nehme ich die Beine in die Hand, wenn mir jemand zu nahekommt. Allein, aber sicher, denn ich kann niemanden trauen. Woher soll ich letztlich wissen, wer zu ihnen gehört und dass man mich nicht hinterrücks verrät? Ich habe meine Konten über Nacht online aufgelöst, alles, was ins Auto gepasst hat, mitgenommen und dann bin ich innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Jeglichen Kram, der mir in die Finger gekommen ist, habe ich zu Geld gemacht, um mich über Wasser zu halten. Das Gute an meinem vorherigen Lebensstil ist gewesen, dass ich durch das Studium sehr sparsam gewesen bin. Da kommt einiges zusammen, auch das Erbe meiner Eltern. Mit diesem Geld bin ich vor dem, was ich gesehen habe und vor dem Mann, der Dr. Connor und ebenso unseren Patienten kaltblütig ermordet hat, geflohen. Niemand wird mir das je glauben. Wem soll ich vertrauen, wenn sogar die Polizei korrupt ist? Ich habe immer gedacht, so etwas passiert nur in Filmen. Filme, die ich früher gerne gesehen habe wohlgemerkt, weil ich es für pure Fiktion und nicht für die Realität gehalten habe. Jetzt, wo ich selbst mitten in einem stecke, brauche ich solche Filme nicht mehr. Mir ist auch bewusst, dass nicht alle Polizisten so sind, aber wie soll ich die Guten von den Bösen unterscheiden? Sie haben wohl kaum ein Zettel auf der Stirn kleben, der mir dabei helfen wird. Ich weiß, dass sie nach mir suchen. Es ist überall in den Nachrichten gewesen, auf jedem Sender und in jeder Zeitung des Landes. Sie suchen mich als wichtige Zeugin, erhoffen sich Details, was an jenem Tag geschehen ist. Details, die nur ich ihnen liefern kann, aber nicht werde. Sie wissen, dass ich etwas gesehen habe. Warum bin ich sonst verschwunden? Es wird spekuliert, ob ich zu der Gang gehöre, ein Opfer oder bereits tot bin, vergraben an einem unbekannten Ort. Sollen sie das ruhig denken. Nur er weiß, dass ich es nicht bin, denn niemand außer ihm hat das Interesse, mich tot zu sehen – ich weiß schließlich, wer er ist. Ich habe ihn im Fernsehen erkannt, heuchelnd und schuldbewusst gestanden, dass er kurz auf der Toilette gewesen ist. Lügner. Seine versteckte Botschaft an mich, wie er laut und deutlich zu der Presse gesagt hat: »Sollte sie noch leben, werde ich sie finden.« Ich weiß, er wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Dann wird er vor meiner Tür stehen, um mich zu holen. Aber ich bin nicht dumm und versuche, Fehler zu vermeiden. Bis zum heutigen Tag bin ich darin sehr erfolgreich. Dass ich noch lebe, ist der beste Beweis, oder? Schwachstellen kann ich nicht riskieren, dafür lebe ich, wie gesagt, zu gerne. Selbst in Angst. Außerdem zählt Storm auf mich.
Ich blicke meinem Hund in seine braunen Augen, die mir treu entgegen schauen. Ja, ich werde gebraucht – ein schönes Gefühl. Ebenso, dass wir hier vorerst ein Zuhause haben. Zum ersten Mal seit dieser langen Zeit gönne ich mir dieses Stückchen Zuflucht und ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass mein Leben nicht immer so aussehen wird wie die letzten Monate, erreicht mich. Wer soll mich hier schon finden? Die Insel ist winzig. Zum Glück ist die Miete für das Haus spottbillig. Vermutlich, weil es klein ist, aber für mich ausreichend. Ich brauche nichts Großes oder Auffälliges. Stattdessen habe ich nach einem Ort gesucht, der abgelegen und sich weit weg befindet. Hier habe ich ihn gefunden. Eine kleine Insel mit wenigen Einwohnern, abgeschottet von der restlichen Welt. Die Uhren scheinen hier langsamer zu laufen, als auf der verbleibenden Welt. Hinzu kommt, dass ich die Miete bar zahlen kann, solange ich dem jeden Monat pünktlich nachkomme.
Meine Gedanken schwirren wild hin und her. Jetzt, wo ich den Schlüssel im Schloss zu der Tür mit den Erinnerungen in meinem Kopf geöffnet habe, rauschen die Bilder nur so heraus. Ich schlucke den Kloß in meinem Hals runter, spüle mit einem Schluck Wein nach. Dr. Conners kalte Augen verfolgen mich jede Nacht in meinen Träumen. Ich habe das Gefühl, ihn durch meine Flucht zu verraten. Mary wird wissen wollen, was passiert ist, sie hat das Recht dazu, die Wahrheit zu kennen. Ich würde es an ihrer Stelle auch erfahren wollen, doch diesen Gefallen kann ich ihr nicht tun, geschweige denn, mein Beileid bekunden. Vor seinen Blicken in meinen Träumen bin ich machtlos, davor kann ich nicht weglaufen. Ein so gutmütiger Mann und dann dieser schreckliche Tod. Er hat es keinesfalls verdient, niemand hat das. So sehr ich versuche, die Bilder zu verdrängen, desto präsenter sind sie.
All das Geld, was für mein Studium bestimmt gewesen ist, ebenso all das Geld, was meine Eltern mir vererbt haben und das, was ich mir selbst zur Seite gelegt habe – es wird einige Zeit reichen, danach sehe ich weiter. Ich werde Gras über die Sache wachsen lassen, ehe ich mir vielleicht einen Job suche. Ein bis zwei Jahre kann ich so durchhalten, wenn ich sparsam bleibe. Ich habe mein altes Auto verkauft, an Menschen, die sich nicht mit Papieren aufhalten, und mir einen neuen Wagen angeschafft, von denselben Leuten, zusammen mit einem neuen Namen. Aus Hazel Summer ist Hazel Smith geworden. Ich weiß, es ist riskant, Hazel zu behalten, aber außer meinem Vornamen ist mir nichts geblieben.
Meine damals dunkelrot gefärbten Haare, sind heute naturblond, zudem viel länger als früher. Aus dem modischen Bob ist jetzt eine lange Mähne geworden, die weit über meinen Rücken hinabfällt. Manchmal erkenne ich mich selbst kaum wieder und doch bin es irgendwie immer noch ich. Wie kann ich mir so fremd sein?
Ich bin bis auf diese kleine Insel geflüchtet, hier kann ich für mich sein. Nur zum Einkaufen muss ich mein Grund und Boden verlassen. Seit drei Wochen bin ich jetzt hier, hoffe, dass ich mich irgendwann heimisch fühlen und mir wieder ein wenig mehr Leben aufbauen kann. Es ist so schwer gewesen, etwas zu finden, wo ich mich auch nur ansatzweise sicher fühle. Sicher? Lachhaft. Aber hier, Meilen um Meilen von dem Ort meiner Albträume entfernt, schaffe ich es möglicherweise, ein wenig zu mir selbst zu finden. Storm und ich. Du bist nicht alleine, erinnere ich mich. Mit einem müden Lächeln proste ich Storm zu: »Wir beide meistern das!« Er hebt den Kopf von meinen Beinen an, legt ihn schief zur Seite. Seine treuen Augen mustern mich aufmerksam. Was meine Grandma wohl macht? Sie fehlt mir am meisten, immerhin ist sie meine alleinige noch lebende Verwandte. Einzig durch mein Verschwinden ist sie ebenfalls in Sicherheit. Das ist alles, was zählt, egal wie sehr sie mir fehlt. Storm brummt, stupst mir mit der Nase auffordernd ans Bein. »Du hast schon wieder Hunger, was?« Er dreht sich aufgeregt im Kreis, woraufhin ich kichern muss. »Okay, verstanden.«
Motiviert stehe ich auf. Ab jetzt wird alles anders, und damit fange ich direkt an – ich werde mal wieder etwas Leckeres für mich kochen. Meine Kleidung ist viel weiter geworden, zu weit. Kummer und Angst haben mir den Appetit genommen. Das Essen an den Raststätten hat den Rest dazu beigetragen. Kummer schlägt mir auf den Magen, seit eh und je. Das liegt jetzt hinter mir, erinnere ich mich abermals. Ich trinke den Rest Wein auf Ex, nehme das leere Glas mit in die Küche, die schon bald nach frischen Kräutern, Knoblauch und Tomatensauce duftet. Meine Vorräte, die ich mitgebracht habe, gehen langsam zu Neige, also werde ich in absehbarer Zeit über meinen Schatten springen müssen und das erste Mal den Supermarkt der kleinen Insel aufsuchen. Das wird wohl mein größter Test werden: Einkaufen gehen wie jeder normale Mensch, auch wenn es mir Unbehagen beschert. Keine große Sache, das kann ich schaffen, denke ich, während ich eine Kerze anzünde und mich an den Tisch setze. »Willkommen in deinem neuen Leben«, murmle ich, ehe ich es mir schmecken lasse.
Vogelgezwitscher weckt mich am nächsten Morgen, während ein paar Sonnenstrahlen vorwitzig durch die Rollläden scheinen, dem Boden so ein neues Muster verpassen. Gähnend schaue ich zum Wecker, halte überrascht inne. Es ist fast neun Uhr. Wow, wenn das mal kein gutes Zeichen ist! Sonst wache ich immer viel früher auf. Wenn die Träume mich quälen, ist an weiterschlafen nicht zu denken, aber so spät? Wahnsinn. Ich fühle mich sogar ziemlich ausgeruht und erfrischt. Was ein Gläschen Wein und gutes Essen so bewirken kann! Ich strecke mich, genieße das Ziehen meiner Muskeln, schaue neben das Bett. Feixend mustere ich meinen Hund, der auf dem Rücken liegt, alle Viere von sich gestreckt und leise schnarchend. Dieser Anblick ist herzerwärmend, entlockt mir jeden Tag aufs Neue ein Lächeln.
»So ein Wachhund«, murmle ich mit erhobenen Mundwinkeln, schleiche kopfschüttelnd aus dem Zimmer, um Storm nicht zu wecken. Dieser Hund ist die reinste Schnarchnase – vermutlich gibt es ein Faultier unter seinen Ahnen. Aber er passt zu mir, sein Leben ist genauso hart gewesen wie meins. Er ist ein Kämpfer. Ich habe ihn in einem Straßengraben gefunden. Ein kleines dreckiges Häufchen Elend, welches zu stark zum Sterben gewesen ist. Seine Geschwister haben es nicht geschafft, nur er hat überlebt – vergessen vom Rest der Welt, weggeworfen in einer Kiste, zurückgelassen und nicht gewollt. Er trägt Spuren und Narben wie ich. Innerlich sowie äußerlich, denn ihm fehlt ein halbes Ohr, für mich ist er jedoch perfekt. Als ich ihn angesehen habe, ist mir sofort klar gewesen, er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Das Schicksal hat gewollt, dass wir uns finden und uns gegenseitig helfen, zu überleben. Vielleicht ist es albern, ans Schicksal zu glauben, mag sein, aber ich will nicht für immer einsam bleiben. Storm gibt mir das Gefühl, nicht mehr allein sein zu müssen, er ist meine neue Familie. Vor allem liebt er mich, wie ich bin.
Tiefe Trauer überkommt mich, als ich an meine Freunde und meine Großmutter denke. An Silvi, meine beste Freundin, die hochschwanger gewesen ist, als ich verschwunden bin. Ich werde ihr Kind nie kennenlernen, dabei sollte ich die Patentante werden. Das ist nun ein anderes Leben. Ich unterdrücke die Tränen, beginne damit, mir Frühstück zu machen. Nacheinander schlage ich die Eier in eine Schüssel, füge Vollkornmehl hinzu und etwas Milch, einen Hauch Vanille und eine Messerspitze Backpulver, ehe ich langsam Pfannkuchen in der gusseisernen Pfanne ausbacke. Der Duft lässt meinen Magen knurren, mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, und hellt die trüben Gedanken auf. Nicht daran denken, sage ich mir immer wieder. Neues Leben! Nicht daran denken, denn das macht alles viel unerträglicher. Eine Devise, die ich wiederhole, um sie zu festigen.
Ich höre Krallen über das Laminat kratzen, gähnend trottet mein Hund in die Küche, als hat er geahnt, dass mir gerade die Decke auf den Kopf zu fallen droht. »Hallo, Schlafmütze.« Ich stelle Storm das Futter hin, woraufhin er wie ein ausgehungerter Löwe, der seit Wochen nichts gefressen hat, darüber herfällt. Ich lasse mich auf dem Küchenstuhl nieder, bestreue einen der Pfannkuchen mit Zucker, ehe ich genüsslich hineinbeiße. Verdammt, wie lecker! Ich bin ein Pfannkuchen-Junkie. »Was hältst du davon, wenn wir nach dem Frühstück zum Strand gehen?«
Storm hebt kurz seinen Kopf, sein Ohr wackelt. Ein kleines »Wuff« entfährt ihm, was ich als Zustimmung werte. Immerhin wohne in nun auf einer Insel, das sollte ich genießen, solange es geht.
Kapitel 3 - Nick
Ich liebe freie Tage. Was gibt es besseres, als auszuschlafen, dazu das Wissen, dass man den lieben langen Tag das machen kann, worauf man Lust hat? Ich genieße die Morgensonne, gepaart mit der frischen Brise, die mir entgegenweht, während ich am Strand durch den Sand jogge. Meine Füße versinken dabei im weichen Sand, während meine Schuhe an meinem Hals hin und her baumeln. Es ist anstrengender hier zu laufen als auf der Straße, aber ich liebe das Meer, die unendliche Weite. Ein Grund, wieso ich nach meiner Ausbildung und meinem Dienst auf dem Festland wieder hierher zurückgekommen bin. Ich liebe diese Insel, jedenfalls jetzt.
Früher, als ich jünger gewesen bin, habe ich weit weg gewollt – viel erleben, Partys feiern, bloß nie mehr zurückkommen. Und jetzt? Jahre später sind wir fast alle wieder hier und glücklich damit. Wir haben gemerkt, was uns die Insel gibt – wie groß der Zusammenhalt ist, wie viel so etwas wert ist. Draußen auf dem Festland bist du ein namenloser Fremder, du kannst dich auf niemanden verlassen, zumindest nicht so wie auf diesem winzigen Fleckchen. Hier hält man zusammen! Leider mischt sich auch die halbe Insel in dein Leben ein, doch sie stehen dir ebenso bei. Selten ziehen Fremde her, was den meisten Einheimischen so gefällt. Nicht, dass wir ungesellig wären, im Gegenteil, dennoch schätzen wir unsere Ruhe. Der eine oder andere findet einen Partner auf dem Festland, das schon, aber so richtig neue Bewohner sind eine Seltenheit – abgesehen von den Sommertouristen.
Ich bin gerade von einem vierwöchigen Lehrgang in der Stadt zurück, und verdammte Scheiße, das Meer hat mir gefehlt. Der salzige Geruch, das Schreien der Möwen, das Rauschen der Wellen. All das vermittelt mir das Gefühl von Freiheit und Ruhe wie sonst nichts auf dieser Welt. Der Strand ist ausgestorben, denn es ist keine Touristenzeit mehr. Der Hochsommer ist vorbei, die Saison neigt sich dem Ende zu. Die paar Touris, die sich hier noch tummeln, sind nicht der Rede wert. Es gibt immer vereinzelte Ganzjahrestouristen, die lieber im Herbst und Winter am Meer sind, harte Fischer, Senioren, die eine oder andere Familie, aber das ist nur eine Handvoll. Endlich gehört der Strand wieder uns, Ruhe kehrt mit dem Herbst ein. Es hat Vor- und Nachteile, wenn Touristen kommen, wie eben alles im Leben. Man lernt interessante Menschen kennen, doch sie verstopfen das Dorf und den Strand. Diebstähle, Schlägereien, all das sind Dinge, mit denen wir meist nur in der Saison zu kämpfen haben. Ebenso der Müll, der oftmals achtlos liegen gelassen wird und den wir Einheimischen beseitigen, weil wir unsere Insel lieben. Manchmal ist es auch etwas langweilig, wenn die Saison zu Ende geht – man kann eben nicht alles haben. Sollte es mir doch irgendwann zu öde werden, was ich bezweifle, steht mir die Welt offen, doch bis es so weit ist, genieße ich das Meer und die Geselligkeit.
Ich bin so in meinen Gedanken versunken, dass ich nicht merke, wie ein weißer Blitz auf mich zugeschossen kommt. Hinzu fliegt ein kleines rotes Ding an meiner Nase vorbei, sodass ich stoppen muss, und obendrein in ein Loch trete, weil ich abgelenkt bin. Ich taumle. Eine Sekunde später werden meine Beine gerammt und ich kann nichts mehr unternehmen, um den Sturz zu verhindern. Meine Arme rudern, auf der Suche nach Gleichgewicht, wild in der Luft herum. Ich rolle mich geübt am Boden ab, bekomme allerdings eine Ladung Sand ins Gesicht, während ich einen Purzelbaum schlage. Wütend spucke ich die Körner aus, trotzdem knirscht es in meinem Mund, als ich genervt die Zähne aufeinanderbeiße.
Ich schaue nach rechts, um zu erfahren, was mich gerade mit Gewalt umgerissen hat, entdecke dabei einen Dalmatiner, der voller Freude in die Fluten springt, um nach einem roten Ball zu schnappen, der mir zuvor knapp an der Nase vorbeigeflogen ist. Empört stehe ich auf, klopfe mir dabei zornig den Sand von der Hose und meinem T-Shirt. Immer diese Hundebesitzer, die keine Kontrolle über ihre Tiere haben. Es muss ein Touri sein, der Hund kommt mir nicht bekannt vor und wie gesagt, hier kennt jeder jeden, selbst jeden verdammten Hund. Wäre ich im Dienst, dürfte diese rücksichtslose Person ein fettes Bußgeld abdrücken. Und was für eins, der würde sich grün und blau ärgern. Diese Touris, die denken, sie können machen, was sie wollen. Das kommt auf meine Nachteilliste, so viel ist klar. Na, warte!
Aufgebracht drehe ich mich um, erstarre augenblicklich, als ich mich Nase an Nase mit einer wirklich niedlichen Blondine wiederfinde. Na ja, Nase an Nase kann man nicht sagen, denn sie ist winzig. Ich muss ziemlich weit nach unten schauen, um in ihre Augen, die wunderschön sind, zu blicken – ein tiefes Braun, was mir eine Gänsehaut beschert.
»Oh mein Gott, sind Sie verletzt? Es tut mir so leid. Ich bin in Gedanken gewesen und hätte besser aufpassen müssen, wohin ich werfe. Storm ist wie ein Rammbock. Alles was zwischen ihm und seinen Ball kommt, wird mitleidslos weggefegt. Oje, Sie bluten. Ich … ich … Warten Sie, ich schau mir das an.«
Ehe ich auch nur einen Ton sagen kann, geht sie vor mir in die Hocke und ich folge ihr sprachlos mit den Augen, während sie beginnt, mich mit geschickten Fingern abzutasten, und mir dabei sehr nahekommt. Hitze steigt in mir auf, ob ich will oder nicht. Ein Prickeln breitet sich genau dort aus, wo sie mich berührt. Diese Frau haut mich total um – im wahrsten Sinne des Wortes. Erst rennt ihr Hund mich über den Haufen, dann redet sie ohne Punkt und Komma, ohne Luft holen zu müssen, auf mich ein und tastet mich zudem ohne Scham ab. Das überfordert mich gerade. Sie schaut so schuldbewusst aus ihren langen Wimpern nach oben, dass meine Wut verpufft, ehe sie sich den Anschiss ihres Lebens anhören muss – dabei wäre ich so gut in Fahrt gewesen. Sie nagt an ihrer Unterlippe, zieht sie zwischen die Zähne und tastet mein Knie gewissenhaft ab, welches eine leichte Schürfwunde aufweist. Dieser Kratzer ist ein Hauch von nichts, ich habe weitaus Schlimmeres erlebt. Aber … Irgendwie möchte ich sie noch schmoren lassen. Wie sie so an ihrer Lippe saugt, vor mir auf den Knien, weckt verdammt schmutzige Gedanken in mir. Ich muss dringend etwas Abstand schaffen, um mich zu ordnen, und zwar schnellstmöglich.
»Das wird mich nicht umbringen«, schmunzle ich doch achselzuckend, trete einen großen Schritt zurück, atme tief ein, sehr tief. Aus Reflex fahre ich mir durchs Haar, mustere mein Gegenüber abermals, versuche ganz automatisch, mir ein Bild von ihr zu verschaffen. Ich analysiere, würde meine Schwester jetzt behaupten und sie hätte recht, das liegt wohl an meinem Beruf. Auf dem zweiten Blick entdecke ich dabei einige vorwitzige Sommersprossen auf ihrer Stupsnase. Ich habe eine Schwäche für Sommersprossen, ehrlich. Sie zuckt bei meinen Worten, was ich allerdings nicht sinnvoll deuten kann. Ihre braunen Augen blicken mich nervös an, mustert mich eindringlich, fast ängstlich, und sie nestelt an der Leine in ihren Händen herum. Sie weicht meinem Blick schnell wieder aus, lässt ihr Haar vor das Gesicht fallen, als will sie sich vor mir verstecken. Das ist keine normale Reaktion oder ist sie einfach nur schüchtern? Nein, das passt nicht zusammen. Verwundert halte ich inne, doch sie steht bereits auf, klopft sich ebenfalls den losen Sand von ihren nackten wohlgeformten Beinen. Ich nehme mir einen Moment, genieße den Anblick, der sich mir bietet. Sie scheint keines der Beachbunnys zu sein, wie wir die Sonnenanbeterinnen nennen, die im Sommer den Strand bevölkern, denn ihre Haut ist so dermaßen blass, als hätte sie eine lange Zeit keine Sonne gesehen. Mein Blick wandert nach oben, über ihre Hüfte, die schmale Taille, hin zu ihren ausdrucksstarken Augen, die mich an Nugatschokolade erinnern. Ob ihr das schon mal jemand gesagt hat? Ich liebe Schokolade beinahe so sehr wie Sommersprossen und irgendwie lässt diese Frau mein Herz gerade ein wenig schneller schlagen. Sie hat eindeutig mein Interesse geweckt. Sie blitzt mich leicht verärgert an, die Angst, die ich eben gemeint gesehen zu haben, ist verschwunden, dafür steht ihr Verärgerung deutlich ins Gesicht geschrieben. Ein wohliger Schauer gleitet meinen Rücken hinab. So etwas, dass mir eine Fremde so unter die Haut geht, ist mir noch nie passiert. Also schiebe ich es lapidar auf den Sturz, möglicherweise hat mein Kopf doch etwas abbekommen.
»Fertig mit der Glotzerei?«, knurrt sie, woraufhin ich auflache. Sie hat gerade noch so süß und schüchtern gewirkt, jetzt könnte man glauben, sie will mich gleich in Flammen aufgehen lassen – bei den Blicken, die sie mir zuwirft. Okay, ich gestehe ihr zu, dass meine Musterung zwar nicht höflich gewesen ist, dennoch anerkennend. Sie rümpft ihre kleine Stupsnase erbost, lässt dabei die Sommersprossen tanzen, was einfach liebreizend wirkt. Fast bin ich in Versuchung, die kleinen Sprenkel zu zählen.
»Also, erst rennst du mich um, dann motzt du mich auch noch grundlos an?«, erwidere ich gut gelaunt. »Außerdem habe ich nicht geglotzt. Ich habe nur geschaut, ob ich klarsehen kann, nachdem ich gestürzt bin. Wer weiß, vielleicht habe ich eine Gehirnerschütterung? »
»Storm hat dich umgerannt, nicht ich. Im Übrigen habe ich mich entschuldigt, mehrfach. Es tut mir aufrichtig leid, aber das ist kein Freifahrtschein, mich so … zu mustern. Das ist unangebracht und unhöflich. Ich bin keine Stute auf dem Viehmarkt. Typen wie du, sind einfach ätzend.«
»Typen wie ich? Du kennst mich gar nicht.« Ich muss nun herzlich lachen, was sie dazu auffordert, ihre Augen noch etwas mehr zu verengen, dabei so finster in meine Richtung zu schauen, dass man fast Angst haben könnte. Sie hat ein kleinwenig Recht, aber das werde ich nicht zugeben, sondern strahle sie einfach an. Keine Stute auf dem Viehmarkt? Ich mag dieses Geplänkel wirklich, genau richtig. Sie hat Feuer, das gefällt mir.
»Ja, Typen wie du. Die denken, nur weil sie gut aussehen, können sie machen, was sie wollen. Weißt du, das könnt ihr gar nicht. Nur weil man attraktiv ist, ist das kein Freifahrtschein für ein arschiges Machoverhalten, wozu deine Musterung von eben definitiv gehört.«
»Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass du mich attraktiv findest, oder dafür, dass ich dich bewundernd gemustert habe?« Sie steht so dicht vor mir, dass ich runter schauen muss, wenn ich mit ihr rede. Angriffslustig verschränkt sie die Arme vor der Brust, schiebt ihre Lippe trotzig vor. Eine zarte Röte bedeckt ihre Wangen, so aufgebracht ist sie. Es wirkt so herrlich ungekünstelt, dass sie auf Anhieb noch ein paar Sympathiepunkte bei mir sammelt. Ich hasse es, wenn Frauen aufgesetzt und künstlich sind. Ihr ist offenbar egal, was ich von ihr denke, auch wenn sie gerade ein wenig übertreibt. So dramatisch ist meine Musterung nun echt nicht gewesen. »Du bist total niedlich, wenn du sauer bist. Ich kann das gar nicht ernst nehmen bei deiner Größe«, stichle ich, sie schnaubt stattdessen empört.
»Volltrottel. Das ist mir echt zu blöd«, zischt sie, pfeift sogleich nach ihrem Hund. Er kommt erneut wie ein Blitz angerannt, rempelt mich dabei abermals an, sodass ich einen Schritt nach vorne machen muss. Wir wären zusammengestoßen, wenn sie nicht nach hinten hüpfen würde – als wäre ich die Pest in Person. Okay, das ist verletzend. Das bin ich nicht gewohnt. Ich bin zwar kein David Beckham, aber auch kein Quasimodo. Es kratzt etwas an meinem Stolz. Sie wirkt fast zufrieden, grinst ihren tropfenden Hund an. »Guter Junge«, lobt sie ihn zudem, woraufhin er erfreut mit dem Schwanz wedelt und mir einen kurzen Blick zuwirft.
»Anscheinend mag dein Hund mich nicht«, mutmaße ich weiterhin amüsiert über die ganze Situation. Der Tag entwickelt sich besser, als ich angenommen habe.