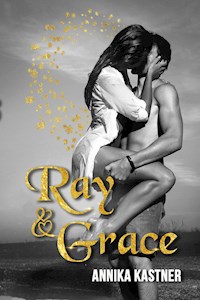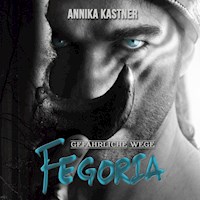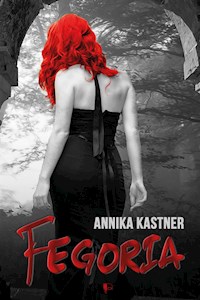
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Booklounge Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fegoria
- Sprache: Deutsch
"Ich bin Alice – in meinem ganz persönlichen Wunderland. Weiße Hasen habe ich keine, aber einen kleinen Drachen. Mein Hutmacher ist ein sturer Prinz, der mir das Leben gerettet hat, und zudem heißer ist, als es erlaubt sein sollte." Alice ist von ihren Freundinnen, denen es wichtiger scheint, perfekte Fotos für ihre Blogs und Selfies für Instagram zu inszenieren, genervt und führt die gemeinsame Wanderung alleine fort. Als sie den Eingang eines Berges ausfindig macht, lässt sie sich von ihrer Neugierde treiben und betritt das märchenhafte Fegoria. Umgeben von Orks, Trollen, Drachen und Lichtelben, die ihr Leben gewaltig auf den Kopf stellen, versucht sie mit aller Macht, zurück in ihre Welt zu gelangen. Nachdem sie jedoch mit der wohl größten Lüge ihrer Existenz konfrontiert wird, begibt sie sich mit Crispin, Thronfolger im Nebelwald, auf die Suche nach sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fegoria
Roman
Annika Kastner
Booklounge Verlag
Überarbeitete Ausgabe
Copyright © 2018
Alle Rechte beim Booklounge Verlag
Booklounge Verlag, Sabrina Rudzick
Johann-Boye-Str. 5, D-23923 Schönberg
www.booklounge-verlag.de
978-3-947115-09-9
Inhalt
Widmung
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Danksagung
Orte und Personen in Fegoria
Widmung
Für meinen wundervollen Sohn Joshua und meinen Mann Philipp. Danke, dass ihr mich unterstützt und euch die unzähligen Notizzettel zu meinen Büchern nie stören. Ich liebe euch über alles.
Für meine Eltern, die meine Lesesucht immer gefördert haben, mir viele Bücher haben kaufen müssen, und den Rest meiner verrückten Familie.
Kapitel Eins
Ich schultere den Rucksack und versuche, das Brennen meiner Nackenmuskulatur zu ignorieren. Da es nicht meine erste Wanderung ist, und auch nicht die Letzte, könnte man meinen, dass mein Körper dies mit Leichtigkeit wegsteckt, was allerdings nicht der Fall ist. Vielleicht sollte ich vermehrt trainieren, statt über Büchern zu hocken, oder einfach weniger einpacken. Ja, das wäre eine Alternative. Leider scheine ich es nur vor jedem Fußmarsch erneut zu vergessen.
Bereit, meine Reise fortzusetzen, wippe ich auf den Fußballen auf und ab. »Leute, seid ihr bald so weit?« Ich drehe mich ungeduldig meinen beiden Freunden zu, die das tausendste Selfie von sich und dem riesigen Berghang machen. Ein Foto kann ich verstehen, zwei oder gar drei ebenso, aber muss man es so übertreiben? Von den gefühlt einhundert Bildern werden sie sowieso nur eines für ihre Blogs nehmen. Ein Hoch auf das digitale Zeitalter. Als sie mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, zu wandern, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie jeden ihrer Schritte bei Instagram, oder sonst wo, posten würden. Mal ganz im Ernst: Man sieht sich ohnehin zu selten und anstatt die Zeit zu nutzen, so etwas? Hier spielt das reale Leben und nicht die virtuelle Welt, verdammte Axt. Außerdem ist es super unhöflich. Punkt.
Momentan stehen wir mehr, als dass wir wandern, und mein Rücken schmerzt unheimlich von diesem blöden Rucksack. Wenn ich nicht in Bewegung bleibe, wird das sicherlich kein gutes Ende nehmen. Ich wippe noch einige Male auf und ab, schaue dann ungeduldig zu ihnen hinüber. Die beiden sind jedoch so vertieft in ihre Fotosession, dass sie mich gar nicht hören oder hören wollen. Sie kichern und posieren für ihre Fotos, während ich die Augen verdrehe. »Hier spielt das echte Leben, Leute«, brumme ich und schlendere langsam voraus. Sie werden mich hoffentlich irgendwann einholen, ansonsten werde ich ihnen Essen von zu Hause schicken, damit sie eine neue Story, eine Food-Story, zum Posten haben.
Mein Körper verlangt bereits nach einer warmen Dusche, einem leckeren Stück Kuchen und einem weichen Kissen, denn die Sonne steht mittlerweile nicht mehr so hoch am Himmel. Es wird kühler und obendrein sind wir schon ewig unterwegs. Am besten wäre jetzt ein saftiger Schokoladenkuchen mit Karamellglasur. Allein der Gedanke lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, mein Magen knurrt leise. Ich lecke mir über die Lippen und ziehe ein Kaugummi aus meiner Tasche, den ich mir schnell in den Mund schiebe, auch wenn er meinen Heißhunger auf Süßigkeiten überhaupt nicht befriedigt. Während ich dicht an der Felswand entlanglaufe und hinauf in den noch blauen Himmel schaue, lasse ich Kaugummiblasen platzen, die den Duft von Erdbeeren versprühen. Keine meiner cleversten Ideen – es sorgt nur dafür, dass sich mein Magen nach etwas Essbaren verzerrt.
Erste rosa Streifen breiten sich am Himmel aus. Ein Zeichen, dass es nun wirklich Abend wird. Ich habe keine Lust, beim Einbruch der Nacht nach dem Weg zu suchen. Oder noch schlimmer, in der Kälte zu übernachten. Wer weiß, was hier für Tiere in der Dunkelheit umherstreifen. Wieder schaue ich kurz zurück, doch das Bild meiner Freunde ist unverändert, also laufe ich langsam alleine weiter.
Die frische Luft tief inhalierend, bemerke ich, dass mir die Ablenkung vom Lernen sehr guttut. Das Studium ist echt hart und verlangt mir einiges ab, aber das habe ich bereits vorher geahnt. So ist das mit Wünschen und Zielen, es kostet manchmal mehr Schweiß und Disziplin, als einem lieb ist, dennoch ist Aufgeben keine Option für mich. Was ich beginne, ziehe ich bis zum Ende durch. Basta!
Ich lasse meine Hand beim Laufen über den rauen, kalten Stein des Berges gleiten. Kleine Kiesel lösen sich unter meinen Fingern und kullern zu Boden. Wie lange der Berg hier wohl schon steht? Der Gedanke, dass er seit Dinosaurierzeiten existiert, ist faszinierend. In meiner Vorstellung sehe ich ein Mammut, wie er an dem Bergrücken schnuppert, und muss lächeln. Ja, Fantasie habe ich immer ausreichend. Meine Gedanken schweifen an ferne Orte und ich summe sanft vor mich hin. Die Minuten verstreichen. Ewig kann mich die Tagträumerei nicht vor der Kälte schützen, die in meine Kleider kriecht, also drehe ich mich erwartungsvoll seufzend um. Zu weit will ich mich schließlich nicht von den anderen entfernen.
»Leute«, rufe ich gereizt und stelle fest, dass ich ein gewaltiges Stück alleine zurückgelegt habe. Was für Bilder machen sie nur so lange? Das kann doch nicht ihr Ernst sein! Warten oder gehen? Tja, das ist die Frage, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Oder soll ich zurückgehen und sie hinterherschleifen? Immerhin ist das eine Alternative.
In diesem Moment erregt etwas an der Bergwand meine Aufmerksamkeit, weshalb ich mich der Nische zuwende. Wieso ist mir das nicht eben aufgefallen? Sie ist nicht riesig, aber ich könnte eventuell so hineinpassen, wenn ich Kopf und Bauch einziehe. Neugierig beiße ich mir leicht auf die Unterlippe. Die Langeweile verleitet mich dazu, dichter heranzugehen.
Ein kurzer Blick zu meinen Freunden zeigt mir, dass sie weit hinter mir endlich ihre Rucksäcke schultern und laut über etwas lachen. Na ja, zumindest kommen sie nun in Wallung. »Leute, ich schau mir das hier mal an«, rufe ich, woraufhin sie winken und direkt wieder in die andere Richtung schauen. Anscheinend hat sie etwas abgelenkt, aber sie haben mich wenigstens gehört und gesehen, was mich ein wenig beruhigt. Das heißt schließlich, sie merken noch, dass ich da bin, denke ich leicht verärgert.
Die Nische ist wirklich nicht sonderlich breit. Ich lehne mich vor, um zu schauen, was genau meine Aufmerksamkeit erregt hat. Der Stein scheint unter meinen Fingern zu pulsieren, was ich ganz klar meiner Fantasie zuschreibe. Es wirkt fast so, als drängt Licht aus der Nische, was allerdings unmöglich ist und meine Neugierde noch steigert. Der Berg ist viel zu klobig, dass Licht von der anderen Seite durchdringen könnte. Ich nage kräftiger an meiner Lippe – eine Geste, die ich immer mache, wenn ich nervös oder aufgeregt bin. Meine Neugierde wächst von Sekunde zu Sekunde und ich versuche, mich durch den schmalen Schlitz zu drücken, was mir jedoch nicht gelingt. Mein Rucksack ist eindeutig zu breit und störrisch. Kurz zögere ich, trete noch mal zurück. Meine Gedanken drehen sich nur darum, dass ich wissen will, was in diesem Felsspalt steckt. Was soll schon passieren? Nur ein kurzer Blick, die anderen haben genügend Zeit, mich einzuholen. Außerdem kann ich so die Kälte vertreiben, mich bewegen, ohne vor Langeweile zu sterben.
Ich setze den Rucksack auf dem Boden ab und ziehe die Wasserflasche an den Mund, um einen Schluck zu trinken. Das Wasser schmeckt durch die Flasche leicht metallisch, mein Mund verzieht sich. Danach lasse ich die Schultern einige Male kreisen und stöhne vor Entzücken auf. Es tut so gut, die Last endlich los zu sein. Meine Freunde halten mich oft für waghalsig, weil ich ständig allen Dingen auf den Grund gehen muss. Das liegt einfach in meiner Natur. Mich interessiert, was hinter Dingen verborgen liegt oder welche Geschichte sie zu erzählen haben. Genau deswegen will ich, seit ich denken kann, Geschichte studieren. Und nun, mit vierundzwanzig Jahren, habe ich mein Studium fast beendet und schon viel von der Welt gesehen. Meine Familie nennt mich liebevoll Tomb Raider, was völliger Schwachsinn ist. So läuft es im echten Leben nie ab. Dennoch liebe ich diese Filme. Ich bin ja nun keine Archäologin oder so, aber manchmal ertappe ich mich bei dem Wunsch, ein wenig mehr Abenteuer zu erleben.
Meinen Rucksack lasse ich stehen und beginne, mich langsam, Stück für Stück, durch den schmalen Spalt zu schieben. Den Bauch muss ich ordentlich einziehen und kann nur schwer atmen. Für jemanden mit Platzangst wäre das hier sicherlich die Hölle auf Erden. Mit den Händen taste ich mich an der Wand voran, was kleine Steine zu Boden rieseln lässt.
Licht! Ich sehe definitiv Licht. Wo kommt es her? Über mir befindet sich ausschließlich Gestein, was ein Hereinscheinen unmöglich macht. Wie eine Motte werde ich vom Licht angezogen und schiebe mich immer weiter durch den engen Spalt. Vielleicht ist diese Aktion wirklich dämlich, doch es ist so, als müsste ich dem Licht auf den Grund gehen. Es ist ein Gefühl, tief in mir, das mich weiter drängt.
Ich zucke zusammen, als etwas mein Gesicht streift, und quietsche erschrocken auf. »Was zum …«, flüstere ich, als ich merke, dass Blätter auf mich hinab rieseln. Blätter? Wo kommen die her? Der Platz ist nicht ausreichend, um mich umzusehen. Zumindest sind es keine Spinnen oder andere ekelige Tiere, womit ich weniger gut umgehen kann und da eher ein richtiges Mädchen bin. Lara Croft hat damit hingegen weniger Probleme – also doch keine Schatzjägerzukunft für mich. Schmunzelnd schiebe ich mich vorsichtig weiter. Eine frische Brise weht mir entgegen und ich atme geräuschvoll ein. Die Luft, die abgestanden riechen müsste, versprüht eher etwas Frisches und Erdiges. Sie riecht anders als sonst, sauberer, was merkwürdig ist. Irgendwie bringt mich das ganz durcheinander, nichts passt an diesem Ort zusammen. Das Licht wird immer heller und Nebel umwandert meine Füße. Völlig verrückt. Nebel in einem Berg? Vielleicht befindet sich hier drinnen eine Höhle oder gar Dinosaurier – das wäre es. Bei dem Gedanken muss ich unwillkürlich breit grinsen. Als ob das nicht schon jemand vor mir gefunden hätte.
Plötzlich bemerke ich die Stille um mich herum. Vor der Nische ist das Rauschen des Windes zu hören gewesen, der Gesang der Vögel und das Geraschel vom Wald. Hier hingegen ist es still, nur mein Atem klingt laut in meinen Ohren. Mein Herz rast, meine Hände schwitzen. Das ist nicht normal. Auf keinen Fall. Halluziniere ich etwa? Habe ich Sauerstoffmangel? Ich sollte umdrehen und es dabei belassen. Wäre da nicht dieses Gefühl … Es ist, als würde es flüstern: Komm, Alice! Komm! Nur noch ein paar Meter, sage ich zu mir selbst, dann drehe ich um. Mutig taste ich mich weiter voran und muss nun den Kopf nicht mehr einziehen, was eine Wohltat ist.
Nach zwei weiteren Minuten ist der Nebel plötzlich so dicht, dass ich nichts mehr, außer das milchige Weiß, sehe. Realistisch betrachtet, müsste es eher stockduster sein. Zögernd bleibe ich stehen. Bis hier hin und nicht weiter. Es wird Zeit, umzudrehen. Völlig egal, wie groß meine Neugierde ist, das ist mir dann doch zu suspekt.
Als ich mich zurückschieben will, zurück zu meinen Freunden, gelingt es mir nicht. Ich versuche, einen Fuß in die Richtung zu setzen, aus der ich gekommen bin, doch er stößt gegen Stein. »Was soll das?«, fluche ich und taste den Stein ab. Wo ist der Weg hin? Er kann unmöglich weg sein! Wie vom Erdboden verschluckt! Habe ich eine Abzweigung genommen und es nicht bemerkt? Angst durchfährt meine Venen. Es geht nur noch voraus, weiter in den Nebel und in den Berg hinein. Kein Weg zurück? Der Gedanke bereitet mir eine Gänsehaut. Ich bin sicher ausschließlich geradeaus gegangen. Der Weg muss doch da sein! Es ist wie verhext, hinter mir ist und bleibt kalter, feuchter Stein.
»Was hast du dir da nur wieder eingebrockt«, schimpfe ich mit mir selbst und könnte mich ohrfeigen. Ich bin eine komplette Idiotin. Da ich keine andere Wahl habe, schiebe ich mich immer weiter. Was soll ich auch sonst tun? An die Wand gepresst stehen bleiben und auf meine Freunde warten? Meine Hände gleiten über den kalten Stein. Nach einigen Metern wird die Decke höher und der Weg breiter. Ich atme tief ein und strecke mich, ehe ich vorsichtig weitergehe. Es ist kühl geworden. Ob die anderen meinen Rucksack gefunden haben? Sie werden sicherlich Hilfe nach mir schicken. Oje, meine Eltern werden richtig sauer sein.
Ein Bruchteil von Sekunden bin ich in meinen Gedanken gefangen, ehe ich weichen Boden unter meinen Füßen bemerke und den Berg verlasse. Ist das etwa Waldboden? Mein Mund klappt ungläubig auf und zu, während meine Füße im weichen Boden versinken, obwohl vor ein paar Sekunden noch hartes Geröll unter mir gewesen ist. Das Laub fällt raschelnd von den Bäumen und regnet auf mich hinab, verfängt sich dabei in meinen langen Haaren. Nebel umwandert die Baumstämme und ich fröstle vor Kälte und Furcht. Wie kann es plötzlich Nacht sein? Entweder werde ich verrückt oder ich sollte schleunigst umdrehen. Gedacht, getan: Ich will zurückgehen, doch statt den Pfad erneut zu betreten, drehe ich mich im Kreis. Wo ist der verdammte Berg hin? Was ist hier nur los?
Alleine in einem gruseligen Wald stehend, zweifle ich jetzt erst recht an meinem Verstand. Kopfschüttelnd drehe ich mich immer wieder um meine eigene Achse, halte Ausschau nach dem Rückweg. Das … ist verrückt. Ungläubig lache ich auf. Ein Berg verschwindet nicht einfach so. Warum ist es Nacht? Warum ist es so kalt und neblig? Wir haben Sommer, das Laub fällt noch nicht von den Bäumen. Ich bin doch erst einen Moment im Berg, keine Stunden. Es kann unmöglich Nacht sein. Mein Herz rast im wilden Galopp, kalter Schweiß bedeckt meine Haut. Ich habe nie verstanden, wieso es Angstschweiß heißt, jetzt kapiere ich es. Auszurasten bringt mich zwar nicht weit, aber ich bin kurz davor.
Lange bin ich nicht im Berg gewesen, rede ich mir abermals zu. In dem Berg, der verschwunden ist, wohlgemerkt. Vermutlich ist das einer dieser verrückten, sehr realen Träume. Gleich wache ich sicherlich auf und lache herzhaft darüber. So wird es sein. Oder ich bin an dem Baum, an dem ich vorhin Pause gemacht habe, eingenickt. Alles klingt logischer als das, was mir gerade widerfährt.
Musternd nehme ich meine Umgebung wahr. Selbst die Bäume wirken anders auf mich. Majestätisch und groß ragen sie empor. Sie sehen viel älter aus als all die Bäume, die ich je zu Augen bekommen habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ich bin an einem anderen Ort, oder in einer anderen Welt. Die Blätter sind viel größer, die Bäume knochiger und der Wald riecht anders. Gesünder? Kann ein Wald überhaupt gesünder riechen? Sogar der Mond schaut aus, als sei er viel näher an der Erde. Alles scheint vorzeitlicher, unberührter. Ja, das ist es. Es erweckt den Eindruck, dass dieser Wald alt und unentdeckt ist.
Mein Herz rast immer noch wie verrückt und meine Angst steigt ins Unermessliche. Mein Verstand versucht, die Lage zu analysieren, doch es gibt schlicht keine Erklärung für das Hier und Jetzt. »Wach auf!«, ermahne ich mich, während ich mir ins Bein kneife, aber es bleibt unverändert: Ich stehe tatsächlich im Wald.
Ein Brüllen lässt mich zusammenzucken und ich halte mir schützend die Hände über den Kopf. Alles in mir ist sofort in Alarmbereitschaft. Meine Instinkte setzen ein, können das Geräusch jedoch nicht zuordnen. Mein Gehirn kennt kein Tier, das so brüllt. Über mir rast eine riesige Kreatur durch die Bäume und verursacht, dass mehr Blätter auf mich hinabfallen – es ähnelt einem Wasserfall aus Laub. Ich starre dem Wesen hinterher, schüttle benommen den Kopf. Vielleicht hat es einen Erdrutsch gegeben und ich liege bewusstlos am Berg … Wie soll ich mir sonst das Tier mit Flügeln erklären, das direkt über mir geflogen ist? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist ein Drache gewesen. Klar, auch das noch! Wird ja immer schöner hier! Meine Beine gleichen einem Wackelpudding und ich lasse mich an dem Baum hinter mir hinabgleiten, der mir gerade in wenig Halt gibt, während ich mich sammeln muss.
Drache, prähistorische Blätter, Berge … die verschwinden.
Mit den Händen fahre ich durch mein Haar, meine Finger zittern dabei wie verrückt. »Ein Drache«, murmle ich wiederholt leise vor mich hin und schaue hinauf in den Himmel, doch selbst den sehe ich in der Nebel- und Wolkenmasse nicht mehr. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich langgehe oder was ich überhaupt machen soll.
Wenn man nicht weiß, wohin der Weg einen führt, ist es dann nicht egal, wohin man geht? Wer hat das noch gleich gesagt? Es ist ein Märchen gewesen … Die Grinsekatze? Wie auch immer, hier kann ich jedenfalls nicht bleiben, so viel steht fest. Mir ist eiskalt und ich reibe meine Arme. Meine Jacke liegt sicher und warm in meinem Rucksack, vor dem nicht existierenden Berg.
Ich zwinge mich, trotz wackliger Beine, aufzustehen und laufe langsam los, während ich versuche, mich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Es ist unmöglich. Selbst wenn ich den Himmel sehen könnte, bezweifle ich, dass hier die gleichen Sterne strahlen. Es ist nicht nur ein Gefühl, eher so, als wüsste mein Unterbewusstsein mehr, als mein Verstand erkennt. Schatten wandern zwischen den Bäumen hindurch und fast meine ich, ein Flüstern wahrzunehmen, was aber auch die Bäume und das sich im Wind bewegende Laub sein können. Es ist die perfekte Horrorfilmkulisse … Ich hasse Horrorfilme!
Mondlicht bricht gelegentlich durch den Nebel und taucht den Wald immer wieder für kurze Augenblicke in sanftes Licht, verlängert die Schatten. Es trägt dazu bei, dass sich meine Angst steigert. Die Schatten scheinen sich zu bewegen, was sicher Teil meiner Einbildung ist. Angst gaukelt einem vieles vor, davon habe ich momentan genug. Ich habe kein Zeitgefühl, laufe einfach weiter geradeaus. Irgendwann werde ich ja irgendwo ankommen müssen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, vielleicht auch nur ein oder zwei Stunden – wie lange ich schon unterwegs bin, weiß ich wirklich nicht –, halte ich an. Es muss doch jemanden geben, der mir helfen kann. »Hallo?« Meine Stimme klingt zittrig, eine Antwort erhalte ich dennoch nicht. Nur das Flüstern ist allgegenwärtig, was dafür spricht, dass ich tatsächlich nicht ganz dicht bin. Ich reibe mir immerfort die Arme und schaue mich um. Kein Haus in Sicht. Nichts. Mein blödes Smartphone, um jemanden anrufen zu können, steckt im Rucksack, wo es mir herzlich wenig hilft. Ebenso wenig die verdammte Taschenlampe, welche auch warm und sicher in meinem Rucksack verweilt. Geile Aktion, Alice!
Ich drücke mir zwei Finger auf die Nasenwurzel, kneife meine Augen zusammen und bete kurz zum Allmächtigen, dass er mich aus diesem Albtraum erlöst. Das klingt echt verrückt! Nein, es klingt nicht nur verrückt, das ist es wahrhaftig. Weiter, ich habe keine Wahl. Irgendwann wird dieser Wald zu Ende sein. Es muss hier Menschen geben, Häuser, Zivilisation.
Nach einigen hundert Metern bleibe ich stocksteif stehen. In der Ferne sehe ich die Umrisse eines Menschen im Nebel und mein Herz macht einen freudigen Hüpfer. Habe ich es doch gewusst! Mensch bedeutet, ein Handy ist in greifbarer Nähe. Das wiederum bedeutet, Hilfe holen zu können, also laufe ich los. »Hey«, rufe ich dem Schatten zu und meine Furcht ist abrupt vollkommen vergessen. Glücksgefühle durchströmen mich bei der Aussicht, dass mir jemand helfen wird und ich nicht allein in diesem Wald bin. Bald werde ich zu Hause sein und lache bei einer Tasse heißen Kakao über diese absurde Geschichte. Vor allem über den großen Vogel, den meine Fantasie zu einem geflügelten Untier gemacht hat. Mein Gefühl rät mir zwar, anzuhalten, doch das ignoriere ich gekonnt. Das Bedürfnis, nicht mehr alleine zu sein, überwiegt alles andere. »Hey«, rufe ich erneut lautstark. »Ich habe mich verlaufen, kannst du mir helfen?«
Vor mir lichtet sich der Nebel und ich stoppe, als ich dem Menschen nahe genug bin, um zu erkennen, wie riesig er ist. Er steht mit dem Rücken zu mir und überragt mich sicher um drei Köpfe. Was zum Henker … Er ist so breit wie ein Schrank und ehe mein Verstand mir mitteilen kann, dass er kein Mensch ist, dreht sich das Wesen, mit einem blutigen Stück Fleisch im Mund, um. Neben seinen Füßen liegt etwas, was einst ein Hirsch gewesen ist. Jetzt ist es nur noch ein roher Fleischhaufen, auf dem ein Geweih steckt. Eisengeruch vom Blut weht mir entgegen, was einen Würgereiz aufkommen lässt. Mein Mund öffnet sich vor Entsetzen und Ekel, doch es entweicht kein Ton, nicht der klitzekleinste Ton. Ich versuche, japsend Luft zu holen, und unterdrücke den Würgereflex, der meinen Hals hinauf kriecht. Langsam trete ich den Rückzug an, Schritt für Schritt, nur weg von diesem Ding. Ich will so viel Abstand wie möglich zwischen uns bringen. Plötzlich ist der Gedanke, wieder alleine im Wald zu sein, viel verlockender als die Gesellschaft dieses Wesens.
Oh mein Gott! Es hebt den Blick, starrt mich an und die Welt um mich herum scheint zu verstummen. Ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen. Das Ding lässt sein Fleischstück zu Boden fallen, wo es mit einem widerlichen Platschen landet. Mein Blick folgt automatisch dem Fleischbrocken. Ob es wirklich ein Hirsch ist, vermag ich nicht zu sagen, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur nicht genauso enden.
Mein Magen rebelliert allmählich gewaltig. Bedächtig hebe ich meinen Blick und starre das Ding vor mir wieder an. Was bist du, denke ich. Sein Körper ist grau und sieht ledrig aus, mit abstehenden Ohren und Haaren an seinen viel zu langen Armen. Seine Hände sind so groß wie eine Pizza, mit langen gebogenen gelben Fingernägeln – er ist wahrhaftig abstoßend.
Speichel fliegt mir aus seinem Mund entgegen, als er mich wütend anbrüllt. Sein fleischiges Gesicht verzieht sich dabei zu einer furchtbaren Fratze und entblößt Zahnstummel, die der Albtraum eines jeden Zahnarztes wären. Die Laute, die es ausstößt, sind als Sprache nicht zu erkennen. Sie klingen grob, nein, animalisch und nicht menschlich. Es ist wie der Schrei eines mürrischen Bären. Anscheinend habe ich ihn gestört, denn er wirkt mächtig verärgert.
Ich hebe die Hände – zum Zeichen, dass ich ihm nichts Böses will –, während ich mich schleichend entferne. Schritt für Schritt taste ich mich rückwärts vor, während das Ding mit den Zähnen knirscht und seine gelben Augen sich zu Schlitzen verengen. Sein Kiefer mahlt kräftig aufeinander, Blut fließt aus seinen Mundwinkeln und tropft auf seine haarige Brust. Er reißt das Geweih vom Boden, beißt hinein und es zersplittert in seinem Maul. Wenn er mir Respekt einflößen will, hat er Erfolg damit. Ich bin kurz davor, mir vor Angst in die Hose zu machen. Immerhin ist mein Arm nicht viel dicker als das Geweih, welches er mühelos zerteilt hat. Wie soll ich mich verhalten? Was ist das für ein Wesen? In einer Doku haben sie gesagt, man darf keine ruckartigen Bewegungen machen, wenn man von wilden Tieren angegriffen wird. Unter welche Kategorie fällt es? Tier? Monster? Mutierter Neandertaler?
Mein Herz pocht wie wild und ich habe das Gefühl, es springt mir gleich aus der Brust. Ich glaube, dass mein Versuch, unauffällig zu verschwinden, funktioniert, doch aus heiterem Himmel stürmt das Ding, überraschend schnell für die Masse, die es bewegt, auf mich zu. Entsetzt schreie ich auf und wirble ruckartig herum. Mein Körper reagiert wie von selbst, meine Beine laufen davon. Noch nie bin ich schneller gelaufen als jetzt. Egal, was die Doku meint, das ist der Moment, in dem man seine Beine in die Hände nehmen und nur rennen muss.
»Fuck«, fluche ich atemlos und springe über jegliches Gehölz, während Godzilla, wie ich ihn in diesem Moment taufe, hinter mir alles zu Kleinholz verarbeitet. Ich ignoriere Äste und Zweige, die an mir reißen und mir ins Gesicht schlagen. Adrenalin vertreibt sämtliche Schmerzen. Meine Lunge brennt bei jedem Schritt, doch ich wage es nicht, langsamer zu werden, denn ich ahne, dass es mein Tod bedeuten würde.
Wie kann das Ding so beweglich sein? Ist das überhaupt möglich? Ich blicke über meine Schulter. Ein fataler Fehler, wie ich im nächsten Moment feststelle. Ehe ich es verhindern kann, stolpere ich über eine Baumwurzel und taumle, bevor ich mit der Stirn gegen einen dicken, tief hängenden Ast knalle und einen Moment nur Sterne vor den Augen sehe. Schmerzvoll presse ich die flache Hand gegen meine Stirn, die sich feucht und klebrig anfühlt. Mein Schädel droht zu explodieren. Alles, was gerade zählt, ist dieser albtraumhaften Gestalt zu entkommen, weshalb ich mich zusammenreiße, und mich sammle.
»Gruaaa«, brüllt das Ding hinter mir auf und ist mir bereits dicht auf den Fersen. Ich muss hier weg, komme was wolle! Trotz der Schmerzen, meine Seite brennt von den sich krampfenden Muskeln, zwinge ich mich, weiterzulaufen. Meine Beine sind wie mit Blei gefüllt, doch ich renne und renne. Panisch suche ich nach einem Ausweg und mein Blick fällt direkt auf die Bäume – etwas anderes gibt es hier ohnehin nicht. Dieses Wesen ist so schwer, dass sicherlich kein Ast es aushalten kann. Das ist meine Chance. Wahrscheinlich mein einziger Ausweg, denn lange werde ich das Tempo nicht mehr halten können. Meine Muskeln sind jetzt schon kurz vorm Aufgeben.
Ich schaue in die Baumkronen und suche nach einem erreichbaren Ast. Kaum entdecke ich einen, nehme ich Anlauf, renne auf ihn zu und springe ab. Meine Finger umschließen das raue Holz. Durch den Schwung kann ich mich hinauf hangeln und beginne sofort, zu klettern. Früher bin ich eine ziemlich gute Turnerin gewesen, auch wenn die Schulzeit Jahre her ist, so etwas verlernt man nicht. Wenn ich eines kann, dann ist es das. Diese Leidenschaft habe ich sogar während meines Studiums verfolgt. So viele verdammte Felswände habe ich schon erklommen, da finde ich auch hier genug Halt. Ast für Ast ziehe ich mich hinauf in die Baumkrone und fühle mich fast sicher, als plötzlich der ganze Baum bebt. Erschrocken greift meine Hand ins Leere und ich rutsche schmerzhaft ein Stück nach unten. Holzsplitter bohren sich in meine Hände und ich beiße die Zähne zusammen, klettere tapfer weiter. Es geht um mein Leben, ein paar Holzsplitter sind nichts dagegen.
Unter mir versucht Godzilla, mich vom Baum zu schütteln und brüllt wie verrückt. Seine Laute sind wutgeladen, voller Entrüstung und Zorn. Wie kann ich mich auch wagen, mich ihm zu widersetzen, wo ich auf seinem Speiseplan stehe! »Verpiss dich«, schreie ich, doch er brüllt umso lauter. Wo bin ich hier nur gelandet? Als es nicht mehr höher geht, klammere ich mich an einem der Äste fest und der Baum ächzt unter der Kraft der Schläge. Er rüttelt wie ein Irrer am Stamm und ich bin naiv genug, zu glauben, dass der Baum dies lange aushalten wird. Er knarrt schon und beginnt zu schwanken. Dieses Vieh muss unmenschliche Kräfte haben und eine unbezwingbare Gier nach mir, dass es den kompletten Baum entwurzelt. Mir rollen Tränen die Wangen hinab, ich schnaube wütend.
»Ich schmecke total eklig«, brülle ich. »Geh doch einfach und such dir ein anderes Festmahl. Ich bin giftig und ranzig, du wirst dir den Magen verderben, außerdem bleibe ich dir in deinem hässlichen Hals stecken.« Ich weiß noch nicht mal, ob das Vieh mich versteht. Es grunzt und knurrt nur, hört nicht auf, den Baum zu bearbeiten. So will ich nicht sterben! Ich will überhaupt nicht sterben! Vor allem nicht von diesem Monster gefressen werden. Lange wird der Baum nicht mehr durchhalten. Mir bricht der Schweiß aus jeder Pore meines Körpers, mein Oberteil klebt an meinem Rücken und mein Verstand arbeitet auf Hochtouren. Mir will kein Ausweg einfallen, weshalb ich mich fester an den Ast klammere und Stoßgebete gen Himmel schicke. Wenn es einen Gott gibt, muss er doch eingreifen. »Hilfe!«, brülle ich, doch niemand antwortet mir. Nicht mal ein Vogel ist zu hören, nichts und niemand, der sich darum schert, dass ich gleich gefressen werde. Ich breche einen Ast ab und werfe damit nach ihm, doch er bemerkt es nicht. Ehe ich mir eine Lösung überlegen kann, kippt der Baum langsam zur Seite und ich brülle wie am Spieß. Mein Schrei hallt durch den ganzen Wald. Jetzt schrecken sogar einige Vögel aus dem Schlaf auf und fliegen kreischend in der Luft herum. Es kommt mir vor, als fällt der Baum in Zeitlupe. Mein Blick haftet auf den immer näher kommenden Boden und ohne lange zu überlegen, springe ich zum nächsten Baum hinüber. Mein zweiter fataler Fehler, denn meine Hände finden erneut keinen Halt – ich falle wie ein Stein in die Tiefe. Ich rausche durch Geäst, welches mir die Haut zerkratzt. Zwar federt es meinen Sturz ein bisschen ab, trotzdem ist der Aufprall so hart, dass mir Luft aus der Lunge entweicht. Stöhnend bleibe ich liegen und schaue in den Himmel, wo sich nun allmählich Sterne zeigen. Der Nebel wabert um mich herum und ich fühle mich so benommen, dass ich kaum etwas wahrnehme, außer den Schmerz meines geschundenen Körpers.
Irgendwie bin ich froh über die Dunkelheit, die sich um mich legt. Ich fühle mich ganz wattig und wende den Kopf leicht zur Seite. Das Ding! Ich schaue es genau an. Mein Blickfeld verschwimmt schlagartig, ich blinzle rasch, als das Ding auf mich zustürmt, doch etwas springt ihm in den Weg. Nicht mehr fähig, zu reagieren, wird alles um mich herum schwarz und ich versinke dankbar in der Finsternis.
Kapitel Zwei
Schon den ganzen Abend liegt irgendwas in der Luft. Unzufrieden blicke ich mich um. Es ist, als hat die Welt einen Moment den Atem angehalten und ihn dann mit aller Kraft ausgestoßen. Es fühlt sich an, als ist etwas Elementares passiert, von dem wir nur nichts mitbekommen haben. Eine Erschütterung, die durch alle Schichten unserer Welt geht.
Wir sind auf dem Heimweg, unsere Patrouille ist zu Ende, Mitternacht naht. Ich wende mich nach links zu meinen Gefährten und halte schließlich inne. Stirnrunzelnd mustere ich die Umgebung, wechsle einen stummen Blick mit den anderen und werde das ungute Gefühl nicht los, irgendetwas Wichtiges verpasst zu haben. Die Bäume wehklagen leise, rufen nach uns. Es wütet tief im Inneren unserer Heimat, dem dichten alten Wald, und fügt ihm Schmerzen zu. Ihr Geflüster und die Rufe hallen von Baum zu Baum. Ich seufze schicksalsergeben. So viel dazu, dass es eine ruhige Nacht wird.
Ein Schrei durchdringt den Wald und ich wende ruckartig meinen Kopf in die Richtung, aus der er gekommen ist. Meine Hand legt sich automatisch um den Knauf meines Schwertes. Es ist ein Reflex, der unwillkürlich eintritt. Immer öfter kommt es zu Angriffen in unseren Wäldern, weswegen wir mehr Patrouillen aussenden müssen, um unsere Heimat zu verteidigen. Es sind dunkle und düstere Zeiten, denen wir die Stirn bieten. Orks, Trolle und all das Gesindel werden mutiger. Pure Dummheit treibt sie in unsere Wälder, denn hier finden sie den Tod – kein Reh kann das wert sein. Doch dieser Schrei klingt nicht nach einem Reh, sondern nach einer Frau. Einer menschlichen Frau, die in unseren Wäldern ebenso wenig heimisch ist wie andere Wesen.
Meine Füße berühren kaum den Boden, so schnell laufe ich, während Laub aufgewirbelt wird. Die Schritte der anderen sind im Gleichschritt mit meinem. Wir sind ein eingespieltes Team, ergänzen uns perfekt. Vögel fliegen kreischend in den Himmel und schimpfen über ihre gestörte Nachtruhe. Mein Blick folgt ihnen kurz, visiert den Ort an, von wo sie aufgeschreckt sind. Wieder dröhnt ein Schrei zu uns herüber. Meine Ohren hören nicht weit von uns einen Baum knarren und krächzen. Sein Wehklagen säuselt in mir nach. Was auch immer dort sein Unwesen treibt, ist stark und hat in unserem Wald nichts zu suchen. Es wird hier definitiv sein Ende finden, den Preis dafür zahlen, dass es unsere Grenzen überschritten hat.
In einem Bruchteil von Sekunden erblicke ich einen Troll. Groß und widerwärtig steht er in Nebelschwaden gehüllt vor einem der alten, majestätischen Bäume. Sein Gestank lässt mich die Nase rümpfen. Wütend reißt er am Stamm und der Baum entwurzelt zusehend. Die mächtigen Wurzeln geben auf, lösen sich aus dem Erdreich. Sandklumpen und Laub fliegen durch die Luft, als er langsam zur Seite kippt und die Erde aufreißt. Zwei Eichhörnchen segeln durch die Luft, landen glücklicherweise sicher auf anderen Baumstämmen. Der Troll grunzt zufrieden, Siegesgebrüll schallt durch den Wald. Du freust dich zu früh, denke ich knurrend, als abermals ein Schrei erklingt und die nächtlichen Geräusche übertönt. Weitere Vögel flüchten meckernd in den dunklen Himmel.
Mein Blick wandert den Baum hinauf, erfasst die Situation. In der Baumkrone entdecke ich eine junge Frau, die sich panisch an einen dicken Ast klammert. Sie beschimpft den Troll mit fremdartig klingenden Worten, bringt mich einen Moment aus dem Konzept. Der Baum kippt allmählich, sie stößt sich vom Ast, auf dem sie hockt, ab und springt in den Baum, der ihr entgegenkommt. Wäre sie eine Elbin, wie ich zuerst angenommen habe, würde sie nun in dem anderen Baum sitzen, doch sie findet keinen Halt und kracht laut durch das Geäst. Mit einem dumpfen Aufprall landet sie im Laub auf dem Boden, wirbelt es dabei auf. Der Nebel wabert kurz auseinander, fließt dann zurück zu ihr und bedeckt sie fast vollständig. Sie bleibt am Boden liegen, das Heben und Senken ihrer Brust erkenne ich allerdings. Sie lebt! Schmerzhaft muss es für ein mickriges menschliches Wesen dennoch sein – diese zarten Körper, die nichts aushalten, gleichwohl unseren von der Form ähneln. Sie stöhnt voller Pein auf und ich knurre zornig. Die Anspannung der anderen spüre ich deutlich, sie sind genauso wütend wie ich.
Der Troll brüllt, die Baumstämme vibrieren von seinem Schrei. Er will sich seine Beute holen, sich an seinem Opfer laben, aber ich springe ihm vor die Füße. Mein Blick hebt sich, ich lächle ihn kalt an. Heute gibt es kein Menschenfleisch für ihn, er ist zu weit gegangen. Er hätte in seinem Revier bleiben sollen, statt in unserem zu jagen. Stockend wandert mein Blick, bis ich ihm in die kalten gelben Augen schaue, die blutunterlaufenen sind. Rote Adern ziehen sich hindurch. Haare sprießen aus seiner Nase und den Ohren, rosa Speichel rinnt aus seinem Mund, zeugen davon, dass er heute schon gespeist hat. Blut besudelt seine vernarbte Brust – ein weiteres Indiz. Der Anblick reicht, meinen Zorn wie eine Flamme hochzuzüngeln. Er hat getötet, in unserem Reich.
Ich verabscheue Trolle ebenso wie sie uns. Er hätte in den Bergen bleiben sollen, wo er hingehört. Er riecht nach Kupfer, Eisen und Unrat. Ich presse angewidert die Zähne zusammen, ehe ich kalt lächle. Er mustert mich und ich lasse mein Schwert in der Hand kreisen, provoziere ihn. »Heute gibt es keine Beute für dich. Du hast dir den falschen Wald ausgesucht, hier ist unser zu Hause.«
Seine Augen treten aus den Höhlen. Speichel spritzt auf meine Hände, als er schnaubt. Angewidert rümpfe ich die Nase, lasse ihn dabei nicht aus den Augen. Cian und Noam treten neben mich, bilden eine undurchdringbare Reihe. Trolle geraten geradezu in Raserei, wenn sie uns erblicken. Nicht, dass sie sonst besonders schlau sind, aber dann sind sie noch unvorsichtiger. Sie wollen unser Blut, komme was wolle. Sie wollen sich an unserem Fleisch erfreuen, es ist eine Delikatesse für sie.
»Hör auf, zu spielen. Lass es uns einfach beenden und ab nach Hause. Die Nacht ist fast vorbei«, fordert Noam, bevor ich zustimmend nicke. Wir umkreisen den Troll mit wenig Abstand. Er ahnt, dass er einen Fehler gemacht hat, sein Instinkt sagt es ihm gewiss, warnt vor uns. Kampflos gibt er sein Leben und seine Beute mit ziemlicher Sicherheit nicht auf. Schlagend beißt er nach uns, doch wir sind schnell und geschickt, ausgebildete Kämpfer. Immerfort weichen wir seinen Hieben aus, während unsere Schwerter seinen ledernen Körper treffen. Blut rinnt aus seinen Wunden, aber er zuckt nicht einmal zusammen. Noch nicht. Er hat keine Chance gegen uns drei. Nicht mal gegen einen von uns, dafür sind wir zu flink. Ich ducke mich wiederholt unter seinen Pranken hinweg, mein Schwert findet prompt sein Ziel.
Dem Troll entfährt ein lautes Uff, als es ihn durchbohrt, doch er gibt nicht auf, packt mein Schwert mit beiden Pranken. Er ahnt wahrscheinlich, dass dies sein Todeskampf ist. Er will es mir entreißen, jedoch ist mein Griff eisern. Ich entziehe es ihm, er brüllt vor Wut und Schmerzen. Er wirbelt herum, um von mir wegzukommen, holt mit seiner fleischigen Pranke aus, schlägt sie Cian vor die Brust, womit dieser sicher nicht gerechnet hat. Seine gelben Nägel kratzen dabei lautstark über die Rüstung, wodurch mein Bruder durch den Schwung von den Füßen gerissen wird. Mit voller Wucht kracht er gegen einen Baumstamm, Laub prasselt auf ihn hinab und die Bäume wehklagen.
»Was ist das gewesen, kleiner Bruder?«, ziehe ich ihn belustigt auf. Der Blick, den er mir daraufhin zuwirft, ist mehr als finster, indessen er knurrend aufsteht. Seine Augen blitzen zornig vor Wut. Damit werde ich ihn die nächsten Tage gnadenlos aufziehen, denn das ist seit Jahren nicht mehr passiert. Noam springt zurück und mein Schwert erwischt den Troll an seinen Waden. Er fletscht die Zähne, dreht sich schwungvoll zu mir. Seine Augen ziehen sich zusammen, fixieren mich. Er will sich auf mich stürzen, doch Noam schlägt ihm von hinten den Kopf ab. Blut bespritzt Bäume um uns herum sowie meine Stiefel, während sein Körper laut zu Boden sackt.
Ich trete den Kopf angewidert zur Seite, die gelben Augen gucken mich stumpf an. Dieser Gestank, einfach widerlich. Einer weniger auf der Welt, nichtsdestotrotz streifen noch immer zu viele von ihnen umher, auf der Suche nach Opfern zum Fressen. »Ich hasse diese abartigen Kreaturen«, knurre ich, als ich mich zu der Frau umdrehe. »Jetzt wagen sie sich bereits in unseren Wald. Das muss aufhören.« Dann nehme ich mir endlich Zeit, sie anzusehen. Sie scheint bewusstlos zu sein. Ihr blutrotes Haar liegt dabei wie ein Fächer um ihr Gesicht im bunten Laub. Der Nebel wabert um sie herum, verleiht ihr etwas Magisches, sie wirkt fast wie eine Waldnymphe, so friedlich liegt sie dort.
Ich lege den Kopf schief und mustere sie genauer. Ihr Gesicht ist entspannt, als schläft sie nur, wäre da nicht die Platzwunde an ihrer Stirn, aus der ein bisschen Blut austritt. Ihr schlanker Körper steckt in merkwürdigen Kleidern, die ich vorher nie gesehen habe. Die Stoffe wirken rau, aber robust. Ihr Schuhwerk ist klobig, aus Material, das ich nicht kenne oder was Frauen sonst tragen. Sie ist wunderschön, das kann ich nicht leugnen. Ich habe das merkwürdige Bedürfnis, ihr die Strähne, die der Wind ihr ins Gesicht weht, aus jenem zu streichen, allerdings werde ich diesem Verlangen nie nachkommen – so bin ich nicht. Etwas in mir regt sich, doch es ist genauso schnell wieder verschwunden, wie es gekommen ist. Ich fühle mich eigenartig, wenn ich sie ansehe und das ärgert mich maßlos. Warum denke ich überhaupt über sie nach? Ich kenne sie nicht und habe kein Interesse daran, dies zu ändern. Es liegt daran, dass sie so fremd wirkt, und an dem Mitleid, welches ich für ihre Pein durch den Troll empfinde.
»Sie ist wahrlich attraktiv, nur was ist sie?« Noam geht in die Hocke und mustert sie ebenso ausgiebig wie ich zuvor. »Solche Kleider habe ich noch nie gesehen.« Er zupft an ihrem Obergewand, das eng an ihrem Körper anliegt, aber keine Reize zeigt.
»Ein Mensch?« Cian reibt sich die Seite und stellt sich zu uns. Sein braunes Haar hängt ihm wirr ins Gesicht, was er umgehend hinters Ohr klemmt, während er sein Schwert zurück in die Lederscheide steckt und das Blut zuvor an einem großen Blatt abwischt.
»Für einen Menschen ist sie fast zu schön. Ihr Haar, so etwas habe ich noch nie gesehen.« Noam wirkt nachdenklich. Sachte hebt er eine Strähne ihres langen Haares hoch. Ich denke darüber nach, ob es so weich ist, wie es aussieht, doch das frage ich ihn besser nicht, er würde mich für verrückt erklären. Wieso auch immer mich ihr Anblick verwirrt, ich will nicht weiter grübeln, sondern endlich nach Hause. Die Nacht ist lang gewesen, also bücke ich mich und hebe sie in meine Arme, um hier wegzukommen. Das Flüstern der Bäume verstummt, sie sind zufrieden, dass wir den Troll getötet haben, der ihnen Schmerzen bereitet hat. Sanft raschelt das Laub im Wind, weht uns dabei lose Blätter vor die Füße.
Mir steigt der Duft des Mädchens in die Nase. Sie riecht frisch und süß. Kurz schließe ich die Augen, atme tief ein. Sie duftet bezaubernd nach Vanille. Ihr Haar, auch wenn ich es nicht habe wissen wollen, ist genauso seidig, wie es anmutet. Kein Mensch in ihrem Alter hat in den Dörfern so ein gepflegtes Äußeres, dafür ist die Arbeit zu hart. Ist sie eine Adelige? An ihren langen Wimpern glitzern Tränen, während auf ihrer Stirn eine dicke Beule die Platzwunde betont. »Wir müssen sie mitnehmen«, brumme ich widerwillig. Ich ahne, dass sie mir Ärger machen wird. Mein Gefühl täuscht mich selten – sie schreit regelrecht danach.
»Vielleicht ist sie auf dem Weg zu uns gewesen?« Cian reibt sich den Nacken. »Wer weiß, womöglich kommt sie aus einem der Flussdörfer von der anderen Seite des Berges und hat uns um Hilfe bitten wollen oder sich verlaufen.«
»Mach dich nicht lächerlich. Sie soll alleine über die Bergroute gekommen sein, wo es von Trollen wimmelt? Niemals! Außerdem wäre sie maßlos dumm, ohne Begleitung unterwegs zu sein – als Frau.« Wir machen uns auf den Heimweg, wobei ich die Fremde die ganze Zeit in meinen Armen trage. Sie ist leicht wie eine Feder. Ihr kleiner Körper schmiegt sich in meine Arme, während ihr Kopf an meiner Brust ruht. Es fühlt sich nicht richtig an, sodass ich sie am liebsten an Cian, der sich immer noch unauffällig die Stirn reibt, reichen möchte, doch ich kann es nicht. Ich versuche, ihren himmlischen Duft zu ignorieren, was mir schwerfällt, weil er zu exotisch ist. Warum fällt mir überhaupt auf, wie gut sie riecht?
»Eventuell ist sie ja kein Mensch.« Noam beäugt sie weiterhin neugierig, wobei der Blick, den er ihr zuwirft, mich innerlich knurren lässt. Er soll kein Interesse an ihr haben, schließlich wissen wir nicht, wer oder was sie ist. Egal, denn dass uns ihr Erscheinen Missvergnügen bereiten wird, spüre ich bereits innerlich. Zusammen mit einem anderen Gefühl, welches ich nicht verstehe. Möglicherweise zieht mich ihr äußeres Erscheinungsbild an, was weiß ich. Was auch immer es ist, es ist unwichtig.
Kapitel Drei
Mein Körper fühlt sich völlig zerschlagen an. Mühsam öffne ich die Augen, ein schmerzhaftes Stöhnen entweicht mir ungewollt. Meine Lider schließen sich wie von selbst wieder, während es in meinem Kopf fürchterlich hämmert. Das muss der schlimmste Kater meines Lebens sein! Was für verrückte Träume ich gehabt habe, unfassbar. Dafür würde jeder Psychiater Eintritt zahlen oder mich sogar direkt einweisen sowie im Anschluss den Schlüssel im Meer versenken. Drachen und Berge, die verschwinden … Absolut lächerlich!
Ich sammle mich kurz, zwinge meine Augen umgehend dazu, sich erneut zu öffnen. Blinzelnd gewöhne ich mich schwerfällig an die Helligkeit, die in meinen Augen brennt. Mein Blick huscht umher, doch am liebsten möchte ich einfach weiter schlafen oder besser aufwachen, denn das, was ich sehe, kann kaum der Realität entsprechen. Der Raum ist mir völlig fremd. Ich liege in einem großen Bett, unter einer schweren, weichen Decke. Versuchsweise bewege ich meine Füße, woraufhin die Decke raschelt. Immerhin scheint mein Körper zu funktionieren, auch wenn er wehtut. Über mir befinden sich dicke Vorhänge, die das Bett umranden. Durch einen kleinen Schlitz dringt minimales Licht. Da ich weder der Typ für Besäufnisse noch für One-Night-Stands bin, bezweifle ich, dass ich mit jemanden nach Hause gegangen bin. Diese Erklärung fällt demnach weg, aber das, woran ich mich erinnere, ist so verrückt, dass ich eher das Besäufnis in Betracht ziehe. Durch den Schlitz sehe ich ein Feuer im Kamin prasseln. Vorsichtig beuge ich mich vor. Die Schmerzen in meinem Rücken sind zwar höllisch, dennoch muss ich wissen, wo ich bin. Den Vorhang ziehe ich achtsam zur Seite, schaue mich genauer um. Augenscheinlich bin ich alleine, was mich etwas beruhigt. Die Decke, der Boden und die Wände sind aus Holz, Äste und grüne Zweige wachsen durch ein Fenster in den Raum. Es wirkt, als sitze ich direkt in einem Baum. Alles scheint aus einem Stück Holz geschaffen worden zu sein. So etwas habe ich noch nie gesehen, aber es ist wunderschön, einzigartig. Ein riesiger Kleiderschrank nimmt fast die komplette Wand ein. Er ist ebenfalls aus Holz und reich verziert mit wundervollen Schnitzereien. Blumenranken schlängeln sich die Länge hinauf, gehen in große Blüten über und verdünnen sich zu weiteren Ranken, die Kreise bilden. Ein wahres Meisterwerk. Mitten im Raum steht ein rustikaler Tisch mit zwei Stühlen und einem silbernen Krug darauf. Plötzlich merke ich, wie ausgedörrt mein Hals ist. Mühsam kämpfe ich mich aus der weichen Decke, was schwerer ist, als man denkt. Meine nackten Füße berühren den Boden. Entsetzt schaue ich an mir hinab. Nackte Füße? »Was zum …«, fluche ich laut. Wo sind meine Jeans und meine Stiefel hin? Das ist doch ein schlechter Scherz! Jemand hat mich tatsächlich ausgezogen, als ich geschlafen habe. Der Gedanke gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt trage ich ein helles, weiches Kleid mit goldenen Ranken. Es schmiegt sich eng an meinen Oberkörper, betont so ziemlich jede Rundung, die ich besitze, und läuft von der Hüfte abwärts großzügig aus. Es ist so gar nicht das, was ich sonst im Alltag trage, oder was ich bezahlen kann. Mit den Händen betaste ich meinen Kopf, bemerke, dass sogar mein Haar geflochten ist, welches in einem langen Zopf an meinen Rücken hinunterfällt. Wie kann ich mich daran nicht erinnern? Hat man mich betäubt? Was ist mit mir passiert? K.-o.-Tropfen? Eine Entführung? Würde man mich dann in solch ein Zimmer stecken? Unvorstellbar. Das widerspricht sich alles. Verdammt, meine Kopfschmerzen sind kaum auszuhalten.
Vorsichtig tapse ich zum Tisch und bleibe einen Moment unschlüssig stehen. Mein Durst ist übermenschlich, weshalb ich zögerlich den Krug greife und an dem Inhalt schnuppere. Es riecht zwar nach nichts, sieht aus wie Wasser, doch wer sagt mir, dass es nicht mit Drogen versetzt ist? An meiner Lippe nagend bin ich hin und her gerissen. Der Durst ist so schrecklich, dass ich alles für ein Glas Wasser geben würde. Während ich weiterhin hadere, drehe ich den Krug in meinen Händen und kann nicht anders, als ihn ebenfalls zu bewundern. Er ist aus Silber, sehr filigran gearbeitet, mit Kristallen versetzt, die seinen Rand schmücken. Ein weiteres Meisterwerk. Selbst der Kelch auf dem Tisch passt dazu und zeugt von ungeheuren handwerklichen Fähigkeiten. Das muss alles ein Vermögen gekostet haben und sie stellen es mir einfach ins Zimmer? Sie kennen mich gar nicht. Was, wenn ich eine Diebin wäre? Diese Teile gehören in ein Museum, sie wirken antik und unfassbar alt. Ich habe noch nie ein vergleichbares Stück in den Händen gehalten, nur in Geschichtsbüchern gesehen. Ob ich will oder nicht, meine Neugierde übernimmt die Oberhand.
Ich erkunde den Raum weiter, fahre mit den Händen über das Holz der Wände, was mich meinen Durst völlig vergessen lässt. Es wirkt, als ist der Raum komplett aus einem Stück Holz hergestellt worden, was bei der Größe schier unmöglich ist. Solche großen Bäume gibt es nicht. Staunend öffne ich den großen Schrank, der mit wunderschönen Kleider bestückt ist. Vorsichtig betaste ich die weichen Stoffe, die unter meinen Fingern rascheln. Ein Stück ist schöner als das andere. Ich seufze verzückt, denn schließlich träumt jedes Mädchen von solchen Kleidern. Den Schrank lasse ich offen und setze meine Erkundung fort. Langsam fahre ich mit den Händen über die Ablage des Frisiertisches, schaue in den Spiegel. Ich erkenne mich in diesem schönen Kleid selbst kaum wieder. Es betont meine helle Haut, lässt mein rotes Haar leuchten wie noch nie. Zöpfe, Frisuren allgemein, sind nicht unbedingt meine erste Wahl, ein einfacher Pferdeschwanz genügt, für alles andere habe ich zwei linke Hände. Dieser Zopf, wer auch immer ihn geflochten hat, ist allerdings perfekt und lässt mich strahlen. Unter meinen grünen Augen liegen tiefe Schatten, an meiner Stirn habe ich eine dicke Beule vom Ausmaß eines Golfballs. Ich verziehe bei dem Anblick das Gesicht. Kein Wunder, dass mich solche Kopfschmerzen plagen. Die Platzwunde hat jemand gesäubert, während das Blut bereits geronnen ist, es scheint zu heilen. Gut, wenigstens etwas Positives. Wer auch immer mich hergebracht hat, hat mich ebenso versorgt. Dann kann es ja kein schlechter Mensch sein. Meine Arme sind von Kratzern übersät. Ich ahne, dass mein Rücken nicht besser aussieht, was die Schmerzen erklärt. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich von einem Baum gefallen. Na ja, eher gesprungen. Kann ich dieser Erinnerung trauen? Das ist absurd.
Ich wende mich vom Spiegel ab, trete ans Fenster. Vorsichtig schiebe ich die Ranken beiseite, die sich weicher anfühlen, als ich erwartet habe, bevor ich hinaus luge. Heilige Maria! Offensichtlich träume ich doch. Vor mir erstreckt sich eine Welt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, was ich erwartet habe, das jedenfalls nicht. Ich blinzle ungläubig in die Sonne, die warmen Strahlen kitzeln meine Nase. Alles, was ich sehe, versuche ich, zu erfassen, um es für immer in meinen Gedanken abzuspeichern – so wunderschön ist es.
Das Zimmer gehört zu einem verdammt großen Baum, einem riesigen Klotz. Obwohl ich mich vorbeuge, ist es mir unmöglich, seine Baumkrone zu sehen und dessen Ausmaß einzuschätzen. Er bildet den Mittelpunkt einer ganzen Reihe solch majestätischer Bäume, in denen ich Menschen sehe, die in den Stämmen leben, und deren Bäume durch dicke Äste verbunden sind. Das ist verrückt und wunderschön zugleich. Wie kann man so friedvoll mit der Natur leben? Wo bin ich nur gelandet?
Ich lehne mich weiter vor. Ein Vogelschwarm, bunt wie der Regenbogen, wird dabei von mir aufgeschreckt. Sie haben neben meinem Fenster auf einem Ast gesessen, jetzt steigen sie hinauf in den Himmel wie bunte Farbkleckse. Verärgert piepen die kleinen Schönheiten und lassen mich bei so einer Farbpracht auflachen. Solche Vögel leben sonst nur im Paradies, ganz bestimmt. Leuchtende, satte Farben, dass ich mich wie ein Kind im Märchen fühle. Meine Angst ist, bei dem Wunder, welches sich mir gerade offenbart, völlig vergessen. Ich liebe Märchen seit Kindheitstagen und fühle mich, als bin ich mitten in einem gelandet. Vorsichtig strecke ich meine Hand nach einem kunterbunten Vogel aus, der auf dem Ast sitzt, doch er dreht mir den Rücken zu. Schnell hopst er einige Zentimeter von mir weg, ich kann es ihm nicht verdenken. Ich bin mir sicher, dass hier ist nicht mein Zuhause oder die Welt, wie ich sie kenne. Wo auch immer ich bin, ich muss weit, weit weg sein. Solche Bäume gibt es bei uns nicht, diese bunten Vögel sind mir fremd – ich habe schon einiges auf der Welt gesehen. Wir sind in meiner Kindheit viel gereist, aber das, nein, das habe ich noch nie erlebt oder gar davon gehört.