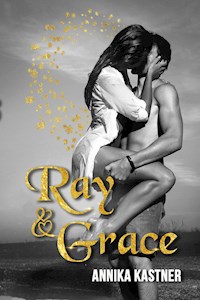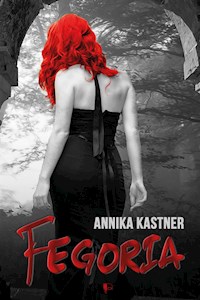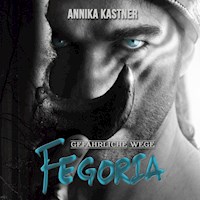Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Booklounge Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fegoria
- Sprache: Deutsch
HIER ENDET UNSERE GESCHICHTE NICHT, SIE BEGINNT ERST. »Es gibt nichts, was ich mehr begehre als meine Seelengefährtin.« Der letzte Kampf steht bevor. Crispin braucht eins mehr als alles andere: Verbündete. Er hat Fegoria bewiesen, dass ein Bündnis mit den Alben möglich ist. Nun liegt es an Elil, Crispins Befehl auszuführen und ihm seine Loyalität zu beweisen. Die Götter haben hingegen andere Pläne und spinnen die Fäden im Hintergrund geschickt zu ihren Gunsten. Was für eine Hexerei hält ihn auf der Insel, auf der er gestrandet ist, gefangen? Licia ist die letzte ihrer Art - die letzte Tochter des ewigen Waldes. Der Faunus hat von ihrer Welt Besitz ergriffen. Als ist ein Monster nicht genug, strandet auch noch ein Alb auf ihrer Insel. Sie ist sich sicher, dieser Krieger führt nichts Gutes im Schilde: Wer tötet sie zuerst?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fegoria
In den Wäldern des Faunus
Roman
Annika Kastner
Erstausgabe im Juni 2022
Alle Rechte liegen beim Verlag
Copyright © Juni 2022
Booklounge Verlag
August-Bebel-Str. 57
23923 Schönberg
Inhalt
Willkommen
Zitat
Fegoria - In den Wäldern des Faunus
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Elil
Licia
Playlist
Willkommen
Hallo, meine lieben Leser. Schön, dass ihr wieder den Weg nach Fegoria gefunden habt.
Diesmal stehen nicht Alice & Crispin im Vordergrund und doch ist diese Geschichte ein wichtiger Schritt, den unsere Freunde gehen müssen, damit Crispin sein Schicksal erfüllen kann. Ich habe beim Schreiben nie erwartet, dass Elil sich so in unser Herz schleichen wird, aber er tat es. Daher habe ich beschlossen, ihm seine eigene Geschichte zu geben. Es wird uns vor allem die Albe näherbringen. Wie sagt man so schön? Nichts ist einfach nur schwarz und weiß, nein, es gibt auch Grautöne. Und unsere Gruppe muss lernen, einander zu vertrauen, zusammen zu arbeiten und darauf hoffen, dass die Götter ihre Pläne haben.
Ich widme dieses Buch jedem, der Bücher und Fantasy so liebt wie ich.
Ich widme es dir, mein lieber Leser, denn ohne dich gäbe es diese Welt nicht.
Meinem Mann Philipp und meinem wundervollen Sohn danke ich von Herzen. Jungs, ich liebe euch so sehr!
Und meinen Freunden und meiner Familie. Danke, dass es euch gibt.
Vor allem auch meinem Vater, ich wünschte, du könntest noch einmal in die Welt von Fegoria eintauchen, und die Reise mit uns erleben.
Und auch ein Dank an Sabrina, für all die Jahre, die wir nun zusammenarbeiten. (Anm. v. Verlag – Sabrina dankt dir ebenso und hat dich vollends ins Herz geschlossen.)
Eure Annika
Zitat
Dem Schicksal kann man nicht aus dem Weg gehen, wenn zwei Seelen sich treffen.
Zitat – Verfasser unbekannt
Fegoria - In den Wäldern des Faunus
Vielen Dank an Diana Gus!
Elil
Wie ein Dieb schleiche ich mich im Morgengrauen davon, noch bevor die ersten Vögel zum Morgenlied ansetzen oder die ersten Wüstenmäuse ihre Nasen aus dem Sand schieben. Unbemerkt verschmelze ich mit dem Zwielicht, ehe die Sonne wirklich aufgeht und dem Mond seine Schranken weist, um die Schatten der Nacht zu vertreiben. Es ist die Zeit, die ich am meisten mag. Die Stille. Die Dunkelheit. Die Ruhe, die sie für meine aufgewühlten Gedanken bringt. Das Wissen, dass hell und dunkel nebeneinander existieren können. Meine Schritte sind leise, kaum zu vernehmen, denn ich verstehe mich in dem, was ich mache.
Es liegt mir im Blut, mich wie ein Schatten zu bewegen, ein Trugbild in der Finsternis, und wenn ich nicht gesehen werden möchte, so bleibe ich unbemerkt. Einer der Gründe, wieso Castiell stets auf mich gesetzt hat und ich jahrelang seine Truppen anführen durfte, ehe Grimm sich bequemte, meinen Platz einzunehmen. Unverdient wohlgemerkt, wofür ich seinen Kopf noch immer in den Boden rammen könnte. Während ich mir meinen Ruf hart erkämpfen musste und ihn mit Blut und Schweiß bezahlt habe, so bekam er meinen Rang vor die Füße gelegt, nur, weil er als Sohn des Königs geboren worden war. All das Leid, die Anstrengungen und die Schmerzen, die ich erduldet habe, nur um mir einen Namen zu machen. Und all das habe ich aufgegeben, für das hier. Diesen Ort, den ich jetzt Heimat nenne und der so anders ist als alles, was ich kenne – in jeglicher Hinsicht.
Ein kurzes Gefühl des Bedauerns durchzuckt mich, ohne es verhindern zu können. Ein Leben löscht man nicht von heute auf Morgen aus. Nein, ich bin noch nicht vollends angekommen, hier, in meiner neuen Heimat, meinem neuen Platz und der Verantwortung, die er mit sich bringt. Ebenso dem Vertrauen, welches Crispin und Alice mir zollen. Es ist ein neues, ein anderes Leben. Eins, das mir noch nicht so ganz passt, aber immer mehr zu meinem wird. Es gefällt mir, wie sonderbar es hier ist und wie anders ich sein kann. Eine ganz andere Version von mir als jene, die ich all die Jahrhunderte verkörpern habe müssen.
Spion, Mörder, Krieger – im Laufe der Jahrhunderte, die ich nun in Fegoria verweile, hat es viele Bezeichnungen für mich gegeben. Ich höre sie flüstern, die anderen Wesen, spüre ihre Angst und das Misstrauen, welches sie mir entgegenbringen. Ich werde anders angesehen als die Elben, dabei sind sie uns im Kern ähnlicher, als man denkt. Allerdings ist mir gleich, was sie über mich reden oder gar denken. Ich habe mir nie viel aus der Meinung der anderen gemacht. Ehre für den Namen der Familie. Loyalität, Anerkennung, Ruhm. Alles Dinge, nach denen wir stets streben, nach denen ich bis vor Kurzem gestrebt habe, weil ich der Meinung gewesen bin, dass es für mich nur einen Weg gibt. Gnadenlos, tödlich, ohne Gewissen, so sagt man es meinem Volk nach und so habe ich mich verhalten. Wenn sie über uns reden und diese Worte wählen, haben sie kein Unrecht. Aber ist es nicht die Welt selbst, die uns genau dazu macht? Erfülle ich nicht die Rolle, die mir angedacht ist? Habe ich eine Wahl – bis jetzt? Nein. Ich bin in dieses Leben und diese Welt hineingeboren worden, habe unter der Herrschaft von Castiell jenes getan, um zu überleben und das Überleben meiner Schwester zu sichern. Es ist nun mal die Art und Weise, wie wir leben.
Niemand hat je gefragt, ob wir uns nicht auch nach mehr sehnen. Nach einem Zuhause, wo die Sonnenstrahlen mich durch das Fenster wecken, statt auf den kalten Stein zu starren. Nicht, dass ich es zugeben würde, aber ich genieße es, den warmen Wüstensand unter meinen Füßen zu spüren und jetzt im Wüstenhain die Sonne aufgehen zu sehen. Ich mag die Hitze und wohlige Wärme. Und es geht nicht nur mir so. Ich sehe es meinem Volk an, all den Alben, die mir hierher gefolgt sind. Es wirkt so, als würden sie das erste Mal frei atmen können, denn Castiells Augen wachen nicht länger über sie. Jene, die alles riskieren, weil sie mir vertrauen und hierher gefolgt sind, zu ihrem einstigen Feind. Nur mein Wort darauf, dass wir Willkommen sein werden. Ja, selbst ich habe lernen müssen, zu vertrauen, in Alice und Crispin, auch wenn es mir anfangs schwergefallen ist und ich nur meine Schwester vor Ärger bewahren habe wollen, kann ich heute einen Elben meinen Freund schimpfen.
Freund. Elbenfreund. Es geht mir noch nicht locker von der Zunge. Manchmal irritiert es mich, aber es ist die Wahrheit. Der König der Elben und Gemahl meiner Cousine ist mein Freund. Mein Verbündeter. Crispin, jener, der seit Jahrhunderten mein Feind gewesen ist. Ein genauso großer Krieger wie ich, auch wenn ich ihm das nie sagen würde. Wären wir je gegeneinander angetreten, weiß ich nicht, wer von uns gesiegt hätte. So ungern ich es mir eingestehe, sind wir uns ähnlicher, als man meinen mag. Mein Leben hat sich wirklich von Grund auf gewandelt.
Die Abenteuer, die ich nun erlebe, sind anders als alles Vorherige. Crispins Aufgaben an mich sind nicht vergleichbar mit denen Castiells. Er erwartet nicht, dass ich Angst und Schrecken verbreite oder Gewalt anwende, um Furcht zu schüren. Ich kann frei entscheiden, mich einbringen und dazu beitragen, diese neue Ordnung aufzubauen, ohne mit einer Bestrafung rechnen zu müssen, wenn ich anderer Ansicht bin als mein König. Ich bin nicht nur ein Zuschauer, sondern kann für mein Volk das beste erwirken. Dieses Wissen verursacht eine tiefe Befriedigung in mir und beweist, dass es wert ist, altes hinter sich zu lassen. Ich fühle mich als wertvoller Teil von etwas Großem und glaube fest an Crispin als König. Seine Ideale sind edelmütig und groß. Mit Alice an seiner Seite wird er uns Frieden bringen, da bin ich sicher.
Crispin ist ein anderer König als Castiell oder Elon. Er ist zwar meist kühl und reserviert zu anderen, aber nicht grausam. Er versucht, etwas zu bewegen, mit allen Mittel und Wegen, auf seine Art. Sein Volk verehrt ihn für seine Tapferkeit, den Mut und die Hingabe, die er an den Tag legt. Den, der eine Albin zu der seinen gemacht hat, ein Zeichen gesetzt hat, allen Widrigkeiten zum Trotz. Er hat jede Regel Fegorias gebrochen. Für sie, eine Albin. Er hat Blut und Schweiß gelassen, das ganze Land durchquert, nur um sie zurückzuholen und sein Leben anschließend in die Hände eines Alben gelegt – in meine Hände wohlgemerkt. Sein Wille ist unermüdlich, ebenso seine Liebe zu ihr. Daran zweifelt niemand mehr, nicht hier. Ich am Allerwenigsten.
Wo wir gerade bei ihr sind: Alice – sie stellt ganz Fegoria auf den Kopf, aber auf eine gute Art und Weise, auch wenn sie immer wieder aneckt. Sie schenkt uns Hoffnung, wo es keine gibt, auch wenn ich mir wenig Chancen auf eine Seelengefährtin ausmale, gönne ich es meinem Volk. Jedem, dem dieses Privileg zugeteilt sein wird. Viel zu lange haben sie unter Castiells Tritten und Tyrannei leiden müssen. Dass wir verhasst und gefürchtet sind, kann ich Fegoria nicht verübeln. Wir sind nicht unschuldig an dieser Angst. Und doch haben wir stets das getan, was unser Oberhaupt befohlen hat, denn eine Wahl gibt es für keinen von uns. Nein, ich korrigiere mich – hat es einst gegeben. Jetzt haben wir sie!
Ich nehme die ängstlichen Blicke der anderen Wesen durchaus wahr, aber sie werden sich an uns gewöhnen und merken, wie sehr wir uns bemühen. Eines Tages. Wir geben unser Bestes, na ja, wir versuchen es wenigstens. Man kann schließlich nicht über Nacht ein anderer werden. Wir sind, wie wir sind. Aber wer definiert Gut und Böse? Wenn ich ehrlich bin, werde ich gern gefürchtet. Ich genieße den Respekt, der mir entgegengebracht wird. Angst sorgt für Vorsicht, was wiederum für Sicherheit und Kontrolle sorgt. Nur so habe ich meine Familie all die Jahre schützen können, oder das, was noch davon übrig geblieben ist.
Fühle ich Bedauern für all die Toten, die auf den Schlachtfeldern durch meine Hand gestorben sind? Nein. Würde ich es tun, würde es mich zerfressen. Sie oder ich. Ich habe getan, was nötig gewesen ist, um zu überleben, und meine Schwester zu schützen. Mit diesem Wissen kann ich nachts ruhig schlafen. Würde ich es wieder so machen? Auf jeden Fall, wenn ich die, die mir am Herzen liegen, so schützen kann.
Ich mustere die Wachen im Vorbeigehen und kneife verärgert die Augen zusammen. Verfluchte Zwerge, eingeschlafen mit dem Trinkschlauch in der Hand. Man sollte sie zur Strafe auspeitschen, an den Pranger stellen. Sie sollen Wache halten, sich nicht bis zu Besinnungslosigkeit betrinken. Halt, schalle ich mich selbst. Das wird hier anders geregelt. Trotzdem möchte ich ihm meine Faust in den Magen rammen und aufwecken, weil er nicht nur sich gefährdet, sondern alle, die sich auf ihn verlassen. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, achtsam zu sein. Castiell und Grimm werden nicht lange die Füße stillhalten – nein, ich kenne beide besser, als mir lieb ist. Sie werden Rache nehmen und Pläne schmieden. Schreckliche Pläne, in denen keiner von uns überleben wird. Castiells Vergeltungsschlag ist uns sicher. Dafür, dass Crispin Alice zurückbekommen hat und vor allem auch Rache an uns, jenen, die ihm den Rücken gekehrt haben. Castiell verzeiht nicht, es gibt keine zweiten Chancen. Auch uns erwartet dort nur noch der Tod. Wir sind Verräter. Dieses Wort schmeckt bitter. Bin ich ein Verräter, wenn ich mir nur das Beste für mein Volk erhoffe?
Ich gebe ein Zeichen mit meiner Hand und aus dem Schatten löst sich ein Alb, den ich dort in weiser Voraussicht positioniert habe. Er nickt mir zu, verschmilzt dann wieder mit der Dunkelheit – für unwissende Augen unsichtbar. Vorsicht ist gut, Kontrolle ist besser. Ich habe meine eigenen Wachen aufgestellt, die unser Zuhause im Auge behalten. Ich leiste still meinen Beitrag zum Wohle aller, ohne, dass Alice und Crispin es erfahren müssen. Ich erwarte keinen Dank oder Lobpreisungen, meine Krieger ebenfalls nicht. Sie vertrauen auf meine Führung und sind stolz auf jenes, was sie leisten. Nein, wir machen das, was getan werden muss. Dies habe ich stets so gehandhabt. Ihr Volk ist nun auch mein Volk. Dieser Ort ist unser Zuhause, wo alle leben, die mir etwas bedeuten. Diesen Ort gilt es, zu schützen, und zwar mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.
Alice und Crispin haben genug erlebt, sie müssen Kraft sammeln für jenes, was vor ihnen, ach was, vor uns liegt. Darum ist es jetzt an mir, die mir aufgetragene Aufgabe zu erledigen. Egal, ob es mir gefällt oder nicht, sie zu verlassen. Wie wird das Ende aussehen? Ich weiß es nicht. Bei den Göttern, werde ich es erleben? Nun aber, handle ich im Auftrag von Crispin, unserem König.
Ich werde zu der Insel der Wolfsmenschen reisen und schauen, ob Castiell bereits dort gewesen ist oder ob wir dort mehr Verbündete finden werden, nachdem der letzte Posten auf dem Festland von ihm vernichtet worden ist. Wir sind viel zu wenige, um zu siegen. Castiell sammelt ebenso Anhänger wie wir. Alle Stämme der Wolfsmenschen auf dem Festland sind ausgelöscht. All meine Drachenreiter haben nur noch Schutt und Asche vorgefunden. Es gibt keine Überlebenden, aber wenn es noch welche geben sollte, dann werde ich sie dort finden. Die Zeit arbeitet gegen uns und ich weiß, wie schwer Crispin diese Bitte an mich gefallen ist und doch hat er darum gebeten – seinen einst größten Feind. Dies ist mehr Vertrauen, als ich jemals erwartet habe. Es erfüllt mich mit Stolz. Er weiß um meine Qualitäten. Auf Bararod, meinem Drachen, werde ich schnell sein, viel schneller als jedes Pferd oder Boot. Ich höre sein Schnauben schon von Weitem, er wittert mich, als ich mich den Höhlen nähere.
Meine Mundwinkel verziehen sich zu einem ehrlichen Lächeln, als ich die dunkle Felsspalte betrete, in der er mit den anderen Drachen ruht, geschützt vor der brennenden Sonne. Im Gegensatz zu mir mag er es dunkel und feucht, die Hitze setzt ihm eher zu. Ich bleibe im Eingang stehen, kurz darauf erscheint er aus der pechschwarzen Dunkelheit. In seinen Augen spiegeln sich das Mondlicht und die Sterne, die über mir am Firmament funkeln, wider. Majestätisch ragt er über mir empor. Aus einem Impuls heraus lege ich meine Stirn an seine, nachdem er den Kopf senkt. Seine Haut ist fest wie Leder und warm. Er ist nicht nur ein Reittier, nein, er ist durchaus mehr.
»Hallo, mein Freund, bist du bereit für ein neues Abenteuer«, begrüße ich ihn, mein Schutztier. So viele Jahre sind wir schon aneinandergebunden. So viele Kämpfe haben wir ausgetragen und Narben davongetragen – innerlich und äußerlich. Er ist mehr als eine Kreatur an meiner Seite. Er ist ein treuer Freund und Gefährte.
Das erste, was Castiell einem austreibt, sind Gefühle. Dabei habe ich immer mehr gefühlt als andere Albe, es nur besser zu verstecken gewusst. Vollkommen anders als meine Schwester, die all ihre Empfindungen offen darlegt. Als Castiell gemerkt hat, wie zielstrebig und wertvoll ich für ihn bin, hat er mein Training persönlich übernommen. Meine Familie trägt den Namen großer Kämpfer. Allen voran Kota, Alice‘ Vater. Ich stamme aus einer angesehenen Familie, mein Rang und das Prestige bringen eine gewisse Verantwortung, einen Ruf, dem ich gerecht werden will. Es hat da eine Albin in meiner Jugend gegeben, sie ist … zu sanft, viel zu sanft gewesen, wenn ich heute an sie denke. Aber wir sind Freunde gewesen, wenn man es so nennen kann, ich habe sie mit durch das Training bringen wollen, doch Castiell hat es als Schwäche gedeutet, dass ich mich für sie eingesetzt habe. Mitgefühl macht schwach. Nichts verachtet er mehr. Nein, er will seine Krieger gefühllos, kalt. Es darf uns nicht kümmern, was mit den anderen geschieht.
Eines Morgens habe ich sie enthauptet vor meiner Tür aufgelesen. Ich habe die Botschaft verstanden. Sie ist in seinen Augen entbehrlich gewesen, nichts wert. Im Reich der Albe darf man nicht lieben. Man darf nichts fühlen, oder man wird von Castiell vernichtet. Ich bin froh, dass es an jenem Tag nicht Alliarias Kopf gewesen ist. Jeder kann ihm von Nutzen sein oder den Platz freimachen. Unter seiner Herrschaft gibt es täglich Auspeitschungen und Hinrichtungen. Auch wenn meine Narben geheilt sind, spüre ich sie, die Peitschenhiebe für Ungehorsam, für Fehler. Versagen darf man nicht. Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich mache keine Fehler mehr und bin stärker denn je. Ich zeige keine Gefühle, bin zu dem Krieger geworden, den er für mich angedacht hat, nur, dass ich jetzt für die andere Seite mein Leben einsetze, mit Freuden. Dies hat niemand vorhersehen können, ich am wenigsten. Ich kämpfe nicht nur mit. Nein, ich kämpfe für einen Elben.
Meine Schwester Alliaria ist wie Alice. Eine Träumerin. Es ist so schwer gewesen, sie all die Jahre zu schützen und zu vertuschen, dass sie Kranke gepflegt oder Essen an jene, die nicht genügend davon haben, verteilt hat. Sie und ihr weiches Herz sind die größte Gefahr für sie selbst. Das ist auch der Grund, weshalb ich heute überhaupt hier stehe. Bereue ich es? Absolut nicht! Das Wissen, dass sie hier sicher ist, lässt mich des Nachts besser schlafen. Mein Posten ist mir stets zugutegekommen, um Alliaria zu helfen, sie zu schützen, wenn sie wieder zu leichtsinnig gewesen ist. Nicht zu vergessen die Furcht, es sich mit mir zu verscherzen, sollte man ein falsches Wort darüber verlieren, was man eventuell glaubt, gesehen zu haben. Nur so hat sie überhaupt die Stelle als Zofe ergattern können und ist auf Alice getroffen – es ist mein Rang, mein Einfluss gewesen.
So, genug davon, ich habe eine Aufgabe, die es zu erledigen gilt und die meine volle Aufmerksamkeit benötigt. Ich verschränke die Finger ineinander und lasse sie knacken, ehe ich die Höhlen verlasse. Bararod folgt mir ins Freie, atmet tief die kühle Morgenluft ein. Er schüttelt sich und streckt seine langen muskulösen Glieder von sich, ehe er mich erwartungsvoll anblickt und drauf wartet, dass ich aufsitze. Ich werfe noch einen Blick auf mein neues Zuhause, welches schlafend vor mir liegt, und verabschiede mich still. Mögen wir uns wiedersehen, wenn die Götter es für richtig erachten. Wer weiß, wohin mein Weg mich noch führen wird …
Kaum sitze ich auf, breitet Bararod seine langen Schwingen aus und steigt empor in den Nachthimmel. Der Wind reißt an mir, während ich mich an ihm festhalte.
Ich halte mich oben, weit über den Wolken, genieße den kalten Wind, der mir ins Gesicht weht, und schließe kurz die Augen, lasse mich völlig in diesem Moment gehen. Frei. Hier oben bin ich fessellos. Das Gefühl, alles ist realisierbar, begleitet mich schon immer. Gelöst von sämtlichen Pflichten für einen winzigen Augenblick. Ein Gefühl, welches nicht unmöglich zu sein scheint, wenn ich hier oben in die unendliche Ferne blicke. Nur ich und meine Gedanken.
Als Bararod mich gefunden und sich dazu entschlossen hat, sich mir anzuschließen, ist es einer der besten Tage meines langen Lebens gewesen. Nicht jedem Alb ist ein Drache vergönnt. Sie wählen ihre Gefährten genau aus und ich weiß dieses Privileg zu schätzen. Ich lebe für das Fliegen. Schon immer ist es mein größter Traum gewesen, eines Tages hier oben zu sein, wo sonst nur Mond und Sterne in der Nacht funkeln und die Sonne uns wärmt. Bararod kennt meine dunkelsten Geheimnisse und ist mir stets ein treuer Gefährte. Er würde für mich sterben, das weiß ich. Wie oft habe ich mich ihm anvertraut, wohlwissend, dass er weder wertet, noch urteilt. Drachen sind überaus feinfühlig und intelligent. Es ist mir ein Rätsel, wieso Elben dies nicht erkennen.
Hier oben verfliegt die Zeit nur so. Ich könnte ewig weiter reisen, bis ans Ende der Welt. Ich lenke Bararod tiefer, breche mit der Abenddämmerung durch die violette Wolkendecke und lasse das Land hinter mir. Unter mir erstreckt sich nur die Weite des Meeres.
Wir sind den ganzen Tag geflogen, und doch strotzt er noch vor wilder Energie. Den Wüstenhain, die Eisebene, den Nebelwald und auch die Lagunen haben wir weit hinter uns gelassen. Mit jeder Meile wächst aber auch die Sorge, was in meiner Abwesenheit passieren wird. Was, wenn sie mich brauchen und ich nicht schnell genug bin? Es fällt mir schwer, mich auf andere zu verlassen, die Zügel abzugeben. Es kann so viel geschehen. Ich habe mich nie zuvor anderen Wesen so geöffnet wie diesen. Leicht angespannt mustere ich die Umgebung. Immer wieder überfliege ich kleine Inseln, die unter mir farbenprächtig im Licht der Sonne erstrahlen.
Doch in diesem Moment erstreckt sich unter mir ein weites, mir unbekanntes Waldgebiet. Mit hohen Klippen und Bergen. Der Wald wirkt braun und trostlos, was nicht zu dem warmen Klima passt, durch das ich gerade fliege. Es müsste nur so strotzen vor grünen kräftigen Pflanzen. Mysteriös. Ich durchquere diese Route heute zum ersten Mal. Was hätte mich auch vorher zu der abgelegenen Insel der Wölfe führen sollen? Die Stille unter mir sollte friedlich wirken und doch sind all meine Sinne plötzlich auf Vorsicht. Ein Gefühl, dass ich achtsam sein sollte, welches mich schon oft gerettet hat. Doch ich entdecke nichts, was dieses Gefühl ausgelöst haben könnte. Alles ist ruhig. Zu ruhig? Kurz erwäge ich eine Pause, aber ich höre lieber auf die innere Stimme in mir und werde keinen Fuß auf das Eiland unter mir setzen. Tatsächlich frage ich mich gerade, wieso ich überhaupt diese Route gewählt habe. Ich hätte auch weiter südlich fliegen können, sie wäre sogar schneller gewesen, und es war eigentlich auch der ursprüngliche Plan. Habe ich mich verschätzt? Oder war es mein Unterbewusstsein? Es fühlt sich an, als habe mich etwas hierher gelenkt. Als müsste ich genau hier sein, was ich nicht verstehe. Als gäbe es hier mehr als jenes, welches sich gerade zeigt. Unwillkürlich streiche ich mir über mein Herz, verborgen unter meiner schwarzen Kampfmontur. Es klopft hart gegen meine Rippen, als wäre es aufgeregt. Etwas in mir fühlt sich komisch an, ich vermag nur nicht zu sagen, woher das Gefühl kommt – ein leichtes Ziehen in meiner Brust.
»Sei wachsam«, flüstere ich meinen Drachen zu, schmiege mich an seinen Rücken und lasse ihn dicht unter den Wolken fliegen. Aufmerksam beobachte ich den Himmel um uns herum, doch ich vermag nichts zu entdecken, was dieses Gefühl rechtfertigen würde. Ist es mein Instinkt, der Alarm schlägt? Wir sollten wieder an Höhe gewinnen und von hier verschwinden. Meine ganze Aufmerksamkeit ist nach vorne gerichtet.
Von unten schießt etwas aus dem Dickicht der Insel hervor und schlingt sich um die Hinterbeine meines Drachens. Der Angriff trifft uns unerwartet. Ein Ruck geht durch Bararods Körper, als er plötzlich mitten im Flug gestoppt wird und er mich fast über seinem Kopf gleiten lässt. Mit Mühe und Not klammere ich mich an ihm fest, fluche lauthals, während mein Herz wie wild schlägt.
Mit einem lauten Brüllen seinerseits, werden wir plötzlich in die Tiefe gerissen. Ich kann mich gerade so festhalten, um nicht hilflos in die Tiefe zu stürzen. Einen Aufprall von hier würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Selbst als Unsterblicher dürfte es schwer sein, einen Kopf, der bei einem Aufprall aus dieser Höhe sicher platzen würde, neu entstehen zu lassen. Und selbst wenn, an die Schmerzen mag ich gar nicht denken. Meine Hände suchen nach Halt, doch durch den Ruck bin ich aus dem Sattel, direkt auf Bararods Hals, katapultiert worden und drohe immer wieder abzurutschen.
Was zum Henker geht hier vor?
Ich versuche trotz allem an mein Schwert zu gelangen, ohne ihn dabei loszulassen, um meinen Drachen zu befreien, während Bararod sich wehrt und buckelt, mir damit jegliche Chance nimmt, ihm zu helfen. Er ist ebenso verwirrt wie ich. Ich umgreife ihn fester, während der Boden rasend schnell näherkommt. Ein unbekanntes Gefühl der Hilflosigkeit durchzuckt mich. Eine Situation wie diese, hat es noch nie gegeben. Was ist so mächtig und kraftvoll, einen ausgewachsenen Drachen vom Himmel zu pflücken? Bei den Göttern, was ist das für ein Hexenwerk, mit dem wir es zu tun haben?
So schnell wie der Angriff gekommen ist, ist er wieder vorbei und Bararod wird losgelassen, kurz bevor wir durch die Bäume krachen. Er dreht sich wild im Kreis, schlägt verzweifelt mit seinen großen Schwingen und versucht, sich wieder auszubalancieren, doch er hat keine Chance … Wir segeln über die Bäume, Äste schlagen mir ins Gesicht, reißen meine Haut auf. Das Adrenalin unterdrückt jeglichen Schmerz, den ich ansonsten verspüren würde. Ich beiße die Zähne aufeinander, schmecke Blut in meinem Mund. Plötzlich sehe ich zwei große Lianen auf uns zukommen und weiß, wenn sie uns beide erwischen, haben wir endgültig verloren. Bararod ist völlig von Sinnen. Er agiert panisch und unbedacht, so kenne ich meinen Freund nicht. Aber wir sind auch noch nie vom Himmel gepickt worden wie Fliegen. Also handle ich so, wie es mir logisch erscheint, auch wenn es mir schier das Herz bricht.
Ich lasse Baradords Rücken bei der nächsten Drehung los und falle wie ein Stein in die Tiefe, wappne mich für den Schmerz, der mich gleich treffen wird, doch ich werde es überleben. Nur so werde ich uns vielleicht retten können. Ich sehe, wie die Lianen ihn umschlingen, höre sein zorniges Brüllen, ehe sie ihn wegreißen und ich ihn aus den Augen verliere. Wie eine Katze drehe ich mich im Flug, lande in einem der Bäume. Meine Hände suchen Halt, doch ich habe zu viel Schwung und sie rutschen ab, Rinde reißt mir die Haut auf. Mit voller Wucht pralle ich auf einen dicken Ast. Die Luft wird mir aus den Lungen gedrückt. Ich höre sogar eine Rippe brechen.
Scharfer Schmerz schießt durch meinen Körper, ich stöhne gepeinigt auf, versuche Halt zu finden, rutschte allerdings mit den Armen ab und mein Rücken prallt auf dem Ast unter mir auf … Selbst der nächste Ast ist meiner, ehe ich an einem Halt finde und das trockene Laub auf mich hinab rieselt, während ich stöhnend Luft in meine Lungen ziehe. Mit rasendem Herz und schmerzendem Körper klammere ich mich, wie ein Kätzchen auf dem reißenden Fluss, am letzten Baumstamm fest. Verdammte Scheiße, mir rutscht sogar eine Verwünschung heraus, die ich natürlich von Alice gelernt habe. Trotz der Schmerzen ziehe ich mich leise fluchend auf den dicken Ast, beiße die Zähne fest zusammen, um meine Beine nachzuziehen. Ich bestehe aus Schmerzen, mein Körper protestiert. Ich glaube, es gibt gerade kein Körperteil, welches nicht von Pein gequält wird.
Auf dem Ast hockend, muss ich mich erst einmal sammeln. Langsam strecke ich meine Glieder der Reihe nach aus, um zu analysieren, wie schwer ich verletzt bin. Immer wieder verzieht sich mein Gesicht unwillkürlich. Ich habe noch nicht begriffen, was genau uns erwischt hat oder was geschehen ist. Also verschaffe ich mir einen Überblick über das weite Gebiet, welches sich vor mir erstreckt. Blut läuft über meine Stirn, ich wische es gedankenlos fort. Auch das Stechen in meiner Seite versuche ich auszublenden. Gebrochene Rippen sind nicht neu für mich, auch wenn sie verdammt qualvoll sind. Es ist nicht das erste und wird ebenso wenig das letzte Mal sein, dass dies geschieht. Sie werden heilen, das tun sie immer. Qualvoll, aber nicht tödlich. Also heißt es, Zähne zusammenbeißen und zusehen, dass ich Bararod finde.
Der Wald erstreckt sich um mich herum, egal wohin ich blicke: dichter Wald, ein Urwald, alt, sehr alt. Riesige Bäume, bauchige Büsche und niemand zu sehen. Allerdings fehlt das üppige Grün, denn die Bäume wirken krank, ausgedörrt und mit braunen Blättern, statt einem saftigen Grün. Nur wenig farbige Triebe vermag mein Auge zu erspähen, was mich überaus beunruhigt. Nicht einmal Vögel vermeine ich zu hören, was kein gutes Zeichen ist. Es liegt etwas in der Luft, etwas Bedrückendes, gar Düsteres, was ich nicht zuordnen kann und mich zur Vorsicht mahnt. Es verursacht mir einen kalten Schauder am gesamten Körper. Zur Sicherheit kontrolliere ich den Sitz meiner Waffen, die den Absturz gut überstanden haben.
In der Ferne höre ich plötzlich Bararod brüllen, ehe es wieder gespenstisch still wird. Ein Ast knackt unter mir und ich zucke erschrocken zusammen, als das Geräusch die Stille durchbricht. Wo sind die Tiere, die Waldgeräusche, die Vögel, die wir hätten aufscheuchen müssen? Wo ist all das Leben, welches in einem Wald wie diesem herrschen müsste?
Eine dunkle Vorahnung macht sich in mir breit. Egal, was hier vorgeht, es ist nichts Gutes und ich sollte zusehen, dass wir verschwinden. Über diesem Ort liegt eine düstere Atmosphäre, etwas Böses, das ich bis in meine Knochen spüre. Die Bäume, der Boden … Der Herzschlag des Waldes ist durchtränkt von Furcht und Angst, wie nicht einmal Castiell sie bei seinem Volk ausüben kann. Hier haust etwas weitaus Schlimmeres, dem ich nicht begegnen möchte, dessen bin ich mir sicher.
Ich warte ab, verharre reglos, lausche dem Wind, der durch die Bäume rauscht, doch niemand greift mich an. Vielleicht haben sie nur meinen Drachen gewollt und mich nicht mal bemerkt. Wir sind weit oben gewesen, von hier unten wird man mich auf seinem Rücken nicht unbedingt gesehen haben. Ich lasse mich geschickt vom Baum fallen, meine Rippe protestiert unter peinvollem Schmerz und ich unterdrücke mit Mühe ein Stöhnen, als ich hart auf meinen Füßen lande. Stell dich nicht so an, ermahne ich mich selbst. Du hast schon deutlich Schlimmeres erlebt.
Meine Füße versinken im weichen Morast, der meine Stiefel bis zu den Knöcheln einsinken lässt und ein schmatzendes Geräusch verursacht. Kleine Fliegen summen sofort um meinen Kopf herum, die einzigen Tiere weit und breit. Auf die hätte ich allerdings gerne verzichtet. Plagegeister. Auch auf dem Boden entdecke ich keine Spuren, wie man sie sonst im Moor findet. Rehe, Einhörner, Timberfüchse … Nein, nichts. Nur brackiges, stinkendes Wasser, welches in meine Stiefel eindringt. Ein deftiger Fluch verlässt meine Lippen. Ich hasse nach Aas stinkendes Moorwasser.
Ich muss hier raus, Bararod finden und zusehen, dass ich von dieser Insel komme, ehe ich dem Wesen begegne, das selbst diese uralten Bäume in Furcht versetzt. Wie die Elben spüren auch wir die Gefühle der Pflanzen um uns herum. Ihr leises Flüstern, das Wehklagen oder die Freude. Nur, dass wir Albe uns nicht so sehr darum scheren wie die Elben – wir blenden solche Dinge eher aus. Es ist nicht wichtig, was sie mir zu sagen hat. Jetzt muss ich allerdings erst mal aufpassen, dass mich das verfluchte Moor nicht verschluckt, denn meine Stiefel versinken immer mehr. Es wird Zeit für mich aufzubrechen, die Dunkelheit wird bald hereinbrechen und bis es so weit ist, möchte ich mir immerhin einen Überblick verschafft oder wenigstens einen einigermaßen sicheren Platz für die Nacht gefunden haben.
Der Himmel verfärbt sich bereits und die ersten Sterne erscheinen am rosavioletten Himmel. Bevor die Finsterkeit ganz hereinbricht, hoffe ich, auf Bararod zu treffen. Ich mache mir Sorgen um meinen Freund und was mit ihm geschehen sein mag. Was habe ich den Göttern getan, dass sie mich so bestrafen? Sollte ich nicht in ihrer Gunst stehen? Immerhin habe ich ihren ach so wichtigen König zu seiner Königin geführt und mich auf seine Seite gestellt. Ist das nicht ihr Wille gewesen? Ist dies der Dank? Was erwarten sie denn noch von mir? Ich habe mein Leben riskiert, das meiner Schwester und all der Alben, die mir gefolgt sind. Trotz unserer Vorgeschichte habe ich Crispin als König akzeptiert – einen Elben! Ein bisschen Wohlwollen wäre nicht zu viel verlangt, oder?
Ogerdreck, verhexte Trollpisse. So mieft der Dreck, in dem ich stehe und aus dem ich meinen Stiefel mit einem Plopp herausziehe. Wenn ihr Wohlwollen so aussieht, dann kann ich darauf getrost verzichten. Meine Mundwinkel verziehen sich zu einer Grimasse. Widerlich. Ich bin alles andere als zart besaitet, aber dieser Geruch ist tödlich … Als würde der Boden zu meinen Füßen verwesen.
Ich hebe den anderen Fuß, und mühsam löst er sich aus dem teerartigen Untergrund mit einem weiteren ekelerregenden Geräusch. Himmel, bei allen Drachenreitern, so wird es Stunden dauern, voranzukommen. Ich schaue hinauf zu den Bäumen. Vielleicht könnte ich … Nein. »Ach, verdammt …«, zische ich und fange an, mich in die Richtung vorzuarbeiten, in die Bararod verschwunden ist. Schritt für Schritt, meinen geschundenen Körper ignorierend. Eine Armee Moskitos verfolgt mich immerzu, denn diese kleinen Biester sind hungrig und anscheinend gehört mein Blut zu ihrer Leibspeise. Verreckt doch daran, ihr Viecher!
Licia
Ich schlinge meine dünnen Arme um meinen ausgezehrten schmutzigen Körper. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht so recht, was ich mit ihnen anfangen soll. Ich mustere sie einen Augenblick, ehe ich seufze. Mein Körper ist ausgemergelt und erschöpft, ein schrecklicher Anblick. Mir fehlen Gesellschaft, meine Familie und Freunde, grüne Wiesen und Felder. Oh, und die farbenfrohen Blumen. Der Herbst, der Winter und, ja, der Frühling, wenn alles zu neuem Leben erwacht. Gutes Essen und frisches Wasser nicht zu vergessen. Nährstoffe. Mir fehlt so vieles, dass ich es nicht vollständig aufzählen kann.
Ein Gefühl tiefen Verlustes überschwemmt mich so sehr, dass mir Tränen kommen, die ich mir sonst verbiete. Heiß und unaufhaltsam steigen sie mir in die Augen. Ich wage es kaum, zu blinzeln. Meine Hand wandert wie von selbst zu der schweren Kette um meinen Hals, die mich schon so lange an diesen verfluchten Ort bindet, den ich einst geliebt habe. Kaltes, lebloses Eisen. Wie oft habe ich versucht, dieses zu lösen, doch es ist schier unmöglich, meine abgerissenen und blutigen Nägel sind stumme Zeugen meiner verzweifelten Versuche. Wie ein Tier hält er mich hier gefangen. Tag um Tag, Jahr um Jahr … Das Eisen liegt kühl und dick um meinen aufgeschürften Hals. Wie lange ich sie schon trage, vermag ich nicht mehr zu sagen. Ich habe aufgehört, die Tage zu zählen, als aus ihnen Wochen und aus Wochen Monate geworden sind. Es ist unwichtig. Die Hoffnung auf Rettung ist mit den unzähligen Tagen gänzlich verschwunden, und nun hoffe ich nur noch auf Erlösung durch den Tod … Eines Tages, wenn die Götter mir die Gnade erweisen. Ein Tag verschwimmt mit dem Nächsten und doch weigere ich mich, daran zu zerbrechen.
Einst bin ich wie eine Göttin verehrt worden: In wundervolle Kleider gehüllt, habe ich in den heiligen Tempeln, von den Göttern selbst gesegnet, gelebt. Die Tage durchzogen von Licht und Sonnenschein, erfüllt mit Liebe und Lachen. Es sind glückliche Tage gewesen. Wesen aus ganz Fegoria sind zu uns gekommen, auf der Suche nach Hilfe, Ruhe und Frieden, doch hat die Welt uns nun vergessen, mich vergessen, und aus ihren Erinnerungen getilgt, denn niemand wäre so wahnsinnig, diese Insel überhaupt noch zu betreten. Statt eines Ortes der Hoffnung, ist dies eine Grabstätte geworden. Als er gekommen ist, hat er das Paradies, welches es einst gewesen ist, zerstört.
Ich schließe meine Augen, lasse die Magie durch mich hindurchfließen und vergrabe meine Hand in die weiche Erde des Bodens unter mir. Sie begrüßt mich, möchte meinem Willen folgen, doch kann auch sie mich nicht retten. Niemand kann das. Tief in mir spüre ich den Hauch des Lebens um mich herum, die Pflanzen, das Wasser … wie es unter mir pulsiert. Das, was übrig ist. Es ist ein Teil von mir, so wie ich ein Teil von ihm bin. Ich rufe, ohne dass ein Ton meine Lippen verlässt, nach Lavendel. Mein Ruf hallt durch den Boden des kleinen Flecks der Lichtung, auf dem ich angekettet bin und schon spüre ich es. Nicht weit von mir, zwischen all dem Moos, befindet sich das, was ich suche. Etwas, das mir Linderung verschaffen wird. Ich lege den Kopf schief, schicke mehr meiner Magie durch meine Hände in den Boden und kurz darauf erwacht unter meiner Hand ein kleiner Lavendelstrauch. Still bedanke ich mich bei der Erde für ihre Gabe an mich. Mit einem Lächeln zupfe ich die Blüten ab, zerdrücke sie leicht mit meinen Fingern und reibe damit vorsichtig meinen Hals ein, um mir Linderung zu verschaffen. Seufzend schließe ich die Augen. Was haben die Götter sich nur dabei gedacht, dieses Monster aus ihrem Reich zu verbannen, es uns aufzulasten? Es ist ein Fluch. Schlimmer als das.
Ausgerechnet mich hat der Faunus auserwählt, zu überleben, während er all meine Schwestern getötet hat. Ich weiß, dass dies der Ort sein wird, an dem ich eines Tages vergehe wie sie. Manchmal, in schwachen Momenten, hoffe ich, dass dieser Augenblick früher als später eintrifft. All die Blumen um mich herum, an denen der Faunus sich zuvor gelabt hat, zeugen vom Ableben meiner Schwestern. Unser Blut für seine Macht – es macht ihn unsterblich. Er erhält den letzten Funken Göttlichkeit, der noch ihn ihm glüht. Unsere Gaben würden auf ihn übertragen.
Die einzige Lichtung voller Blumen in den Wäldern des Faunus ist das Totenbett der Nymphen des ewigen Waldes. In unseren Adern fließt pures Leben, ein Geschenk von Mutter Gaia. Unser Blut vermag es, jede Krankheit zu heilen oder das Leben zu verlängern. Einst haben wir dieses Geschenk mit Bedacht vergeben, Tränke gebraut, haben Heilpflanzen wachsen lassen und in einigen Fällen Wesen, wenn sie dessen würdig gewesen sind, ein besonders langes Leben geschenkt. Diese Entscheidungen liegen stets bei den Göttern, die uns ein Zeichen senden. Doch wir müssen in Ungnade gefallen sein, denn die Götter haben uns hierbei im Stich gelassen. Die Welt hat uns vergessen und aus dem Ewigen Wald sind die Wälder des Faunus geworden. Mit ihm kamen der Tod und der Zerfall meiner Heimat. Wald kann man es nicht mehr nennen, denn dem üppigen Grün ist ein Braun gewichen. Alles stirbt. Es verwelkt. Er saugt jegliches Leben in sich auf, ergötzt sich daran. Ich spüre die Schreie der Pflanzen tief in mir, ihr Leid, welches sie erfahren müssen, und eine weitere Träne läuft meine Wange hinab. Ich, die letzte Zeugin unserer Auslöschung.
Mein Blick wandert hinauf zum Himmel. Die Sonne verabschiedet sich bereits vom Tag und die letzten Strahlen kitzeln meine Nase. Sie legt ihr Abendgewand an, rosa Schlieren bedecken das Himmelsdach über mir. Mein Atem geht schwer und doch schaffe ich es, keine Träne mehr zu vergießen. Ich habe längst zu viele an diesem Ort gelassen, der Boden ist damit getränkt. Einst habe ich geglaubt, die Welt würde uns brauchen, doch nun bin nur noch ich übrig. Was, wenn ich vergehe? Dann wird mit mir die Gabe der Götter verschwinden. Es wird niemand kommen, um uns zu retten. Nein, zu viele Jahre, ohne Hilfe oder gar ein Zeichen, sind ins Land gegangen.
Nachdenklich reibe ich meine nackten, mit Blessuren übersäten, Beine mit dem Lavendel ein, dessen Duft mir in die Nase steigt. Er beruhigt meine Nerven. Dieser Ort ist verflucht. Der Faunus ist das Unheil, welches über uns gekommen ist. Ein alter Dämon, ein gefallener Gott, von seinesgleichen verstoßen, eine Bürde für Fegoria. Nicht einmal die Götter haben ihn, dieses abgrundtief böse Wesen, in ihren Heiligen Hallen haben wollen. Doch was haben sie sich nur dabei gedacht, ihn einfach zu uns zu lassen?
Neben mir, im Wald, kracht es gewaltig und ich zucke vor Schreck zusammen, als ein Drache – sich wild windend – über mir hinweg gezogen wird. Er kämpft mit den Klauen und Zähnen gegen die Magie des Faunus, doch so wie ich hat selbst er keine Chance. Immer wieder versucht er, die Flügel zu spannen, doch die Ranken sind unerbittlich. Voller Mitleid beobachte ich seinen Untergang, bin unfähig, einzugreifen. Die Anakondalianen sind gnadenlos. Sie werden das Opfer zum Faunus bringen und er wird sich dessen Energie und Magie bemächtigen. Sein Hunger ist allgegenwärtig und mit jedem Opfer wächst seine Gier noch mehr.
Ich rapple mich auf, verfolge mit den Augen den Flug des Drachen … in der Hoffnung, dass er es doch schafft … aber nein. Er verschwindet aus meinem Blickfeld. Plötzlich wird es wieder still im Wald. So ruhig, dass ich mein eigenes Herz, das vor Aufregung noch wie wild schlägt, rasen höre. Ich warte einen Augenblick, horche in den Wald hinein, doch es bleibt stumm. Was auch immer mit dem Drachen passiert ist, es bleibt mir verborgen und ich hoffe für ihn, dass er nicht so lange leiden wird, wie ich es tue.
Also setze ich mich wieder auf den Boden, warte darauf, dass die Nacht hereinbricht oder mein Peiniger zurückkommt, um mich zu quälen. Er ist achtsamer geworden. Da ich die Letzte meiner Art bin, passt er stets auf, nicht zu viel an sich zu nehmen. Sollte ich sterbe, wird auch er vergehen – früher oder später. Die Götter haben ihm die Unsterblichkeit genommen und nur durch mich kann er sie dennoch erlangen. Auch wenn er achtsam mit meinem Blut umgeht, so hat er stets Vergnügen daran, mich zu quälen.
Die Sonne sinkt immer tiefer, die Sterne erwachen und tupfen den Himmel mit leuchtenden Punkten. Wie es wohl ist, so weit oben, den Sternen so nahe und fliegen zu können? Ich rolle mich zu einer Kugel zusammen, bette meinen Kopf auf den weichen Blumen. Sie biegen sich mir entgegen, fangen meine Tränen auf, während ihr Duft meine Sinne streift. Ich vermisse meine Schwestern mehr, als ich in Worte fassen könnte. Ihr Gelächter, ihr Geschnatter … einfach ihre Nähe. Ich habe noch nie einen Fuß von dieser Insel gesetzt, nicht in all den Jahren meiner Existenz. Wir sind friedliebend und genügsam, nie habe ich meinen Platz hier hinterfragt. Die Blumen schmiegen sich an mich und versuchen damit, Trost zu spenden, doch sie schaffen es nicht – die Seelen meiner Schwestern, ihre letzte Essenz. Immerhin bin ich nicht vollends alleine und ein Hauch ist mir geblieben – der letzte Teil, der dem Faunus und dessen Magie trotzt. Seine Magie hindert ihre Seelen daran, fortzugleiten, zurück zu unserer Göttin. Müde dämmere ich ein, völlig in meinen Gedanken von einer besseren Zeit versunken, als ein Knacken meine Ohren durchdringt. Sofort öffne ich die Augen, bleibe aber regungslos liegen und schaue mich unauffällig um. Da ist es wieder: Knack! Knack! Knack! Zweige brechen. Knack! Ein Fluchen dringt in meine Ohren. Leise, aber deutlich zu hören, ertönt eine tiefe männliche Stimme. Sie gehört nicht dem Faun, den ich so sehr verachte. Knack! Die Schritte näher sich an meiner Lichtung heran. Ich befürchte kurz, dass ich bereits träume. Wann hat das letzte Mal jemand einen Fuß auf unsere Insel gesetzt? Es ein Jahrhundert her, ganz bestimmt.
Aufgeregt setze ich mich hin, mein Herz beginnt, rasant zu klopfen. Es wummert so fest in meiner Brust, dass ich befürchte, es könnte gleich hinaus hüpfen. Wer ist das? Es sind nicht die Hufe des Faun. Seine Stimme würde ich sofort erkennen, ebenso seinen fauligen Atem. Die Bäume flüstern, nicht weniger aufgeregt als ich, und ich lausche ihnen aufmerksam. Ein Fremder. Eindringling. Und ich spüre etwas, dass ich seit Langem nicht verspürt habe – Hoffnung … wilde, beflügelnde Hoffnung.
Glücksgefühl und Angst flammen gleichermaßen in mir auf. Hilflos, auf einem Serviertablett auf einer Lichtung angekettet zu sein, ist nicht gerade beruhigend, wenn man nicht weiß, was als Nächstes passieren wird, aber es kann nicht schlimmer sein als alles, was ich bereits habe erdulden müssen. Allerdings gibt es durchaus schlimmere Wesen als einen Faunus. Weitaus schlimmere Wesen. Wie kommt der Fremde hier her? Wie ist das … Der Drache, fällt mir siedend heiß ein. Wer auch immer er ist, er muss mit dem Drachen gekommen sein. Ich zähle eins und eins zusammen, es schaudert mich. Als mir klar wird, wer Drachen reitet, betritt auch schon ein hochgewachsener Alb meine kleine Lichtung und die Freude verblasst geschwind. Ich erkenne dieses Wesen sofort: die helle Haut, das dunkle Haar, der hochgewachsene schlanke, aber muskulöse Körper, der in schwarzen Kleidern steckt. Wieder flucht er ausgiebig, stolpert kurz über eine vorwitzige Wurzel, ehe er aus dem Moor auf die Wiese tritt, von der aus ich ihn beobachte.