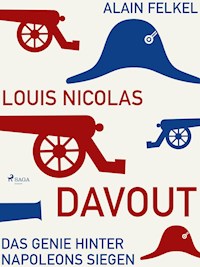
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vergangenheit in großer Pracht und Intensität: Alain Felkel erzählt das wechselvolle Leben von Louis Nicolas Davout. Er begleitet den für seine erbarmungslose Strenge und Disziplin gerühmten "eisernen Marschall" durch die Wirren der Französischen Revolution und belegt, wie Davout auf den Schlachtfeldern von Ägypten bis Russland zum wichtigsten Helfer Napoleons wurde. 1805 entscheidet Davouts Einsatz die Schlacht von Austerlitz, 1806 bezwingt er die Preußen bei Auerstedt. 1809 rettet sein taktisches Geschick den Sieg im Feldzug gegen Österreich. Doch der Preis, den der Marschall zahlt, ist hoch. Seine Siege wecken den Neid des Kaisers. Als er 1812 wagt, Napoleon auf Augenhöhe zu begegnen, fällt er in Ungnade. AUTORENPORTRÄT AAlain Felkel studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Spanisch-Romanistik und Iberoamerikanische Geschichte in Marburg, Salamanca und Köln. Seit 1997 ist er als Drehbuchautor und historischer Berater für Fernsehproduktionen tätig. 2006 Co-Autor des TV-Serienbegleitbuchs "Die Germanen" und 2009 Autor von "Aufstand. Die Deutschen als rebellisches Volk". Heute lebt er als freier Autor und Regisseur in Köln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Felkel
Louis Nicolas Davout
Das Genie hinter Napoleons Siegen
Saga
Meinen Eltern und Susann
Vorwort
Schauen Sie sich Davout an, wie er manövriert!
Er wird mir noch diese Schlacht gewinnen!
Napoleon zu den Marschällen Lannes und Massénaam 22. April 1809 in der Schlacht bei Eckmühl
Der lange Trauerzug in Begleitung von 1500 Soldaten bahnte sich seinen Weg durch Paris, nachdem die letzten Worte der Totenmesse in der Kirche von Sainte-Valère beim Invalidendom verklungen waren. Die Spitze der andächtig schreitenden Kolonne bildete eine Abteilung Gendarmen, gefolgt von Musikern und Fahnenträgern des 43. und 59. Linienregiments, denen sich eine Abordnung von Veteranen der Napoleonischen Kriege anschloss. Hinter diesen rollte der Leichenwagen vorbei, auf dem der fahnengeschmückte Katafalk von Marschall Louis Nicolas Davout lag, der im Alter von 53 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Als sich der Sarg auf Höhe der Invaliden befand, ging ein Ruck durch die Kriegskrüppel, die unter Davout in so vielen Schlachten siegreich gefochten hatten. Obwohl ein königliches Verbot ihnen den Besuch der Begräbnisfeierlichkeiten untersagte, waren sie trotz ihrer Behinderungen über die Mauer des Invalidenhospitals gestiegen und durch Gräben gekrochen, um Davout das letzte Geleit zu geben. Mit Tränen in den Augen salutierten sie, als der Leichenwagen an ihnen vorbei fuhr. Ein letztes Mal bewunderten sie das an den Zügeln geführte Schlachtpferd des Marschalls, dem vier Soldaten folgten. Diese trugen samtene Kissen, auf denen Davouts Orden gebettet waren; Ehrenzeichen jener blutigen Siege, welche die Invaliden am Straßenrand mit abgerissenen Gliedern, zerschmetterten Hüften und zerschlagenen Gesichtern bezahlt hatten. Hinter den Kissenträgern schritt die Familie, allen voran der erst zwölfjährige Sohn Davouts, Louis-Napoleon, einher. Dann gewahrten die Schaulustigen des Trauerzugs Marschälle, Generäle, Senatoren und Abgeordnete beider Regierungskammern, denen schweigend der Abgesandte des Königs folgte. Das Zugende bildeten die Musiker und Infanteristen des 20. Linienregiments sowie eine Abteilung Gendarmen.
Langsam wand sich der Trauerzug vom Invalidendom durch die Straßen von Paris zum Friedhof Père-Lachaise. Dort wurde der Marschall neben dem Grab seiner geliebten Tochter Josephine bestattet, während Marschall Jourdan, der Sieger von Fleurus, für seinen Kameraden eine halbstündige Grabrede hielt. Diese endete nach einem Abriss der Verdienste des Marschalls mit folgenden Worten:
Aber, meine Herren, ein großer Mann stirbt nicht ganz. Von unserem berühmten Marschall, dem Fürsten von Eckmühl, bleiben uns das Beispiel seiner Tugenden, die Erinnerung seiner großen Qualitäten und seine hervorragenden Dienste, die er dem Vaterland erwiesen hat ...1
Soweit die Worte des Marschalls Jourdan an jenem 4. Juni 1823, welche der damals weit verbreiteten Ansicht Ausdruck verliehen, dass der Mensch durch unsterblichen Ruhm zur Ewigkeit findet. Leider irrte sich Jourdan hinsichtlich Davouts. Das Andenken des Fürsten von Eckmühl – einer der Ehrentitel, die der Tote neben dem des »Herzogs von Auerstedt« trug – hat sich weder in der Geschichtswissenschaft noch im Bewusstsein der europäischen Völker eingegraben.
Als ich Anfang 2013 das Archiv des »Service Historique de la Défense« im Schloss von Vincennes aufsuchte, um mit der Aktenrecherche für mein Buch zu beginnen, stieß ich gleich bei meinen ersten Gehversuchen auf ein unerwartetes Hindernis. Nachdem ich mein Anliegen auf Französisch vorgetragen hatte, schockierte mich eine Bibliothekarin damit, dass sie den Gegenstand meiner Anfrage nicht kannte. Dieser Suchbegriff bestand aus sechs Buchstaben und las sich »Davout«.
Wäre ich auf der Straße, im Bistro oder in einem Pariser Restaurant gewesen, hätte mich diese Reaktion nicht weiter erstaunt. In einem kriegsgeschichtlichen Archiv, in dem Akten der Napoleonischen Kriege einen wesentlichen Bestandteil ausmachen, hatte ich dies jedoch nicht vermutet.
Doch es sollte noch besser kommen. Liebenswürdig wie meine Ansprechpartnerin war, bat sie einen weiteren Bibliothekar um Hilfe, der zuerst wissend nickte, als er erfuhr, um was es ging. Kurze Zeit später jedoch wirkte er ratlos. Eifrig bemüht, sich dies nicht anmerken zu lassen, blätterte er durch ein Findbuch.
»Wie, sagten Sie, hieß Ihr Marschall noch gleich?«, fragte er in beiläufiger Harmlosigkeit.
»Davout«, antwortete ich.
»Davout, Davout ... Davout, sagten Sie?«
»Ja«.
Es folgte eine gedankenschwere Pause, dann die Frage: »Welche Epoche ist das?«
Die Antwort, die ich ihm gab, liegt auf der Hand. Jetzt, da der genaue Zeitraum bekannt war, zeigte sich die Tüchtigkeit des Mannes, und es wurde das richtige Findbuch samt entsprechendem Eintrag sofort gefunden, sodass ich die Akten in den Lesesaal bestellen konnte.
Trotzdem gab mir der Vorfall zu denken. Während der Vorrecherchen in Deutschland hatte ich oft die Erfahrung gemacht, dass außerhalb eines engen Kreises von Historikern und auf die napoleonische Epoche spezialisierten Reenactern viele Menschen nichts mit dem Namen »Davout« anzufangen wussten. Doch stets hatte mich der Gedanke getröstet, dass dies in Frankreich anders sei.
Ich wurde eines Besseren belehrt. Die verhältnismäßig geringe Anzahl französischer Sachbuchpublikationen und Biografien über Davout ließ erahnen, wie schlecht es selbst westlich des Rheins um das öffentliche Gedenken an den Fürsten von Eckmühl bestellt ist. Abgesehen von zwei eher als Raritätenkabinette zu bezeichnenden Museen und einem Standbild in Auxerre erinnert nur noch ein 63 Meter hoher Leuchtturm an der bretonischen Küste an jenen Kriegshelden Frankreichs, der für kurze Zeit im Sommer 1815 das Schicksal der Grande Nation in den Händen hielt.
Noch heute gibt es in ganz Paris, das sonst mit Straßennamen französischer Schlachtenerfolge nicht eben geizt, weder eine Straße oder Brücke noch einen Platz, der an den Sieg Davouts bei Auerstedt erinnert. Nicht einmal der Triumphbogen, jener für die Ewigkeit gebaute Siegestempel, weist den Namen Auerstedt auf. Dass dies so ist, liegt an Napoleon Bonaparte. Beständig wob er noch zu Lebzeiten dank kaiserlicher Bulletins, Moniteur-Artikeln und Memoiren an der eigenen Übermenschenlegende.
Als besonders zäh erwies sich damals wie heute der napoleonische Mythos vom unbesiegbaren Schlachtengott, den nur eigene Krankheit, Naturkatastrophen, feindliche Übermacht oder die Unfähigkeit der eigenen Marschälle besiegen konnten. Doch der Kaiser war als Feldherr nicht unfehlbar, wie seine Niederlagen in den Schlachten von Aspern-Essling, Leipzig und Waterloo sowie der gescheiterte Russlandfeldzug beweisen.
Es ist keine Frage, dass Napoleon eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten der Neuzeit und einer der bedeutendsten Strategen der Kriegsgeschichte ist. Mehr als ein Jahrhundert vor Hitler erfand er den Blitzkrieg, die alles umfassende Operation, deren Zielsetzung nicht das Gewinnen einzelner Schlachten, sondern die Vernichtung der feindlichen Armee innerhalb weniger Wochen war. Seine Feldzugspläne waren kühn, die Schnelligkeit seiner Manöver atemberaubend.
Und trotzdem: Der Nimbus des unbezwingbaren Kaisers war selbst in seinen siegreichen Jahren nicht in allererster Linie das Produkt seines Feldherrngenies, sondern seines propagandistischen Talents.
Geschickt wurden Beinahe-Katastrophen – wie der im Jahr 1799 gescheiterte Feldzug nach Syrien – zu Erfolgen umgedeutet. Skrupellos schrieb sich Napoleon wie im Fall der Schlacht von Marengo die Siege anderer zu oder redete deren Triumphe klein. Mit Stillschweigen überging er eigene Irrtümer. Im Fall des Russlandfeldzugs lastete er seinen Generälen und Marschällen jene Misserfolge an, die er selbst zu verantworten hatte. Schon Napoleons größter Rivale, der republikanische General Moreau, wusste um dessen größte Schwäche und urteilte im Jahr 1800 treffend über ihn:
Was die Entwicklung von Plänen, die Leitung großer Militäroperationen und die Kriegspolitik anbetrifft, ist er unser aller Meister. Was aber die methodische Kriegsführung auf einem abgesteckten Kriegsschauplatz oder ein Schachspiel angeht, verhält es sich anders; hier glaube ich, ihm überlegen zu sein.2
Die Schachspiel-Metapher von Napoleons Rivalen wirkt auf den ersten Blick etwas bemüht, doch sie trifft den Kern des Problems: Denn als Stratege war Napoleon kaum zu schlagen, aber als Taktiker hatte er seine Schwächen. Es ist ein Fakt, dass Napoleon sich 1805 in Böhmen in eine äußerst prekäre Lage manövriert hatte und während des polnischen Feldzugs von 1807 mehrfach auf eine sichere Niederlage zusteuerte. Dass er dieser jedes Mal entging, verdankte er den Fehlern seiner Kontrahenten, der außerordentlichen Tapferkeit seiner Soldaten und dem taktischen Geschick seiner Marschälle.
Zu ihnen zählte Davout, ein prinzipientreuer Mann, der zu Beginn der Offizierslaufbahn Anführer einer der ersten Truppenmeutereien der Revolutionszeit gewesen war. Während des 1. Koalitionskriegs von 1792–1797 hatte er sich zum Brigadegeneral hochgedient, dann am Ägyptenfeldzug Napoleons teilgenommen. Obwohl der Feldzug scheiterte, hatte Davout Glück. Zurück in Frankreich stieg er unter Napoleon vom Brigadegeneral zum jüngsten Marschall Frankreichs auf. Bald rechtfertigte er das Vertrauen, das der Kaiser in ihn gesetzt hatte.
Durch Davouts taktisches Geschick gewann Napoleon die Schlachten von Austerlitz, Eylau, Eckmühl und Wagram. Mit seinem entscheidenden Triumph bei Auerstedt über die Hauptarmee der Preußen stellte der junge Marschall sogar seinen Kaiser in den Schatten, der am selben Tag bei Jena die Preußen schlug.
Was den Russlandfeldzug anbetrifft, so kam Davout beim Vormarsch und beim Rückzug eine tragende Rolle zu. Das Debakel dieses Feldzugs wäre vielleicht vermieden worden, hätten alle Marschälle ein so vorbildlich gerüstetes Armeekorps wie Davout gehabt und wäre er mit seinen strategischen Vorstellungen beim Kaiser erfolgreich gewesen. Doch das Gegenteil war der Fall. Der Marschall fiel während des Russlandfeldzugs beim Kaiser in Ungnade. Der Bruch mit Davout beraubte Napoleon seines fähigsten Offiziers. Der Kaiser detachierte den Fürsten von Eckmühl nach Norddeutschland, um Hamburg zu verteidigen, wo sich der diskreditierte Feldherr erneut auszeichnete.
Aber Davout war nicht nur ein hervorragender General, sondern auch ein großartiger Verwalter der besetzten Gebiete. Mehr fach bekleidete er das Amt eines Militärgouverneurs: 1807/1808 in Polen, 1810–1812 und 1813/1814 in Deutschland, bevor er 1815 während der »Hundert Tage« Kriegsminister wurde. Mit dieser Ernennung trug Napoleon einer weiteren Stärke des Marschalls Rechnung: der Fähigkeit Davouts, einen Feldzug logistisch vorzubereiten.
Historische Bedeutung erwarb der Fürst von Eckmühl jedoch nicht nur durch seine kriegerischen Tugenden, sondern auch dadurch, dass er sich in den Tagen nach Waterloo gegen Napoleon stellte und diesen dazu nötigte, Frankreich zu verlassen. Wenig später schloss er unter der Bedingung einer Generalamnestie für alle Soldaten und Offiziere, die Napoleon gefolgt waren, einen Waffenstillstand mit den Alliierten, der die Kampfhandlungen abschloss. Damit ermöglichte Davout trotz persönlicher Antipathie gegen die Bourbonendynastie die Rückkehr König Ludwigs XVIII. an die Macht und beendete einen Weltkrieg, der, von einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, 23 Jahre gedauert hatte.
Anschließend führte er die Reste der kaiserlichen Armee über die Loire, wo sich das Heer auflöste. Kurz darauf trat Davout vom Amt des Kriegsministers zurück und schied aus der Armee aus.
Diese Tat wurde von vielen Zeitgenossen als Verrat gewertet und fand nicht den Beifall der Öffentlichkeit. Zumal sie von einem Mann ausging, der für seinen Jähzorn und seine angebliche Neigung zur Grausamkeit nicht nur in der französischen Armee, sondern auch in Deutschland berüchtigt war.
Dort hatte sich während der Belagerung von Hamburg eine schwarze Legende verbreitet, die Davout zum Henker Hamburgs stilisierte, der aus nichtigem Grund Hunderte erschießen ließ. Diese Behauptungen sind hinsichtlich ihrer Monstrosität grotesk, knüpfen jedoch daran an, dass Davout während der Hamburger Belagerung einige wenige Todesurteile vollstrecken ließ. Sicher trug zu seinem Negativimage bei, dass er in der französischen Armee wegen seines Hangs zu drakonischen Maßnahmen gefürchtet war.
Gemäß seinem selbstgewählten Motto »Justum et tenacem« (»Hart, aber gerecht«) konnte die Prinzipientreue des Marschalls durch seine Unerbittlichkeit bisweilen grausame Züge annehmen. Wenn es sein musste, ließ er überführte Mörder, Plünderer, Marodeure, Vergewaltiger und vermeintliche Spione sofort vor das Standgericht stellen und erschießen. Sicher war er nicht der einzige unter Napoleons Marschällen, der dies tat, doch der konsequenteste in der Anwendung jenes Strafmaßes. Und vor allem unternahm er nichts dagegen, dass ihn die Gräuelpropaganda der Alliierten als zweiten Herzog von Alba schilderte, der im 16. Jahrhundert während des Freiheitskampfes der Niederlande ganze Landstriche der Halsgerichtsbarkeit unterzogen haben soll. Populärhistoriker wie Bleibtreu trieben die Kolportage sogar so weit, Davout die Erschießung des Buchhändlers Palm anzudichten, obwohl diese auf Veranlassung Napoleons von Davouts Intimfeind Berthier befohlen worden war.
Betrachtet man das Ausmaß der damals üblichen Kriegsgräuel an der Zivilbevölkerung, so verwundert es jedoch, dass es unter Davout, abgesehen vom Ägyptenfeldzug, kaum zu Übergriffen kam. Diejenigen, die den Marschall am meisten zu fürchten hatten, waren seine eigenen Soldaten, nicht die Unterworfenen.
Doch Verleumdungen und Vorurteile sind hartnäckig. Bis heute verzerren sie das Bild eines der redlichsten Marschälle des Empire. Mit Recht moniert Stendhal in seinen »Denkwürdigkeiten über Napoleon«, dass der Marschall der am meisten missverstandene Charakter der napoleonischen Epoche sei und in seiner historischen Bedeutung völlig unterschätzt werde.
Dies hat sich bis heute kaum geändert, wie allein die Anzahl der Publikationen über ihn beweist. Bücher über Napoleon sind Legion, Abhandlungen über den Marschall gibt es nur wenige.
Aus der Feder des Marschalls selbst existieren drei Hauptwerke, das »Journal des Opérations du 3e Corps«, die Verteidigungsschrift »Mémoire de Mr. Le Maréchal Davout au Roi« und die bei Vigier abgedruckte Version eines handgeschriebenen Memoirenfragments »Souvenirs du Maréchal Prince D’Eckmühl sur les Cent Jours«. Darüber hinaus befinden sich in den Archiven Frankreichs unzählige Briefe Davouts an seine Frau, Napoleon und diverse Dienststellen.
Von den im 19. Jahrhundert verfassten Biografien zeichnen sich die Bücher von Chenier, Joly und Vigier durch detailreiche Kenntnis der Originalquellen aus. Die vierbändige Biografie der Tochter des Marschalls, Adélaïde-Louise, Princesse d’Eckmühl et Marquise de Blocqueville, stammt aus den Jahren 1879/1880. Sie besteht aus bis dahin unveröffentlichtem Quellenmaterial – zumeist Briefe – aus dem Nachlass des Marschalls.
In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts erschienen gleich drei Buchpublikationen auf dem Markt. »The Iron Marshal« von John J. Gallaher (die einzige englische Biografie über den Marschall), »Davout le terrible« von François-Guy Hourtoulle und die gründliche Studie »Davout et l’Art de la guerre« von Daniel Reichel. Letztere ist, anders als der Titel vermuten lässt, nicht eine bloße Studie zu den Taktikgrundsätzen des Marschalls, sondern enthält auch viele biografische Informationen zum Werdegang Davouts. Bei den zu Beginn dieses Jahrhunderts veröffentlichten Büchern Frédéric Hulots und Pierre Charriers handelt es sich bei ersterem Werk um ein populäres Sachbuch, bei letzterem um ein zur Polemik neigendes Porträt mit wissenschaftlichem Anspruch.
Was Deutschland anbetrifft, existiert bis zum heutigen Tag keine einzige deutsche Biografie.
Das vorliegende Buch basiert in erster Linie auf dem Studium oben genannter biografischer Sekundärliteratur und der Auswertung von Akten- und Briefsammlungen. Zwecks Quellenstudium begab sich der Autor ins »Service Historique de la Défense« des französischen Verteidigungsministeriums. Darüber hinaus kamen kontextbezogen Memoiren und Briefe beteiligter Zeitzeugen Davouts und themenrelevante Sekundärliteratur zur Verwendung.
Was die Gliederung des Buches anbetrifft, möchte ich dem Leser kurz erläutern, welche Erzählstrategie ich angewandt habe.
Manche Biografen neigen dazu, die Geschichte ihres Protagonisten in die ordnenden Bahnen einer Chronologie zu lenken, die vom ersten Geburtsschrei bis zum letzten Todesseufzer zur Ordnungsmaxime wird. Diese Vorgehensweise erschien mir jedoch angesichts des Ereignisreichtums von Davouts Leben als unangemessen.
Diese Biografie ist anders strukturiert. Sie verfolgt einen fiktionalen Erzählansatz. Und so beginnt dieses Buch nicht im Jahr 1770, sondern 1815, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Davout und dem Kaiser, um in einen Rückblick zu münden, der das Leben des Marschalls erzählt.
Es ist der Versuch der Rehabilitation eines Verkannten, der viel zu lange von der historischen Zunft als Nachtschattengewächs Napoleons wahrgenommen wurde; ein Abenteuerroman der Geschichte, der nicht erfunden werden musste, weil er auf Fakten beruht.
I
Der gestürzte Kriegsgott
Am Abend des 16. Juni 1815 ereignete sich über dem belgischen Örtchen Ligny unweit von Namur ein grandioses Naturschauspiel. Während Franzosen und Preußen in mannshohen Getreidefeldern erbittert um den Sieg rangen, wuchsen am Himmel urplötzlich riesige Wolkenberge zu einer tiefschwarzen Gewitterfront zusammen, deren unheilschwangerer Schatten sich wie Nacht über die Walstatt legte. Dann brach das Inferno über die Schlacht herein. Blitze zuckten über den lichterloh brennenden Dörfern der Hauptkampflinie, sintflutartige Regengüsse nahmen den Kämpfenden die Sicht und verwandelten die zerfahrenen Straßen sofort in undurchdringlichen Morast, auf dem sich die Züge der berittenen Artillerie reihenweise festfuhren. Flinten und Kanonen versagten ihren Dienst, weil das Zündpulver nass wurde. Wo nicht im mörderischsten Nahkampf Säbel und Bajonett wüteten, erstarben die Gefechte.
Doch anstatt das Gemetzel abzubrechen, nutzten Preußen wie Franzosen die eingetretene Gefechtspause fieberhaft, den letzten Waffengang vorzubereiten. Während der preußische Feldherr Blücher seine Truppen für den Entscheidungsangriff auf seiner rechten Flanke konzentrierte, ließ Napoleon im Schutze des Regenschleiers seine Alte Garde aufmarschieren, um mit einem letzten Angriff das preußische Zentrum zu zertrümmern.
Der Aufmarsch der Franzosen war gerade beendet, als das Gewitter sich legte. Für einen Augenblick herrschte Stille. Dann riss der Himmel auf und eine majestätische Abendsonne drang durch die Wolken. Dies war der Moment, in dem die Schlacht von Neuem erwachte. Mit begeistertem »Vive L’Empereur!« stürzte sich die Alte Garde auf die Preußen und schlug sie nach heftigen Nahkämpfen vollständig. Fluchend erkannte Blücher seinen Fehler, doch es war zu spät. Bei einem Gegenangriff erhielt sein Schimmel einen Kopfschuss und begrub ihn im Todeskampf unter sich, wobei der Feldmarschall schwere Quetschungen erlitt.
Aber Blücher hatte Glück. Während die Reiterschlacht um ihn herum tobte, zog sein Adjutant Nostitz den Feldmarschall kaltblütig mithilfe eines Ulanen unter seinem toten Pferd hervor und barg ihn, als es dunkel wurde, vom Schlachtfeld.
Im Schutz der Nacht irrte Nostitz stundenlang mit dem Verletzten umher, bis er bei Gentinnes auf die preußischen Linien stieß. Jetzt erst konnten die Fliehenden aufatmen. Nostitz nahm mit Blücher in einem Bauernhof Quartier, wo dieser endlich einige Stunden Schlaf fand. Der Feldmarschall war gerettet, die Schlacht verloren.
Napoleon hatte einen beachtlichen Sieg errungen und glaubte die Preußen vernichtend geschlagen. Jetzt konnte er sich völlig auf die vereinigte britisch-holländische Armee unter dem Herzog von Wellington konzentrieren. Dieser war am Tage unweit von Ligny bei Quatre Bras von den Truppen Marschall Neys angegriffen worden und hatte sich nach heftigen Gefechten auf die Höhen des Mont St. Jean bei Waterloo zurückgezogen. Und dieser Umstand stimmte Napoleon optimistisch, die Armee Wellingtons in der kommenden Auseinandersetzung zu vernichten. Wenn er ihn entscheidend schlug, sah er eine Chance, dass England aus der übermächtigen Allianz der Verbündeten ausscherte, die sich nach seiner Flucht aus Elba gegen ihn gebildet hatte.
Am 1. März 1815 war Napoleon in Südfrankreich gelandet und hatte nach einem Triumphzug durch Frankreich die bourbonische Herrschaft gestürzt. Daraufhin hatten England, Russland, Preußen, Österreich und Schweden ihn zum Aggressor gegen den Weltfrieden erklärt und am 25. März gemeinsam beschlossen, 700 000 Mann unter der Führung des Fürsten von Schwarzenberg gegen Napoleon ins Feld zu stellen. Um die Finanzierung einer derartig gewaltigen Armee zu gewährleisten, war Großbritannien die Verpflichtung eingegangen, mithilfe der Rothschilds fünf Millionen Pfund Sterling zur Verfügung zu stellen.
Schied also England aus, so schien es Napoleon nicht unwahrscheinlich, dass Österreich von einem Kampf gegen Frankreich Abstand nahm, was seine Siegeschancen gegenüber Preußen und dem Zarenreich schlagartig erhöht hätte.
Aber Napoleon verrechnete sich. Statt sich, wie er zu Unrecht vermutete, übereilt nach Lüttich zurückzuziehen, zog Blücher mit seiner geschlagenen Armee Wellington entgegen, um sich mit ihm bei Waterloo zu vereinen.
Von all dem ahnte Napoleon nichts. In bester Siegeslaune schickte er noch am Abend der Schlacht eine erste Depesche nach Paris, die den Franzosen den Sieg über die Preußen verkündete.
Zwei Tage später, am 18. Juni 1815 pünktlich um 6 Uhr morgens, weckten 101 Kanonenschüsse Paris auf und stürzten es in einen Freudentaumel. Verschlafen strömten Tausende auf die Place Vendôme, die Champs-Elysées und zum Invalidendom, wo Zeitungsverkäufer gratis Flugblätter verteilten, die den Triumph von Ligny verklärten. Tränen des Glücks stiegen den Anhängern des Kaisers in die Augen. Im Überschwang der Gefühle verbreiteten sich Gerüchte, dass Blücher gefallen und der Herzog von Wellington gefangen sei. Und so blühten an jenem herrlichen Pariser Sommersonntag des 18. Juni 1815 trügerische Illusionen hinsichtlich eines zukünftigen Friedens, die nur wenig mit den politischen und militärischen Realitäten der Gegenwart zu tun hatten.
Denn am selben Tag, an dem in Paris die Rauchwolken von 101 Triumphschüssen in den Himmel stiegen, verlor Napoleon die Schlacht von Waterloo gegen die vereinigten Armeen Wellingtons und Blüchers. Als die Sonne unterging, wälzte sich die Masse des französischen Heeres in panischer Flucht unaufhaltsam nach Süden. Fassungslos sah Napoleon, wie er von einem widrigen Schicksal binnen einer Stunde um die Früchte eines sicher geglaubten Sieges betrogen wurde, der den Feldzug entschieden hätte. Verzweifelt suchte er inmitten eines der letzten, noch intakt gebliebenen Karrees der Alten Garde den Tod. Nur unter Aufbietung aller Kräfte gelang es seinen Getreuen Soult und Bertrand, ihn vom Schlachtfeld zu zerren. Mit einer kleinen Eskorte, bestehend aus seinem Generalstab und einigen Gardejägern zu Pferd, ließ der gestürzte Kriegsgott die Trümmer seiner Armee hinter sich. Im gestreckten Galopp ritt Napoleon nach Philippeville, wo er am 19. Juni um 9 Uhr im Gasthof »Le Lion d’Or« endlich Rast machte.
Trotz Erschöpfung fand er keine Ruhe. Fern davon, sich von den Strapazen zu erholen, diktierte er seinem Sekretär zwei Briefe: einen für den Ministerrat, der das Ausmaß der Niederlage herunterspielte, und einen anderen für seinen Bruder Joseph, in dem er ihm schonungslos die Größe des Desasters offenbarte. An die 24 000 Mann waren bei Waterloo entweder gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft geraten, 114 Kanonen unwiederbringlich verloren und die Armee in völliger Auflösung. Aber Napoleon hatte keine Zeit für Zahlenspiele. Nachdem er die Briefe an Joseph abgeschickt hatte, ritt er mit seinem Gefolge weiter nach Laon, wo er einige Stunden rastete und Soult die Reorganisation der geschlagenen Nordarmee übertrug. Obwohl ihm dieser davon abriet, nach Paris weiterzureisen, machte er sich von Neuem auf den Weg. Der Kaiser wusste: Er musste unter allen Umständen in die Hauptstadt seines Reiches eilen, wollte er an der Macht bleiben und seinen Feinden nicht wie 1814 erneut Gelegenheit geben, ihn zu stürzen.
In Paris ahnte man von alldem nichts. Am 19. Juni wiegte sich die Seinemetropole in trügerischer Sicherheit. Obwohl der Feldzug noch nicht beendet war, suchten an jenem herrlichen Sommertag Tausende unbeschwert ihr Vergnügen auf den Boulevards und in den Cafés. Der Krieg, so schien es, war weit weg und der endgültige Sieg nah. Wozu sich also sorgen?
Und trotzdem gab es Franzosen, die an jenem Tag ein ungutes Gefühl hatten, einen untrüglichen Instinkt, dass etwas nicht stimmte. Einer von ihnen war der Kriegsminister von Frankreich, Louis Nicolas Davout, Herzog von Auerstedt und Fürst von Eckmühl.
Grund dieser Beunruhigung war eine Depesche, die Davout im Laufe des Tages zugestellt bekommen hatte. Die Nachricht enthielt die dringende Aufforderung, alles an Waffen, Ausrüstungsgegenständen und verfügbarer Munition sofort in die Magazine der Nordarmee zu schicken und den Ausbau der Pariser Befestigungen voranzutreiben. Dies ließ Davout aufhorchen. Als Kriegsminister wusste er die Arsenale der Nordarmee bestens ausgerüstet. Waren diese Vorräte etwa in die Hände der Alliierten gefallen? Wenn ja, konnte das nur bedeuten, dass der Kaiser eine Niederlage erlitten hatte. Davout brauchte Gewissheit. Befolgte er den Befehl blindlings, drohten die Munitionstransporte in die Hände des Feindes zu fallen. Mit banger Erwartung wartete er auf Nachrichten aus dem Louvre. Hier befand sich der Anfangs- und Endpunkt des optischen Telegrafennetzes Frankreichs, die Schaltzentrale des Kaiserreichs, befehligt von Joseph Bonaparte, dem älteren Bruder Napoleons. Kam eine Nachricht an, entschlüsselten Telegrafisten die Botschaften, welche die Signalflügelarme des Balkentelegrafen anzeigten, und gaben diese an Depeschenreiter weiter, die sie zu ihrem Bestimmungsort beförderten.
Doch so sehr der Kriegsminister auch auf die erlösende Nachricht hoffte, der Louvre blieb stumm. Davout beschloss, seine düsteren Ahnungen vorerst zu verdrängen. Aber Gästen eines gemeinsamen Abendessens entging an diesem Tag nicht, dass der fast 1,80 Meter große, kahlköpfige Mann mit dem feingeschnittenen Gesicht äußerst nervös war. Der Kriegsminister wirkte fahrig, beinahe geistesabwesend und beteiligte sich kaum an den Gesprächen bei Tisch.
Die Antwort auf seine Fragen sollte der Marschall schon am nächsten Morgen erhalten. Als Davout im Norden von Paris die Befestigungsarbeiten bei Villette leitete, fiel ihm eine Kutsche auf, die in Begleitung eines Adjutanten geradewegs aus Belgien kam. Der Fürst von Eckmühl beschloss, sich mit dem Offizier zu unterhalten, der den Leichnam eines gefallenen Generals nach Hause brachte. Was der Adjutant erzählte, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Der Offizier berichtete ihm, von flüchtigen Soldaten gehört zu haben, dass die französische Armee vernichtet und auf der Flucht sei. Dies reichte, um den Kriegsminister davon zu überzeugen, dass seine Anwesenheit beim Ausbau der Befestigungen überflüssig war und er sofort andere Prioritäten zu setzen hatte. Eine Nachricht von derartigem politischen Sprengstoff bedurfte der Überprüfung, zumal der Bericht des Adjutanten in den Augen des argwöhnischen Kriegsministers nicht vollkommen glaubwürdig war. Schließlich hatte jener Adjutant weder bei Waterloo gekämpft, noch die Flucht der Truppen vom Schlachtfeld selbst beobachtet. Was der Mann berichtete, fußte auf den Aussagen flüchtiger Soldaten, die er in Avesnes getroffen hatte. Diese konnten jedoch noch während der Kämpfe desertiert sein und aus Angst vor Strafe ihre Flucht mit dem Gerücht einer Niederlage bemäntelt haben. Nein, der Marschall musste sich selbst überzeugen und erteilte einem vertrauenswürdigen Offizier, Colonel Michelet, den Befehl, die Lage zu sondieren.
Davout brauchte noch nicht einmal einen Tag zu warten. Noch am Abend des 20. Juni bestätigte Michelet die Aussage des Adjutanten in allen Punkten. Davout war erschüttert und verlor für einen Augenblick die Fassung, dann fügte er sich in das Unvermeidliche. Verhielt es sich so, wie Michelet berichtete, galt es, sofort energische Maßnahmen zu ergreifen. Noch stand der Feind nicht in Frankreich, noch waren die Grenzfestungen unbezwungen. In seiner Funktion als Kriegsminister schickte der Marschall zwei telegrafische Depeschen zum Gouverneur von Lille und zum Generalkommandanten des 16. Militärbezirks, in denen er sie dazu aufforderte, ihre Plätze standhaft zu verteidigen und auf weitere Anweisungen zu warten. Dann begab er sich in den Élysée-Palast, wo der Ministerrat unter Joseph Bonaparte schon zusammengetreten war und der Bruder des Kaisers den Brief vorlas, den Napoleon ihm geschickt hatte. Der Rat war wie Davout geschockt. Einzig Polizeiminister Fouché behielt die Fassung, da die Niederlage ihm in die Karten spielte und er im Geheimen den Sturz Napoleons vorbereitete.
Joseph Fouché war der verkörperte Gegensatz zu Davout, weshalb ihn dieser aus tiefstem Herzen verabscheute. Seinen Feinden galt der schmächtige, äußerlich wenig einnehmende Polizeiminister als der geborene Opportunist und Intrigant. Die Ranküne war sein Metier, Verschwörungen und Bespitzelungen sein Lebenselixier. 1793 hatte er als radikaler Jakobinerführer für den Tod König Ludwigs XVI. gestimmt, dann Robespierre unterstützt, um diesen kurz darauf mit der bürgerlichen Opposition zu stürzen und aufs Schafott zu bringen. Während der folgenden Zeit des Direktoriums war Fouché zum Polizeiminister aufgestiegen und hatte sich mit dem korrupten Regime arrangiert. In einer weiteren Volte schloss er sich Napoleon Bonaparte an, der am 18. Brumaire 1799 gegen das Direktorium putschte und sich selbst zum 1. Konsul der Republik ernannte. In den folgenden Jahren des Konsulats und des Kaiserreichs hatte Fouché Napoleon als Polizeiminister gedient, bis er Hochverrat beging und mit England Geheimverhandlungen führte, was ihm die Verbannung auf seine Güter einbrachte.
Danach war es lange Zeit still um ihn gewesen, bis Napoleon Fouché wieder begnadigte und ihm die Verwaltung Illyriens übertrug 3, wo er bis zur ersten Abdankung Napoleons blieb. In der folgenden Zwischenzeit der ersten Restauration hatte es Fouché nicht geschafft, ein wichtiges Amt zu bekommen. Erst als Napoleon Elba verließ und in Frankreich landete, war es ihm gelungen, die Gunst des Kaisers wiederzuerlangen. Doch zu seiner Enttäuschung hatte ihm Napoleon erneut nur das Amt des Polizeiministers in Aussicht gestellt, was den Ehrgeizigen sehr verbitterte, da er sich zu Höherem berufen glaubte.
Jetzt, nach Waterloo, witterte Fouché seine Chance, sich für all die durch Napoleon erlittenen Erniedrigungen zu rächen und den Despoten endgültig zu stürzen. Dies erforderte jedoch eiserne Verstellung und so gab sich der Altmeister der Intrige seinen Kollegen gegenüber zutiefst betrübt über die Niederlage von Waterloo. Scheinheilig kam er mit Davout und seinen Ministerkollegen darin überein, dass es besser sei, vorerst keine übereilten Schritte zu tätigen und die Ankunft Napoleons abzuwarten.
Dieser Beschluss, mit dem sich der Ministerrat selbst zur Untätigkeit verdammte, kam Fouché wie gerufen. Noch in derselben Nacht schürte er die Angst der Abgeordneten, indem er gezielt Gerüchte streuen ließ, dass Napoleon nach Paris käme, um die Kammern aufzulösen und die Diktatur auszurufen.
Dies konnten die Liberalen, allen voran der Marquis de Lafayette, nicht zulassen. Als der Morgen dämmerte, waren er und seine Gefolgsmänner bereit, sich dem Kaiser zu stellen und im Sinne Fouchés jene historischen Entscheidungen zu treffen, die letztendlich zur Entmachtung Napoleons führen sollten.
Der Kaiser kam um 9 Uhr völlig erschöpft und ausgelaugt in einer schäbigen zweispännigen Kalesche in Paris an. Napoleon, so viel wurde auf den ersten Blick klar, war nur noch ein Schatten seiner selbst und stand körperlich wie seelisch kurz vor dem Zusammenbruch. Schwer atmend, mit wächsernem Gesicht, stieg er aus dem Wagen. Keuchend quälte er sich die Treppen des Palastes hoch, wo er von seinem Außenminister Caulaincourt empfangen wurde. Seine einst durchdringenden blauen Augen waren leblos, der Blick stumpf. Mit brüchiger Stimme befahl er den Lakaien, ihm ein Bad zu bereiten. Dann beklagte er sich lauthals bei seinem Außenminister über den Verlauf der verlorenen Schlacht, bis er sich der erneuten Hoffnung hingab, mithilfe der beiden Kammern eine neue Armee zu erschaffen.
Caulaincourt war diesbezüglich weniger optimistisch. Er wusste, dass die Abgeordnetenkammer unter Führung La Fayettes diesem Vorhaben keine Zustimmung gäbe. Aber Napoleon winkte nur müde ab und ließ seinen Außenminister im Flur stehen, um ein Bad zu nehmen. Er saß kaum in der Badewanne, als ihm der Fürst von Eckmühl gemeldet wurde. Obwohl der Kaiser vor allem dringend Ruhe gebraucht hätte, konnte er es sich nicht versagen, Davout zu empfangen. Audienzen dieser Art waren am Hofe Napoleons nicht ungewöhnlich. Der Korse hatte schon oft seine Marschälle, Minister und Generäle beim Bad empfangen, doch an jenem Tag waren die Umstände so gewichtig, dass Davout diese Episode schriftlich festgehalten hat.
»Da haben wir’s, Davout, da haben wir’s!«
Bei diesen Worten hob Napoleon beide Arme zum Himmel und ließ sie sogleich wieder kraftlos ins Wasser klatschen, sodass die Uniform des Marschalls nass wurde. Der Kriegsminister überspielte diesen peinlichen Vorgang und kam zur Sache.
»Majestät, ich erwarte Ihre Befehle!«
Es waren Worte, die in den Wind gesprochen waren. Napoleon wirkte fahrig, hörte nicht zu. Stattdessen beklagte er sich über Marschall Ney, der seiner Ansicht nach bei Waterloo versagt hatte. Wenn der Kaiser hoffte, bei Davout Verständnis zu finden, sah er sich getäuscht. Seine Worte mussten für den Fürsten von Eckmühl bitter klingen. Wie Ney hatte er sein Leben für Napoleon aufs Spiel gesetzt, als er sich auf seine Seite stellte und das Amt des Kriegsministers annahm. »Er hat sich für Sie die Schlinge um den Hals gelegt, Sire«, bemerkte Davout bitter.
Napoleon überhörte den anklagenden Unterton in Davouts Stimme, driftete schon wieder in seinen Gedanken ab.
»Was soll aus all dem werden, Davout?«
Der Fürst hatte darauf eine klare Antwort. Er setzte dem Kaiser auseinander, dass nichts verloren sei, wenn er sofort von seinem Recht als Souverän Gebrauch machte und die Kammern beurlaubte, um Frankreich diktatorisch zu regieren, bis der Feind geschlagen war. Nur so war Davouts Meinung nach das Vaterland zu retten.
Napoleon überlegte kurz und lehnte den Ratschlag seines Kriegsministers ab, was er auch in der anschließenden Ministerkonferenz noch einmal unterstrich.
So leicht jedoch ließ sich Davout nicht abschütteln. Eindringlich beschwor er seinen Souverän, seinen Vorschlag noch einmal sorgfältig zu prüfen.
Aber Davout scheiterte. Napoleon wollte die von ihm geschaffene, erst wenige Wochen alte Verfassung nicht gleich brechen, indem er sie durch die Errichtung einer Diktatur außer Kraft setzte.
An jenem 21. Juni 1815 wähnte er sich noch sicher, Davouts Ratschlag nicht befolgen zu müssen. Doch der Kaiser unterschätzte seine innenpolitischen Feinde. Jetzt rächte es sich bitter, La Fayette in all den vergangenen 20 Jahren den Weg zur Politik verbaut zu haben. Noch einmal zeigte sich die einzigartige Beredsamkeit des alten Mitkämpfers George Washingtons, der bei Yorktown für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gestritten und 1789 zusammen mit Mirabeau das Panier der Revolution ergriffen hatte. Wenn auch Fouché hinter den Kulissen die Fäden zog, so darf die Bedeutung La Fayettes beim Sturz Napoleons nicht unterschätzt werden.
Es waren sein Einfluss, sein Mut und sein rhetorisches Talent, die den Kaiser dazu brachten, für immer der Macht zu entsagen. Ein zynischer Drahtzieher wie Fouché allein hätte dies nicht fertig gebracht. Dafür bedurfte es des inneren Feuers und des Charismas von La Fayette. Nur dieser konnte in den Kammern den Mut wecken, einem Titanen wie Napoleon die Stirn zu bieten.
Es waren La Fayette und seine Gefolgschaft, welche die Nationalgarde zum Schutz beider Kammern mobilisierten. Und es war der unermüdliche Marquis, der die Abgeordneten und Pairs dazu brachte, eine Erklärung zu verabschieden, in der sie verkündeten, dass Senat und Abgeordnetenhaus unauflösbar seien und jeder Versuch der Zuwiderhandlung als Hochverrat bestraft würde.
Mit diesem genialen Schlag, der einem Staatsstreich gleichkam, hatte das Parlament die Gesetzesinitiative vollkommen an sich gerissen und den Kaiser in eine Sackgasse manövriert. Von nun an diktierten die Kammern Napoleon das Geschehen, ganz so wie Fouché und La Fayette es geplant hatten. Die Minister der kaiserlichen Regierung erhielten von den Abgeordneten den Befehl, sich dem Parlament zur Verfügung zu stellen und über die politische Lage zu berichten, ohne dass Napoleon dies verhindern konnte.
Was die Volksvertretung von den Ministern zu hören bekam, bestätigte sie darin, einer Fortführung des Krieges nicht zuzustimmen. Stattdessen wurden Stimmen laut, die unverblümt die Abdankung Napoleons forderten, damit der Frieden so schnell wie möglich geschlossen werden konnte.
Aber Napoleon dachte nicht daran aufzugeben. Ein letztes Mal versuchte er, die Volksvertretung umzustimmen, und sandte seinen Bruder Lucien zu den Kammern, was seine endgültige Niederlage besiegelte. Zu sehr haftete dem Bruder Bonapartes der Ludergeruch des 18. Brumaire 1799 an, erweckte sein Erscheinen die Erinnerung an jene Grenadiere, die mit aufgepflanztem Bajonett den Rat der Fünfhundert auseinandergetrieben hatten. Lucien Bonaparte war chancenlos, so sehr er sich auch mühte. Als er sich im folgenden Plädoyer für seinen Bruder dazu hinreißen ließ, den Franzosen den Vorwurf zu machen, undankbar gegenüber ihrem Kaiser zu sein, erlitt er durch La Fayette eine entscheidende Niederlage. Wütend erhob sich der Marquis von seinem Sitz und vernichtete den Ankläger des Volkes kraft seiner messerscharfen Rhetorik.
Wie? Sie wagen uns den Vorwurf zu machen, wir hätten nicht genug für Ihren Bruder getan? Haben Sie vergessen, dass die Gebeine unserer Söhne, unserer Brüder überall von unserer Treue Zeugnis geben? In den Sandwüsten Afrikas, an den Ufern des Guadalquivir und des Tajo, an den Gestaden der Weichsel und auf den Eisfeldern von Moskau sind seit mehr als zehn Jahren drei Millionen Franzosen für einen Mann umgekommen! Für einen Mann, der noch heute mit unserem Blut gegen Europa kämpfen will. Das ist genug, übergenug für einen Mann! Jetzt ist es unsere Pflicht, das Vaterland zu retten.4
Kaum hatte La Fayette diese Worte gesprochen, brach lauter Beifall los. Der Versuch, die Kammern für die Diktatur Napoleons zu gewinnen, war auf parlamentarischer Ebene endgültig gescheitert. Nun sah La Fayette die Gelegenheit gekommen, dem Kaiser in Abstimmung mit Fouché den Gnadenstoß zu versetzen. Noch bevor Napoleon weitere Vorschläge machen konnte, konfrontierte der Marquis Lucien Bonaparte am folgenden Tag damit, dass die Kammern die Absetzung seines Bruders verlangten, sollte dieser nicht binnen 24 Stunden freiwillig abdanken.
Derartig schachmatt gesetzt, entsagte Napoleon endlich dem Thron und dankte zugunsten seines vierjährigen Sohnes, des Königs von Rom, ab, der unter dem Namen »Napoleon II.« zum Kaiser proklamiert wurde. Aber dieser Passus war schon Geschichte, kaum dass die Tinte unter der Abdankungsurkunde getrocknet war. Denn jetzt trat Fouché endlich aus dem Szenenhintergrund ins Rampenlicht der politischen Bühne, und der Machtwechsel vollzog sich mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Als ersten Schritt versagten die Kammern dem Thronfolger schlichtweg die Anerkennung, dann entfernte Fouché seinen gefährlichsten Rivalen, La Fayette, aus Paris, indem er ihn als Unterhändler zu Wellington schickte. Jetzt war der Weg zur Macht frei. Auf Antrag Fouchés beschloss das Parlament die Bildung einer provisorischen Regierung, deren Vorsitz, wie sollte es anders sein, wiederum Monsieur Joseph Fouché übernahm.
Damit war der ehemalige Polizeiminister in der Schlüsselposition, die er sich von Anfang an gewünscht hatte. Nun gab es auf Regierungsebene kein Hindernis mehr, einen Waffenstillstand mit den Alliierten zu verhandeln. Der neue starke Mann Frankreichs konnte jetzt hoffen, den Parlamentariern in kurzer Frist die Rückkehr Ludwigs XVIII. schmackhaft zu machen. Und war dies gelungen, so rechnete sich Fouché aus, dann würde er endlich den Preis seines Verrats bekommen: einen Ministerposten seiner Wahl.
Aber noch war Fouché nicht am Ziel. Noch immer gab es eine Macht im Staate, welche das feingesponnene Intrigennetz Fouchés mit einem einzigen Gewaltakt mühelos zerfetzen konnte: die Armee. Diese stand unter dem Oberbefehl des Kriegsministers Davout und war durchweg bonapartistisch gesinnt. Vor allem die bei Waterloo geschlagenen Truppen der Nordarmee stellten eine Gefahr dar. Kamen diese nach Paris zurück, so konnte eine bedrohliche Situation entstehen, wenn sie von der Abdankung Napoleons erfuhren. Dann musste damit gerechnet werden, dass sich die Truppen empörten und Napoleon wieder zur Macht verhalfen.
Zusätzlich zur Armee gab es auch noch eine andere Gefahr: die Bevölkerung der Pariser Vorstädte. Die einstigen Sansculotten der Revolution, die Arbeiter, Tagelöhner, kleinen Handwerker und Kleinbürger zeigten sich Napoleon noch immer treu ergeben. Tagtäglich wuchs die Menge derer, die vor dem Élysée-Palast zusammenliefen und nach Napoleon riefen. Die Situation wurde immer angespannter, die Stimmung aufgeheizter. Schon skandierten sie Rufe wie »Es lebe der Kaiser!« und »Gebt uns Waffen!«
All diese Vorgänge machten Fouché klar, dass der Ex-Kaiser Paris verlassen musste – und zwar schnell. Ein erster Versuch, Napoleon durch den Abgeordneten Almeida zur Abreise aus der Hauptstadt zu bewegen, scheiterte kläglich. Die Regierung musste schwerere Geschütze auffahren, um Napoleon zu vertreiben.
Wer war geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen? Für Fouché gab es nur einen, der dafür in Frage kam: Davout.
Der Kriegsminister war in den vergangenen 48 Stunden zunehmend mit Napoleon in Konflikt geraten, je stärker dieser den Willen zeigte, Frankreich seinem politischen Ehrgeiz zu opfern. Als der Kaiser sich erneuten Fantastereien hingegeben hatte, mithilfe neuer Konskriptionen 300 000 Rekruten ins Feld zu stellen, war ihm Davout über den Mund gefahren. Barsch hatte er Napoleon klargemacht, dass er ihm diese 300 000 Konskribierten nicht gäbe.
Genau so hart war der Fürst von Eckmühl mit seinem Souverän ins Gericht gegangen, als dieser kurz vor seiner Abdankung plötzlich ins Auge fasste, die Kammern doch noch mit militärischer Gewalt aufzulösen. Jetzt, wo Napoleon scheinbar Davouts Vorschlag aufgriff, wandte sich sein Kriegsminister gegen ihn und redete ihm ins Gewissen.
Davouts Meinung nach hatte Napoleon die historische Chance verpasst, sofort nach seiner Ankunft in Paris unter Berufung auf den nationalen Notstand eine Diktatur zu errichten. Jetzt, da die Volksvertretung sich für permanent und ihre Auflösung zum Hochverrat erklärt hatte, sah Davout vom juristischen Standpunkt das Recht auf Seiten der Kammern.
Darüber hinaus gab es noch andere Gründe für Davout, einen Staatsstreich abzulehnen. In der Vendée, in der Bretagne, im Languedoc und in der Provence, wo die Mehrheit der Bevölkerung antinapoleonisch gesinnt war, erschütterten Aufstände das Land. Schon zog das Schreckgespenst des Bürgerkriegs auf, wurden erklärte Bonapartisten in Marseille zu Hunderten abgeschlachtet.
Und selbst bei einem geglückten Staatsstreich und einem Sieg Napoleons über die Royalisten hätte Frankreich der Invasion der Verbündeten nicht standgehalten. Im Norden fraßen sich die Heerwürmer der Briten und Preußen durch das Land und marschierten auf Paris zu. Im Osten setzten sich jenseits des Rheins die Heeressäulen der Österreicher und Russen gegen Frankreich in Marsch. Schon jetzt befanden sich 105 000 Preußen und Briten auf dem Vormarsch nach Paris, denen nach Gneisenaus Schätzungen nur 60 000 Franzosen entgegengeworfen werden konnten.
Angesichts dieser ungleichen Kräfte stellte sich gar nicht die Frage, den Krieg ernsthaft fortzuführen. Im Gegensatz zu Napoleon sah Davout Frankreichs Chance einzig darin, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, bevor die Alliierten Paris eroberten. Gab es die Aussicht auf einen ehrenvollen Frieden, so musste sie genutzt werden. Und stand Napoleon diesem Frieden im Weg, so musste er aus Paris fortgeschafft werden.
Ganz so einfach war die Sache trotzdem nicht. Davout befielen Skrupel. Zu stark spürte er den Zynismus seiner Mission. Ausgerechnet ihm, der bis dahin als einer der treuesten Anhänger des Kaisers gegolten hatte, oblag es, Napoleon wie einen Hund auf die Straße zu setzen. Waren es Gewissensbisse, die den Marschall quälten? War es Furcht vor Napoleon oder Angst vor dem Makel, mit dem er seine Ehre durch diese in den Augen der Armee verräterische Aktion befleckte?
Davout versuchte, die schwierige Aufgabe gut vorzubereiten. Da er wusste, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für Frankreich war, wählte er einen Mittelsmann aus, der Napoleon darauf vorbereiten sollte, nach Malmaison zu ziehen. Seine Wahl fiel auf einen der Adjutanten Napoleons, General de Flahaut, den Liebhaber von Hortense Beauharnais, der Stieftochter des Kaisers. Der jedoch verweigerte sich öffentlich dem Befehl, was zu einer heftigen Szene zwischen ihm und dem Marschall führte, der sich ein derartiges Verhalten nicht bieten lassen wollte.
»Sagen Sie Ihrem Bonaparte, wenn er sich nicht sofort aus dem Staub macht, werde ich ihn festnehmen lassen!«
Bei diesen Worten richtete sich Flahaut, der Freund der Königin Hortense, stolz auf und maß den Marschall, der sich so weit vergessen konnte, mit einem Blick, in dem Verachtung und Mitleid gepaart waren: »Sagen Sie das dem Kaiser selbst, Sie, der Sie doch stets zu seinen Füßen gekrochen sind!«
»Herr, ich bin Ihr Vorgesetzter!«, fährt Davout auf, den gutgezielten Hieb durch Pochen auf die Subordination abwehrend. Es gelingt ihm nicht: »Mein Vorgesetzter? Nicht mehr! Denn bei einer Armee, der Sie angehören, bleibt kein Mann von Ehre!«5
Diese Worte eines scheinbar aufrechten Dieners des Kaisers sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, was ihre Glaubwürdigkeit hinsichtlich Davouts Reaktion anbetrifft. Entgegen seiner Haltung Davout gegenüber sollte Flahaut noch vor Napoleons Abreise nach Rochefort schnell das Interesse an seinem heiß geliebten Kaiser verlieren und bald in die Dienste der Bourbonen treten, um Karriere zu machen.
Indes wäre es auch eines Davout unwürdig gewesen, sich Flahauts zu bedienen, um Napoleon von der Bühne der französischen Politik zu verabschieden. Nein, das Schicksal hatte andere Pläne, die zu einer letzten Konfrontation der beiden einstigen Revolutionsgeneräle führen sollten.
Und so machte sich Davout am 24. Juni 1815 schweren Herzens auf den Weg in den Élysée-Palast. Auf dem Weg dorthin begegnete er Tausenden von Anhängern des Kaisers, die mit grünen Zweigen durch die Straßen zogen und für Napoleon demonstrierten. Was Davout zu hören bekam, bestätigte ihm die Wichtigkeit seiner Mission. Losungen wie »Keine Abdankung! Die Minister sind Verräter! Kammerauflösung! Nieder mit den Bourbonen!« machten die Runde.
Überall zeigten sich dem Marschall gefährliche Anzeichen einer revolutionären Situation, Straßen voller Menschenmassen, aggressive Sprechchöre und der Verfall der öffentlichen Ordnung. Daran änderte sich auch nichts, als es dem Fürsten endlich gelang, zum Élysée-Palast vorzudringen. Als er aus seiner Kutsche stieg, fand er zu seinem Erstaunen im Schlosshof große Gruppen von Offizieren vor, die zum Palast gekommen waren, um den Kaiser noch einmal zu sehen. Dies war ein Anblick, der den Marschall zur Weißglut brachte. Zornig warf er ihnen vor, ihre Truppen im Stich gelassen zu haben, und befahl den Verschreckten, sich bei ihren Einheiten einzufinden.
Dann begab er sich zu Napoleon, der ihn schon erwartete. Hatte der Kriegsminister gehofft, dass der Kaiser ihm seine Mission leicht machte, sah er sich schnell eines Besseren belehrt. Als Davout den Saal betrat, empfing Napoleon ihn kalt und zeigte großen Widerwillen, ihn anzuhören.
Der Marschall ließ sich nicht einschüchtern. Er setzte Napoleon auseinander, dass es zum Wohle Frankreichs besser sei, wenn er als Zeichen seiner Machtentsagung Paris verließe und vorerst zu seiner Schwester Hortense nach Malmaison zöge, wo ihn die Regierung besser schützen könne. Napoleon hörte Davout erst schweigend zu, doch dann gewann sein Stolz die Oberhand. Trotzig deutete er auf ein offenes Fenster, durch das deutlich die Rufe der Straße in die Stille des Palastes drangen.
Hören Sie das Geschrei da draußen? Wenn ich mich an die Spitze dieses Volkes setzen wollte, würde ich schnell fertig mit all jenen Leuten, die erst Mut gegen mich aufbrachten, als sie mich wehrlos wussten. Man will, dass ich weggehe? Gut, darauf soll es mir auch nicht mehr ankommen.6
Napoleon hatte kaum den Satz beendet, als er wütend den Raum verließ, ohne Davout die Hand zu reichen. Nüchtern hielt der Marschall am gleichen Tag das Treffen mit dem Kaiser in seinem Notizbuch fest: »Die Begegnung war eisig, die Trennung noch eisiger.«
Der lapidare Kommentar des Marschalls erscheint auf den ersten Blick um Sachlichkeit bemüht. Aber es ist das Nichtgesagte, die Sprachlosigkeit, die diesen Satz so bedeutsam macht.
Grußlos verabschiedeten sich hier zwei Männer, die, ohne jemals miteinander befreundet gewesen zu sein, durch schicksalhafte Symbiose miteinander Weltgeschichte geschrieben hatten.
Beide verdankten einander viel: Napoleon Davout seine größten Siege, Davout Napoleon seinen kometenhaften Aufstieg.
Aber das machte ihn noch längst nicht zur willenlosen Kreatur des Kaisers. Erstaunt musste Napoleon feststellen, dass er Davouts Patriotismus unterschätzt hatte. Ein fataler Irrtum, den Napoleon erst Wochen später auf der Fahrt nach Rochefort seinem Bewacher General Becker gegenüber zugab: »Wer hätte das gedacht von Davout? Er liebte Frankreich mehr als mich!«
Mit dieser Feststellung hatte der abgedankte Kaiser recht. Während Napoleon sich Anfang Juli auf den Weg zum französischen Atlantikhafen Rochefort machte, um Frankreich zu verlassen, versuchte Davout, Paris davor zu bewahren, dasselbe Schicksal wie Moskau und Hamburg zu erleiden.
Doch erste Waffenstillstandsverhandlungen mit den anrückenden Engländern und Preußen scheiterten. Erst als sie bei Rocquencourt nach heftigen Kämpfen eine Kavalleriebrigade verloren und bei Issy auf Widerstand stießen, ließen Blücher und Wellington wieder Verhandlungen zu.
Wie Davout dürstete es auch die Sieger von Waterloo nicht mehr nach weiteren Blutbädern, besonders wenn die Übergabe der feindlichen Hauptstadt durch Unterhandlungen zu erreichen war.
Anfang Juli begannen daher erste Waffenstillstandsverhandlungen. Grundbedingung für das Ende der Kampfhandlungen war der Abzug der französischen Armee aus Paris hinter die Loire. Obwohl Davout sich anfangs weigerte, dies zu akzeptieren, sah er bald ein, dass ihm aufgrund der desolaten Verfassung der Armee keine andere Wahl mehr blieb. Der Abschluss eines Waffenstillstands war seiner Ansicht nach dringlichstes Gebot, und diesen, davon war er überzeugt, konnte Frankreich nur mit der Restauration Ludwigs XVIII. erlangen:
Ich schicke Eurer Exzellenz die Nachrichten, die ich darüber erhalten habe, wie die Dinge bei den Truppen stehen. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren, um den Vorschlag anzunehmen, den ich gestern gemacht habe. Wir müssen Ludwig XVIII. proklamieren, wir müssen ihn bitten, ohne die fremden Truppen in Paris einzuziehen, die niemals einen Fuß auf Pariser Boden setzen dürfen. Ludwig XVIII. muss mit der Unterstützung der Nation regieren [...] Der Gedanke an die Zukunft leitet mich. Ich habe meine Vorurteile und meine früheren Ansichten überwunden. Innerste Überzeugung und absolute Notwendigkeit haben mich davon überzeugt, dass es kein anderes Mittel mehr gibt, unser Vaterland zu retten.7
Dies ließ sich Fouché nicht zweimal sagen. Mit dieser Äußerung hatte Davout den Weg frei gemacht für die Restauration von Ludwig XVIII. aus dem Hause Bourbon. Jetzt musste Fouché die Gunst der Stunde nutzen, bevor es sich der Marschall anders überlegte.
Von nun an überstürzten sich die Ereignisse. Am 3. Juli schloss die provisorische Regierung mit den Alliierten einen Waffenstillstand. Tags darauf zog die französische Armee sich aus Paris zurück. Während die Alliierten Paris besetzten, marschierten die Franzosen hinter die Loire, die bis zum Friedensabschluss zur Demarkationslinie zwischen dem unbesetzten Frankreich und den Alliierten werden sollte. Davout selbst überwachte höchstpersönlich die Einquartierung der Truppen und schied am 8. Juli als Kriegsminister aus dem Amt. Trotzdem ließ er die Zügel nicht schleifen. Kraft seiner Autorität hielt er noch die Loire-Armee zusammen, die als Unterpfand für spätere Friedensverhandlungen wichtig werden konnte.
Diese war nach wie vor nicht gewillt, sich Ludwig XVIII. zu unterstellen. Immer noch glaubten einige Offiziere, die Alliierten aus dem Land verjagen zu können. Noch einmal warf Davout seine Autorität in die Waagschale und versuchte ihnen klarzumachen, dass die vom König geforderte Unterwerfung eine der Hauptbedingungen für die Unterbrechung der Kampfhandlungen gewesen war.
Eindringlich schärfte Davout seinen Offizieren ein, dass die Kämpfe jederzeit wieder aufflackern könnten, da die durch Deutschland anmarschierenden Russen und Österreicher bis jetzt nicht in die Waffenstillstandsverhandlungen einbezogen worden seien. In den Augen von Kaiser Franz und Zar Alexander stellte die provisorische Regierung nicht die legitime Regierung Frankreichs dar.
Am 14. Juli berief Davout die Generäle und Oberste der Loire-Armee ein, um ihnen die Dringlichkeit der Lage klarzumachen.
Die einstimmige Unterwerfung aller Truppen unter den Oberbefehl des Königs ist höchst dringlich. Es muss so sein, dass die Gesamtheit unserer Unterschriften unsere Kraft und unsere Einheit verdeutlicht. Die Armeen Europas haben sich auf Frankreich geworfen, um es mit Blut und Feuer zu überziehen; es gibt keine Hoffnung mehr, sie mit der Waffe in der Hand zu vertreiben. Nur die Regierung von Ludwig XVIII. kann die Verwüstung und Zerstückelung Frankreichs verhindern. Und deswegen sollte sich die Armee um ihn scharen. Meine Haltung leitet nur das öffentliche Interesse. Man wird mich nicht bei Hofe sehen, noch eine Beschäftigung annehmen sehen. Ich werde in den Ruhestand gehen und den Rest meiner Tage der Erziehung meiner Kinder widmen.8
Dies war ein großes persönliches Opfer, das ein Mann darbrachte, dessen Lebenssinn darin bestanden hatte, für die Französische Republik und das napoleonische Kaiserreich Krieg zu führen. Das Beispiel des Marschalls fand Nachahmer, aber der Unterwerfungsakt war eine Arznei mit bitteren Nebenwirkungen. Davout hatte sich nicht mit seiner Forderung nach einer Generalamnestie für alle Offiziere und Soldaten durchsetzen können, die während der Hundert Tage den Eid auf Napoleon geleistet hatten. Der König hatte sich zu nichts verpflichtet.
Wenige Tage nach der Vereidigung der Armee auf den König wurde eine Liste mit den Namen von 19 Offizieren veröffentlicht, die man des Hochverrats am König bezichtigte und die Verhaftung von 38 weiteren Personen angekündigt. Diese sollten in Haft bleiben, bis ihr Fall vor dem Gerichtshof geklärt werden konnte.
Genau das hatte Davout verhindern wollen. Empört protestierte er gegen diese Maßnahme und setzte sich verzweifelt für diejenigen Offiziere ein, die seiner Meinung nach den König nicht verraten hatten. Doch Davouts Protest verhallte ungehört. Fouché selbst war es gewesen, der die Geächteten auf die Liste gesetzt hatte, und der König ließ nicht mit sich handeln, was Marschall Ney, den Davout vergebens zu verteidigen versuchte, das Leben kostete.
Immerhin hatte Davout trotzdem einen Teilerfolg zu verzeichnen: Er fand Zeit, die meisten der Geächteten noch rechtzeitig zu warnen oder ihnen zur Flucht zu verhelfen, bevor er am 1. August den Oberbefehl über die Loire-Armee niederlegte.
Zu diesem Zeitpunkt war Napoleon schon darüber unterrichtet, dass er den Rest seines Lebens auf der Insel St. Helena verbringen würde. Dies war ein Schock für ihn, der felsenfest damit gerechnet hatte, einen beschaulichen Lebensabend in England zu verleben.
Trotzdem wusste der Ex-Kaiser der Franzosen sich schnell in die neue Situation einzufinden. Gemeinsam mit seinen Getreuen Las Cases und Gourgaud beschloss er, noch an Bord des britischen Linienschiffs »Bellopheron« mit der Niederschrift seiner Memoiren zu beginnen.
In diesen fällte er nach all den Jahren, gezeichnet von Bitterkeit, ein vernichtendes Urteil über seine einstigen Weggefährten, besonders über Davout:
Er hat mich zum Schluss genauso verraten wie all die anderen. Als er meine Sache gefährdet sah und als er sie verloren glaubte, wollte er all die Ehren und alles, was er mir an Reichtümern verdankte, retten. Er hat mir schlecht gedient.9
Dies ist ein schwerer Vorwurf und zugleich der Beweis, dass die Zusammenarbeit von Davout und Napoleon von Anfang an die Geschichte eines großen Missverständnisses war. Der Kaiser hatte Davouts Pflichtergebenheit mit Untertänigkeit verwechselt und in ihm nur seinen ehrgeizigen Gefolgsmann gesehen. Bei genauerem Studium von Davouts Vergangenheit wäre ihm aufgefallen, dass dessen Vaterlandsliebe einer eisernen Familientradition entsprang.
II
Vom Kadetten des Königs zum Revolutionsgeneral
»Wenn ein D’Avoust der Wiege entsteigt, wird ein Schwert aus der Scheide gezogen.«
Burgundisches Sprichwort
Am 7. Mai 1770 wurde in der Geschichte des Königreichs Frankreich und Österreichs ein neues Kapitel aufgeschlagen. In Reichweite der kaiserlichen Festung Kehl gegenüber dem französischen Straßburg steuerten mehrere festlich geschmückte Kähne eine unbewohnte Rheininsel an, die im Niemandsland zwischen beiden Mächten lag.
Anmutig setzte ein blauäugiges, weißgepudertes Mädchen von 14 Jahren seine Füße auf den Boden der Insel und ging, begleitet von ihren Höflingen, auf einen Pavillon zu, dessen Holzwände kostbare Stofftapeten mit allegorischen Darstellungen schmückten. Dieser Pavillon war zweigeteilt. Die östliche Hälfte symbolisierte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, der Tisch in der Mitte markierte die Grenze und die westliche Hälfte des kleinen Saals verkörperte das Königreich Frankreich.
Jetzt kam der wichtigste Teil der Prozedur und der schamhafteste Akt für die Vierzehnjährige. Unter den Augen der Zeremonienmeister schritt die junge Habsburgerin andächtig zu dem Tisch in der Saalmitte und entledigte sich ihrer Kleider, bis sie ganz nackt war. Dann überschritt sie zitternd die symbolische Grenze zwischen Frankreich und dem Reich und ging in den anderen Trakt, wo sie sofort nach französischer Mode neu eingekleidet wurde. Nun erst war dem Protokoll Genüge getan, konnte sich die junge Österreicherin nach Salischem Recht10 als Braut des zukünftigen Königs Ludwig XVI. von Frankreich betrachten, den sie in einer Woche treffen sollte.
An jenem 7. Mai 1770 hatte Marie Antoinette von Habsburg den Ritualtod erlitten, um als Thronfolgerin und spätere Königin Frankreichs wiedergeboren zu werden.
Der Zufall wollte es, dass in derselben Woche, in der dieser wunderliche Akt geschah, ein Junge im burgundischen Dorf Annoux geboren wurde, der einst ein großer Feind des Reiches werden sollte: Louis Nicolas Davout.
Seine Mutter, Françoise-Adélaïde Davout, war eine geborene Minard de Velars, sein Vater, Chevalier Jean François D’Avoust, trug den Titel eines Junkers und stammte aus uraltem burgundischem Adel. Zum Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Sohnes bewohnten beide zusammen ein ärmliches Landhaus, das Jean François D’Avoust von seinem kargen Sold angemietet hatte, den er als Leutnant im Kavallerieregiment La Rochefoucault bekam.
Eins nämlich war allen D’Avot, Davo, Davoust, Davoult, D’Avoust, D’Avout oder Davout11, wie sie im Lauf der Jahrhunderte geschrieben wurden, gemeinsam: die Vorliebe für das Waffenhandwerk und den Soldatenstand. Aus dem Tale Avot in Burgund stammend, hatten Generationen dieser kriegerischen Familie erst unter dem Andreaskreuz der Burgunderherzöge, dann unter dem Lilienbanner Frankreichs gekämpft. Zu Reichtum waren die wenigsten dieser streitbaren Sippe gelangt.
In dieser Hinsicht bildete Jean François D’Avoust12 keine Ausnahme. Zeitzeugen beschrieben ihn als schmuck, tapfer und von untadeligem Benehmen, aber mit dem Makel behaftet, arm zu sein. Wie bedeutend dieser Mangel an Eigentum und Besitz in einer ständischen Gesellschaft wie der des 18. Jahrhunderts sein konnte, zeigt ein Bericht über die Eignung von Nachwuchsoffizieren, die 1764 verfasst wurde. Hier heißt es über Jean François D’Avoust lapidar: »Sehr gutes Subjekt, sehr fleißig, er ist guter Abstammung und hat den Eifer, nützlich zu sein, er hat kein Vermögen«.13
Daran änderte sich auch durch die Heirat mit Françoise-Adélaïde de Minard nichts. Entgegen den Gepflogenheiten des Jahrhunderts hatten beide 1768 aus Liebe und nicht aus materieller Berechnung geheiratet, was die Mutter der Braut nicht guthieß. Aber die bildhübsche, energische Françoise-Adélaïde hatte es verstanden, sich gegen den Willen ihrer Mutter durchzusetzen, die in der Verbindung mit einem mittellosen Offizier eine klassische Mesalliance sah. Indes, die anfängliche Abneigung von Davouts Schwiegermutter legte sich bald, als sie sah, dass sich ihr Schwiegersohn rührend um ihre Tochter und sein Kind kümmerte, wann immer es ihm sein Dienst ermöglichte.
Die junge Familie blieb nur kurze Zeit in Annoux und zog Ende 1770 nach Étivey bei Avallon, wo die Mutter von Françoise-Adélaïde wohnte. Dort brachte die junge Mutter drei weitere Kinder zur Welt: Julie (1771), Louis Alexandre Edme François (1773) und Isidore Louis Charles (1774). Das Leben der Davouts schien unbeschwert, als am 26. Dezember 1778 eine schreckliche Tragödie über die Familie hereinbrach.
Der Schicksalsschlag ereignete sich, als Jean François D’Avoust an einer Treibjagd auf Wildschweine teilnahm. Während die Treiber das Wild durch den Wald hetzten, löste sich aus der Flinte eines Jägers ein Schuss und verletzte den jungen Familienvater schwer im Unterbauch. Zwar gelang es, den Junker noch in ein nah gelegenes Hospital zu bringen und ihn vorläufig zu stabilisieren, aber den Ärzten wurde nach mehreren Operationen bald klar, dass Jean François D’Avoust nicht zu retten war. Am 3. März 1779 schloss der Leutnant nach mehrwöchigem Todeskampf für immer die Augen. Er hinterließ eine verzweifelte Frau mit vier kleinen Kindern.
Françoise-Adélaïde wusste vor Trauer weder ein noch aus. Wie sollte sie sich und ihre Zöglinge durchbringen? Zum persönlichen Schmerz um den Verlust des geliebten Mannes gesellten sich Geldprobleme: 372 Pfund schuldete sie den Chirurgen des Hospitals, 66 Pfund dem Apotheker, 180 Pfund für die Trauerfeierlichkeiten.
Die Not war groß und wurde einzig durch den Umstand gelindert, dass ihre Mutter Mme. de Velars sich vorerst um die Erziehung ihrer Kinder kümmerte und Louis Nicolas bei einer renommierten Privatlehrerin namens Mme. Moreau anmeldete.
Diese Maßnahme, die als Vorbereitung auf den Besuch einer höheren Schule gedacht war, wurde ein Fehlschlag.
Der Neunjährige erwies sich nicht als besonders gelehrig und machte vor allem in Latein wenig Fortschritte. Die Lektionen von Mme. Moreau langweilten den Knaben. Stattdessen spielte Davout in jeder freien Minute lieber mit seinen Mitschülern Krieg.
Bei diesen Spielen, die er meistens auch anführte, bewies er unermüdlichen Eifer und ließ keinen über seinen Berufswunsch im Zweifel. »Wenn ich groß bin, werde ich die Köpfe der Feinde mit einem großen Säbel abschlagen«, hörte man ihn oft sagen, worauf Mme. Moreau stets resigniert erwiderte, dass er wohl nur zum Offizier tauge.
Zu diesem Zeitpunkt ahnten weder Mme. Moreau noch der kleine Louis, dass seine kindlichen Fantasien nur drei Monate später einen entscheidenden Anschub erfahren sollten. Von der Situation überfordert, hatte Françoise-Adélaïde D’Avoust ihren ältesten Sohn Louis Nicolas in der Militärschule von Auxerre-Sur-Yonne angemeldet, wodurch sich ihre finanzielle Lage etwas enspannte. Dank einer Maßnahme des Kriegsministeriums, das den niederen Adel der Provinz für die Armee begeistern wollte, wurde der Schulbesuch mit einem Stipendium gefördert. Françoise-Adélaïde konnte sich glücklich schätzen. Ihr Glück bestand nicht nur darin, für ihren Sohn einen der heiß umkämpften Plätze an der Militärschule ergattert zu haben. Vielmehr zählte, dass sie die Unterbringung ihres Sohnes sowie dessen Unterricht und Verpflegung nichts kostete. Um dem jungen Kadetten den Schulbesuch zu ermöglichen, bewilligte ihm das Kriegsministerium eine Pension von 1100 Pfund jährlich, was deutlich über dem Durchschnitt lag. Normalerweise betrug die Höhe der Jahrespensionen für den Besuch der Militärschule in Auxerre 700 Pfund. Aber dies war nicht der einzige Geldsegen, der über das leidgeprüfte Haus der Davouts hereinbrach. Gegen Ende des Jahres 1779 genehmigte der König Françoise-Adélaïde eine Witwenrente von 200 Pfund jährlich, was ihre Existenz absicherte. Zur gleichen Zeit gelang es der jungen Witwe, ihre Tochter Julie in einer Mädchenschule unterzubringen und für den Schulbesuch ihres Sohnes Alexandre ebenfalls ein Stipendium zu erlangen. Was ihren jüngsten Sohn Charles anbetrifft, so brachte sie ihn bei einem Regimentskameraden ihres Vaters, einem gewissen M. d’Hargicourt unter. Jetzt, nachdem sie die Erziehung und Zukunft ihrer Kinder abgesichert hatte, konnte die junge Mutter endlich aufatmen.
Zu Beginn des Jahres 1780 betrat der »Cadet gentilhomme« Louis Nicolas Davout in einer blauen Uniform mit roten Aufschlägen und weißen Knöpfen das alte Jesuitenkollegium von Amyot, die Militärschule von Auxerre. Diese wurde von Benediktinern geleitet und war erst 1776 gegründet worden. Die Militärschule von Auxerre war Baustein eines umfassenden Reformprogramms, das die Ausbildung des französischen Offizierskorps von Grund auf zu erneuern trachtete. Die schweren Niederlagen des Siebenjährigen Krieges hatten die taktischen Schwächen und das strategische Unwissen vieler französischer Offiziere offenbart, die das Schlachtfeld für einen besseren Exerzierplatz hielten. Katastrophale Niederlagen wie die Schlachten von Rossbach (1757) und Minden (1759) hatten den guten Ruf der einst gefürchteten französischen Armee schwer erschüttert.
Mit der Reform von 1776 hoffte das Kriegsministerium, dies zu ändern. Zu diesem Zweck wurde ein Dutzend Militärschulen gegründet, die ihre Standorte in der Provinz hatten. Mit dieser Maßnahme sollte vor allem der niedere Landadel, dessen Angehörige oft zu arm waren, um Offizier zu werden, mithilfe von Pensionen die Chance erhalten, die Offizierslaufbahn einzuschlagen.
In dieser Hinsicht hatte der Besuch des Militärkollegs die Funktion, dem Schüler eine solide Allgemeinbildung und militärische Werte wie Disziplin und Standhaftigkeit zu vermitteln. Die Lehrer dieser Kollegien waren in Ermangelung geeigneter Pädagogen keine Offiziere, sondern erfahrene Geistliche, die klassische Lehrfächer wie Latein, Mathematik, Englisch und sogar Fechten unterrichteten. Hatten die Schüler sich nach fünf Jahren Schulunterricht bewährt, entschied ein Auswahlverfahren darüber, ob sie in Paris die École Royale Militaire, das West Point des Ancien Régime, besuchen durften.
Dass ausgerechnet Davout sämtliche Instanzen dieser Einrichtung erfolgreich durchlaufen würde, schien zu Beginn des Jahres 1780 noch völlig undenkbar. Der Neunjährige tat sich mit der strengen Disziplin im Militärkolleg äußerst schwer und kam mit dem Erziehungskonzept der Benediktiner nicht zurecht. Er störte oft den Unterricht und glänzte eher als Raufbold denn als Musterschüler. Dies ging sogar so weit, dass er eines Tages einem Mitschüler vorschlug, ihn bei den tagtäglichen Schulhofschlägereien zu beschützen, falls dieser für ihn lästige Hausaufgaben erledigte.
In einem Brief aus dem Jahre 1807 meinte Davouts Mutter rückblickend, dass ihr Sohn während seiner Kindheit dafür bekannt gewesen sei, mit äußerster Kaltblütigkeit für viel Lärm zu sorgen. Diese und andere Eigenschaften – der Hang zur Provokation und Rebellion sowie eine außergewöhnliche Nervenstärke – sollten sich im Lauf der Jahre zu seinen Hauptcharakterzügen entwickeln.
Aber noch etwas anderes zeigte sich in diesen prägenden Jahren: sein Hang zu den Kriegskünsten sowie seine hohe analytische Begabung. Während er überhaupt keine Neigung zu Latein zeigte und in Deutsch versagte, war er ein guter Fechter und erbrachte unter der Anleitung des Pädagogen Dom Laporte in Algebra und Geometrie ausschließlich exzellente Leistungen.





























