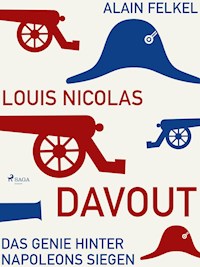Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kampf gegen die Schrecken der Meere. Das Buch über die Piratenjäger Seit Beginn der Seefahrt ist Piraterie eine Gefahr für die Weltmeere. Brutal nutzen Piraten kriegerische Wirren und anarchische Zustände, um ihr Gewerbe zu professionalisieren und sich in Bünden zusammenzuschließen. Sie fallen über Handelsschiffe und reiche Küsten her, um sie auszurauben. Wikinger, Likedeeler, Barbaresken und Bukanier sind die Schrecken der Meere und des Seehandels. Bis zu dem Tag, an dem sich die geschädigten Mächte zur Piratenjagd rüsten. Piratenjägern aus aller Welt ist Felkels Buch gewidmet. Sie begeben sich auf die Spur der Seeräuber, um ihnen ihr Handwerk zu legen. In erbitterten Waffengängen und Strafexpeditionen, aber auch mit List und Diplomatie setzen die Piratenjäger alles daran, die Meere von ihren Widersachern zu befreien. Doch Piraterie stirbt nicht aus. Seit dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts werden erneut Menschen mitsamt ihren Schiffen geraubt und erst gegen Lösegelder in Millionenhöhe wieder freigelassen. Und wieder entsenden Handelsmächte ihre Kriegsflotten, um der Gefahr wirksam zu begegnen. Von der Antike bis zur Gegenwart zeichnet Alain Felkel in Operation Piratenjagd diesen epischen Konflikt nach. Spannend wie ein Kriminalroman! AUTORENPORTRÄT Alain Felkel studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Spanisch-Romanistik und Iberoamerikanische Geschichte in Marburg, Salamanca und Köln. Seit 1997 ist er als Drehbuchautor und historischer Berater für Fernsehproduktionen tätig. 2006 Co-Autor des TV-Serienbegleitbuchs "Die Germanen" und 2009 Autor von "Aufstand. Die Deutschen als rebellisches Volk". Heute lebt er als freier Autor und Regisseur in Köln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Felkel
Operation Piratenjagd
Von der Antike bis zur Gegenwart
Saga
Meinen Eltern und Susann
Prolog
»Dies verfluchte Gewerbe besteht schon so lange und ist so umfänglich, dass sie wie Unkraut oder Hydraköpfe ebenso rasch wieder emporschießen, wie wir sie niederhauen können.«
Dieses Zitat aus dem Jahr 1672 stammt aus der Feder von Sir Thomas Lynch. Es beschreibt ein Phänomen, das überall und zu jeder Zeit auf hoher See und in Küstennähe herrschte, wenn ein Seekrieg, der vor allem mit Freibeutern geführt worden war, beendet wurde: das sprunghafte Anwachsen von Piraterie nach Beendigung der Kampfhandlungen. Es zeigt deutlich die Resignation des damaligen Gouverneurs von Jamaika, der seit seinem Amtsantritt hart gegen die Seeräuber vorging, aber nur begrenzten Erfolg mit seinen Maßnahmen hatte. Offensichtlich hatte Lynch die Anhänglichkeit seiner Landsleute an das einträgliche Gewerbe der Piraterie unterschätzt. Die Raubzüge Henry Morgans und der Seekrieg gegen Spanien hatten viele Freibeuter reich gemacht. Nach dem 1670 geschlossenen Frieden mit Spanien hatten sie nicht von ihrem alten Metier lassen können und waren Seeräuber geworden. Zu dem Zeitpunkt, als der Gouverneur jene oben zitierten Zeilen schrieb, hatten sie keine Kaperbriefe mehr, die sie als Parteigänger Englands auswiesen und vor dem Henker schützten. Doch die Gefahr, geschnappt zu werden, war in ihren Augen nicht besonders groß. Die wenigen Schiffe des Gouverneurs konnten nicht überall sein. Wo ein Pirat aufgeknüpft wurde, fanden sich sofort mehrere, die ihn ersetzten. Kein Wunder, dass sich der zermürbte Repräsentant Englands einem Herkules gleich im Kampf mit der schlangenköpfigen Hydra wähnte. Schlug man dieser einen Kopf ab, wuchsen zwei neue Häupter nach. Herkules fand jedoch im Gegensatz zu Sir Thomas Lynch einen Weg, sich seines Problems zu entledigen. Jedes Mal, wenn er dem Untier einen Kopf zerschmetterte, brannte sein Neffe Iolaos sofort die Wunde mit einer Fackel aus, sodass der Bestie bald keine Köpfe mehr nachwuchsen und sie unter seinen Hieben verendete. Der Gouverneur Jamaikas versetzte den Seeräubern der Karibik viele harte Schläge, erlebte jedoch den Sieg der britischen Krone über die Bukanier nicht mehr.
Heute stehen die führenden Handelsnationen der Welt wieder vor einer ähnlichen Herkulesaufgabe wie Sir Thomas Lynch. Weltweit bleckt ein vielköpfiges Untier die Zähne, das ungleich schwerer zu bezwingen ist als damals die Bukanier: die moderne Piraterie. Im Gegensatz zur Hydra des Herkules-Mythos reißt sie keine Viehherden, sondern Containerschiffe, Massengutfrachter und Supertanker – und zwar in solchen Mengen, dass der Welthandel schweren Schaden nimmt.
Wie die antike Schlangengestalt hat auch die moderne Piraterie viele Köpfe. Einer der gefährlichsten war der Somalier »Big Mouth«, der mit bürgerlichem Namen Mohammed Abdi Hassan heißt.
Zwischen 2006 und 2011 entführte er Dutzende Schiffe, unter denen sich so prominente Opfer wie der Supertanker »Sirius Star«, die »Faina« und der belgische Bulk Carrier »Pompei« befanden. Big Mouth wurde am 12. Oktober 2013 zusammen mit einem Vertrauten am Flughafen von Brüssel verhaftet. Belgische Undercoveragenten hatten ihn, als Filmemacher getarnt, nach Brüssel gelockt, um ihn als Experten für eine TV-Dokumentation über die somalische Piraterie zu interviewen. Die Verhaftung Big Mouths wurde zu einem Meilenstein der Piratenbekämpfung. Mit ihm war den Piratenjägern erstmals kein Handlanger, sondern einer der ganz großen Bosse ins Netz gegangen. Die Verhaftung des somalischen Piratenbosses ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die in den letzten drei Jahren eingesetzt hat. Anfang 2014 verzeichnete der Jahresbericht des International Maritime Bureau für 2013 weltweit einen drastischen Rückgang piratischer Angriffe. Im Jahr 2013 wurden 12 Schiffe entführt und 202 überfallen.
22 Schiffe gerieten unter Feuer, 28 Angriffe scheiterten. Dies ergibt in der Summe 264 Vorfälle und bedeutet einen Rückgang um 41 Prozent zu den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2011, in dem 445 Schiffsüberfälle stattfanden und Piraten der Weltwirtschaft einen Gesamtschaden von 7 Milliarden US-Dollar zufügten.
Der Grund für die Abnahme der Piraterie liegt hauptsächlich in der erfolgreichen Bekämpfung des somalischen Seeraubs, der seit Beginn des 21. Jahrhunderts fast industrielle Form angenommen hatte. Als eine der wichtigsten Antipirateriemaßnahmen erwies sich die Errichtung eines 480 Kilometer langen Transportkorridors im Golf von Aden, der durch die vor Ort eingesetzten Seestreitkräfte geschützt wird. Hinzu kam die perfektionierte Eigensicherung der Schiffe. Am effektivsten war jedoch das Anheuern privater, bewaffneter Sicherheitsdienste und die seit 2008 intensivierten Seepatrouillen und Militärkonvois der multinationalen Streitkräfte von NATO, EU, UN sowie verschiedener Nationalstaaten wie USA, Russland, Indien, China und Japan. Die frühzeitige Aufklärung und Radarüberwachung des Seeraums verhinderte Piratenattacken, bevor Seeräuberboote sich überhaupt den Beuteschiffen annähern konnten. Die verbesserte strafrechtliche Ahndung von Piratendelikten durch neu gegründete Gerichtshöfe auf den Seychellen und in Kenia half, juristische Zuständigkeiten zu klären und die Seeräuber schneller und effektiver zu verurteilen, als dies bisher geschehen war. All diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Seefahrt am Horn von Afrika sicherer zu machen. Trotz dieser unbestreitbaren Erfolge gibt es allerdings keinen Grund, sich auf den Weltmeeren in Sicherheit zu wiegen. Piratenbekämpfung ist teuer. 2012 kostete der weltweite Einsatz der Seestreitkräfte die Entsendestaaten nach Angaben des deutschen Bundesministeriums für Verteidigung eine Milliarde Euro. Nach wie vor macht den internationalen Seestreitkräften zu schaffen, dass 80 Prozent der Delikte in den Hoheitsgewässern und Häfen der von Seeraub betroffenen Nationen und nur 20 Prozent auf hoher See begangen werden. Dies erschwert die Bekämpfung von Piraterie durch Seestreitkräfte enorm. Nach Artikel 100 des Seerechtsübereinkommens der UNO von 1982 dürfen Kriegsschiffe Piratenschiffe nur auf hoher See bekämpfen und aufbringen, jedoch nicht in fremden Hoheitsgewässern. Die Bekämpfung von Piraten in den Hoheitsgewässern obliegt der örtlichen Polizei und der Marine des Staates, wo die Delikte begangen werden.
Dies zeigt das Dilemma der Piratenbekämpfung durch Seestreitkräfte. Der Jahresbericht des International Maritime Bureau kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Welthandel heute noch weit von den Verhältnissen von 1994 entfernt ist. Damals wurden nur 90 Attacken zur See offiziell gemeldet, was wohl auch daran lag, dass die Reeder nicht jeden Überfall ihrer Versicherung meldeten. Diese Unsitte herrscht auch heute noch vor. Meldungen von Piratenüberfällen sind nicht förderlich fürs Geschäft. Sie verursachen erhöhte Hafenliegegebühren und verteuern Versicherungspolicen. Bedenkt man, dass der Leiter des International Maritime Bureau, P. K. Mukundan, 1999 den damaligen Stand von 285 Seeräuberangriffen für besorgniserregend hielt, relativieren sich die jüngsten Erfolge schnell.
Eine Analyse der aktuellsten Überfälle zeigt ebenfalls deutlich, dass die Seeräuberei noch längst nicht auf dem Rückzug ist, sondern sich zu verlagern beginnt. Aus Angst vor Seeräuberüberfällen sind im letzten Jahr immer mehr Reedereien dazu übergegangen, die Passage durch den Golf von Aden und den Suezkanal zu vermeiden. Stattdessen schicken sie ihre Megatransportschiffe direkt auf die Reise um Afrika herum in die Häfen Europas. Doch die Schifffahrt auf der 5600 Kilometer längeren und 500 000 Euro teureren Route ist seit dem letzten Jahr ebenfalls risikoreich geworden. Denn um die Häfen der westlichen Hemisphäre zu erreichen, müssen die Frachtschiffe um das Kap der Guten Hoffnung entlang die Westküste Afrikas hochfahren und den piratenverseuchten Golf von Guinea passieren. Dies sorgte in der letzten Zeit für weitere Verluste. Im Jahr 2013 fanden allein im Golf von Guinea 48 Seeräuberattacken statt, darunter zwei Schiffsentführungen, 13 Feuerüberfälle und 13 Enterungen, wobei 36 Seeleute gekidnappt wurden und ein Seemann den Tod fand. Damit wird offensichtlich: So leicht lässt sich eine der ältesten Geißeln der Seefahrt nicht bezwingen. Zu krass ist das Missverhältnis zwischen der bitteren Armut der durch Kriege erschütterten Staaten, der sogenannten »Failed States«, und dem Reichtum der vorbeifahrenden Containerschiffe. Zu groß ist die Verlockung, Pirat zu werden. Zu leicht war es in den letzten beiden Jahrzehnten, mit Piraterie schnelles Geld zu verdienen. Viele Seeräuber in den typischen Piratenregionen wie Indonesien und dem somalischen Puntland sind meist einfache Fischer. Sie können kaum von ihrem Gewerbe leben und verdienen sich mit Seeraub ein Zubrot. Auf ihr Kerbholz gehen oft Delikte wie Diebstahl und bewaffneter Raub im Hafen und in der Hoheitszone ihres Heimatlandes. 2013 kam es allein in der Malakkastraße zu 149 Vorfällen, von denen 77 Prozent Diebstähle oder geringfügige Delikte waren. Sie alle wurden im Schutze der Dunkelheit begangen, blitzschnell ausgeführt und endeten damit, dass die Piraten im dichten Inselgewirr Indonesiens untertauchten, was eine Verfolgung meist unmöglich machte.
Dieser Art von Subsistenzpiraterie steht die gewerbliche Seeräuberei organisierter Verbrecherbanden gegenüber. Ihr Portfolio reicht vom Diebstahl ganzer Schiffe, Schiffsentführungen bis zur Erpressung von Lösegeld für Mannschaft und Schiff. Diese Banden sind hervorragend organisiert, ihre taktischen Manöver gleichen Militäroperationen. Im Habitus und Auftreten erinnern sie eher an Milizen als an Piraten, was an ihrer hervorragenden Bewaffnung liegt. Ihre Operationsbasen oder Schlupfwinkel sind entweder gesichert wie Festungen oder befinden sich in völlig unübersichtlichen Inselgruppen. Manchmal ist es die militärische Stärke der Piraten oder, wie im Fall von Somalia, die Gefahr einer politischen Eskalation, welche die Seeräuber vor Verfolgung schützt. Oft vereiteln auch korrupte Staatsorgane und Militärs die Strafverfolgung der Seeräuber, da sie selbst an deren Raubzügen prozentual beteiligt sind. Wer glaubt, dass dies jedoch nur eine Spielart moderner Piraterie ist, irrt sich. Die Geschichte zeigt, dass die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, unter denen sich Piraterie entwickelte, stets gleich waren. Zu jeder Zeit fielen Seeräuber über blühende Küstenstriche her, lauerten Piraten an den wichtigsten Handelsstraßen Kauffahrern auf. Stets waren es dieselben Faktoren, unter denen Seeraub stattfand.
Bittere Not, Kriegswirren und völlige Rechtsfreiheit bewirkten zu allen Zeiten einen Boom von Piraterie. Seeräuber wie Wikinger und Vandalen plünderten das Meer und entvölkerten mit ihren Überfällen ganze Landstriche. Meist leiteten ihre über Jahrzehnte währenden Überfälle sogar vorläufige Landnahmen ein, die zu dauerhaften Eroberungen wurden. Den gleichen Weg gingen Sarazenen und Barbaresken. Jahrhundertelang bedrohten sie die christliche Seefahrt, wobei sie sich an den Küsten des Mittelmeeres festsetzten und Staaten bildeten.
Seeräuberbünde wie Vitalier, Likedeeler und Bukanier schufen gefährliche politische Freiräume, in denen sie nach Lust und Laune walteten. Protestantische Seeräuber meist englischer und niederländischer Nation jagten unter dem Deckmantel, den katholischen Antichristen zu bekämpfen, dem spanischen Gold nach. Indische, chinesische und indonesische Seeräuber wurden zur Nemesis westeuropäischer Handelskompanien und Kolonialreiche, bis diese ihre Herausforderer strafrechtlich zu verfolgen begannen und letztendlich besiegten. Die Männer, die im Auftrag der geschädigten Mächte den Kampf mit den Seeräubern aufnahmen, waren oft aus demselben Holz geschnitzt wie ihre Todfeinde. Unter ihnen befanden sich ehemalige Freibeuter, einstige Kapitäne der Handelsmarine und hohe Seeoffiziere. Doch auch ehrgeizige Politiker, Händler und Herrscher kämpften gegen Piraten. Mit äußerster Zähigkeit jagten sie ihre Gegner, die ihnen im Falle der Niederlage genauso wenig Pardon gewährten, wie sie selbst den Seeräubern. Dramatische Zweikämpfe und erbitterte Seegefechte waren ihr tägliches Brot. Trotzdem sind die meisten von ihnen vergessen. Im Gegensatz zu Seeräubern wie Klaus Störtebeker, Henry Morgan und Edward Teach fand kaum ein berühmter Piratenjäger den Weg in die Welt von Volkssage, Lied, Roman und Kino. Versuche, dies zu ändern, scheiterten. Daran konnte selbst staatliche Erinnerungskultur nichts ändern. Obwohl in Hamburg die Kolossalstatuen der Piratenjäger Simon von Utrecht und Ditmar Koel für jedermann sichtbar die Brückenpfeiler der Kersten-Miles-Brücke zieren, kennt sie kaum jemand aus der Bevölkerung. Dies liegt daran, dass die Feinde der Seeräuber weder Mythen noch romantisch verklärte Gloriolen umranken. Noch weniger eignen sie sich zur Projektion sozialutopischer Gegenentwürfe. Das Handwerk des Piratenjägers bestand aus nüchterner Polizeiarbeit, gepaart mit seemännischem Können und militärischem Mut.
Piratenjäger waren stets Repräsentanten der vorherrschenden Gesellschaftsordnung und als solche keine Streiter für soziale Gerechtigkeit. Vielmehr lagen ihrem Handeln machtpolitische und wirtschaftliche Erwägungen zugrunde. Ihre Aufgabe war die Wiederherstellung der Sicherheit auf See, sodass Menschen und Waren wieder sicher ihre Bestimmungsorte erreichen konnten. Viele von ihnen siegten, doch einigen wurde der Kampf gegen die Piraten zum Verhängnis, denn nicht immer verlief die Seeräuberjagd erfolgreich. Aber dies ist genau das stoffliche Spektrum, aus dem das Buch »Operation Piratenjagd« mit Hilfe von Quellen und Sekundärliteratur die Dramatik zieht.
Vorweg vielleicht noch einige klärende Worte zur Stoffauswahl. Wie der Titel des Buches schon sagt, ist dies hauptsächlich ein Werk über Seeräuberbekämpfung und Piratenjagden, kein Generalabriss der Piraterie. Mancher Leser wird berühmte Seeräuber und Freibeuter wie Francis Drake vermissen.
Dies hat den Grund, dass Drake trotz seiner Taten nicht Objekt gezielter Gegenmaßnahmen war. Sein letzter Raubzug gegen die Spanier 1596 war ein von der Englischen Krone und von Privatleuten, unter denen sich auch Drake und Hawkins befanden, finanzierter, regulärer Kriegszug. Auch wenn Lope de Vega später diesem Kampf und damit den spanischen Siegern in seiner Dichtung »La Dragontea« ein Denkmal setzte, fällt dieser Sieg nicht unter den Aspekt Piratenjagd. Die Thematik Drakes führt zu einer anderen Problematik, deren sich der Verfasser durchaus bewusst ist und die in einer Frage kulminiert: Was ist Piraterie? Was ist Korsarentum? Sind beide Phänomene überhaupt trennbar? Im 19. Jahrhundert orientierte sich das Völkerrecht am Piratenbegriff des portugiesischen Strafgesetzbuches von 1886, dessen § 162 die Piraterie folgendermaßen definierte:
»Pirat ist, wer als Führer eines bewaffneten Fahrzeugs auf dem Meer umherfährt ohne Auftrag eines Herrschers oder selbstständigen Staates, um Raub oder irgendwelche Gewaltakte zu begehen.
Diese an sich klare und praktische Definition verlor sich im letzten Jahrhundert. Heute wird im Völkerrecht unter Piraterie etwas anderes verstanden. Am 10. Dezember 1982 trat Artikel 101 der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft, der Seeraub folgendermaßen definiert:
»Seeräuberei ist jede der folgenden Handlungen:
jede rechtswidrige Gewalttat oder Freiheitsberaubung oder jede Plünderung, welche die Besatzung oder die Fahrgäste eines privaten Schiffes oder Luftfahrzeugs zu privaten Zwecken begehen und die gerichtet ist
auf hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen Personen oder Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeugs;
an einem Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein Schiff, ein Luftfahrzeug, Personen oder Vermögenswerte;
jede freiwillige Beteiligung am Einsatz eines Schiffes oder Luftfahrzeugs in Kenntnis von Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug ist;
jede Anstiftung zu einer unter Buchstabe a oder b bezeichneten Handlung oder jede absichtliche Erleichterung einer solchen Handlung.«
Diese auf den ersten Blick saubere Definition bietet nicht nur Lösungen, sondern schafft auch Probleme. Die meisten Seeräubereien fanden oder finden nicht auf hoher See, sondern in Territorialgewässern statt – also innerhalb der staatlichen Hoheitszone von 12 Seemeilen (22 Kilometer) –, wo der Begriff der Piraterie seit 1982 keine Anwendung mehr findet. Schiffsüberfälle, die innerhalb der Territorialgewässer begangen werden, werden juristisch als bewaffneter Raub zur See gewertet und unterliegen der strafrechtlichen Ahndung und Rechtsprechung des betroffenen Nationalstaats. Des Weiteren finden sich zusätzliche Einschränkungen, die jenseits des Begriffs der Territorialgewässer den Aspekt der hohen See noch mehr eingrenzen. Auf diese juristischen Spitzfindigkeiten wie die gesonderten Bestimmungen zu Archipelgewässern, Anschlusszonen oder Festlandssockeln soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Elementar für das Konzept des Buches ist der in Artikel 101 des Seerechtsübereinkommens der UNO enthaltene Passus, dass unter Piraterie grundsätzlich ein Delikt verstanden wird, das durch eine private Person mithilfe eines privaten Schiffes zu privaten Zwecken – gemeint ist die persönliche Bereicherung – begangen wird.
Das führt zur Frage, warum in diesem Buch neben somalischen und indonesischen Piraten scheinbar ausgewiesene Freibeuter und Kaperer wie die Barbaresken oder Bukanier auftauchen. Hierzu ist es notwendig, auf die verschiedenen Formen von Seeraub einzugehen. Das Mittelalter und die frühe Neuzeit kannten ein Nebeneinander von staatlich legitimiertem und privatem Seekrieg. Infolge des Mangels von staatlichen Marinen wurde die Seekriegsführung oft an privatwirtschaftlich organisierte Kriegsleute übertragen, die mit der Erlaubnis eines Souveräns als Parteigänger agierten. Im Englischen hießen sie »Privateers«, im Französischen »Corsaires«. Jene Privateers oder Corsaires rüsteten entweder ihre Schiffe selbst zur Kriegsfahrt aus oder wurden von professionellen Ausrüstern, den Armateuren, ausgerüstet, bevor sie auf Beutefahrt gingen. Dieses Phänomen war auch in Deutschland bekannt. Auf Deutsch nannte man Kaperfahrer erst »Utligger« (Auslieger), dann Freibeuter.
Im Gegensatz zu dieser Art maritimer Fehdehilfe beziehungsweise staatlich legitimierten Seeraubs standen die Seefahrer, die auf den Wogen des Meeres auf eigenes Risiko raubten. Sie waren Seeräuber, rechtlos, und lebten in ständiger Gefahr, bei Ergreifung hingerichtet zu werden. In den Augen der Strafjustiz waren Piraten ebenso Abschaum wie Mörder und Straßenräuber. Was sie begingen, waren ehrlose und todeswürdige Verbrechen, da ihnen dem Gesetz nach die Legitimation zum Raub in Form eines Kaperbriefs fehlte.
Der Kaperbrief – auch »Letter of Marque«, »Kommission«, »Bestallungs-« oder »Markebrief« genannt – wurde eigens im Konfliktfall ausgestellt und galt nur zu Kriegszeiten. Er gab dem Parteigänger des Ausstellers im Konfliktfall die Vollmacht, feindliche Schiffe gegen eine vorher vereinbarte Abgabe an den Aussteller zur Kriegsbeute zu nehmen. Außerdem verlieh er dem Kaperfahrer Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung durch die feindliche Macht. Im Normalfall bewahrte er ihn davor, bei Gefangennahme wie ein Pirat behandelt und hingerichtet zu werden.
Doch was auf dem Papier wie eine saubere Trennung der Begrifflichkeiten aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als unrealistisches Konstrukt. Viele Kaperfahrer erlitten den Piratentod, weil die feindliche Macht sie aus kriegstaktischen Gründen als Piraten ächtete, um sie effizienter bekämpfen zu können. Hinzu kam, dass die meisten Freibeuter oder Korsaren sich nach Kriegsbeginn nicht mehr an ihre Kaperbriefe hielten. Ohne Skrupel raubten sie die Schiffe neutraler Mächte aus. Darüber hinaus plünderten sie auch nach Kriegsende wahllos auf dem Meer weiter. Der Gegenschlag ließ nicht lang auf sich warten. Die unrechtmäßig geschädigten Untertanen wandten sich an ihren Souverän um Hilfe, der ihnen Repressalienbriefe ausstellte, mit denen sie sich wiederum an den Untertanen des Kaperbriefausstellers schadlos hielten.
Die daraus entstehende Kette von Piraterien und Repressalien ließ sich auch durch die seit 1373 in Europa auftauchenden Prisengerichte nicht mehr in den Griff bekommen. Immer wenn langwierige Seekriege ausbrachen, verwischten sich die Konturen zwischen Piraten und Kaperern. Das betraf zeitlich vor allem das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit, räumlich besonders das Mittelmeer, die Nord- und Ostsee sowie die Karibik. Aus diesen Gründen ist es undenkbar, ein Buch über Piratenjagd zu schreiben, ohne auch auf Korsaren, Kaperfahrer und Freibeuter einzugehen.
I
Piratenabwehr in grauer Vorzeit
Wie Vögel im Netz gefangen · Dionysos und die Räuber · Roms Sieg über die Kilikier
Wie Vögel im Netz gefangen
Am 21. Januar 1192 v. Chr. war die Bevölkerung Ugarits1 in Todesangst. Wie aus dem Nichts zog ein riesiger Schatten am helllichten Tag über die Levantemetropole und tauchte sie ins Dunkel der Nacht. Eiseskälte legte sich auf die Dächer der Stadt, die eben noch vor Hitze geflimmert hatten. Die lärmenden Gassen und Straßen wurden still, das Leben erstarrte. Fassungslos gafften die Menschen zum Himmel, wo der Kernschatten des Mondes sich langsam zwischen Erde und Sonne schob, bis er sie fast vollständig abdeckte. Gespenstische Ruhe trat ein, für einen Moment schien es, als ob die Welt stillstünde. Was die Ugariter erblickten, verschlug ihnen den Atem. Über ihnen schwebte, von einem feurigen Sonnenkranz umstrahlt, der Mond als nachtdunkle Scheibe. Panik brach aus. War das der Weltuntergang, die Strafe für die Sünden der mächtigen Stadt?
Viele wähnten sich verloren, liefen in der Dunkelheit davon. Doch der Bann des Naturspektakels dauerte nicht lang. Nach zwei Stunden Finsternis gab der Neumond wieder die Sonne frei. Der eisige Schatten verflog und wurde kürzer. Die Kälte wich der Helligkeit und Hitze des Tages. Fast schien es so, als hätte das kosmische Spektakel nie stattgefunden. Trotzdem war nichts mehr wie zuvor.
Die Herzen der Ugariter hatten sich verfinstert. Zürnten die Götter ihnen? Drohte Ugarit der Untergang? Hastig opferten die Priester des Unterwelt- und Seuchengottes Reschef zwei Schafe. Dann lasen sie aus den Lebern der geschlachteten Tiere die Zukunft. Das Ergebnis war fatal. Die Seher deuteten die plötzliche Sonnenfinsternis als böses Omen und sahen die Stadt in großer Gefahr. Die düstere Prophezeiung sollte sich erfüllen. Zwei Jahre später überfielen räuberische Seekrieger die Stadt und machten sie dem Erdboden gleich.
Die Geschichtsforschung weiß bis heute nicht, wer diese Invasoren waren und welche Motive sie für ihre Kriegszüge hatten. Der französische Archäologe Gaston Maspero taufte sie jedoch im 19. Jahrhundert mit dem Namen »Seevölker«, der sich in der Folgezeit in Wissenschaft und Öffentlichkeit durchsetzte. Bis heute rätselt die Wissenschaft, woher diese Seevölker kamen, wer sie waren und welche Motive sie für ihre Kriegszüge hatten.
Was ihre ethnischen Wurzeln anbetrifft, so zeigt sich die mangelnde Präzision von Masperos Bezeichnung. Ein Teil der Seevölker wie die Peleset und Danuna kämpften sowohl zu Wasser wie zu Lande und zogen in Ochsenkarren durch die eroberten Gebiete. Der andere Teil der Seevölker bestand aus den seeräuberischen Stämmen der Šerden, Šekeleš, Tjeker und Ekweš.
Griff diese eigenartige Koalition Ugarit an? Wurde die Stadt Opfer eines Zangenangriffs vom Lande und vom Wasser aus? Die Art und Weise, wie Ugarit erstürmt wurde, lässt eher eine Seeräuberattacke als einen Eroberungszug von Land aus vermuten. Dafür spricht schon die geringe Anzahl der eingesetzten Schiffe. Doch lassen wir König Ammurapi von Ugarit selbst zu Wort kommen, der seinem »Vater«, dem König von Alashya (Zypern) seine verzweifelte Lage kurz vor dem Überfall der Zerstörer Ugarits schilderte.
»Mein Vater, jetzt kommen die Schiffe des Feindes. Meine Städte hat er schon verbrannt und Unheil inmitten des Landes angerichtet. Weiß mein Vater nicht, dass alle Soldaten des Herrn, meines Vaters, im Lande Hattu sich aufhalten, und all meine Schiffe im Lande Lukku sich aufhalten? Bislang sind sie nicht eingetroffen, und das Land liegt so da. Mein Vater möge dies wissen! Nun mehr, sieben Schiffe des Feindes (sind es), die herankommen, aber Übles hat er uns angerichtet. Nunmehr, wenn Schiffe des Feindes wiederum auftauchen, so schicke mir, wenn irgend möglich, Bescheid, damit ich informiert bin.«2
Der Brief, der auf einer Tontafel geschrieben wurde, die in einem Ofen der Schreibstelle des Königspalastes gebrannt werden sollte, erreichte nicht mehr seinen Adressaten. Er wurde erst im 20. Jahrhundert bei Grabungen im Ruinenhügel Ras-eš-Šamra zutage gefördert und bezeugt die dramatische Situation des Königreichs. Da die Schreibtafel im Brennofen gefunden wurde, lässt dies nur den Schluss zu, dass der Königstempel von Ugarit von den Schreibern entweder am selben Tag oder kurz darauf fluchtartig verlassen wurde, was nur mit einem Angriff der Seevölker auf Ugarit und dessen Zerstörung in Zusammenhang stehen kann.
Die Tatsache, dass sieben Schiffe ausgerechnet Ugarit angriffen, als die ugaritische Flotte gegen das Piratenvolk der Lukkaner kämpfte, kann kein Zufall sein. Vielmehr erhärtet sie den Verdacht, dass die Angreifer von der Wehrlosigkeit der Levantestadt wussten, die ihrem Ansturm später erlag.
Doch was war der Grund für diese plötzlichen Raubzüge? Was hatte das Gefüge der Alten Welt dermaßen erschüttert, dass sie aus den Fugen geriet? Die Antwort beruht auf einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren.
Ende des 13. Jahrhunderts v.Chr. kam es im östlichen Mittelmeergebiet zu einer langen Dürre. Diese führte zu einer Hungersnot, die zahlreiche Volksgruppen aus der Ägäis und Thrakien zum Aufbruch aus ihrer Heimat nötigte. Ihr Weg führte sie in das Hethiterreich (in Kleinasien), das ebenfalls unter der Hungersnot litt und zu dieser Zeit von einem Aufstand mehrerer Provinzfürsten gegen den König zerrüttet wurde.
In dieser Situation wurde Ägypten zum Zünglein an der Waage. Das Pharaonenreich trotzte dank der Fruchtbarkeit des Niltals der Hungersnot und exportierte sogar Getreide in die von Hunger bedrohten Gebiete. Die Transporte des Pharaos gingen über Mukiš in Nordsyrien nach Uru in Kleinasien und von dort mit Hilfe von Karawanen nach Hattuša. Aber mit Getreidelieferungen allein war dem Hethiterreich, das Ägypten seit Jahrzehnten im Austausch gegen Gold und Getreide mit Silber und Erzen beliefert hatte, nicht mehr zu helfen. Von allen Seiten angegriffen, brach es nach mehrjährigen Kämpfen zusammen. Mit der Zerstörung des Hethiterreichs spitzte sich die Lage zu. Siegesgewiss überrannten die Seevölker den Alten Orient und besiegten die hethitischen Vasallen Kizzuwatna, den syrischen Stadtstaat Karkemiš sowie das Königreich Alashya. Unter dem Druck ihrer Angriffswellen wechselte das südlich von Ugarit gelegene Königreich von Amurru die Seite und schloss sich ihnen an.
Nun konnte der Angriff auf Ägypten beginnen, das in der Vorstellung der Seevölker das gepriesene Land war, in dem es reiche Städte und Tempel sowie ausreichend Nahrung gab. Doch das Nilreich hatte große Erfahrung in der Abwehr von Piratenüberfällen und Invasionen.
Schon 1385 v. Chr. war das damals unter ägyptischer Oberhoheit stehende Zypern mehrmals Opfer von Angriffen seeräuberischer Lukkaner geworden. Auch Pharao Ramses II. hatte sich genötigt gesehen, zu Beginn seiner Regierungszeit das Piratenvolk der Serden zu züchtigen, das sich nicht davor gescheut hatte, Unterägypten mehrmals zu überfallen. Aber Ramses II. war nicht nur ein hervorragender General, sondern auch ein guter Admiral, wie die Inschrift einer Stele in Assuan belegt:
»Ramses II. überquerte mit seiner Macht den Ozean und die Inseln inmitten waren voller Furcht vor ihm. Sie kamen zu ihm mit den Tributen ihrer Fürsten und sein machtvolles Ansehen hatte ihre Herzen ergriffen. Aber Serden mit rebellischen Herzen konnte man seit jeher nicht bekämpfen, wenn sie machtvoll mit Kriegsschiffen auf dem Meer segelten. Dann konnte man nicht vor ihnen bestehen. Er aber nahm sie gefangen als Siegesbeute durch seinen starken Arm und überbrachte sie Ägypten.«3
Mit der Ansiedlung der Serden in Ägypten bewies Ramses II. politische Weitsicht, auch wenn damit die Piratengefahr für das Pharaonenreich noch nicht vorbei war. 1220 v. Chr. sah sich sein Sohn und Nachfolger Merneptah genötigt, eine schwere Schlacht gegen eine Koalition von libyschen Stämmen und Seevölkern zu schlagen, die diese mehrere Tausend Mann kostete.
Aber dies alles stand in keinem Verhältnis zur Gefahr, der sich Ramses III. im achten Jahr seiner Regierung gegenübersah.4 Diesmal hatten die Seevölker wieder einen Raubbund auf den »Inseln inmitten des Meeres« gebildet. Dort hatten sie eine große Flotte zusammengezogen, während ein Landheer von mehreren Tausend Seevölkerkriegern sich im Land Amurru südlich des Reiches von Ugarit sammelte. Unter einem schwachen Herrscher wäre die Lage des Pharaonenreichs aussichtslos gewesen. Ramses III. war jedoch ein guter General. Drei Jahre zuvor hatte er im westlichen Nildelta ein libysches Heer aufgerieben. Dies gab ihm die nötige Zuversicht, einem feindlichen Angriff zu Lande wie zu Wasser siegreich begegnen zu können.
»... Ich habe veranlasst, die Nilmündung zuzurüsten wie eine gewaltige Mauer aus Kampfschiffen, Lastschiffen und gewappneten Transportschiffen, wobei sie vollständig ausgerüstet waren von Bug bis Heck mit starken Kampfeinheiten unter Waffen. Die Mannschaften waren all die Auserlesenen Ägyptens und sie waren wie die Löwen, wenn sie auf ihren Bergen gebrüllt haben; die Streitwagentruppen wurden gestellt von Kampfläufern, von Waffenträgern und von ausgezeichneten Streitwagenrittern, die ihre Hand zu führen wussten – ihre Pferde vibrierten in allen Gliedern, gewappnet, die Barbarenländer niederzutreten unter ihre Hufe.«5
Begreift man das Steinrelief, das an der Ostseite von Ramses’ III. Totentempel Medinet Habu die entscheidenden Phasen der Schlacht veranschaulicht, als chronologische Abfolge, so vernichtete der Pharao zuerst das Landheer der Eindringlinge im Lande Djahi, bevor er die Flotte der Seevölker auf dem Nildelta überraschte.
Wer heute die Ausschnitte des Steinreliefs von Medinet Habu betrachtet, der bekommt ungefähr eine Ahnung davon, was sich damals vor der ägyptischen Küste abspielte. An jenem Tag der Seeschlacht sah Ramses III. die einmastigen Barken der Piraten in die Nilmündung einfahren. Vogelköpfe zierten ihre hochgezogenen Vorder- und Hintersteven, zwischen denen sich Scharen verwegener Krieger unter Rahsegeln zusammendrängten. Zu ihnen zählten Šekeleš mit Hörnerhelmkappen, Peleset mit Federhauben und Riemenpanzern sowie räuberische Serden6, Tjeker, Danuna und Wešeš. Gerüstet waren die Angreifer mit bronzenen Langschwertern, Dolchen, Lanzen und Wurfspießen. Auf erhobenen Plattformen an Bug und Heck standen die Anführer. In Erwartung sicherer Beute gaben die Piratenhäuptlinge ihren Steuermännern den Befehl, ihre Schiffe dem Ufer zuzusteuern. Dort erwarteten das ägyptische Fußvolk und ein Teil der Flotte des Pharaos ihre Landung.
Waren diese Einheiten der Köder, den Ramses III. bewusst ausgelegt hatte? Jenes »Netz, in dem sich die Gegner verfingen«, wie später die Siegesinschrift von Medinet Habu den Nachkommen des Siegers stolz verkünden sollte? Oder hielten sich die Einheiten der ägyptischen Flotte in einem der Nilarme versteckt, um den Feind in die Falle zu locken? Aus den Abbildungen und erläuternden Texten geht dies nicht klar hervor. Nur eines steht fest: Der Angriff der ägyptischen Flotte erfolgte von zwei Seiten und überraschte die Invasoren.
Wie viele Schiffe an jenem Tag an der Seeschlacht auf dem Nil beteiligt waren, lässt sich nicht mehr in Erfahrung bringen. Auf dem Relief von Medinet Habu sind fünf Seeräuberschiffe zu sehen, die von vier ägyptischen Kampfschiffen angegriffen werden. Vermutlich handelt es sich nicht um die Gesamtzahl aller beteiligten Schiffe, sondern um eine symbolische Verdichtung der Schlacht.
Größere Gewissheit herrscht darüber, wie sich der Kampf zur See abspielte. Nachdem sich die Ägypter mit kräftigen Ruderschlägen den Seevölkerschiffen angenähert hatten, eröffneten die Bogenschützen des Pharaos den Fernkampf. Mit tödlicher Präzision jagten sie Pfeil auf Pfeil in die dicht gedrängten Massen der Feinde. Zusätzlich zum Pfeilregen deckte ein Hagel von Steinen, Wurfpfeilen und Lanzen das feindliche Raubgeschwader ein. Die Seevölker erlitten schwere Verluste. Dies nutzten die Ägypter sofort aus. Wuchtig rammten die löwenkopfverzierten Vordersteven ihrer Schiffe die flachkieligen Vogelbarken, von denen eine sofort kenterte. Dann wirbelten Enterhaken durch die Luft, und der Enterkampf begann. In einem erbarmungslosen Gemetzel gewannen die Ägypter die Oberhand. Unter dem schwankenden Mastenwald der kämpfenden Flotten färbte sich das Wasser rot vom Blut der Erschlagenen, die bald zu Dutzenden in den Fluten des Nils trieben.
Denjenigen der Seevölkerkrieger, die über Bord sprangen, um sich zum Land durchzukämpfen, erging es nicht besser. Die meisten fielen am Ufersaum des Nildeltas oder wurden gefangen genommen. Von den Oberbefehlshabern, welche die Seevölker in die Schlacht geführt hatten, überlebte keiner. Ramses III. tötete nach eigenen Angaben »denjenigen, der sich den Sieg so sehr gewünscht hatte« mit einem gezielten Pfeilschuss, während der zweite Piratenhäuptling ins Wasser fiel und ertrank.
Als die Sonne unterging, gab es keinen Zweifel mehr, wer den Sieg errungen hatte. Erbarmungslos hackten ägyptische Soldaten jedem getöteten Feind eine Hand und den Penis ab, um sie wenig später gegen Kopfgeld einem der Quartiermeister zu geben, dessen Gehilfen die schaurigen Trophäen aufschichteten. Während sich dieses grausame Ritual vollzog, marschierten endlose Reihen gefesselter Seevölkerkrieger in die Gefangenschaft.
Einigen war es bestimmt, im Tempel Amuns geopfert zu werden. Andere erlitten das Los der Sklaverei oder wurden wie die Peleset und Serden ins heutige Palästina7 umgesiedelt. Ramses III. hatte einen großen Sieg erfochten und die Seevölker zu Lande wie zu Wasser entscheidend geschlagen.
»Diejenigen nun, die meine Grenze zu Lande erreichten – ihr Same existiert nicht mehr ... diejenigen aber, die zusammengeschart herankamen vom Meer – die Glut erfüllt sich an ihnen vor den Deltamündungen. ... Diejenigen, die in die Nilmündungen eingedrungen waren, waren gefangen wie Vögel im Netz. So wurden sie vernichtet.«8
Durch seinen Sieg auf dem Nil hatte Ramses III. den Zusammenbruch des Ägypterreiches verzögert und die Sturmwelle des Seevölkerangriffs gebrochen. In den folgenden drei Jahrzehnten bis zu Ramses’ III. Ermordung während einer Palastrevolution verzeichnen die Quellen keinen Angriff der Seevölker mehr.
Als sicher kann angenommen werden, dass der Angriff der Seevölker ein Invasionsversuch von Landstreitkräften war, der mithilfe von Piraten durchgeführt wurde, wie die Teilnahme der Tjeker, Serden und Šekeleš an der Expedition beweist.
Abgesehen von diesen ersten schweren Abwehrschlachten gegen Seeräuber sind uns kaum gezielte Piratenjagden oder Abwehrkämpfe aus der Zeitenwende von der Bronze- zur Eisenzeit bekannt. Zwar behauptet der griechische Historiker Thukydides, dass schon der mythische König Minos von Kreta die Meere von Seeräubern säuberte, doch herrscht hier große Unsicherheit, wann dies war und zu welcher Zeit der angebliche Piratenbezwinger überhaupt gelebt hat.
Dionysos und die Räuber
Einzig die griechischen Epen und Mythen erhellen jene dunkle Zeit der Raubzüge der Hellenen, die einst die Insel- und Küstenwelt der Ägäis in erschreckendem Maße verheert haben müssen.
In den Abenteuern von Jason und den Argonauten, der Ilias und der Odyssee lassen sich mannigfach Hinweise auf die Seeräubereien der griechischen Helden und ihrer treuen Gefolgsmänner finden. So erhielt Jason mit seinen Gefährten den Auftrag, das Goldene Vlies zu stehlen, bot die Entführung Helenas durch Paris den Anlass für die Zerstörung Trojas und wurde der Ursprung aller Irrfahrten des Odysseus der unglückselige Gedanke, die in Troja gemachte Beute noch durch weitere Raubzüge an Thrakiens Küste anzureichern.
In Homers Odyssee erzählt der nach Ithaka heimkehrende Odysseus dem Schweinehirten Eumaios von einer schweren Niederlage, die er als Führer hellenischer Piraten im Nildelta erlitten hat. War dies ein Nachruf auf die große Abwehrschlacht von Ramses III. auf dem Nil? Oder eine Hommage Homers an zeitgenössische, historisch verbürgte Piratenangriffe auf Ägypten?
Die Erzählung hält dies offen. Sie ist als eine der Lügenschichten getarnt, die der als Bettler verkleidete Odysseus seinem einfachen Wirt, dem er sich zunächst nicht zu erkennen gibt, als erdichtete Biografie auftischt.
Nun sind Epen und Mythen keine Tatsachenerzählung historischer Ereignisse, doch in einem zeigen sie sich hilfreich. Sie gewähren einen Blick auf die Gedankenwelten und Erfahrungshorizonte der jeweiligen Epoche, die von der Allgegenwart des Seeraubs stark geprägt war. In den griechischen Mythen spielen vor allem die Tyrrhener eine Rolle, die in grauer Vorzeit die Ägäis besiedelten. Ein Teil von ihnen – die pelasgischen Tyrrhener – wurde von den Hellenen an die unwirtlichen Küstenstreifen Nordwestkleinasiens, die Inseln der Nordägäis verdrängt, andere tyrrhenische Stämme ins westliche Mittelmeer nach Sardinien. Dies sollte den Hellenen bald zum Nachteil gereichen. Die Tyrrhener rächten sich durch zahllose Seeräubereien für die Vertreibung aus ihrer ursprünglichen Heimat und wurden so sehr zum Schrecken der Ägäis, dass bald jeder Grieche das Wort »Tyrrhener« mit »Pirat« gleichsetzte.
Ist auch wenig über ihre Raubzüge bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. bekannt, so bewahrten doch Mythen die Erinnerung an jene grausamen Küstenräuber, die ihren Gegnern derartig überlegen waren, dass nur noch die griechische Götterwelt in der Lage war, ihren Übermut zu bändigen.
So ergeht es den Tyrrhenern sehr schlecht, als sie das Standbild der Hera aus ihrem unverschlossenen Tempel auf Samos rauben und damit fliehen wollen. Göttlicher Frevel hält das Schiff im Hafen fest, so sehr sich die Piraten auch in die Riemen legen, um den Hafen zu verlassen. Die Tyrrhener verzweifeln. Erst als sie begreifen, dass sie zu weit gegangen sind, tragen sie das Götterbild ans Ufer, opfern Hera eifrig und können so den Hafen wieder verlassen. Aber ein Götzenbild zu rauben ist eine Sache, einen Gott zu stehlen eine andere, womit wir beim zweiten blasphemischen Schurkenstreich der Tyrrhener wären, den Homer in seinen Hymnen ins Gewand des Mythos gekleidet hat. Unbelehrbare Plünderer, die sie sind, scheuen die Tyrrhener nicht davor zurück, während einer Razzia den Fruchtbarkeitsgott Dionysos am Strand zu rauben. Trotz seiner Beteuerung, ein Gott zu sein, verschleppen sie Dionysos und werfen ihn in Banden geschlagen in ihr Schiff. Doch kaum ist die frevelhafte Tat begangen, folgt die Strafe auf dem Fuß. Der Geraubte wirft die Fesselung ab und beschwört mit Götterkraft einen Sturm herauf, der das Schiff der Seeräuber in Seenot bringt. Als die Tyrrhener ihren Irrtum bemerken, bieten sie Dionysos vergeblich die Freiheit an. In Gestalt eines Löwen verwandelt er erzürnt die Piraten in Delfine und verdammt sie dazu, bis ans Ende ihrer Tage im Meer zu schwimmen.
Woanders brauchte es keine Götter, um Piraten zu bestrafen. Im 8. Jahrhundert v. Chr. suchte die Flotte des Assyrerherrschers Sargon II. die Meereswogen des Mittelmeeres und des Persischen Golfes nach Piraten ab und sorgte so für die Sicherheit zur See. Die Schiffe Sargons II. waren für die Verhältnisse der damaligen Zeit bestens gerüstet zur Piratenjagd. Eine Steinplatte des verfallenen Königspalasts von Nimrud hat die Erinnerung an die Flotte der Assyrer bewahrt, deren Mannschaften hauptsächlich aus Phöniziern bestanden.
Die Phönizier waren eine Seefahrer- und Handelsnation, die seit 1000 v. Chr. das Mittelmeer besiedelte. Sie waren die erste Seefahrernation, die sich nicht mehr davor scheute, über das offene Meer zu navigieren. Grund genug für Sargon II., ihnen die Leitung seiner Marine anzuvertrauen.
Die Schiffe, welche die Phönizier im Dienst des assyrischen Königs steuerten, hießen »Biremen«. Sie hatten zwei Ruderreihen und wurden aus Zedernholz gebaut. Sie waren hochbordig, besaßen einen senkrechten Steven und ein bauchiges Heck. Aus ihrem stumpfen Bug ragte der zu einer kegelförmigen Ramme verlängerte Kiel. Am Heck befand sich ein erhöhtes Verdeck und in der Bordmitte ein Mast mit einem rahgetakelten Segel, das schnell gerefft werden konnte. Back- wie steuerbords schützte ein Schanzkleid zwei Ruderreihen mit mindestens neun bis zehn Ruderern vor feindlichen Geschossen. Über der höchsten Ruderreihe befand sich das Kampfdeck, von dem aus Schwerbewaffnete durch an der Reling befestigte Schilderreihen die Feinde mit Fernwaffen unter Beschuss nehmen konnten. Gesteuert wurde das antike Kampffahrzeug vom Heck aus mithilfe von zwei Steuerrudern, die sich ebenfalls jeweils back- und steuerbords befanden. Die Länge der Bireme betrug nach Schätzungen 30 Meter, der Tiefgang zwei, die Breite höchstwahrscheinlich fünf bis sechs Meter.
Zur damaligen Zeit war die Bireme ein furchtbarer Gegner für jedes Piratenschiff, zumal die phönizischen Seeleute für ihre Geschicklichkeit und die assyrischen Soldaten wegen ihrer Tapferkeit gefürchtet waren.
Mithilfe einer derartig starken Flotte gelang es den Assyrern, das Rote Meer von Piraten zu säubern. Indes, Sargon II. wie auch sein Sohn Sanherib waren zu kriegerisch, als dass ihnen ein langes Leben beschieden gewesen wäre. Beide fanden ein gewaltsames Ende, Sargon fiel im Jahr 705 v. Chr. gegen die Kimmerer, Sanherib 25 Jahre später durch den Mordstahl seiner Söhne. Wieder entstand ein Machtvakuum, erneut wurde der Seehandel vermutlich zum Freiwild raubgieriger Piratenvölker.
Für ein weiteres Jahrhundert erfahren wir kaum etwas über Raubzüge zur See sowie deren Ahndung. Wahrscheinlich liegt dies am Umstand, dass der organisierte Kampf gegen Seeräuber auf der Rechtsauffassung beruht, dass Piraterie überhaupt ein Verbrechen ist. Diese Ansicht setzte sich in der Antike erst spät durch, genauso wie der Begriff »Peirates«, den heute jeder in seiner latinisierten Form »Pirat« kennt. Die Bezeichnung fand erst ab dem dritten vorchristlichen Jahrhundert Verwendung und leitet sich vom griechischen Wort πειραν (peiran), »versuchen, unternehmen, auskundschaften«, und πεĩρα (peira), »Wagnis, Unternehmen, Überfall«, über πειρατής (peiratēs) ab.
Doch so schnell setzte sich der Piratenbegriff nicht durch. Noch bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. bezeichnete man im griechischen Kosmos die Seeräuber als »Leistes«, als »Plünderer« beziehungsweise »bewaffnete Räuber«. Dies weist eindeutig darauf hin, dass damalige Piraterie wie schon all die Jahrhunderte zuvor dem Küstenraub huldigte.
»Die alten Hellenen ... hatten kaum damit begonnen, mit Schiffen häufiger zueinander hinüberzufahren, als sie sich auch schon auf den Seeraub verlegten, wobei gerade die tüchtigsten Männer sie anführten, zu eignem Gewinn und um Nahrung für die Schwachen; sie überfielen unbeteiligte Städte und offene Siedlungen und lebten so fast ganz vom Raub. Dies Werk brachte noch keine Schande, eher sogar Ruhm.«9
Angesichts solcher Rechtsauffassung wundert es nicht, wenig von Piratenjägern und Strafexpeditionen zu hören. Erst ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert blitzen Glanzlichter der Piratenjagd auf. Als die griechische Kolonisation im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. ihre maximale Ausdehnung erreichte, veränderte sich langsam die Auffassung der Griechen von Piraterie. Gezwungen, ihren Seehandel zu verteidigen, ging insbesondere das aufblühende Athen ab dem 6. Jahrhundert gegen Piratenstützpunkte auf Limnos, Kythnos, Mykonos und den Sporaden vor.
Etwa zur selben Zeit vollzog sich ebenfalls im westlichen Mittelmeer ein Wandel. Hier waren es Karthager und Etrusker, die sich von den Phokäern bedroht fühlten. Diese waren vor den Persern unter Kyros ins westliche Mittelmeer geflohen und hatten sich auf Korsika niedergelassen. Von dort aus schädigten sie den karthagisch-etruskischen Seehandel, wo sie nur konnten. Dies blieb nicht ungestraft. Um 540 v. Chr. schlugen die vereinigten Seeflotten der Karthager und Etrusker die Flotte der Phokäer vor Korsika, was eine der ersten großen Piratenplagen der Antike beendete.
Eine weitere bekannte Strafaktion ist die des athenischen Flottenführers Kimon, der in der Glanzzeit des von Athen beherrschten 1. Attisch-Delischen Seebundes um 475 v. Chr. die alte Pirateninsel Skyros eroberte und mit Athenern besiedelte.
Athen war es nicht lang vorbestimmt, als Hegemonialmacht das östliche Mittelmeer zu beherrschen. Im fast dreißigjährigen Peloponnesischen Krieg gegen Sparta und dessen Verbündete erlitt es eine entscheidende Niederlage im Kampf um die Vormacht in der Ägäis.
Um 400 v. Chr. war der 1. Attisch-Delische Seebund nur noch Geschichte. Nach der katastrophalen Niederlage der Athener auf Sizilien reckte die Piraterie erneut ihr Haupt im östlichen wie westlichen Mittelmeer.
349 v. Chr. durchzog eine griechische Seeräuberflotte sengend und mordend das westliche Mittelmeer, sodass sich die zwei rivalisierenden Großmächte Karthago und Rom dazu genötigt sahen, im darauffolgenden Jahr einen Vertrag abzuschließen. Diese vertragliche Vereinbarung regelte einerseits die karthagisch-römischen Zwistigkeiten zur See und versuchte andererseits, eine gemeinsame Richtlinie im Kampf gegen Piraten festzulegen. Dass sich mithilfe derartiger Verträge der zunehmende karthagisch-römische Gegensatz nicht aus der Welt schaffen ließ, ist bekannt. Was die Piratenbekämpfung anbetrifft, zeigt der Vertrag eindrucksvoll die Verflechtung von Seeraub, Seekrieg und Seehandel und die ambivalente Haltung der antiken Seemächte gegenüber der Piraterie.
Noch im vierten vorchristlichen Jahrhundert ist Seeraub selbstverständlich und nur ein Verbrechen, wenn Angehörige eines anderen Staates ihn betreiben. Wenn es für sie nützlich war, griffen die antiken Staaten selbst zum Mittel der Piraterie oder bedienten sich der Seeräuber.
Für Staaten ohne große Kriegsmarine hatte dies den Vorteil, sofort über eine schlagkräftige Armada zu verfügen. Für die Seeräuber rechneten sich Militärbündnisse, weil sie unter dem Deckmantel kriegerischer Operationen umso ungehinderter die feindlichen Küsten und Seefahrtswege plündern konnten. So nimmt es aus heutiger Sicht nicht wunder, dass es bei derartigen politischen Verhältnissen unmöglich war, die Seewege dauerhaft vor Piratengeschwadern zu schützen.
Überall herrschte ein Zustand kriegerischer Anarchie. Durch die zerrütteten politischen Verhältnisse traten Piraten immer selbstbewusster auf. Sie kannten keine moralischen Skrupel und zeigten das Machtbewusstsein von Kleinkönigen, wie das folgende moralische Traktat belegt, das von einer legendären Begegnung Alexanders des Großen mit einem unbekannten Seeräuberhäuptling handelt:
»Was anderes sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde durch Zuzug verkommener Menschen so ins Große wächst, dass Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne Weiteres den Namen Reich an, den ihm offenkundig nicht etwa hingeschwundene Habgier, sondern erlangte Straflosigkeit erwirbt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. Denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz: Und was fällt dir ein, dass du den Erdkreis unsicher machst? Freilich, weil ich’s mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich Räuber. Du tust’s mit einer großen Flotte und heißt Imperator.«10
Die moralische Anekdote ist bezeichnend für das Wechselspiel zwischen Großmachtpolitik und Piraterie zur Zeit Alexander des Großen.
Die bekanntesten Piratenjäger dieser Ära waren die makedonischen Admiräle Hegelochos und Amphoteros. Ihnen gelang es 332 v. Chr., den mit den Persern verbündeten Erzpiraten Aristonikos – der von den Persern eingesetzte Tyrann von Methymna – mitsamt seinen Gefährten im Hafen von Chios gefangen zu nehmen. Kurz darauf wurden die Piraten hingerichtet.
Für kurze Zeit gelang es den Admirälen Alexanders des Großen, im östlichen Mittelmeer für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit dem Tod Alexanders des Großen endete jedoch der Versuch der Makedonen, mithilfe einer straff geführten Seepolizei die Seeräuberei des Mittelmeers in den Griff zu bekommen.
Durch die Kriege um Alexanders Thronfolge versanken die östliche Mittelmeerwelt und das Schwarze Meer in Chaos und Elend, auch der Seeraub nahm wieder zu. Einzig dem bosporanischen König Eumelos gelang es 304 v. Chr., die Piraten des Schwarzen Meeres niederzuringen. Dies brachte ihm nach Diodors Schilderungen »in fast allen Ländern der Erde den herrlichsten Ruhm ein, da die Kaufleute seine Hochherzigkeit verkündeten«.11
Heldentaten wie diese fanden kaum Nachahmer. In den folgenden Jahren wurden Piratengeschwader erneut zum Schrecken der Küste. Angesichts einer derartigen Bedrohungslage blieb den Bewohnern reicher Inseln und Küstenregionen nur die Defensive übrig.
Ein wirksames Mittel gegen Piratenüberfälle war, einige Kilometer landeinwärts von der Küste zu siedeln. Dies hatte den Vorteil, dass den Bewohnern im Falle eines rechtzeitig bemerkten Angriffs noch genug Zeit zur Verteidigung oder Flucht blieb. Eine andere Defensivmaßnahme war, eine Siedlung so anzulegen, dass sie vom Meer aus nicht bemerkt werden konnte. Dies schützte zwar nicht vor einem zielgerichteten Angriff, aber vor streunenden Piratenbanden, die keine Ortskenntnis besaßen. Die meisten Küstenbewohner befestigten jedoch ihre Städte. Zusätzlich legten sie ihre Siedlungen auf schwer zu erstürmenden Höhen an, sodass die Piraten kein leichtes Spiel hatten.
Was die Seeräuber anbetraf, so gingen sie meist nach folgendem Schema vor. Nachdem Späher die Lage an den Küsten sondiert hatten, landeten sie meist nachts an unbewachten Stellen der Küste und griffen die Stadt völlig überraschend im Morgengrauen an. Dabei erfolgte der Angriff entweder mit Stoßtrupps von der Landseite oder mit der gesamten Flotte von der Seeseite, je nachdem, was den Piraten opportun schien.
Eine besondere Angriffstaktik entwickelten die Heniochen, die wie Taurier, Zygen und Achäer Seeräuber waren und an der nordöstlichen Schwarzmeerküste lebten, was Strabo, der antike Historiker und Geograf, in seinen »Geographika« berichtet.12
Dies lag an dem von ihnen verwendeten langen und schmalen Bootstyp (»kamarai«) der in der Lage war, 30 Mann zu fassen. Das brachte folgende Vorteile mit sich: Dank der leichten Bauweise konnte die Mannschaft ihre Schiffe nach der Landung an der Küste auf den Schultern in die Wälder tragen und sie so vor den Augen Neugieriger verbergen. Während nur ein kleiner Teil der Mannschaft zur Bewachung zurückblieb, griff der andere den Ort an und überrumpelte die Bewohner. Beim Überfall rafften die Piraten alles an Menschen, Vieh und beweglicher Habe zusammen, bevor sie den Ort verwüsteten und sich wieder mit ihrer Beute zurückzogen.
Erwiesen sich ihre Gefangenen als reich, so setzten sich die Seeräuber direkt mit ihren Verwandten in Verbindung, um Lösegeld zu erpressen. Waren die erbeuteten Gefangenen arm, so wurden sie unbarmherzig zu den Sklavenmärkten der Ägäis und des Schwarzen Meeres verschleppt und dort verkauft.
Dies zeigt an, dass ab dem 4. vorchristlichen Jahrhundert aufgrund der unablässigen Kriege und des erhöhten Arbeitskräftebedarfs eine Professionalisierung des piratischen Gewerbes eingesetzt hatte. Aus Küstenraub war Menschenjagd geworden, aus gelegentlichen Überfällen zur See ein regelrechter Raubkrieg. Durch den Kriegszustand und den allgemeinen Mangel an regulären Kriegsflotten bedingt, waren Piratenführer zu regelrechten Söldnerhauptleuten geworden, die entscheidenden Einfluss auf das Kriegsgeschehen nahmen.
Dies zeigte sich besonders während der Belagerung von Rhodos durch den Diadochenherrscher Demetrios Poliorketes, der 370 Schiffe vor Rhodos zusammenzog, wovon ein Großteil durch Piraten gestellt wurde. Aber Rhodos trotzte allen Versuchen Demetrios’, der letztendlich geschlagen wurde. Drei Jahre später hatten sich Demetrios’ Heer 8000 Seeräuber angeschlossen, um Beute in Thessalien zu machen.
Mit dem Sieg der Seleukiden 281 v. Chr. über die Makedonen in der Schlacht von Kurupedion13 endeten die Kämpfe um die Nachfolge im Alexanderreich, was zum allmählichen Rückgang der Piraterie führte. In Ägypten bildete sich das Ptolemäerreich, während in Makedonien Antigonos II. Gonatas König wurde.
Obwohl jedes dieser drei Reiche ans Mittelmeer grenzte, und über beachtliche Seestreitkräfte verfügte, stieg in der Folgezeit Rhodos zur ersten Seemacht der Levante auf. Durch ein ausgeklügeltes Flottenbauprogramm und dank der hohen Disziplin seiner hervorragenden Marine gelang es dem Inselreich, mit seinen Wachtschiffen die Piraten trotz aufflackernder lokaler Konflikte niederzuhalten. Der Grund für die eindeutige Frontstellung des Inselstaates gegenüber den Seeräubern war, dass Rhodos in erster Linie keine politische, sondern eine wirtschaftliche Macht darstellte. Der Inselstaat strebte nicht wie die lokalen Großmächte der Levante nach Hegemonie oder territorialen Eroberungen, sondern nach Handelsgewinn. Dies erforderte sichere Seefahrtswege auf dem Meer und die Bekämpfung derjenigen, die Rhodos’ Handel gefährdeten. Im Gegensatz zu den unzähligen Kleintyrannen der Ägäis und den hellenistischen Herrschern bediente sich Rhodos nicht der Piraten, weder als Söldner noch als Bündnispartner.
Durch Anlehnung an Makedonien, das Seleukidenreich sowie das Ptolemäerreich gelang es dem Inselstaat, seine Unabhängigkeit erfolgreich zu behaupten. Erst Rom verdrängte Rhodos, das künftig aber zum ersten Bundesgenossen der Tiberrepublik wurde.
Die römische Republik hatte sich seit dem Abschluss des Kooperationsvertrags mit Karthago im westlichen Mittelmeer zur ersten Großmacht entwickelt. In nur drei Jahrhunderten hatte Rom die italische Halbinsel befriedet, das einst blühende Karthagerreich geschlagen sowie Korsika, Sardinien, Sizilien, Spanien und die Nordküste Afrikas erobert.
Dann war Rom über Istrien an der Adria entlang auf Makedonien vorgestoßen. Nachdem die Tiberstadt im Jahre 228 v. Chr. die illyrischen Piraten unter ihrer Königin Teuta durch einen blutigen Feldzug gebändigt hatte, waren Roms Legionen unaufhaltsam gen Osten marschiert. In mehreren Kriegen zerschlug Rom das Königreich Makedonien, während es gleichzeitig den Einflussbereich des ägyptischen Ptolemäerreiches und des syrischen Seleukidenreiches in der Levante zurückdrängte.
Der endgültige Sieg über Makedonien und das Seleukidenreich lieferte den Römern ab Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts den Schlüssel zur Ägäis. Nun war ein weiteres Ausgreifen nach Asien möglich, vorausgesetzt, Rom beherrschte die Meere.
Doch genau hier stellte sich Rom eine Macht entgegen, die weder Königreich, Polis noch Republik war: die Kilikier, ein verwegenes Seeräubervolk aus Kleinasien.
Roms Sieg über die Kilikier
»Wir, deren Vorfahren den König Antiochos und Perseus mit der Flotte besiegt und in allen Seeschlachten die Karthager, die im Seewesen geübtesten und tüchtigsten Leute, überwunden hatten, wir konnten uns nirgends mehr mit den Seeräubern messen. Wir, die wir vormals nicht allein Italien in Sicherheit hielten (...), wir waren da nicht allein nicht mehr im Besitz unserer Provinzen und der Seeküsten Italiens und unserer Häfen, sondern selbst nicht einmal der appischen Straße ...«14
Die kurze Skizze Ciceros umreißt klar die Machtlosigkeit Roms gegenüber der Gefahr, die von der größten und gefährlichsten Seeräuberorganisation der Antike ausging.
Im 1. Jahrhundert v.Chr. hatte sich aus den ursprünglich in Kilikien, im Südosten Kleinasiens, hausenden Seeräubern ein gut organisierter Piratenbund gebildet, vor dessen Geschwadern das Mittelmeer von den Säulen des Herkules bis zum Hellespont erzitterte. Grund für diesen Aufstieg war, dass Rom binnen Jahrzehnten eine Staatenwelt zerschlagen hatte, deren politisches System seit dem Ende der Diadochenkriege austariert gewesen war. Die Auseinandersetzungen Roms mit den hellenistischen Großreichen hatten Völker entwurzelt und einst blühende Landschaften verwüstet, das römische Verwaltungs- und Steuersystem die Überlebenden endgültig ruiniert und in die Armut getrieben.
Waren dies schon immer klassische Faktoren gewesen, Piraterie entstehen zu lassen, so besorgte die fortschreitende politische Destabilisierung des Seleukidenreiches ab 140 v. Chr. den Rest. Glaubt man den Ausführungen des griechischen Historikers Strabo, so wurde der seleukidische Rebell Diodotus Tryphon ab 140 v. Chr. der erste Piratenkönig Kilikiens.
Diodotus Tryphon zog sich nämlich nach dem gescheiterten Versuch, sich zum Herrscher des Seleukidenreiches emporzuschwingen, ins raue Kilikien zurück. Das unwirtliche Land lag gegenüber Zypern und erstreckte sich von Korakesion (das heutige Alanya) bis zur Nordgrenze des heutigen Syrien.
Es war aufgrund seiner schroffen Steilküste, den vielen kleinen versteckten Buchten, Grotten und einsamen Inseln geradezu prädestiniert zur Piratenküste. Hier baute Tryphon die spätere Hauptstadt Korakesion auf einer 250 Meter hohen Felsenhalbinsel zu seiner neuen Operationsbasis aus. Er stieß immer wieder zu Kaperfahrten gegen den Feind vor, bis ein syrisches Heer ihn einschloss und zur Übergabe zwang. Tryphon überlebte die Niederlage nicht. Er beging Selbstmord. Paradoxerweise wurde sein Tod die Geburtsstunde des größten Piratenbundes der Antike.
In den vier Jahrzehnten nach Tryphons Tod errichteten die Kilikier ein System von Ankerplätzen, stark befestigten Häfen und Stützpunkten, die gleich Adlerhorsten auf kaum zugänglichen Felsen thronten. Auf diese Weise waren sie fast unangreifbar. Und das mussten sie auch sein, wollten sie ihre Beute sichern. Denn die Seeräuberei gedieh prächtig. Nach Strabo hatte das vor allem folgende Gründe:
»Besonders aber reizte zu solchem Frevel die so gewinnvolle Ausfuhr der Sklaven; denn der Fang war leicht, und ein großer und geldreicher Markt war gar nicht fern, die Insel Delos, welche Myriaden von Sklaven an einem Tage aufnehmen und absetzen konnte, sodass daher auch das Sprichwort entstand: Kaufmann, fahr heran und lade aus: Alles ist verkauft. Die Ursache war, dass die nach den Kriegen mit Korinth und Karthago reich gewordenen Römer viele Sklaven brauchten.«15
Mit diesen Worten lieferte Strabo den entscheidenden Hinweis auf den wirtschaftlichen Hintergrund des Aufstiegs der kilikischen Piraterie. Delos war die Hauptinsel der Kykladen und hatte 167 v. Chr. den Status eines Freihafens bekommen, was der Kykladeninsel unermesslichen Reichtum bescherte.
Dass Menschen als Ware in Rom so begehrt waren, lag an einem fundamentalen gesellschaftlichen Wandel der römischen Landwirtschaft: der Umstellung von der bäuerlichen Kleinwirtschaft auf die Latifundien, einer fast industriellen Bewirtschaftung riesiger Agrarflächen durch Sklaven und saisonale Hilfsarbeiter. Da es zu jener Zeit keine landwirtschaftlichen Maschinen gab, bedurfte es eines steten Nachschubs an Menschen, der diesen Mangel wettmachte. Die meisten der Versklavten hielten jedoch die harte Landarbeit nicht länger als zehn Jahre durch. Auf den Galeeren und in den Bergwerken war die Lebensdauer eines Sklaven noch kürzer. Drei Jahre, so rechnete einst Cato der Ältere, hielt es ein Rudersklave auf den Schiffen der römischen Republik aus. Dann starb er entweder oder er konnte seine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Sechs bis maximal acht Jahre schuftete ein Sklave in den unzähligen Bergwerken, bevor er zu leichteren Arbeiten verwendet wurde. Im Handwerk beschäftigte Sklaven traf es etwas besser: Sie schafften mitunter 12 bis 15 Jahre. Es war eine zynische Rechnung. Sie zeigte klar die Abhängigkeit Roms von der Sklaverei und den menschenverachtenden Charakter seiner Herrschaftsform.
Nicht nur Rom zog Nutzen aus dem Treiben der Kilikier. Das ägyptische Ptolemäerreich, Zypern sowie die Häfen Pamphyliens und Lykiens profitierten von der Menschen- und Beutejagd, die alles und jeden treffen konnte.
Da Rom vorerst gegen die Piraten nicht einschritt oder auch infolge schwacher Seestreitkräfte nicht einschreiten wollte, wurden die Kilikier immer stärker.
Solange die Seeräuber das politische Gleichgewicht nicht gefährdeten und Rom wirtschaftlich nicht schadeten, scheint die römische Republik die Raubzüge der Kilikier geduldet zu haben. Dies änderte sich, als die Piraten Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts immer zahlreicher wurden.
Jetzt sah sich Rom genötigt, militärisch einzugreifen. Mit einer großen Flotte stießen die Römer 102 v. Chr. über Athen nach Kilikien vor, wo sie eine Provinz errichteten. Dann fügten sie im kombinierten Angriff von See- und Landstreitkräften den Piraten zum ersten Mal eine Niederlage zu. Damit ging für kurze Zeit der Seeraub zurück. Mit dem zwei Jahre später verabschiedeten Seeräubergesetz16 aus dem Jahr 100 v.Chr. verpflichtete Rom seine Bundesgenossen dazu, ihre Territorien den Piraten nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Außerdem schärfte Rom ihnen ein, die Bekämpfung der Seeräuber selbst in die Hand zu nehmen.
Die Gesetzesinitiative erwies sich jedoch als illusorisch. Die Bundesgenossen Roms scheuten die Kosten eines jahrelangen Kleinkriegs mit den Piraten. Ein weiterer Grund für das Scheitern des römischen Antipiratengesetzes war, dass die Tiberrepublik in Konflikt mit König Mithridates VI. von Pontos geriet. Dies kam den Piraten gerade recht, die sofort die Möglichkeit sahen, im Fahrwasser beider Großmächte auf Raubfang zu gehen. Die Jagd dauerte lang. Anders als das Makedonen- und Seleukidenreich erwies sich der König von Pontos Rom lange Zeit gewachsen.
Es war nicht das erste Mal, dass Rom mit Mithridates aneinandergeriet. Nach ersten Annexionen Kappadokiens und Bithyniens im Jahr 90 v. Chr. hatte der Pontiker nur durch massiven Druck Roms dazu bewegt werden können, die besetzten Kleinkönigreiche wieder herausgegeben. Als der König Bithyniens, Nikomedes IV., auf Anstiftung des römischen Gesandten Manius Aquilius zwei Jahre später Mithridates angriff, wurde er unter dem Jubel der unterdrückten Völker Asiens geschlagen.
Der König von Pontos fasste jetzt ins Auge, den günstigen Moment auszunutzen und die römische Provinz Asia zu erobern. Vorher musste Mithridates jedoch ein Hindernis beseitigen: die zahlenmäßig sehr starke italische und römische Bevölkerung von Asia. Der Pontiker wusste ein probates Mittel. Er beschloss, mithilfe der einheimischen Bevölkerung Asias einen Aufstand zu entfachen, der die römisch-italische Oberschicht innerhalb weniger Tage vernichten sollte.
Während er im Verborgenen seine Flotte aufrüstete, ritten die Sendboten Mithridates’ mit geheimen Briefen durch Asia. In diesen Kassibern wurden die nichtrömischen Satrapen und Amtsvorsteher dazu aufgefordert, sich 30 Tage nach Erhalt der Botschaft gegen die Herrschaft Roms zu erheben und alle Römer und Italiker der Provinz niederzumachen.
Um sicherzugehen, dass sein Appell befolgt werden würde, machte Mithridates der Bevölkerung Asias große Zugeständnisse. Er inszenierte sich als Befreier aller von Rom unterdrückten Völker und versprach den Sklaven, die ihre italischen Herren töteten, großzügig die Freiheit. Der König von Pontos war jedoch alles andere als ein altruistischer Freiheitsbringer. Diejenigen, welche Römer und Italiker töteten, sollten die Hälfte von deren Vermögen für sich behalten, die andere jedoch dem König abgeben.
Mithridates VI. musste in Asia nicht lange um Mitkämpfer werben. Die Missstände der römischen Verwaltung, die Korruption seiner Statthalter und besonders das System der römischen Steuerpacht hatten Rom verhasst gemacht. Die Steuern der römischen Provinzen wurden nicht vom römischen Staat selbst, sondern von Pächtern eingetrieben. Diese kauften vom römischen Staat für eine Dauer von 5 Jahren das Recht, Steuern zu erheben. Da die Pächter sich meist verschuldet hatten, um die Pachtsumme überhaupt vorlegen zu können, trieben sie oft rücksichtslos die Steuern ein. Mithridates hatte es somit leicht, gegen Rom zu agitieren. Zudem kam ihm zustatten, dass auf der apenninischen Halbinsel seit drei Jahren der Bundesgenossenkrieg tobte, der viele römische Legionen band. Außerdem bahnte sich ein Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Volkspartei, den Popularen, und der herrschenden Senatspartei, den Optimaten, an. Dies waren gute Voraussetzungen für die Pläne des Königs von Pontos.
30 Tage, nachdem er es befohlen hatte, brach der Aufstand in Asia aus. Er ging als »Vesper von Ephesos« (88 v. Chr.) in die Geschichte ein. In einem Blutrausch sondergleichen fielen die Aufständischen überall zur selben Zeit über die nichts ahnende römisch-italische Bevölkerung her. Grausam entlud sich der seit Jahrzehnten aufgestaute Hass. Die Massaker ereigneten sich nicht nur auf Straßen und Plätzen sowie in Häusern und Villen, sondern auch in Tempeln, wo die Verfolgten Schutz suchten.
Im Artemistempel von Ephesos wurden Verzweifelte, die in ihrer Todesangst schutzflehend heilige Bildsäulen umklammerten, unbarmherzig getötet. Im Aeskulaptempel von Pergamon spickten die Rebellen ihre Opfer mit Pfeilen, während diese ihre Heiligen umfassten. Die Adramyttener17 gingen noch weiter. In ihrer Grausamkeit ließen sie selbst dann nicht von ihren Opfern ab, als diese sich schon ins Meer geflüchtet hatten. Die Bewohner von Kaunos18 ertränkten erst die Kinder vor den Augen der Mütter, dann die Mütter vor den Augen der Männer und letztendlich die Männer selbst. Es war ein fürchterliches Blutbad.
Binnen weniger Tage fielen nach Angaben des römischen Historikers Appian 80 000 Italiker und Römer den wütenden Pogromen zum Opfer. Die hasserfüllte Propaganda Mithridates’ war auf fruchtbaren Boden gefallen. Nach dem Massaker besetzte die pontische Armee die einst römische Provinz. Dann setzte sie nach Griechenland über, wo sich viele Städte gleichfalls gegen Rom erhoben hatten.
Mithridates bekämpfte die Römer jedoch nicht nur zu Lande, sondern auch zur See. Hierbei kam ihm sein Bündnis mit den Kilikiern zugute, welche die Frachtschiffe Roms und seiner Bundesgenossen nach Belieben plünderten.
Der nächste Angriff Mithridates’ galt Rhodos, das aufgrund seiner strategischen Lage als Operationsbasis äußerst wichtig war. Aber Rhodos zeigte dem Pontiker die Zähne. In harten Kämpfen zur See und zu Lande behauptete sich der wehrhafte Inselstaat auch ohne römische Hilfe gegen den sieggewohnten König. Nach einigen Monaten der Belagerung ließ Mithridates frustriert von der Insel ab und wandte sich wieder dem Landkrieg in Griechenland zu. Hier war eine dramatische Veränderung der Lage eingetreten. Nach zäher Belagerung hatte ein römisches Heer unter Lucius Cornelius Sulla erst Athen, dann den Piräus erobert. Jetzt schickte sich Sulla an, das geschlagene pontische Heer in Thessalien zu vernichten.
Wieder zeigte sich das Organisationsgeschick von Mithridates. In wenigen Wochen stampfte er eine gigantische Armee aus dem Boden, mit der sich sein Feldherr Archelaos siegessicher den Römern entgegenstellte. Doch Sulla war ein hervorragender Stratege. Er schlug das Heer des Königs von Pontos 84 v. Chr. erst bei Chaironaia, dann bei Orchomenos so vernichtend, dass Mithridates bald um Waffenstillstand bat.
Dies kam Sulla ganz recht. Aus Rom kamen schlechte Nachrichten. Die Volkspartei der Popularen hatte gegen die Optimaten geputscht und in Rom erneut die Macht an sich gerissen.
Aus diesem Grund bequemte sich der siegreiche Feldherr zu einem vorzeitigen Friedensschluss und zwang Mithridates zu einer Kriegskostenentschädigung von 2000 Talenten.19 Dies mutet auf den ersten Blick viel an, war aber ein geringer Betrag im Vergleich zu den 20 000 Talenten, die Sulla der aufständischen Provinz Asia zur Strafe für ihre Unbotmäßigkeit auferlegte.
Die härteste Strafmaßnahme Sullas betraf allerdings die Flotte von Mithridates. In diesem Punkt zeigte sich der Römer unnachgiebig. Er zwang den Pontiker zur Übergabe seiner Flotte, die aus 70 Schiffen bestand. Doch damit war nach den Schilderungen Appians der Seekrieg noch lange nicht beendet:
»Denn außer diesen (den Römern) kreuzten an seinen Küsten ganz öffentlich zahlreiche Räuberbanden, mehr wie feindliche Flotten als wie Seeräuber. Sie schrieben sich ursprünglich von Mithridates her, der sie aufs Meer ausgesandt hatte, wie er alles, was er nicht lange zu besitzen hoffte, verwüstete. Indessen hatten sie sich außerordentlich vermehrt und griffen nun nicht mehr die zur See Fahrenden allein, sondern auch Seehäfen und feste Plätze und Städte mit offenbarer Gewalt an. So waren Jassos, Samos, Kiazomene und Samothrake noch während Sullas Anwesenheit von ihnen genommen worden. Aus dem Tempel von Samos hatten sie einen Schmuck geraubt, dessen Wert auf tausend Talente veranschlagt wurde.«20
Damit nicht genug. Wie Appian berichtet, plünderten die Kilikier weitere heilige Stätten, die bisher als unverletzlich gegolten hatten. Ihre Erfolgsbilanz konnte sich sehen lassen. Ihnen fielen zum Opfer: die Heiligtümer von Klaros, Chtonia und das Didymaion. Des Weiteren plünderten sie die Tempel des Asklepios in Epidauros und die des Poseidon auf dem Isthmos, bei Tainaron und auf Kalauria. Ebenso wenig verschonten die Piraten in der Folgezeit die Kultstätten des Apollon in Aktion und auf Leukas sowie die Heiligtümer der Hera in Argos und auf dem Lakinion.
Angesichts einer derartigen Erfolgsserie und der erbeuteten Reichtümer verwundert es nicht, dass die Kilikier immer übermütiger wurden und ihren Reichtum öffentlich zur Schau stellten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: