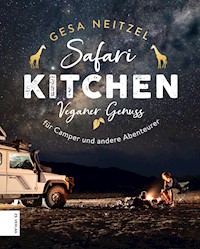12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lagerfeuerromantik und Elefantenglück Gesa Neitzel hat sich während ihrer Ausbildung zum Safari-Guide verliebt – nicht nur in Ranger Frank, sondern auch in den afrikanischen Kontinent, mit all seinen Facetten, Farben und Herausforderungen. Das junge Paar begibt sich auf einen faszinierenden wie waghalsigen Roadtrip quer durchs südliche Afrika: Botswana, Namibia und Sambia. Sie schlafen in einem kleinen Dachzelt auf dem klapprigen Land Rover, begegnen Flusspferden in wackeligen Kanus, Wüstenlöwen beim Reifenwechsel und immer wieder der Frage nach der gemeinsamen Zukunft. Ein Abenteuer im wahren wilden Afrika. »Auge in Auge mit Elefanten, Löwen und Leoparden lernt Gesa jeden Tag aufs Neue, was wirklich zählt.« NDR DAS!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Löwenherzen
Die Autorin
Gesa Neitzel, Jahrgang 1987, war Fernsehredakteurin in Berlin, bevor sie sich in Südafrika zur Rangerin ausbilden ließ. Während der Corona-Pandemie begleitete sie ihren Partner Frank in seine Heimat Australien und widmet sich dort derzeit ganz dem Schreiben, bis die beiden wieder nach Afrika reisen können. 2016 erschien ihr Bestseller Frühstück mit Elefanten, 2019 folgte mit The Wonderful Wild ihre Anleitung für ein wildes Leben.
Das Buch
Während ihrer Ausbildung zur Rangerin hat Gesa Neitzel alles übers Spurenlesen und über Tierbestimmung im Busch gelernt. Dachte sie. Doch der afrikanische Kontinent ist vielfältig und in der Wildnis verhält sich nicht jeder Löwe, wie im Lehrbuch beschrieben. Zum Glück hat sie nun Frank an ihrer Seite und gemeinsam wagen die beiden sich mit ihrem treuen Land Rover Ellie offroad ins Abenteuer. Neben aufregenden Tierbegegnungen mit Krokodilen, Strandwölfen und Gesas Lieblingstieren – den Elefanten, wird es eines Tages aufregender als gewünscht: Ein beängstigendes Feuer schweißt die beiden noch enger zusammen.
Gesa Neitzel
Löwenherzen
Zwei unterwegs in Afrika
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
1. Auflage August 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, 2021Illustrationen: © Pablo Ientile, www.pabloientile.comFotos: © Gesa NeitzelE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2603-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil 1 BOTSWANA
Kapitel 1
Zurück im Land der Riesen
Kapitel 2
N. Y. C.
Kapitel 3
Wiedersehen am Pont Drift
Kapitel 4
Der Geruch von Lagerfeuer
Kapitel 5
Kubu
Kapitel 6
Zurück an den Grenzen der Komfortzone
Kapitel 7
Leopard und Steinböckchen
Kapitel 8
Ein letztes Stück Ursprung
Kapitel 9
Eine denkwürdige Nacht
Kapitel 10
Löwen im Regen
Teil II NAMIBIA
Kapitel 11
Strandwolf
Kapitel 12
Elefanten-Glück
Kapitel 13
Löwenherzen
Kapitel 14
Die letzten Einhörner
Kapitel 15
Ständig krank, niemals tot
Teil III SAMBIA
Kapitel 16
Lunch mit Krokodilen
Kapitel 17
Von Sumpflöwen und Elefantenwaisen
Kapitel 18
Das Tal des Leoparden
Kapitel 19
Feuertaufe
Kapitel 20
Im Fledermauswald
Epilog
Bildteil
Anhang
Danksagung
Wie kann ich helfen?
Quellenverzeichnis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Vorbemerkung
Die folgende Erzählung ist eine komprimierte Zusammenfassung von Ereignissen, die sich im Zeitraum von 2015 bis 2020 abgespielt haben. Obwohl wir in dieser Zeit mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs waren, ist »Ellie der Land Rover« das einzige Auto, das in diesem Buch Erwähnung findet.
Um die Privatsphäre realer Personen zu schützen, habe ich die meisten von ihnen durch erfundene Charaktere ersetzt. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind demnach unbeabsichtigt.
Prolog
Ein lauter Knall riss mich aus dem Schlaf. Die Mittagssonne stand hoch über unserem Zelt; drinnen war es so drückend heiß, dass Frank und ich nur mit Unterwäsche bekleidet auf der Feldpritsche lagen. Frank setzte sich auf und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als wollte er die Müdigkeit wegwischen.
»Was war das?«, fragte ich, noch ganz verschlafen, und rollte zur Seite, um etwas kaltes Wasser aus einer Thermoskanne neben dem Bett in ein Glas zu gießen.
»Klang wie ein Gewehrschuss«, murmelte Frank, streifte sich sein Khaki-Hemd über den Kopf und schlüpfte in ein Paar Shorts. »Shit, ich hoffe, die Gäste haben das nicht mitbekommen.«
Ich verstand sofort, was er meinte. Während »Safari« noch vor ein paar Jahrzehnten quasi gleichbedeutend mit dem Schießen von Wildtieren war, löste das Geräusch eines sich lösenden Schusses dieser Tage in den meisten Fällen Unbehagen unter den Gästen aus; allemal warf es Fragen auf. Wer hatte geschossen? Großwildjäger? Ein Safari-Guide, der auf einem Busch-Walk in eine »haarige« Situation geraten war? Oder hatte sich gar eine Gruppe Wilderer in den Park geschlichen?
In diesem Fall tippte ich auf Letzteres. Das Camp, in dem wir für ein paar Nächte mit unseren Safari-Gästen untergekommen waren, lag in einem entlegenen Teil des Südluangwa-Nationalparks in Sambia. Wenngleich Großwildjagd außerhalb des Parks leider nach wie vor praktiziert wurde, so war es innerhalb der Parkgrenzen strengstens verboten, auf die Tiere zu schießen. In dieser brütenden Mittagshitze hätte außerdem gewiss kein Guide seinen Gästen einen Walk zugemutet. Es war jedoch durchaus möglich, dass eine Gruppe Wilderer sich illegal ein Impala zum Lunch geschossen hatte, während die Park-Ranger um die Mittagszeit ruhten.
Ein weiterer Knall unterbrach meine Gedanken.
»Nee, das war kein Gewehrschuss«, sagte ich zu Frank, »das kam aus dem Küchenzelt!«
Jetzt schlüpfte auch ich in meine Kleidung und spähte aus dem vernetzten Zeltfenster, während Frank den Reißverschluss am Eingang aufzog und hinauskletterte. Ich hörte ein weiteres Geräusch, das ich noch weniger einordnen konnte. Es klang wie das Rascheln des trockenen Grases hinterm Camp, fast so als würde eine Herde Büffel vorbeistreifen. Erst als Frank mir von draußen etwas zurief, vermochte ich, die Geräusche wie zwei Puzzle-Stücke zusammenzusetzen.
»Feuer!«, rief er, und plötzlich ergab alles einen Sinn: Irgendetwas musste im Küchenzelt explodiert sein – daher die Knalle. Und das seltsame Geräusch hinterm Camp stammte nicht vom raschelnden Gras – nein, es war das Knistern der Flammen!
Plötzlich war Frank hellwach – und auf Zack. In Windeseile war er zurück im Zelt und krallte sich die Schlüssel zu »Ellie«, unserem zwanzigjährigen Land Rover Defender, der am Camp-Eingang in der Sonne parkte, damit die Solarzelle auf dem Dach laden konnte.
»Pack unsere Sachen und halt dich bereit! Ich mache Ellie startklar – nur für alle Fälle!« Dann rannte er auch schon los und ließ mich verdutzt im Zelt zurück. Aber für welche Fälle sollte ich mich denn bereithalten?
Die Situation kam mir in diesem Moment noch alles andere als brenzlig vor. Gut, da war ein Feuer in der Küche, aber der Knall war so laut gewesen, dass ihn sicher alle Camp-Angestellten gehört haben dürften. Und die löschten bestimmt schon längst, so dachte ich. Ich trat aus dem Zelt, anstatt, wie von Frank aufgetragen, unsere Sachen zu packen. Erst als ich die riesige Rauchwolke über dem Küchenzelt sah, wurde mir klar, dass dieses Feuer nicht so leicht mit den Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen war.
»Aufwachen, Leute! Da ist ein Feuer! Packt bitte alle eure Sachen«, hörte ich Frank rufen, während er auf dem sandigen Pfad hinter den Zelten Richtung Ellie stürmte.
Unser Zelt lag am Ende des Pfades, dahinter kam nur noch Busch. In entgegengesetzter Richtung reihten sich die vier Gast-Zelte am Ufer eines trockenen Flussbettes aneinander, und am anderen Ende lag das offene Busch-Wohnzimmer, wo die Mahlzeiten unter einer großen Plane eingenommen wurden und während der Mittagsstunden Siesta gehalten werden konnte. Die Gäste schliefen in typischen Safarizelten, und die waren wesentlich geräumiger, als man sich das bei einem Zelt vielleicht erst mal vorstellt. Man kann darin aufrecht stehen, hat ein festes Bett, einen kleinen, aber feinen Kleiderschrank und ein abgetrenntes Open-Air-Badezimmer mit Eimer-Dusche und Toilette inklusive – man glaubt es kaum – Klospülung. So entsteht in der Wildnis ein echtes Gefühl von Sicherheit, und man könnte fast vergessen, dass einen nichts als eine Zeltplane von Elefanten, Löwen, Leoparden und Co trennt, die sich im Südluangwa-Nationalpark frei bewegen.
Ein Feuer allerdings macht natürlich auch vor der dicksten Zeltplane nicht Halt.
Zurück im Inneren griff ich jetzt wahllos nach allen Kleidungsstücken in meinem Sichtfeld und schmiss sie in unsere Reisetaschen. Die Kamera-Ausrüstung hatten wir Gott sei Dank in Ellies Innerem gelagert. Als ich kurze Zeit später beide Taschen ins Freie hievte, spürte ich, wie sich der Wind drehte. Auf einmal blies mir heißer Rauch ins Gesicht, und die Flammen fraßen sich durch das staubtrockene Gras direkt in meine Richtung, als würden sie von einem riesigen Fön vorangetrieben. Da kam Frank zurück über den sandigen Pfad geprescht, Thoma, der Camp-Manager, direkt hinter ihm.
»Nehmt alle eure Sachen und lauft in die Mitte des Flussbettes!«, rief Frank, während Thoma in jedem Zelt nachsah, ob alle Gäste wach waren, dann halfen sie das Gepäck durch den tiefen Sand ins Flussbett zu schleppen. Ich warf mir unsere beiden Taschen jeweils über eine Schulter und tat es ihnen gleich, während ich die Gäste durchzählte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs – alle standen jetzt unter der sengenden Mittagssonne im weißen Sand. Etwas schweißgebadet vielleicht – aber sicher. »Puh, Schwein gehabt«, dachte ich, das hätte auch anders ausgehen können. Ich vergewisserte mich bei jedem, dass alles in Ordnung war und alle ihre Habseligkeiten aus den Zelten mitnehmen konnten, und für einen kurzen Moment schien die Gefahr gebannt.
Aber die Flammen preschten weiter voran.
Frank kam auf mich zu. »Der Schlüssel steckt im Schloss. Falls sich der Wind in Richtung Ellie dreht, muss einer von uns sie ganz weit in die Mitte vom Flussbett fahren.«
»Alles klar«, sagte ich und sprach insgeheim ein Stoßgebet, dass uns das erspart blieb. »Aber was, wenn sie wieder nicht anspringt?«
Seit einiger Zeit schon machte Ellie uns Probleme. In den unmöglichsten Situationen wollte sie einfach nicht anspringen, und jeder Versuch, der Sache auf den Grund zu gehen, war bis jetzt gescheitert.
»Sie wird anspringen. Sie muss«, sagte Frank. Dann rannte er durch den heißen Sand in Richtung Camp. »Und nicht vergessen«, rief er mir noch über die Schulter zu, »second gear low – go, go, go!«
»Go, go, go«, wiederholte ich mantraartig den Satz, den er mir während unserer gemeinsamen Fahrstunden beigebracht hatte. Low Range rein, in den zweiten Gang schalten, und dann bloß nicht den Fuß vom Gas nehmen.
Nun, da die Gäste sicher waren, machten sich die Angestellten daran, alles im Camp, was nicht niet- und nagelfest war, vor den Flammen zu retten. Die Tourismus-Saison in Südluangwa hatte gerade erst begonnen, und das kleine Busch-Camp bedeutete alles für die Männer, die hier arbeiteten, schließlich hing ihr gesamtes Jahreseinkommen davon ab – Geld, das ihre Familien ernährte, die Kinder zur Schule schickte und ihnen ein Dach überm Kopf gewährleistete. Wenn das Camp herunterbrannte, war die gesamte Saison verloren. Denn ohne Camp keine Gäste. Und ohne Gäste kein Geld.
Wir alle eilten ihnen zu Hilfe; jeder schnappte sich, was er oder sie tragen konnte – Stühle, Tische, Bücher, Gläser –, wir trugen alles ins Flussbett. Thoma und Samuel, der Head Guide, beluden derweil den Game Viewer (den offenen Geländewagen, auf dem die Safari-Fahrten durchgeführt wurden) mit sämtlichen Essens- und Getränkevorräten, den Gewehren für die Busch-Walks, Funkgeräten, Solarzellen und allem von Wert, was sie sonst noch finden konnten. Dann bretterte Thoma den Wagen mit voller Wucht in den tiefen Sand, aber leider ohne vorher den Allradantrieb einzulegen, und so blieb er nach zwei Metern bereits böse stecken. Er trat aufs Gaspedal, fuhr vor und zurück, aber alles, was er damit erreichte, war, dass sich die Reifen immer tiefer in den Sand gruben.
Jetzt steckte er richtig fest.
Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: Der Wind drehte erneut und blies die Flammen direkt in Richtung Game Viewer. Samuel sprang vom Beifahrersitz und begann, den Wagen anzuschieben. »Hilfe! Alle Mann, kommt helfen!«, rief er, und ein Haufen Leute strömte von allen Seiten herbei. Der Geländewagen war das teuerste Teil im ganzen Camp; ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe gewesen – mal ganz abgesehen von der Explosion, die der Benzintank ausgelöst hätte. Mit vereinten Kräften schoben wir den Wagen an, die Hinterräder wirbelten den Sand auf, und der Auspuff spuckte pechschwarzen Rauch aus, während Thoma noch immer aufs Gaspedal trat. Dann endlich bewegte sich das Biest vorwärts und rollte mit einem lauten Röhren des Motors in die Mitte des Flusses.
Nachdem das Camp-Fahrzeug sicher war, erinnerte ich mich plötzlich an unseren eigenen Wagen. Ich riss den Kopf herum, um zu sehen, wie weit die Flammen vorgedrungen waren, und hielt entsetzt eine Hand vor den Mund, als ich feststellte, dass bereits drei der vier Gast-Zelte komplett heruntergebrannt waren. In weniger als fünfzehn Minuten war das halbe Camp zu Asche und Staub zerfallen. Panisch sah ich mich nach Frank um und erblickte ihn, wie er zusammen mit Jeremy, dem Barkeeper, beide mit Feuerlöschern bewaffnet, in Richtung Küchenzelt rannte, während die Flammen höher und höher stiegen. Was zum Teufel hatten sie vor?! Aber es blieb keine Zeit, mir Sorgen zu machen. Kurz entschlossen lief ich auf Ellie zu, sprang auf den Fahrersitz und legte in meiner Panik tatsächlich noch den Sicherheitsgurt an.
»Bitte, bitte, bitte, spring an, Ellie«, beschwor ich die alte Dame.
Dann drehte ich den Schlüssel im Schloss.
Teil 1 BOTSWANA
Kapitel 1Zurück im Land der Riesen
»Hallo, Frank? Ka-kannst du mich hören?«
Ich stand auf einem alten Termitenhügel und reckte meinen ohnehin schon langen Körper, um meine Chancen auf etwas Handyempfang zu verbessern, während die ersten Sonnenstrahlen durch die Äste der Regenbäume im Mashatu-Camp brachen. Unten lehnten mein Wanderrucksack und das Gewehr gegen den Termitenhügel. Es war fünf Uhr morgens, in ein paar Minuten würde ich mit meinem Mentor Michael und einer Gruppe Safari-Guide-Schüler*innen zum ersten von zwei Bush-Walks an diesem Tag aufbrechen. Dieser Tage verzichtete ich nicht immer, aber immer öfter auf meine morgendliche Tasse Kaffee, und das aus zwei guten Gründen.
Erstens: Wenn sich der Köper erst mal an »Ricoffy« (den südafrikanischen Instantkaffee) gewöhnt hat, macht die schwache Plörre einen auch nicht wacher, selbst wenn man vier gehäufte Löffel in die Tasse gibt. Zweitens: Wenn ich die Tasse Kaffee wegließ, blieben mir jeden Morgen ein paar Minuten vor dem Walk, um kurz mit Frank zu texten oder zu telefonieren. Einziges Problem: Handyempfang gab es hier nur an einer Stelle, und zwar auf dem Termitenhügel, und der lag etwas außerhalb des Camps. Am frühen Morgen die Erste zu sein, die aus den Zeltreihen heraus ins Freie trat, war stets eine nervenaufreibende Angelegenheit. Schließlich wusste man nie, welche Wildtiere in der Nacht vorbeigeschlichen waren – und welche vielleicht noch immer im Wildsalbei ausharrten, der um diese Jahreszeit besonders hoch stand.
»Gesa? Gesa, bist du noch da?«
Franks Stimme drang an mein Ohr – und sie klang so weit entfernt, wie sie war. 20 000 Kilometer, um genau zu sein. Während ich im Anschluss an unsere gemeinsame Ausbildungszeit nach Mashatu, ins sogenannte »Land der Riesen« im Osten Botswanas, zurückgekehrt war, war er ans andere Ende der Welt geflogen, nach Australien. Frank war in Südafrika geboren und hatte dort die erste Hälfte seines Lebens verbracht. Als Teenager wanderte er mit seiner Familie nach Australien aus. Sie ließen das von der Apartheid gebeutelte Südafrika hinter sich, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch Franks Liebe für die wilden Tiere Afrikas war zu groß gewesen, und so war er nach einigen gescheiterten Versuchen, sich in das australische Arbeitsleben einzufügen, auf den Kontinent seiner Geburt zurückgekehrt, um Safari-Guide zu werden.
So hatten wir uns kennengelernt.
Im Jahr 2015 absolvierten wir die gleiche Ausbildung, und was zunächst als dicke Freundschaft begann, verwandelte sich zum Ende des Jahres in eine ganz frische Beziehung mit, um ehrlich zu sein, erst mal wenig Aussicht auf Erfolg. Denn keiner von uns wusste so recht, was die Zukunft bringen würde. Das wussten wir auch immer noch nicht. Nur dass wir es miteinander versuchen wollten, das wussten wir. Und so standen wir an diesem Morgen an entgegengesetzten Enden der Welt und sahen die gleiche Sonne an – er ihren Rücken und ich ihr Gesicht.
»Was habt ihr denn heute vor?« – »Wann landest du in Johannesburg?«
Wegen der Zeitverzögerung stellten wir die Fragen gleichzeitig und antworteten auch zur gleichen Zeit.
»Elefanten finden.« – »Nächsten Mittwoch.«
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sich eine Gruppe am Camp-Eingang versammelte.
»Du, ich muss jetzt los«, sagte ich schweren Herzens, »aber ich schreib dir später, ja?«
»Alles klar … hey, du fehlst mir!«
»Du fehlst mir auch«, antwortete ich, und kurz bevor ich auflegte, warf er mir noch einen Satz zu, den er immer zum Abschied sagte: »Be safe out there!« Gib acht auf dich da draußen.
Ich hüpfte vom Termitenhügel, setzte mir meinen Rucksack auf und nahm das Gewehr, bevor ich mich in den Halbkreis stellte, zu dem sich die Schüler*innen in der Einfahrt versammelt hatten.
In diesem Monat wurde im Camp der Grundkurs gelehrt. In 55 intensiven Tagen lernten die fünfzehn Schülerinnen und Schüler die Grundkenntnisse, die es brauchte, um als Safari-Guide in Südafrika Tourist*innen die Wildnis zu zeigen. In Botswana, wo sie sich für diesen ersten Teil der Ausbildung befanden, war die Ausbildung zwar nicht anerkannt, aber der Abstecher über die Ländergrenze ermöglichte es den Schüler*innen, in ein anderes Ökosystem zu schnuppern, den Horizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln. Auch ich hatte einen Teil meiner Grundausbildung hier absolviert und schwelgte in Erinnerungen an meine erste Zeit im Busch. An diesem Morgen war auch ich noch Schülerin, wenngleich ich keinem Kurs mehr angehörte.
Nach einem Jahr im südlichen Afrika war ich kurz nach Deutschland zurückgekehrt, doch der Ruf der Wildnis war alsbald zu laut geworden, und so war ich bereits wenig später zurück.
Warum? Weil ich nicht anders konnte. Meine vier Wände in Berlin waren schneller zu eng geworden, als ich »Brandenburger Tor« hätte sagen können, und all das hier hatte mir so sehr gefehlt, dass es wehtat. Außerdem hatte ich hier noch etwas zu erledigen. Ich hatte die Ausbildung zum sogenannten »Back-up Trails Guide« abgeschlossen. Als solcher war ich nun dazu ausgebildet, den sogenannten »Lead Guide« auf Busch-Walks in Südafrika zu unterstützen, das zweite Paar Augen und Ohren und die zweite Gewehrträgerin zu sein. Was mir noch fehlte, war die Prüfung zum Lead Guide, damit ich künftig auch selbst die Walks anführen durfte.
»Guten Morgen, alle zusammen«, sagte Michael, der heutige Lead Guide und Lehrer. »Ich schlage vor, dass wir zunächst zügig zur East-West-Ridge marschieren und von dort oben auf der anderen Seite schauen, ob wir Elefanten finden; dann können wir versuchen, uns ihnen zu nähern. Falls wir auf dem Weg dorthin frische Spuren finden, machen wir einen neuen Plan. Klingt gut?«
Es folgte müdes Nicken der Gruppe.
Michael Venter war Südafrikaner, aber lebte schon lange jenseits der Grenze in Botswana, wo er in verschiedenen Safari-Camps als Freelance-Guide und Ausbilder arbeitete. Er führte seine Walks by the book, wie man im Englischen so schön sagt. Er hielt sich also genau an die Vorgaben und Regeln. Wenn Michael im Busch unterwegs war, ging er kein Risiko ein. Für ihn war eine gelungene Begegnung mit einem Wildtier eine, in die man rein- und rauskam, ohne dabei von dem Tier entdeckt zu werden. Ihm ging es nicht darum, so nah wie möglich heranzukommen – und schon gar nicht eine Reaktion hervorzurufen. Ihm ging es darum, die Tiere aus einer sicheren Entfernung zu beobachten. Dafür hatte er meinen größten Respekt, und es war eine Einstellung, die ich voll und ganz teilte. Während ich in meinem ersten Ausbildungsjahr kaum genug von dem Gefühl bekommen konnte, das die unmittelbare Nähe eines wilden Elefanten hervorrief, so hatten mich genau diese intensiven Begegnungen aber auch gelehrt, dass sie nur mit äußerster Vorsicht, mit Verantwortung und vor allem mit viel Erfahrung und Weitsicht angegangen werden sollten. Ich wollte mich unter keinen Umständen leichtsinnig in eine Situation begeben, in der ich die Waffe in meiner Hand je hätte benutzen müssen. Michaels Philosophie war es, dass vor allem junge Nachwuchs-Guides gar nicht erst an Zusammenstöße mit Büffeln oder Elefanten denken sollten. Abstand halten war seine erste Grundregel, und er bewegte sich mit äußerster Vorsicht durch den Busch.
Das war auch an diesem Morgen so, als ich ihm auf einem ausgetretenen Elefantenpfad gen Norden folgte. Während die acht Schüler*innen hinter mir noch etwas schlaftrunken dahinschlurften, setzte Michael vor mir seine Fußsohlen mit Bedacht auf. Was mir an seiner Art zu führen besonders gut gefiel, war, dass er stets auf Dinge hinwies, die ihm auffielen. Michael redete nicht sonderlich viel, schon gar nicht über Persönliches. Darum war es recht schwer, ihn einzuschätzen. Was ich in Mashatu über seinen Charakter erfahren hatte, stammte daher von den Dingen, auf die er deutete. Und das schienen, neben frischen Spuren am Boden oder potenziell gefährlichen Tieren in der Ferne, vor allem solche zu sein, die er schön fand. Leuchtend gelbe Wildblumen oder die besondere Maserung eines wettergegerbten Vulkangesteins, das scharlachrote Gefieder eines Kaiservogels oder die untergehende Sonne, die den staubigen Himmel über Mashatu jeden Spätnachmittag in ein magisches goldgelbes Licht tauchte. Wann immer ihm so etwas auffiel, gestikulierte er fast so, als zeigte er es einem Taubstummen – große Augen, ausladende Gesten und ein strahlendes, breites Lächeln.
Wir kraxelten die steile Seite der East-West-Ridge hinauf, den Hügelkamm, der das Gebiet, in dem wir marschieren durften, in zwei gleich große Teile unterteilte. Im Norden von diesem Marschgebiet führten mehrere Lodges Safaris durch, im Süden lag eine große kommerzielle Plantage. Die lag zwar so weit weg, dass wir ihre Felder und Sprinkleranlagen nicht sehen konnten, aber ihre Existenz blieb trotzdem nicht unbemerkt. Das Verhalten der Mashatu-Elefanten zeugte oftmals davon, dass diese Gegend gar nicht so wild war, wie sie mir noch während meiner ersten Wochen als Nachwuchs-Guide erschienen war. Die Elefanten wirkten oft gestresst, gehetzt – vor allem, wenn sie gerade aus dem Westen kamen. Denn dort waren sie nicht willkommen; die Farmer scheuchten sie fort, um sie von der Saat fernzuhalten – mit Gebrüll, mit Steinen, mit den laut brummenden Motoren ihrer Fahrzeuge. Ich hatte mich seither oft gefragt, ob der Schuss, den ich eines Nachts während meiner Grundausbildung gehört hatte, vielleicht auch von einem der Farmer gekommen war. Damals hatten meine Mitschüler*innen vermutet, dass Wilderer dahintersteckten. Ich war mir da nicht mehr so sicher.
Nun wäre es aber zu einfach, die Farmer zu verurteilen. Konflikte wie diese sind leider überall dort an der Tagesordnung, wo Menschen und Wildtiere Tür an Tür leben. Umso wichtiger ist es daher, sich auf einem Buschmarsch in solch einer konfliktreichen Gegend mit besonderer Vorsicht zu bewegen.
»Never gets old, does it?«, sagte Michael, als wir die höchste Stelle der East-West-Ridge erreichten. Nein, von diesem Ausblick konnte man wirklich nie genug kriegen. Als wir auf die andere Seite spähten, erstrahlte die saftig grüne Flussaue im besten Licht eines frühen Morgens, unzählige Vögel zwitscherten ihren morgendlichen Gruß, ein Zebra rief in der Ferne, Impalas grasten auf der weiten Ebene, und dort – kurz vor der Felsformation, die sich »das Amphitheater« nannte, streifte eine Herde Elefanten gemächlich durch die Salvadora-Büsche (salvadora australis).
Für die Schüler*innen in der Grundausbildung ging es in diesen ersten Tagen weniger darum zu lernen, wie sie sich einem potenziell gefährlichen Tier gegenüber zu verhalten hatten, als vielmehr ein breites Spektrum an Wissen aufzusaugen. Pflanzen- und Tierkunde, Spuren- und Sternelesen. Alles war wichtig, alles hing miteinander zusammen.
Für mich war es etwas anderes.
Um die Prüfung zum Lead Guide überhaupt bestreiten zu dürfen, musste ich mindestens 150 Stunden zu Fuß und mindestens 50 Encounter, also Begegnungen mit einem potenziell gefährlichen Wildtier, in mein Logbuch eintragen. Bei all dem musste ich in der Position des Back-up auf dem Walk dabei sein – also nicht bloß als eine Schülerin auf den hinteren Plätzen. Ich hatte inzwischen knapp 300 Stunden und über 60 Encounter mit potenziell gefährlichen Wildtieren gesammelt. Unter diesen Begriff fielen zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches: Elefanten, Büffel, Löwen, Nashörner und Leoparden. Bei diesen berühmten »Big Five« reichte es aus, nur einem einzigen Individuum zu begegnen, um ein Encounter geltend zu machen. Und dann gab es noch ein paar Sonderregelungen: Begegnete man zu Fuß Hyänen, galt dies nur dann als Encounter, wenn es ein ganzes Rudel war. Auch Flusspferde konnten als Encounter betrachtet werden – allerdings nur, wenn das Tier sich zum Zeitpunkt der Annäherung nicht im Wasser befand (Flusspferde galten auf einem Buschmarsch gemeinhin nur an Land als gefährlich – auf einem Kanu sieht das jedoch gleich wieder ganz anders aus, aber dazu kommen wir später).
Es blieb alles auch ein wenig Auslegungssache, und so manch ein Back-up Guide wurde durchaus kreativ, wenn es um die Anhäufung der so wichtigen Encounter ging; ein Kollege soll tatsächlich eine lebensbedrohliche Begegnung mit einem Strauß angegeben haben. Wichtig war bei allen Einträgen im Logbuch, dass eine überlegte Herangehensweise nachgewiesen und dokumentiert werden konnte. Das bedeutete mitunter Notizen über:
Den Stand des Windes zum Zeitpunkt der Begegnung
Den Stand der Sonne
Die Himmelsrichtung, in die man sich bewegte bzw. aus der man kam
Hinweise auf die Körpersprache des Tieres und sein Verhalten
Entfernungen
Strategische Gedankengänge, also: Warum wurde die Situation so oder so gelöst?
Ich hatte also genug Stunden und Encounter gesammelt, um die Prüfung abzulegen. Als Nächstes musste ich nun eine*n Prüfer*in finden, der oder die mit mir zusammen auf einen mehrstündigen Busch-Walk gehen und mein Können bewerten würde. Und wie es der Zufall so wollte, stand an diesem Morgen einer neben mir. Es gab damals nur wenige Lehrer*innen, die als Prüfer*innen für die Lead Guide Assessments zugelassen waren. Michael war einer davon. Nur gefragt hatte ich ihn noch nicht.
»Der Wind weht aus westlicher Richtung«, sagte Michael. »Spürt ihr ganz deutlich am Hinterkopf, oder?«
Die Schüler*innen stimmten zu.
»Wir wollen mal schauen, ob wir uns bis zum Amphitheater durchschlagen können, ohne von der Herde gesehen oder gerochen zu werden. Dazu gehen wir jetzt erst mal in nordwestliche Richtung, um aus unserem eigenen Windschatten zu kommen. Und wenn wir dann auf gleicher Höhe mit der Herde sind, biegen wir ab. So gehen wir sicher, dass unser Geruch nicht zu ihnen hinüberweht.«
Ich machte mir im Kopf Notizen zu Michaels Herangehensweise. Ich wäre die Situation ähnlich angegangen, und das gab mir Zuversicht. Den nächsten Abschnitt unseres Marsches legten wir schweigend zurück. Knapp eine Dreiviertelstunde brauchten wir, um auf Höhe der Herde zu kommen. Als noch etwa fünfzig Meter zwischen uns und den Elefanten lagen, bogen wir erneut ab und steuerten auf die sprungturmhohen Felsen zu. Mucksmäuschenstill kletterten wir hinauf und bewerkstelligten es, die ganze Gruppe am Abhang zu platzieren, sodass jeder Schüler einen Sitz in der ersten Reihe bekam und die Elefanten bestaunen konnte, die direkt unter uns grasten und immer noch keine Ahnung hatten, dass wir da waren.
By the book, wie immer.
Michael und ich setzten uns auf jeweils eine Seite der Schüler*innenreihe, sodass wir sie mit den Gewehren einrahmten. Ich schaute hinunter auf die Elefanten. Es befanden sich viele Jungtiere in der Herde, und vor allem die jungen Frauen in unserer Gruppe waren ganz angetan von den Kleinen. Ich aber sah heute fast durch die Tiere hindurch. Meine Gedanken waren bei der Frage, die ich Michael endlich stellen wollte – musste. Ich hatte damit viel zu lange gewartet und war nur noch knapp zehn Tage hier.
Dann nämlich sollte ein ganz neues Abenteuer beginnen: In zehn Tagen würde Frank mich am Grenzübergang in Pont Drift abholen, und dann würden wir gemeinsam einen Roadtrip unternehmen: Wir wollten mit dem Auto kreuz und quer durchs südliche Afrika reisen.
In den letzten Wochen hatten wir den Plan dafür gemeinsam ausgeheckt, und mit jedem neuen Tag war unsere Vorfreude mehr und mehr gewachsen. Johann, ein alter Freund der Steenhuisens, also von Franks Familie, hatte uns dabei geholfen, in Kapstadt einen gebrauchten Land Rover Defender aufzutreiben, der in unserer Preisklasse lag. Er selbst wohnte in Südafrikas Hauptstadt Pretoria; die Sache hatte sich also durchaus kompliziert gestaltet, während wir über drei Länder und zwei Zeitzonen hinweg versuchten, den Kauf abzuwickeln. Gott sei Dank war Johann selbst ein absoluter Land-Rover-Fanatiker mit vier Sammlerstücken in der Garage, jeweils eines aus den letzten Jahrzehnten. Seine Expertise und seine Zuversicht hatten sich als unersetzbar herausgestellt, und ich weiß nicht, ob dieser Land Rover je den weiten Weg von Kapstadt nach Pretoria geschafft hätte, wäre Johann damals nicht gewesen.
Jetzt wartete unser ganz eigener Landy also in Johanns Garage darauf, dass Frank von Australien zurück nach Südafrika flog und dann zuerst ihn in Pretoria und anschließend mich in Mashatu abholen kam. Und dann konnte der Roadtrip endlich starten.
Aber bevor wir uns auf die staubigen Schotterpisten Afrikas wagen würden, musste ich ja erst noch meine Prüfung ablegen …
Kapitel 2N. Y. C.
»Wenn du so weit bist, dann weißt du es einfach«, sagte Frank, während er in Australien seinen Kaffee schlürfte und ich im Dämmerlicht des gleichen Tages wieder auf dem Termitenhügel stand »So war es bei mir auch.« Frank hatte seine Lead-Guide-Prüfung bereits im letzten Jahr abgelegt und bestanden.
»Ehrlich gesagt, alles, was ich momentan spüre, ist, dass mir die Zeit davonläuft«, sagte ich. »Können wir unseren Trip nicht um ein paar Tage nach hinten schieben?«
»Nee, das geht leider nicht. Wir haben doch schon Unterkünfte gebucht. Aber vielleicht solltest du dann einfach noch warten«, schlug Frank vor, »es hat doch keine Eile.«
Da hatte er recht. Während unseres monatelangen Roadtrips bestand für mich kein unmittelbarer Bedarf, Lead Guide zu werden. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich gerade so richtig drin in den Bush-Walks. Seit Wochen war ich täglich zu Fuß unterwegs, und dadurch hatte ich ein Gefühl von Sicherheit gewonnen, ganz so, als könnte mich da draußen nichts mehr aus dem Sattel werfen. Beim Spurenlesen folgte ich meinem ersten Instinkt und fuhr damit richtig gut. Ich nahm mittlerweile fast automatisch die Windrichtung wahr, ohne dafür überhaupt noch meine mit Asche gefüllte Socke in die Luft werfen zu müssen. Bei Begegnungen mit den Big Five dachte ich mit und las das Verhalten der Tiere – soweit ich es beurteilen konnte – vorausschauend und korrekt. Selbst den Ruf meines Nemesis-Vogels, des Rotschnabel-Madenhackers, erkannte ich inzwischen mit Leichtigkeit. Aber wie schnell würde ich aus der Übung kommen, wenn ich wochenlang im Auto unterwegs war? Wie viel würde ich vergessen? Wie schnell rostete das Busch-Wissen wohl ein? Oder war es am Ende doch wie Fahrradfahren?
»Ach, weißt du was?«, sagte ich zu Frank. »Ich mach das jetzt einfach. Einen Versuch ist es wert. Wenn ich durchfalle, habe ich es wenigstens versucht und kann mir später nicht vorwerfen, dass ich mich nicht getraut hätte.«
»Be safe out there«, sagte Frank.
Neun Tage später saß ich mit gesenktem Kopf am Tischende der langen Tafel und spielte mit dem schief abgeschnittenen Ende einer grünen Plastiktischdecke. Die Zikaden zirpten und übertönten fast das allabendliche Geschnatter der Schüler*innen. »Oh Mann, so ein Mist«, dachte ich und schnaubte frustriert wie ein Nashorn kurz vor dem Angriff.
Dem Mädchen, das heute Abend das Buffet vorstellte – eine Aufgabe, die die Schüler*innen abwechselnd übernahmen, um sich im Public Speaking zu üben –, schenkte ich kaum Beachtung; selbst das Wort »Spaghetti« konnte mich heute nicht mehr aufheitern.
Immer wieder warf ich verstohlene Blicke Richtung Lehrer*innentisch, wo Michael saß und – wie ich mir einredete – meinem Blick auswich.
Kacke, Kacke, Kacke. Mist-Kacke.