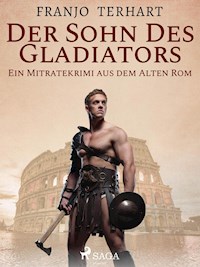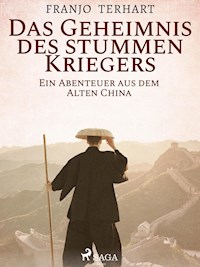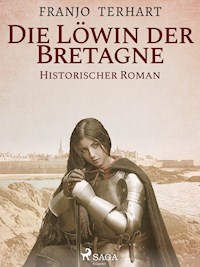
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Rachefeldzug einer beeindruckenden jungen Frau!Mit all seiner Kraft, versucht Frankreich während der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts seinen Einfluss auf die Bretagne auszuweiten. Jedoch gibt die Halbinsel, die bis dahin kulturell und politisch eigenständig war, alles um sich dagegen zu wehren. Die Konsequenz ist ein über zwanzig Jahre dauernder Krieg. In diesem Buch wird die wahre Geschichte der wohlhabenden Adligen Jeanne de Clisson erzählt, die in dem Chaos ihrer Zeit ihren Ehemann und ihren Besitzt verliert. Daraufhin schwört Jeanne furchtbare Rache.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franjo Terhart
Löwin der Bretagne - Historischer Roman
Historischer Roman
Saga
Löwin der Bretagne - Historischer Roman
Copyright © 1999, 2019 Franjo Terhart und SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726159899
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Vorwort
In der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts versuchte Frankreich mit aller Macht, seinen Einflußbereich auch auf die Bretagne im äußersten Westen auszudehnen. Aber die bis dahin kulturell wie politisch eigenständige Halbinsel setzte sich dagegen heftig zur Wehr. Es entbrannte ein Krieg, der über zwanzig Jahre dauerte.
Dies ist die wahre Geschichte der reichen Adeligen Jeanne de Clisson, die in den Wirren dieser Ereignisse nicht nur ihre ganzen Besitztümer und ihre Heimat, sondern auch ihren jungen Ehemann, den Fürsten Olivier de Clisson, verlor.
Jeanne de Clisson schwor daraufhin furchtbare Rache: »Nieder mit Frankreich! Tod den königlichen Blois!«
Jeanne wurde zur Rebellin und Piratin und damit zu einer der schillerndsten Frauengestalten ihrer Epoche.
1
Der Winter des Jahres 1350 hat bereits die bretonische Nordküste erreicht. Die Wassermassen, die auf den ins Meer zurückflutenden Wellenbrechern Schaumkronen entfalten, tragen die Kälte aus den Tiefen des Ozeans auf das wie erfroren daliegende steinige Land zu. Eine Kette einzeln aufragender Felsen reicht bis an die Grenzen des Horizonts; dichte Dunstwolken ziehen stürmisch dahin, Himmel und Meer vereinigen sich. Im düsteren Nebel, der jedermann frösteln läßt, sieht man nichts als riesige Schaumkugeln, die sich erheben, bersten und mit furchtbarem Krachen in die Luft stieben. Man meint, die Erde beben zu fühlen, und ergreift unwillkürlich die Flucht. Doch inmitten dieser Hölle kämpft sich weit draußen ein Schiff – nicht mehr als eine Nußschale – langsam auf die Küste der Bretagne zu. Der eiskalte Wind bläht seine Segel. Mit der morschen Barke, die zudem noch Wasser zieht, haben sich fünf Menschen den tobenden Elementen anvertraut. Ganz vorne im Bug kauert eine Frau mit ihren zwei Kindern. Sie hält die beiden Knaben fest unter ihrem schwarzen Umhang, um sie gegen die entfesselte See einigermaßen zu schützen. Der dunkelblonde, etwa zehn Jahre alte Olivier liegt mit geschlossenen Augen und weißen Lippen in den Armen seiner Mutter. Der andere, Thomas, sein gleichaltriger Freund, wirkt nicht weniger leblos, doch sind ihre grauen Augen starr auf das in der Ferne allmählich sichtbar werdende Ufer, ihre Rettung, gerichtet. Im Heck der Barke versuchen zwei Männer, mit der tobenden See fertigzuwerden und die zerbrechliche ›Nußschale‹ einigermaßen auf Kurs zu halten.
Einer von ihnen steht aufrecht am Steuerruder. Der Mann ist klein und massig und wird deswegen oft unterschätzt. Sein Name ist Roland de Raz. Er hat die Kraft eines Bullen, und die ist in dieser gefährlichen Situation auch bitter nötig, um gegen die schwere See bestehen zu können. Er kennt die Küste und das Meer an dieser Stelle ganz genau. Sie ist nicht ungefährlich, weil Untiefen und Riffe unter der regengrauen Oberfläche lauern. Eine falsche Entscheidung nur – und das Boot würde von diesen messerscharfen Riffen aufgeschlitzt, als ob das Messer des Schlachters durch den Bauch eines Schweines geht. Der Kapitän nickt seinem zweiten Steuermann Pierre le Rouge zu, so als wollte er ihm signalisieren, daß er alles unter Kontrolle habe. Längst hat Roland de Raz bemerkt, daß Pierre seinen Blick kaum von der schwarzhaarigen Frau im Bug des Schiffes abwenden kann. Sie fasziniert ihn wohl gewaltig. Der Kapitän muß lächeln, denn obwohl er weiß, um wen es sich bei dieser mutigen Frau handelt, darf er es Pierre nicht sagen. Die ganze Aktion ist streng geheim. Die Frau befindet sich mit ihren zwei Kindern auf der Flucht. Auf ihren schönen Kopf ist der höchste Preis ausgesetzt, den der französische König jemals für die Ergreifung eines Feindes oder eines Verbrechers gefordert hat. Das ›Schwein‹ Charles de Blois würde sogar seine eigene Mutter verkaufen, wenn es ihm dadurch gelänge, dieses Weib dort endlich zur Strecke zu bringen.
Keine Geringere als diese Frau, die sich jetzt so schützend über die Kinder beugt, ist es nämlich gewesen, die für viele Jahre den gesamten französischen Schiffsverkehr zwischen Loire und Seine lahmlegte. Werweiß schon, wie viele Bewaffnete aufgeboten wurden, diese Bretonin zu jagen? Ohne Erfolg! Niemand kann sagen, wie viele Dörfer sie selbst in Schutt und Asche legte, wie viele Landstriche sie verwüstete und wie viele tapfere Männer durch ihr Schwert enthauptet oder durchbohrt worden sind. Zugegeben, sie mag das Gesicht eines Engels haben und nach zwei Geburten immer noch die Figur einer Tänzerin aus dem Morgenland, aber sie versetzt die Franzosen genauso in Angst und Schrecken wie das Auftauchen englischer Schiffe am Horizont.
Roland de Raz wischt sich mit dem Ärmel das triefnasse Haar aus der Stirn. Schwer stemmt er sich gegen das Ruder, als eine Windböe das Schiff von der Seite erwischt. Aber er ist ein erfahrener Segler. Noch immer umspielt ein spöttisches Lächeln seine Mundwinkel, wenn er mit ansieht, mit welch schmachtendem Blick Pierre an dieser Frau hängt, dabei jede ihrer Bewegungen verfolgt. Leider ist es ihm verboten, die Identität der schönen Unbekannten aufzudecken. Jetzt stellt sich Pierre neben ihn, was nicht einfach ist, weil der Sturm die Barke auf den aufgepeitschten Wellen tanzen läßt wie Kork. Pierres eisige Finger greifen hilfesuchend nach einem Tau, damit er nicht über Bord geschleudert wird.
»Verfluchtes Wetter! Und verdammt kalt, Roland! Ich bin naß bis auf die Haut.«
»Mir geht es nicht anders. Aber in weniger als einer Stunde erwartet uns zwei ein gemütliches Plätzchen am Kaminfeuer im Schloß von Morlaix.«
Pierre le Rouge zeigt auf die einsame Frau.
»Daß sie nicht vor Kälte stöhnt oder sich bei diesem Höllensturm fürchtet. Was ist das nur für eine Frau? frage ich dich.«
Der Angesprochene schweigt.
»Warum bringen wir sie nach Morlaix in aller Heimlichkeit? Kannst du mir das sagen? Als ob sich ein Dieb in der Nacht irgendwo einschleichen würde.«
Roland de Raz stößt mit seinen Füßen ein leeres Faß beiseite, das ihn jetzt behindert. Was soll er dem Freund nur erklären, wenn es nichts zu sagen gibt?
»Hörst du mich nicht, Roland? Bist du etwa taub?«
»Nein, bin ich nicht. Siehst du den Streifen dort? Das ist Land, mein Junge. Wir haben es bald geschafft.«
Auch die Frau hat seinen Ausruf verstanden und blickt nun erst nach vorn zum nahenden Ufer und danach zurück zum Heck. Ihre dunklen Augen leuchten geheimnisvoll, und ihre Wangen glänzen von der Gischt des Meeres.
»Wie sie so dasitzt, das Haar zerzaust, sieht sie aus wie Botizäa, die Königin der Pikten, von der mir meine Mutter, als ich noch ein Kind war, so viele Schauergeschichten erzählt hat«, sagt Pierre.
»Wer ist denn diese Botizäa gewesen? Ich habe ihren Namen noch nie zuvor gehört.«
»Eine unglaubliche Frau ist das gewesen, Roland. Botizäa ist zwar schon lange tot, aber in Schottland unvergessen. Sie hat die römische Flotte angegriffen, als sich ihr Volk in höchster Not befand. Sie hat gekämpft mit dem Mut einer Löwin und gewonnen. Ihre Augen sollen Blut gesprüht haben. Das Beil in der Faust haltend, hatten sie die Römer gefürchtet wie eine Todesgöttin, die aus den Fluten auftaucht, um Schädel zu spalten und Brüste zu durchbohren. So ist diese Königin der Pikten zu Lebzeiten gewesen, heißt es. Und wenn ich diese Frau dort vorne betrachte, dann glaube ich fast, diese Königin ist wiederauferstanden.«
»Vielleicht liegst du gar nicht mal so falsch!«
Pierre le Rouge sah den Kapitän mit großen Augen an.
»Wie meinst du das? Wer ist diese Frau? Warum verrätst du mir ihren Namen nicht?«
»Ich darf es nicht, leider, mein Freund.«
In diesem Augenblick nähert sich die Frau den beiden Männern. Ungläubig bemerkt Pierre le Rouge, daß sie trotz des Seegangs nicht einmal hin und her schwankt, geschweige denn irgendwelche Anzeichen von Furcht erkennen läßt. Als ob sie es gewöhnt sei, bei Sturm auf Deck herumzuspazieren.
»Ich danke euch beiden tapferen Männern. Dank dafür, daß ihr mich und meine Kinder wohlbehütet zurück in meine Heimat gebracht habt.«
Dann wendet sich die schlanke und hochgewachsene Frau direkt Pierre zu. Ein Lächeln umspielt ihre schmalen Lippen. Der Mann errötet unter ihrem Blick.
»Roland de Raz weiß, wer ich bin. Er kennt mich seit vielen Jahren. Ihm ist auch bewußt, daß er sich in große Gefahr begeben hat, nur weil er mir hilft, den Franzosen zu entkommen. Aber es schien mir am sichersten, wenn so wenige wie möglich von meiner Rückkehr wüßten. Ich bin die letzten Jahre fast ausschließlich nur auf See gewesen.«
Pierre le Rouge schluckt und reißt die Augen weit auf. Es gibt im Umkreis von tausend Kilometern nur eine einzige Frau, die dies von sich behaupten kann. War es denn möglich, daß ...
Die Frau nickt ihm bestätigend zu.
»Ja, ich bin Jeanne de Clisson. Du hast dein Leben für mich aufs Spiel gesetzt und verdienst es deshalb zu erfahren, für wen du es getan hast. Nochmals Dank dafür!«
Sie dreht sich um und geht langsam und stolzen Schrittes zu ihren beiden Kindern zurück, die geduldig vorne im Boot auf ihre Mutter gewartet haben. Die zwei Männer sehen ihr nach.
»Was wird sie daheim erwarten, sie, die soviel für unser Land getan hat?«
Es ist Roland de Raz, der dies fragt.
»Der König hat alle ihre Güter konfisziert. Jeder, der ihr hilft, soll des Todes sein. Ihren Mann hat er hinrichten lassen und seinen Kopf zur Abschreckung in Nantes über das Stadttor gehängt. Jeanne de Clisson besitzt nichts mehr außer ihrem Leben und ihren Kindern.«
»Du kennst diese Frau?«
Pierre le Rouge nickt.
»Wer in der Bretagne kennt ihren ruhmreichen Namen nicht? Jedes Kind kann davon erzählen, was sie für uns alle geleistet hat.«
»Ihr Kampf ist noch lange nicht vorbei. Und sie ist noch so jung!«
»Aber sie wirkt bereits, als hätte sie die Erfahrung eines langen, gefährlichen Lebens hinter sich.«
»Die königlichen Blois werden nicht eher Ruhe geben, bis sie Jeanne erfolgreich gejagt, verurteilt und enthauptet haben.«
»Meine Hilfe hat sie uneingeschränkt«, verspricht Pierre. »Wann immer sie mich ruft, ich werde da sein!«
Nur so hat sie überhaupt all die Jahre überleben können, denkt der Kapitän. Indem sie Männer wie Pierre für sich einnahm und so sehr begeisterte, daß sie von da an alles für sie taten. Er selbst nimmt sich davon nicht aus. Hätte er sonst diese gefährliche Überfahrt auf sich genommen? Aber das Leben von Jeanne de Clisson – oder Madame, wie die Franzosen sie respektvoll nennen – ist nicht immer so gefahrenreich verlaufen. Sie wurde als Adelige geboren und stammte aus reichem Hause. Jeanne hatte es sich keineswegs ausgesucht, als gefürchtete Piratin und Rebellin zu enden. Es war ihr vielmehr von einem ungnädigen und harten Schicksal aufgedrängt worden.
2
»Jeanne! Kleines! Du benimmst dich mal wieder unmöglich! Mädchen klettern nicht wie Jungen auf Bäume. Mädchen sind sittsam und versuchen nicht aufzufallen. Steig also sofort herunter und bemüh dich endlich, wie eine kleine Dame zu sein! Im übrigen wird deine Mutter furchtbar schimpfen, wenn sie erfährt, in welche Gefahr du dich begeben hast.«
Amélie, die ältliche Zofe der jungen Grafentochter, seufzte laut, und wischte sich den Schweiß von der Stirn, weil sie auch einen möglichen Tadel durch ihre Herrin fürchtete: Genéviève de Belville. Die Gräfin hatte ihr besonderes Augenmerk auf ihre Tochter gelegt, nachdem sich bewahrheitet hatte, daß es ihr einziges Kind bleiben sollte. Nicht auszudenken, wenn dem Mädchen bei seinen waghalsigen Klettereien etwas zustieße. Aber seit den Tagen, als sie laufen gelernt hatte, gebärdete sich Jeanne wie ein Wildfang: immer ungestüm und ständig auf und davon laufen, wenn man sie bloß einen Moment lang aus den Augen ließ. Man hätte die Kleine schon wie einen Bluthund an die Leine legen müssen, um sie unter Kontrolle zu halten. Da hatte es die Zofe mit ihren zwei Halbbrüdern Maurice und Thomas erheblich leichter, stellten diese sie doch vor weitaus weniger Schwierigkeiten, sie zu beaufsichtigen. Was bei zwei halbwüchsigen Jungen schon wiederum ungewöhnlich war. Die Mutter von Thomas und Maurice war vor Jahren überraschend am Blutfluß im Kindsbett gestorben. Plötzlich knackte es bedrohlich über dem Kopf der Zofe.
Entsetzt sah die Frau, wie sorglos Jeanne auf den Ästen herumhangelte. Dabei grinste die Kleine sie auch noch frech an:
»Mach den Mund zu! Ich fall schon nicht runter, Amélie! Ich kann klettern wie eine Katze, das sieht doch jeder!«
Und ob sie das sah! Aber es entsprach keinesfalls dem guten Ton. Daß Mädchen sich nicht so benehmen wie Jungen, war etwas, was man der Kleinen einfach nicht klarmachen konnte. Es schien beinahe so aussichtslos, als wollte man eine Katze vom Nesträubern abbringen. Amélie seufzte erneut. Aus Jeanne sollte einmal eine große Dame werden. Vielleicht sogar jemand, den der zukünftige Herzog der Bretagne zur Frau nehmen würde. Denn Jeanne war hübsch und verfügte bereits als Siebenjährige über einen ziemlich einnehmenden Charme. Außerdem stammte sie aus den besten Kreisen der Bretagne.
»Ist ja schon gut, Amélie. Du ziehst ein Gesicht wie ein Wolf, der in ein Eisen getappt ist. Bevor du auch noch wie er zu heulen anfängst, klettere ich lieber wieder zu dir herunter.«
Amélie verzog genervt die Mundwinkel nach unten. Jeanne hatte sich ihrer also erbarmt. Bei der seligen Jungfrau Maria, das konnte ja noch heiter werden, wenn das Mädchen älter wurde! Vermutlich hing dann alles nur noch von ihrem Wohlwollen ab. Und wer, bitte, sollte sie dann vernünftig erziehen? Sie jedenfalls würde es sich nicht zutrauen. Jeanne blieb unberechenbar.
Das Mädchen rutschte den unteren Teil des Baumstammes behende herab, wobei sie sich geschickt mit beiden Händen festhielt. Daß sie keine Angst hat, sich dabei weh zu tun, wunderte sich die Zofe.
»So! Da bin ich! Freust du dich?«
Jeanne blickte zu der Frau vor ihr auf, und dies mit einer Unschuldsmiene, als ob sie kein Wässerchen trüben könnte.
Ich kapituliere, dachte Amélie, die bereits einige Kinder hatte aufwachsen sehen. Keines von ihnen war so selbstbewußt wie Jeanne gewesen.
»So? Und was machen wir jetzt? Willst du mich etwa mit Tischsitten langweilen oder mit Verhaltensregeln, wie sie nur Erwachsene für gut finden können?«
Die Zofe schwieg und rieb sich durch die müden Augen. Dann sagte sie: »Wir beide gehen jetzt langsamen Schrittes zurück ins Schloß. Es ist bald Tischzeit, und außerdem glaube ich gehört zu haben, daß Herzog Jean heute zu Besuch kommt.«
Diesmal war es an Jeanne, sprachlos mit offenem Mund dazustehen. Aber nur kurz.
»Onkel Jean kommt zu uns? Heute? Au fein!«
Sie spurtete davon.
»Aber ich habe doch gebeten, langsamen Schrittes ...«
Amélie erhielt keine Antwort. Sie sah das Mädchen über die Wiese zu den breiten Stufen eilen, die zurück ins elterliche Schloß führten. Wenn Onkel Jean kam, der mächtige Herzog der Bretagne, dann gab es für Jeanne kein Halten mehr. Er wäre außer ihrem Vater im übrigen der einzige gewesen, der sie von irgend etwas hätte abhalten können. Onkel Jean, der nach Meinung des Mädchens Belville viel zu selten einen Besuch abstattete, liebte die Kleine nun einmal abgöttisch.
Genéviève de Belville stand im Kabinett ihres Schlosses und schaute aus dem Fenster weit über die Zinnen der Burgmauer hinweg in die Ferne. Sie war allein. Die Gräfin trug ein smaragdgrünes Unterkleid, das in leichten Wellen über ihren schlanken Leib bis hinunter über die gestickten Sandalen wallte. Darüber schmiegte sich eine bis zu ihren Knien reichende samtschwarze Tunika, die von einem kostbaren Gürtel mit einem Beryll in der Taille umschlossen wurde. Ihr kastanienbraunes Haar hielt ein goldfadengesticktes Netz umfangen, doch nichtsdestotrotz hatten sich ein paar Locken auf ihre hohe Stirn verirrt.
Das Kabinett war der Ort, an den sich die Schloßherrin am liebsten zurückzog, wenn sie allein mit sich und der Welt sein wollte. Die Wände des eher karg eingerichteten Raumes waren mit buntfarbigen Teppichen behängt. In der Mitte standen ein schmales Tischchen und ein hoher Stuhl, den ihr Gemahl vor einigen Jahren von einem Kreuzritter, der ins Morgenland gereist war, als Geschenk erhalten hatte.
Genéviève de Belville war in Gedanken versunken. Sie nahm ihre Umgebung kaum wahr, vielmehr malte sie sich lebhaft die mögliche Zukunft ihrer Tochter Jeanne aus. Sie hatten nun mal nur ein Kind, und mit diesem Pfand mußte so hart wie möglich gewuchert werden, um das Bestmögliche für die Familie herauszuschlagen.
Im übrigen waren dies Zeiten, in denen alle Bretonen und ganz besonders ihr Adel zusammenstehen mußten wie ein Heer. Gerade in früheren Jahrhunderten war es häufig vorgekommen, daß sich die einzelnen Fürstenhäuser bis aufs Blut bekriegt hatten, um ihren jeweiligen Einfluß zu vergrößern. Aber heutzutage durfte niemand mehr, der noch alle Sinne beisammen hatte, den Feind unter den eigenen Leuten erblicken. Der alleinige Feind der Bretagne hieß seit langem schon Frankreich, und seine Drohgebärden an den Grenzen des Landes wurden von Jahr zu Jahr gefährlicher. Deshalb war es jetzt um so wichtiger zusammenzustehen. Nur vereint konnten sie den Armeen Frankreichs trotzen oder sie sogar schlagen.
Ein feiner Luftzug blies der Gräfin ins Gesicht. Sie begann zu husten und erwachte aus ihrem Tagtraum. Genéviève de Belville trat vom Fenster weg und setzte sich auf den Stuhl, der mal irgendeinem Scheich in einem fernen Land gehört haben mochte. Jeanne mußte unter allen Umständen mit den Clissons verheiratet werden. Nicht heute, aber sobald sie eine Frau geworden war. Aber der Weg zu dieser Ehe mußte schon heute geebnet werden. Die Clissons besaßen nicht nur große Macht in Nantes, sondern auch Einfluß auf die bedeutendsten herrschaftlichen Häuser der Bretagne. Um so wichtiger erschien es deshalb, wenn das Haus der Belvilles mit dem der Clissons verwandtschaftliche Banden einging. Für beide alteingesessenen Familien würde es von einem nicht zu unterschätzenden Vorteil sein, zukünftig miteinander und niemals mehr gegeneinander Politik zu betreiben. Leider war sie sich mit ihrem Gemahl Maurice uneins in dieser Frage. Maurice mochte die Clissons nicht, weil einige von ihnen ihn bei einer Parforcejagd einmal übervorteilt hatten. Eitles Männergehabe, dachte die Gräfin, und in diesen Zeiten völlig fehl am Platze. Um Maurice doch noch umzustimmen, hatte sie Jean III. zu sich eingeladen. Von seinem hohen Besuch erhoffte sich Genéviève de Belville die nötige Rückendeckung für ihre ehrgeizigen Pläne. Maurice, so meinte sie voraussagen zu können, würde sich einem Ansinnen des Herzogs sicherlich nicht widersetzen wollen.
Vom Vorplatz des Schlosses, also noch jenseits der Brücke, die an nur einer Stelle über den breiten Wassergraben führte, der die ganze Anlage umschloß, klang plötzlich der dumpfe Ruf eines Horns an ihr Ohr. Jemand meldete, daß Besuch nahte. Das konnte nur Jean sein. Die Gräfin erhob sich von ihrem Platz und ging ohne Hast auf eine Ecke des Raumes zu, wo an der Wand ein kleiner vergoldeter Spiegel angebracht war. Geschickt ordnete die Frau mit ihren Fingern ihr dichtes blondes Haar und strich sich noch rasch die samtschwarze Tunika an Schultern und Brust sauber. Genéviève de Belville freute sich sehr auf das Eintreffen von Herzog Jean III., dem das Volk nicht zu Unrecht den Beinamen ›Le Bon – der Gute‹ gegeben hatte. Schon allein deshalb wünschte sie, daß der mächtige Gönner der Familie mit seinem Gefolge auf Belville eintraf, weil dadurch wenigstens für ein paar Tage wieder etwas Leben und Abwechslung ins Schloß kam. Denn für gesellige Anlässe oder Feiern war ihr teurer Gatte nur schlecht zu gewinnen. Derlei kam auf Schloß Belville viel zu selten vor.
Und mit einem feinen Lächeln auf ihren Lippen gedachte sie ihres vom Temperament her oft aufbrausenden Gemahls, der von heute an zumindest in einem Punkt würde umlernen müssen, wenn ihm auch noch zukünftig daran gelegen war, daß die Belvilles ihre wichtige Rolle in der Politik des Landes auch weiterhin besaßen.
Als die Gräfin gemessenen Schrittes die Treppe hinunter in die Vorhalle gegangen und von dort kaum weniger gemächlich auf dem obersten Absatz der breiten Stufen am Haupteingang angelangt war, stieg der Herzog, der wie immer die Spitze seines Reitertrosses anführte, gerade von seinem prächtigen Hengst. Hervé hieß das herrliche Tier, das so schwarz wie die Nacht war – und der ganze Stolz seines Herrn.
»Bei den alten fetten Druiden vom Feenstein!« meldete sich überraschend eine zarte Kinderstimme. »Was hast du da für ein schönes Pferd, Onkel Jean?«
Es war natürlich Jeanne, die sich geschwind wie ein Wiesel einen Weg zwischen den verdutzten Soldaten hindurch bahnte, um so schnell wie möglich an den Rappen mitten auf dem Schloßhof heranzukommen. Graf Maurice de Belville verdrehte entsetzt die Augen wegen ihres ungebührlichen Benehmens und wollte schon die Stimme zu einem mächtigen Donnerwetter erheben. Aber die Gräfin zupfte ihn noch rechtzeitig am Ärmel und hielt ihn so zurück.
»Laß sie! Jean mag sie so am liebsten, glaub mir!« raunte Genéviève ihrem Gemahl zu.
Sie wußte, daß der Herzog das unkonventionelle Verhalten ihrer Tochter Jeanne keineswegs mißbilligte. Er mochte das Mädchen wohl vor allem deshalb so sehr, weil sie ihn ein wenig an die eigene stürmische Kindheit erinnerte und er leider Gottes selbst keinerlei Nachkommen besaß. Zwar wurde in Adelskreisen immer wieder gemunkelt, daß es illegitime Söhne des Herzogs im Lande verstreut gäbe. Zu sehen bekommen hatte allerdings noch niemand ein solches Kind und würde es wohl auch nicht.
»Sie wird von Mal zu Mal aufgeweckter – Eure Jeanne – und scheint mir, beim heiligen Gwénolé, weder Tod noch Teufel zu fürchten.«
Jeanne hatte in diesem Moment das stolze Pferd des Herzogs erreicht und kraulte es am Kopf.
»Reißt nur weit genug Eure Augen auf, Ihr Belvilles da oben, und staunt über Euer Fleisch und Blut!« rief der Herzog erstaunt aus. »Hervé läßt sich sonst von keinem außer mir und meinem treuen Stallknecht Guillaume anfassen. Mit seinen Hufen hat er schon einmal einen Soldaten des Königs entmannt, als dieser ihm zu nahe kam. Aber Eure Jeanne darf den Hengst berühren und, beim Hummer von Quimper, es scheint ihm auch noch zu gefallen. Unglaublich!«
Jean meinte den französischen König, den jeder aufrechte Bretone haßte wie Läuse im eigenen Pelz.
Danach hob Jean lachend das Mädchen vom Boden hoch und setzte es auf seine breiten Schultern. So stieg er mit dem Kind, dessen Locken im Wind wehten, die Stufen zum Schloß seiner Eltern empor. Oben angekommen, setzte er Jeanne behutsam wieder ab, gab ihr dabei einen feuchten Kuß auf beide Wangen, begrüßte den Grafen und die Gräfin eher flüchtig und fragte sogleich nach Erfrischungen und Krügen guten Weins. Im übrigen wolle er sich ein wenig ausruhen, weil die Anreise beschwerlicher als erwartet gewesen sei.
»Ihr solltet wirklich Eure Wege mehr in Ordnung halten, Maurice. Zweimal sind meine Wagen im Schlamm steckengeblieben. Das war wenig erfreulich! Es hielt mich viel zu lange auf! Der letzte Regen hat den Boden aufgeweicht wie Butter. Wir haben Stunden über Stunden verloren, sie wieder herauszuziehen.«
Der Getadelte wich seinem Blick aus und brummte etwas wie: »Wer mich besuchen will, wird mich schon zu finden wissen«, oder so ähnlich –, aber der Herzog war schon weitergeeilt, um diese Bemerkung noch zu hören. Jeder im Schloß und im Umkreis wußte, daß Graf Maurice de Belville einfach viel zu geizig war, um seine Zufahrtswege in Ordnung zu halten. Lieber steckte er sein ganzes Geld in die Jagd, als daß es ihm eingefallen wäre, sein Land, alle Wege und Straßen darin in Ordnung zu halten. Seine Frau ließ keine Gelegenheit aus, ihren knausrigen Gemahl immer wieder daran zu erinnern, weil sie sich für seinen Geiz so sehr schämte. Sogar am Schloß selbst verwandte der Graf sein Geld nur für das Nötigste.
»Ein echter Bretone verschwendet sein Geld nicht für Luxus, wie es die Franzosen tun. Er gibt es sinnvoll aus, entweder für Kriege oder für die Jagd«, lautete seine Devise. Damit war das Thema für ihn beendet.
Am frühen Abend war die Tafel im großen Saal des Schlosses festlich gedeckt. Im Kamin brannte ein großes Feuer. Fackeln an den Wänden erhellten den Saal. Die Stimmung der Gäste war gut. Genéviève de Belville hatte noch Freunde und Verwandte eingeladen. Sie sollten ja schließlich nicht im ungewissen darüber bleiben, wie gut es der Herzog mit den Belvilles meinte.
Speisen und Getränke wurden reichlich aufgetischt. Es gab Fasan und anderes Wildbret, dazu frische Waldpilze, Bohnen und Rüben, süße Kuchen, kleine Crêpes mit Früchten, Wasser und vor allem viel, viel Wein. Wein war teuer und mußte aus Südfrankreich in Fässern bezogen werden, aber Wein war neben der Jagd das einzige, was sich der Graf reichlich gönnte. Eine Delikatesse, die er sich im Gegensatz zu anderen Adeligen im Lande versagte, war Zucker, der noch um vieles teurer und kostbarer war als Wein. Zweimal erst in ihrer Ehe hatte er Genéviève mit dieser sogenannten ›maurischen‹ Delikatesse überrascht: bei der eigenen Hochzeit und am Tage nach der Geburt ihrer Tochter Jeanne. Um so mehr freute sich die Gräfin, als ihr der Herzog bei Tisch überraschend ein solch süßes Stückchen als Gastgeschenk überreichte. Ein Raunen ging durch die Anwesenden, weil Jean III. dadurch nicht nur die Frau des Hauses im besonderen ehrte, sondern auch allen im Lande den Stellenwert verriet, den die Belvilles bei ihm innehatten. Genéviève schoß auch augenblicklich die Röte ins ansonsten makellos reine Gesicht, wobei es auch nicht wenige Spötter unter den anwesenden Adeligen gab, die behaupteten, daß die Gräfin dies ohnehin auf Kommando könne. Der Herzog jedenfalls zeigte sich von ihrem Charme tief beeindruckt und brachte einen Toast auf die »bezaubernde und ewig junge« Genéviève de Belville an.
Bei Tisch ging es recht laut und lebhaft zu. Man aß mit den Händen, zerbrach die Knochen des Geflügels, schmatzte lustvoll, wischte sich die fettigen Finger am eigenen Gewand ab und schob sich kurz darauf das Gemüse oder die Crêpes mit Früchten in den triefenden Mund. Der Wein floß in Strömen; es wurden immer wieder gefüllte Krüge mit dem kostbaren Rebensaft auf den langen Tisch gestellt. Dann, nachdem der erste Hunger gestillt war, kam der Barde und sang, begleitet von einer Laute, vom faulen, aber gierigen König der Franzosen, dessen Bauch bald aus allen Nähten zu platzen drohte. Den Anwesenden gefiel es, und sie lobten den Barden, der sich mit Zugaben bei ihnen bedankte. Die Gespräche bei Tische drehten sich unter anderem auch um jüngste Geschäftsbeziehungen mit Italien, wo in Florenz die mächtige Calimala, die traditionsreiche Zunft von Tuchhändlern, ihre Fühler bereits bis ins Innere der Bretagne ausgestreckt hatte. Hier und da wurde auch heftig über Politik geredet. Vor allem über französische. Graf Bernard de Guincamp brachte das Gespräch unter anderem auf die Templer, deren Orden von den Franzosen in den letzten Jahren verfolgt und systematisch vernichtet worden war.
Philipp der Schöne, einstmals König von Frankreich, hatte vor einigen Jahren die Inhaftierung der Templer befohlen, weil er sich an ihren sagenhaften Schätzen bereichern wollte. Die großangelegte Verhaftungswelle hatte die klugen Ordensbrüder völlig überrascht, so daß sie sich gegen die königliche Willkür kaum zur Wehr gesetzt hatten. Allein am ersten Tag waren 15 000 von den Männern mit den weißen Mänteln und dem roten Tatzenkreuz darauf in Ketten gelegt worden. Philipp und vor allem der Papst hatten den Templern Blasphemie und Paktieren mit dem Teufel zur Last gelegt. Von angeblich schlimmen Greueln war gar die Rede gewesen. Der Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, ein Mann, den jeder aufrechte Bretone geschätzt hatte, war im Jahre 1314 auf der Pariser Seine-Insel bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion verbrannt worden. Auf diese feige Tat bezog sich Graf Bernard de Guincamp, als er ganz erregt ausrief:
»Den armen Molay haben sie ohne jeglichen Prozeß ermordet. Wie ein Stück Vieh wurde er in Paris verbrannt. Diese Franzosen sind schlimmer als seinerzeit die Mauren, sage ich euch. Wir hier sollten uns alle vorsehen und es mit ihnen niemals in Güte versuchen. Kein Franzose dankt es einem, der es mit ihm in Güte versucht.«
»Jacques de Molay war ein aufrechter und tapferer Mann gewesen. Das weiß ein jeder. Ich habe ihn persönlich gut gekannt, diesen klugen Großmeister des Templerordens«, antwortete überraschend der Herzog. Wenn Jean III. seine Stimme bei Tisch erhob, wurde es augenblicklich mucksmäuschenstill im Saal. »Aber eines Tages, mein lieber Graf de Guincamp, wird der Orden dieser armen Ritter des Herrn wieder auferstehen und die Franzosen für alles erlittene Unrecht büßen lassen!«
Die meisten unter den Anwesenden nickten zustimmend, obwohl niemand im Saal zu sagen gewußt hätte, woher der zerschlagene Templerorden seine Macht wieder hätte hernehmen sollen. Philipp der Schöne hatte seinerzeit ganze Arbeit geleistet.
»Und wird dann Baphomet die Franzosen in Angst und Schrecken versetzen?«
Einen Moment lang war nicht eindeutig zu klären, woher das zarte Stimmchen plötzlich kam.
»O nein! Dieses elende Biest schon wieder«, stöhnte Graf de Belville und zog seine strampelnde und sich wehrende Tochter unter dem großen Tisch hervor. Der Herzog strahlte das Mädchen an. Seine Augen leuchteten.
»Hast dich wohl die ganze Zeit über dort unten versteckt gehalten, um zu lauschen, was wir Großen so reden, nicht wahr?
Jeanne nickte brav.
»Komm einmal her zu mir, Kleines! Hab keine Angst! Ich verrate dir nämlich etwas.«
Jeanne trat dicht an den Herzog heran, und dieser flüsterte ihr ins Ohr, daß er dies als kleiner Junge am Tisch seines Vaters auch einmal gemacht hatte.
»Aber erzähl es keinem anderen, versprochen? Es soll unser Geheimnis bleiben.«
Das Mädchen nickte aufgeregt. »Ja!«
»Sie benimmt sich so schlecht wie ein Köhlerskind«, meinte Graf Maurice erbost. »Ein rotzfrecher Wildfang! Als ob es kein Mädchen wäre, sondern sonst was! Nicht einmal ihre Brüder würden es wagen, sich so zu benehmen. Wo bloß ihre Zofe nur wieder steckt? Amélie sollte das Kind doch längst ins Bett gebracht haben.«
Aber der hohe Gast winkte ab. Jeanne störte ihn nicht.
»Was nutzt das schon, wenn einen die Neugier quält, nicht wahr?«
Dieser Herzog, der mächtigste Mann der Bretagne, war ganz nach Jeannes Geschmack. Wenn doch ihr Vater auch nur so unkompliziert wäre, dachte sie. Denn dieser packte sie jetzt am Arm und zerrte sie von der Tafel weg.
»Rauf mit dir, Jeanne! Ins Zimmer! Und laß dich hier unten heute abend nicht mehr blicken!«
»Aber was ist denn nun mit Baphomet, Onkel Jean?« rief das Mädchen verzweifelt aus.
Zum ersten Mal wurden die Gesichtszüge des Herzogs ernst, als er sich Jeanne wieder zuwandte.
»Ich wundere mich, woher du von Baphomet weißt. Es ist nämlich ein großes Templergeheimnis, hörst du?«
Das Kind biß sich auf die Unterlippe. Was sollte sie ihrem Onkel sagen, den sie ja um keinen Preis verärgern wollte?
Gérard de Nantes, ein Vetter des amtierenden Bischofs und enger Freund der Familie der Belvilles, kam dem Mädchen unerwartet zu Hilfe und gestand, daß er selbst Jeanne irgendwann einmal davon erzählt hatte. Und verteidigte sich mit den Worten:
»Ach, Herzog Jean, jeder im Lande weiß doch seit den Tagen der Templerprozesse, daß die armen Ritter des Herrn merkwürdigerweise und völlig unchristlich einen bärtigen Männerkopf angebetet haben. Das ist doch längst kein Geheimnis mehr.«
Er heischte unter den Gästen der Tafel um Zustimmung, und tatsächlich nickten auch einige der Adeligen.
»So! Ist es nicht?« nahm der Herzog seine Frage auf. »Dann laß dir von mir gesagt sein, Gérard de Nantes, daß der Baphomet nur für die Kirche und den französischen König ein – wie beschriebst du ihn noch? – bärtiger unheimlicher Männerkopf ist. In Wahrheit ist er etwas vollkommen anderes. Keiner, der alle Sinne beisammen hat, würde einen solchen Kopf anbeten, und die Templer waren äußerst kluge Leute, mein Lieber. Laß dir das von mir gesagt sein!«
Es schien klüger, sich nicht weiter über dieses Thema mit dem Herzog anzulegen, entschied der Neffe des Bischofs. Der knurrige Unterton in der Stimme des mächtigen Mannes hatte ihn gewarnt.
»Leg dich jetzt schlafen, Jeanne«, wandte sich der Herzog wieder dem Mädchen zu, das noch immer auf eine Antwort wartete.
»Und versprich mir, daß du den Namen Baphomet niemals mehr in den Mund nimmst.«
Jeanne nickte brav. Wenn Onkel Jean dies von ihr verlangte, dann würde sie ihm nicht widersprechen. Aber vergessen würde sie diesen komischen Baphomet nicht, entschied sie, wenn der Herzog schon so ein großes Geheimnis darum machte. Sobald sie älter war, würde sie der Sache einmal nachgehen, nahm sich die Kleine der Belvilles vor und verschwand artig hinter der eichenen Doppeltür. Drinnen im Saal kehrte die Gesellschaft wieder zu ihrer alten Fröhlichkeit zurück.
Spät in der Nacht zogen sich der Herzog, Maurice und Genéviève de Belville und Gérard de Nantes in ein Turmzimmer im Westflügel zurück, um dort wichtige Dinge, die nur sie vier allein etwas angingen, zu bereden. Es ging um die Zukunft Jeannes, genauer gesagt, um ihren zukünftigen Gemahl. Jean III. hatte diesbezüglich die Andeutungen ihrer Mutter Genéviève in der Vergangenheit sehr gut verstanden. Jeanne würde einstmals in eine andere bretonische Familie einheiraten müssen, die ebenso wie die Belvilles über Macht und Ansehen im Lande verfügte. Alles darunter wäre verschenktes Kapital. Für den Herzog kam für diese wichtige Liaison nur eine einzige Familie in Frage: die Clissons aus Nantes; jene Clissons, mit denen sich Maurice de Belville schon einmal wegen eines völlig nichtigen Vorfalls angelegt hatte. Aber auch die Clissons konnten deswegen, zu Recht beleidigt sein, und deshalb war es nützlich, daß der Herzog selbst zwischen den beiden Adelsfamilien vermittelte. Es war niemals Jean le Bons Art gewesen, lange um den heißen Brei herumzureden, sondern er kam, nachdem die Tür hinter ihnen fest verschlossen war, sogleich auf den Punkt ihres Zusammentreffens.
»Gut! Gérard ist auch dabei. Auf ihn komme ich später noch zurück. Zunächst aber zu euch beiden.«
Er nahm das Ehepaar fest in seinen Blick.
»Maurice, Genéviève, Ihr wißt beide, daß ich Eure Tochter Jeanne über alles schätze. Fast könnte ich ein wenig neidisch sein, daß ich nicht selbst so eine aufgeweckte und hübsche Tochter habe wie Ihr.«
Maurice wollte ihn unterbrechen, vermutlich um seine gegenteilige Meinung zum Ausdruck zu bringen, aber der Herzog winkte barsch ab.
»Später, Maurice!«
Unbeirrt fuhr er fort:
»Ich mag Jeanne sehr. Das müßt Ihr wissen. Und deshalb ist mir auch an ihrer Zukunft so sehr gelegen. In diesen Zeiten, wo der Feind an unserer Grenze aufmarschiert, jederzeit darauf wartend, eine Blöße von uns für sich auszunutzen, müssen wir Bretonen zusammenstehen wie ein Mann. Familienfehden untereinander darf es in diesen Tagen nicht mehr geben. Es kann nicht angehen, daß sich Häuser bekriegen wegen irgendwelcher Hasen, von denen der eine behauptet, daß sie ihm gehören, weil sie auf seinem Gebiet rammeln. Solch eine Borniertheit können wir uns nicht mehr leisten. Wenn wir nicht alle zusammenhalten, werden uns die Franzosen vernichten. Das muß uns klar sein! Deshalb bin ich der festen Überzeugung, daß Bande geknüpft werden müssen. Feste Bande, Ehebande, Blutsbande, denn nichts ist stärker als das Blut. Eure Tochter Jeanne muß in ein hohes Haus einheiraten. Nicht irgendein Haus! Für mich persönlich ist es keine Frage, daß es in der Bretagne nur ein einziges solches hohes Haus gibt, nämlich das der Clissons. Jeanne wird, dies ist mein Wunsch, sobald sie sechzehn Jahre alt geworden ist, Olivier de Clisson heiraten. Die Verlobung könnte schon bald sein. In drei, vier Jahren. Ich habe dies alles so beschlossen, weil es sinnvoll und gut ist und wichtig für unser Land. Und du, Maurice, darfst jetzt aussprechen, was du mir vorhin sagen wolltest.«
Der Graf wirkte zerknirscht. Jean hatte ihn mit seiner Rede völlig überrumpelt. Insgeheim ahnte er sehr wohl, wem er diese unangenehme Situation zu verdanken hatte, nämlich seiner Frau. Was sollte er dem Herzog antworten? Natürlich hatte Jean recht, wenn er sagte, daß es für Jeanne nur das Beste geben sollte. Aber mußten es denn ausgerechnet die Clissons sein? Er haßte dieses Familie aus Nantes, diese Angeber, diese Protze, die jedes Jahr ihr Schloß renovierten und sich sogar Möbel aus Italien liefern ließen. Guillaume de Clisson, Oliviers Vater, war sich noch nicht einmal zu schade, ausländische Künstler zu sich zu holen. Was das an Geld kostete, konnte sich ja jeder ausrechnen. Eine solche Verschwendung war Maurice de Belville schier unbegreiflich. Und in so eine Familie sollte seine Tochter Jeanne einheiraten? Das Mädchen würde sich sicherlich alles andere als wohl fühlen, wenn sie in ein so luxuriöses Haus kam, vermutete der Graf. Andererseits waren die Clissons eine mächtige Familie, und eine Verbindung zwischen beiden Häuser ein Ereignis, das mit einem Schlag politische Fakten schaffte. Wenn da nur nicht diese Geschichte mit der Parforcejagd gewesen wäre, bei der ihn die Clissons über den Tisch gezogen hatten ...
Und als ob der Herzog seine Gedanken gelesen hätte, unterbrach dieser seinen Gedankengang:
»Falls Ihr aber das Glück Eurer Tochter und unseres ganzen Landes wegen dieser kindischen Sache von einst aufs Spiel setzen wollt, so laßt Euch folgendermaßen besänftigen: Die Clissons werden sich bei Euch entschuldigen und Euch eine neue Jagd anbieten. Diesmal absolut zu Euren Bedingungen!«
Das war gelogen! Der Herzog hatte überhaupt noch nicht mit Guillaume de Clisson über diese Angelegenheit gesprochen, und ganz bestimmt würden sich die Clissons auch nicht dafür bei Maurice entschuldigen. Aber es war wichtig, dem Grafen jeglichen Wind aus den Segeln zu nehmen, und eine kleine Notlüge konnte ja nicht so schlimm sein, entschied der Herzog. Er würde dies schon beizeiten zu regeln wissen. Er legte eine Hand auf die rechte Schulter des Grafen und blickte diesen aufmunternd an.
»Nun, mein lieber Maurice, welche Antwort gebt Ihr mir heute?«
Was für ein ausgebuffter Fuchs er doch war, überlegte Genéviève. Maurice konnte ja gar nicht anders, als sich ihm zu fügen. Geschickt auch Jeans Taktik mit dieser elenden Jagdangelegenheit. Jean III., Herzog der Bretagne, wurde nicht zu Unrecht von all jenen zugleich gefürchtet und bewundert, die mit ihm näher zu tun hatten. Dieser mächtige Mann überlegte sich bei jedem im voraus ganz genau, wie er ihn zu nehmen hatte und wo seine schwachen Seiten waren. Für Maurice mußte es eindeutig sein, daß eine Einheirat in die Familie der Clissons das Beste war, was seiner Tochter Jeanne passieren konnte. Jetzt waren alle Augen auf ihren Gemahl gerichtet. Dieser räusperte sich mehrmals, bevor er zu reden anfing.
»Bon, mein lieber Herzog! Wie immer Ihr es fordert, soll es geschehen! Wenn Ihr Euch für Jeanne als Brautwerber bei den Clissons von Nantes einsetzt, dann darf ich als Vater, der die Verantwortung für seine Familie trägt, nichts dagegen einzuwenden haben. Die Clissons sind die beste Wahl. Daran ist vom Verstand her nicht zu zweifeln. Ich sehe, daß Ihr damit nur Gutes im Sinn habt, auch wenn meine Gefühle im Augenblick noch nicht so ganz mitspielen wollen. Was aber verlangt Ihr nun genau von mir?«
»Sehr schön, Maurice. Bon! Ihr seid ein äußerst kluger Mann, doch das habe ich niemals anders beurteilt. Ihr erkennt, worum es geht! Très bien! Wir werden uns jetzt folgendermaßen verhalten: Als erstes wird Gérard seinen Onkel, den Bischof von Nantes, über diese Heirat verständigen. Er soll den beiden seinen Segen geben und damit die Verbindung öffentlich gutheißen. Des weiteren werde ich schon in der übernächsten Woche nach Nantes reisen und mit Guillaume de Clisson eine Unterredung über diese Angelegenheit haben. Dabei ist es sehr wichtig, daß ich ihm Euer Einverständnis überbringe und ihn zugleich locke.«
»Locke? Womit wollt Ihr ihn denn locken? Ist meine Tochter denn nicht Verlockung genug?«
Der Graf argwöhnte nichts Gutes. Was plante dieser Fuchs?
»Wo denkt Ihr hin, Maurice? Aber sicher wird man ihn locken müssen. Er kennt Eure reizende Jeanne nicht, weiß aber um die Vorzüge deiner Gemahlin. Also wird er sich denken, daß die Tochter nicht schlechter sein wird als die Mutter. Wer jedoch haben will, muß zuvor einen Köder auslegen. Guillaume hat nichts von Jeanne. Das wird einzig und allein sein Sohn Olivier haben. Deshalb muß auch der Vater zufriedengestellt werden. Ihr werdet ihm etwas Angemessenes anbieten müssen.«
Der Graf schluckte und wurde bleich.
»Was soll ich ihm anbieten. Etwa Geld?«
»Pah!« Der Herzog winkte lässig ab.
»Geld bedeutet den Clissons nicht so viel wie anderen. Davon haben sie nämlich reichlich. Aber Ihr besitzt etwas, was den alten Guillaume mehr als alles andere auf der Welt reizt.«
»Und was wäre das?«
»Nun, überlegt einmal?«
Der Herzog betrachtete Maurice herausfordernd. Der zog die Augenbrauen fest zusammen.
»Aber doch nicht etwa ...?«
»Ganz genau!«
»Doch nicht etwa Brocéliande? Das könnt Ihr nicht von mir verlangen, Herzog!«
Jean le Bon machte eine schon fast hilflose Geste.
»Was bleibt uns anders übrig? Es kann nur Brocéliande sein. Der beste Wald mit dem größten Wildreichtum im ganzen Westen der Bretagne. Selbst ich beneide Euch darum, Maurice.«
»Aber den Wald habe ich von meinem Vater geerbt, und dieser einstmals von seinem Vater. Er ist mein ganzes Glück! Brocéliande befindet sich seit fast zweihundert Jahren in unserem Familienbesitz. Ich will ihn dereinst meinem Sohn Maurice vererben. Und jetzt soll ich Brocéliande abgeben für eine, für eine ...«
»Für eine Hochzeit. Richtig, Maurice! Für eine sehr, sehr wichtige Verbindung. Brocéliande wird ja in der Familie bleiben – in der erweiterten, wenn Ihr versteht. Aber darum geht es nicht. Ihr wünscht nichts als das Beste für Euch, für Jeanne. Folglich müßt Ihr auch selbst bereit sein, das Beste dafür einzusetzen. Anders wird diese Liaison nicht zustande kommen. Das kann ich Euch als alter erfahrener Mann flüstern, Graf Maurice de Belville.«
Maurice wandte sich abrupt ab und ging aufgeregt im Turmzimmer hin und her. Dabei stieß er immer wieder die gleichen Sätze aus:
»Das kann ich nicht versprechen, Jean! Das nicht! Nicht das! Das übermannt mich im Augenblick. Ob ich das tun werde, weiß ich jetzt noch nicht!«
»Sollt Ihr ja auch nicht, mein Guter! Morgen ist auch noch ein Tag – und sogar übermorgen. Ich werde mich bei Euch noch einige Zeit vergnügen und dabei aufs vorzüglichste zu unterhalten wissen. Euer Wein mundet bestens, Euer Koch ist fast so geschickt wie meiner daheim. Eure Kinder sind auch mir eine Augenweide, ganz besonders aber die kleine Jeanne. Wir haben noch genügend Zeit, uns ausführlich zu bereden. Laßt mich Euren Entschluß meinetwegen erst am Tag meiner Abreise wissen. Nichts muß übereilt werden, aber eines steht so fest wie der Feenstein bei Essé: Es muß gehandelt werden, und zwar wohlüberlegt! In dieser Sache können wir nur einen einzigen Vorstoß machen. Und der muß allenthalben Hand und Fuß haben!«
Nach diesen Worten verabschiedete sich der Herzog von seinen Gastgebern und verließ das Turmzimmer. Auch Gérard de Nantes wünschte, sich endlich zu Bett begeben zu können, und bestätigte noch einmal, daß er bereit sei, mit seinem Onkel in Nantes über die Heirat zu sprechen. Zuletzt hockten Genéviève und Maurice allein im Turmzimmer. Maurice blickte seine Ehefrau mit versteinertem Gesicht an. Er fragte sie: »Was denkst du, meine Liebes?«
»Das gleiche wie du vermutlich! Ein wahrer Bretone kennt den Moment, wo er gezwungen ist, etwas aufzugeben um eines großen Zieles willen. Er wird dem Schmerz dabei nicht ausweichen, aber er wird sich ihm auch nicht allzu lang hingeben, weil er sehr genau weiß, worum es geht. Und das allein gibt ihm die Kraft, richtig zu handeln.«
Maurice nickte langsam. Seine Gesichtszüge lockerten sich nur unmerklich.
»Klug geredet, Weib! Aber dieses Einverständnis mit mir habe ich im Augenblick noch nicht. Bitte laß mich noch ein wenig allein hier sitzen. Lösch die Fackeln aus! Ich muß über alles erst einmal gründlich nachdenken.«
Genéviève spitzte die Lippen. Sie erhob sich wortlos, küßte ihren Gemahl auf die Wange, strich ihm kurz übers Haar und verließ das Zimmer. Sie hatte ohnehin angefangen zu frösteln und war froh, ins wohlig warme Bett zu kriechen. Sie vertraute darauf, daß Maurice erkannte, daß das in diesem Moment das Gebot der Stunde war.
3
Einige dramatische Jahre waren seither ins Land gegangen; darunter Jahre mit ungewöhnlich harten Wintern, wie man sie bisher noch nicht an den Küsten und im Binnenland der Bretagne erlebt hatte. Menschen erfroren nachts in ihren Betten, und Männer – tagelang auf Fischfang draußen auf dem Meer in ihren Nußschalen kauernd – wurden von gewaltigen Stürmen und heftigen Unwettern überrascht. Hunderte dieser wagemutigen Fischer fanden den Tod und ließen daheim jammernde Witwen und Waisen zurück. Ohnehin fristeten die meisten Bretonen in ihren einfachen Häusern, gedeckt mit dicken Strohdächern, ein eher bescheidenes Leben. Aber man war stolz auf das Erreichte. Die Frauen fegten am Abend die gestampften Böden und hängten Büschel von Kräutern in die Eingänge. Meist lebten die Menschen von Fisch, aßen eingesalzenen Queller und Blätter, die für Fremde wie Fußlappen aussahen, aber nicht übel schmeckten. Dabei wurde nahe beim Kaminfeuer lebhaft geschwatzt, auch über die adeligen Herrschaften, die es weitaus bequemer und besser in ihren Burgen und Schlössern hatten.
Auch den Belvilles machten die harten Winter zu schaffen. Schneestürme tobten ums herrschaftliche Haus, dessen hohe Türme wie graue Schatten im Wirbel der Schneeflocken standen. Seit Beginn des Winters hatte man wohlweislich alle Luken und Fensteröffnungen mit Holzlatten, Werg und gezupfter Wolle abgedichtet. So hoffte man den eisigen Luftzug abzuwehren. In allen Kaminen loderten Feuer, und auf den Gängen schwelten Kienspäne in geschmiedeten Fackelhaltern, dennoch schien die Kälte im Winter 1330 zum erstenmal seit Menschengedenken Siegerin zu bleiben.
Auch der Adel fror bitterlich, und Jeanne, mittlerweile zwölf Jahre jung, erinnerte sich – wie alle anderen Familienmitglieder in dicke Decken gehüllt – wehmütig an die lebhaften Erzählungen eines fahrenden Ritters, der im Frühjahr, aus Italien kommend, für einige Wochen bei ihnen gewesen war. Dort im fernen Italien brannte die Sonne auch im Winter immer noch so heiß vom Himmel wie bei ihnen im besten Sommer. Das Mädchen seufzte laut auf, als sie sich an seine herrlichen Schilderungen der grünen Hügel der Toskana und Umbriens erinnerte. In einer Landschaft, in der verstreut unter einem ewig blauen und wolkenlosen Himmel wunderschöne alte Städte lagen, in denen die Menschen gemächlich lebten und es dennoch zu erheblichem Wohlstand gebracht hatten.
Genéviève de Belville blickte überrascht auf, als sie ihre Tochter so ungeniert seufzen hörte. Vermutlich langweilte sie sich einmal wieder. Sie selbst war dabei, mit geschickten Fingern den Faden vom Rocken zu ziehen. Ein wenig abseits von ihr schoben der Graf und sein ältester Sohn Maurice die elfenbeingeschnitzten Figuren des Schachspiels übers Brett, das ihnen im letzten Sommer ein spanischer Händler über Umwege aus Syrien mitgebracht hatte. Schach, so fand der Schloßherr, war bei solchen tagelangen Unwettern der beste Zeitvertreib. Sein Sohn Maurice hatte die Regeln des strategischen Spiels schnell begriffen, so daß dem Vater ein nicht gerade ebenbürtiger Gegner, aber immerhin jemand gegenübersaß, mit dem es sich zu spielen lohnte. Auch Jeanne hatte anfangs mehrmals darum ersucht, daß ihr jemand die unterschiedlichen Züge der Figuren erklärte, aber ihr strenger Vater hatte dies jedesmal mit den Worten abgelehnt, daß Gott für Mädchen und Frauen nun mal das Spinnen und Weben geschaffen habe und für Männer eben anderes. Jeanne hatte daraufhin ihre Mundwinkel verzogen und immer wieder gequengelt, sie doch ins Schachspiel einzuweihen. Aber ihr Vater war unerbittlich geblieben. Den Faden vom Rocken zu ziehen, wie es ihr ihre Mutter an jedem Abend vormachte, danach stand ihr nicht der Sinn. Sie hoffte, daß bald der Frühling ins Land einzog, damit sie wieder ins Freie konnte, auch deshalb, um auf Bäume zu klettern, wo sie in einer Astgabel ungestört träumen und nachdenken konnte, während Amélie sie ganz woanders suchte.
Jeannes Mutter schaute nachdenklich zu ihren beiden Männern hin und dachte an ihren Zweitältesten. Ihr Stiefsohn Thomas war mit einem häßlichen Klumpfuß geboren worden, der ihn äußerlich zu einem Krüppel machte. Im letzten Jahr hatte der Bischof von Nantes dafür Sorge getragen, daß Thomas, der ohnehin dem geistlichen Stand von jeher nicht abgeneigt gewesen war, im Kloster von St. Gildas-de-Rhuys als Novize aufgenommen wurde. Thomas war zwar gerade mal fünfzehn Jahre alt, aber die Klosterbrüder hatten sich der Empfehlung des Bischofs nicht widersetzen können. Genéviève de Belville war froh darüber, daß ihrem Sohn auf diese Weise eine Heirat erspart blieb. Man hätte andernfalls der Familie der Braut eine nicht unerhebliche Mitgift andienen müssen, wobei auch damit immer noch nicht sichergestellt war, ob für Thomas überhaupt eine standesgemäße Heirat in Frage gekommen wäre. Denn Maurice, Liebling ihres Mannes, würde einmal, wenn es soweit war, Namen und Besitz derer von Belville erben. Für Thomas selbst würde dann nur ein relativ kleiner Teil des elterlichen Vermögens bereitstehen.
Ihre Tochter Jeanne starrte noch immer ins prasselnde Feuer, lauschte dem Knacken des trockenen Holzes und träumte vor sich hin. Auch die Zukunft ihres einzigen leiblichen Kindes war gesichert. Jean III. hatte erreicht, daß die beiden bis dahin verfeindeten Familien endlich Frieden schlossen. Ein des langen und breiten ausgehandelter Vertrag sah vor, daß Olivier de Clisson und Jeanne de Belville an Jeannes sechzehntem Geburtstag heirateten. Die beiden hatten sich bislang noch nicht gesehen, was nicht unüblich war. Um die Heirat perfekt zu machen, hatte Maurice dem Grafen Guillaume de Clisson seinen Wald beim Weiler Paimpont – Brocéliande – schweren Herzens angeboten. Erst bei diesem verlockenden Angebot hatte der alte Fuchs aus Nantes angebissen. Denn auch ihm ging nichts über eine gute Jagd, und je besser das Revier dafür war, um so größer die Freuden einer solchen Jagd. Maurice de Belville hatte sich zuletzt doch noch dazu durchgerungen, das alte Erbe seiner Familie an die Clissons abzutreten. Die letzten fünf Jahre hatten deutlich gezeigt, daß es um die Selbständigkeit der Bretagne immer schlechter bestellt war. Seit neuestem machten auch die Engländer Ansprüche auf sie geltend, wodurch die Bretagne zum ›Zankapfel‹ zwischen England und Frankreich geworden war. Herzog Jean hatte in einer Versammlung, bei der alle bedeutenden Häuser des Landes vertreten waren, warnend die Hand gehoben und erklärt, daß nun Gefahr bestand, daß ihre Heimat zwischen den beiden Mächten zerrieben würde. Fest stand aber auch, daß man sich nicht gleichzeitig mit den Engländern und den Franzosen anlegen konnte. Somit wurde es um so wichtiger, daß alle Adelshäuser der Bretagne zusammenhielten wie ein Mann. Nur so konnte man der drohenden Gefahr einigermaßen trotzen. Aber schon hatten sich einige Familien berechnend auf die eine oder andere Seite geschlagen. Jean III. sah durch die unvorteilhafte Lage äußerst schwierige Zeiten auf sie alle zukommen. Besser hätte es dem Herzog gefallen, wenn sich alle einstimmig für England gegen die Franzosen ausgesprochen hätten. Aber ein solcher Konsens schien unmöglich, weil uralte Eifersüchteleien, eitle Kämpfe um die Vorherrschaft und böse Intrigen untereinander nach wie vor zu groß und an der Tagesordnung waren.
Die Gräfin spann noch immer gedankenverloren ihre Wolle und beobachtete dabei aus den Augenwinkeln heraus ihre Familie. Ganz besonders aber Jeanne, die jetzt, ihrem angestrengten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, über irgend etwas zu brüten schien. Ihre Tochter konnte mitunter recht anstrengend sein. Auch schien sie leider Gottes das mitunter unbeherrschte Wesen ihres Vaters geerbt zu haben, das sich zuweilen bis zur Rachsucht steigern konnte. Wenn jemand Maurice übel aufgestoßen war, dann mußte sich dieser jemand in acht nehmen. Noch viele Jahre später konnte ihr Gemahl Menschen, die ihm einmal quer gekommen waren, für ihr Verhalten bestrafen. Und Jeanne schien diesen schlechten Charakterzug von ihm geerbt zu haben.
Genéviève erinnerte sich an ein Ereignis aus dem letzten Sommer. Jeanne hatte von einem Pilger, der unterwegs nach Santiago de Compostela gewesen war, einen kleinen Hund geschenkt bekommen, der ihm unterwegs zugelaufen war. Der Pilger, ein Mann aus Bremen, der eine Tunika aus einfachem Grobgarn trug mit zerschnittenem Saum und am Tor um Speise und Trank gebeten hatte, war spätnachmittags ins Schloß gebeten worden, weil er so vorzüglich auf der Flöte spielen konnte. Maurice hatte ihm im Innenhof dabei zugehört und daraufhin beschlossen, den Ausländer für den Abend einzuladen, um bei ihnen am Tisch aufzuspielen. Der Mann – er nannte sich von Renckenberg – hatte eingewilligt und ihnen allen einen unvergeßlichen Abend mit Melodien geschenkt, wie sie in seiner Heimatstadt Bremen zur Zeit Mode waren. Auch die Kinder hatten seinem Spiel begeistert zugehört. Draußen im Hof, bellte fast die ganze Zeit über ein kleiner struppiger Hund. Es stellte sich jedoch heraus, daß er dem Deutschen gehörte.
»Wenn du magst, dann schenke ich ihn dir, Jeanne?«
Die Augen ihrer Tochter hatten geleuchtet wie die Sterne im Mai, wenn der Nachthimmel meist von Wolken leergefegt ist.
»Ist das wahr?« hatte Jeanne begeistert ausgerufen und ihren Vater bittend angeschaut.
Maurice hatte gnädig genickt, denn eigentlich mochte er keine Hunde bei sich im Schloß, die so klein waren, daß sie unter einem Hocker Platz fanden. Aber er wollte den Gast nicht vor den Kopf stoßen. Dieser hatte ihm zwar später mitgeteilt, daß es nicht sein Hund wäre, den er da verschenkt habe, sondern daß dieser ihm auf seinem Weg einfach nachgefolgt sei. Daraufhin mußte, so jedenfalls reimte es sich die Gräfin zusammen, Maurice im stillen beschlossen haben, den Hund, sobald der Mann wieder abgereist war, vom Schloßhof entfernen zu lassen. Dies geschah ein paar Tage später.
Bis dahin hatte sich Jeanne fast schon rührend um das kleine springlebendige Wollknäuel gekümmert. Sie hatte sich in das Tier so richtig verliebt. Jeder hatte es sehen können. Und dann eines Morgens kam der furchtbare Moment, wo das Mädchen den kleinen Hund nirgendwo mehr auffinden konnte. Gaston, der Stallknecht, den Maurice immer für bestimmte schmutzige Fälle einsetzte, hatte das Tier auf seinen Befehl hin beseitigt. Dies war von einer Magd, die nicht wußte, daß die Anweisung vom Schloßherrn persönlich gekommen war, beobachtet worden. Sie führte Jeanne an die Stelle, wo Gaston das Tier mit einem Knüppel erschlagen hatte. Jeanne schrie unter Tränen auf und rannte zurück ins Schloß. Dabei begegnete sie unterwegs dem schiefäugigen Gaston.
»Eines Tages werde ich dafür sorgen, daß jemand dich erschlägt, du böser Mensch«, rief sie wutentbrannt aus und spuckte ihm ins Gesicht.
Der Mann zuckte nicht einmal zusammen. Er hatte keine Ahnung, warum die Tochter seines Herrn auf ihn derart wütend war.
»Ich werde meinen Vater bitten, dich gräßlich zu bestrafen. Wirst schon sehen, du Mistkerl!«
Von dem Augenblick an lag sie Maurice immer wieder in den Ohren, Gaston auspeitschen zu lassen. Über mehrere Wochen lang ging das so. Maurice wollte seiner Tochter gegenüber nicht eingestehen, daß er seinem Knecht selbst den Auftrag zur Tötung des Hundes erteilt hatte. Um sein Gesicht zu wahren, ließ er Gaston zuletzt vor aller Augen im Hof auspeitschen. Der Stallknecht verzog dabei keine Miene, obwohl die Schmerzen unerträglich sein mußten. Nur Jeannes Augen funkelten wild. Sie schien großen Gefallen daran zu finden, wie der Mann bestraft wurde und daß seine Haut unter den mächtigen Peitschenhieben aufplatzte und blutete.