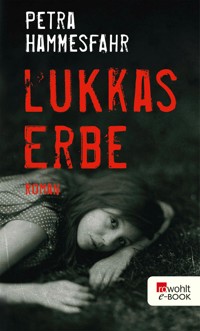
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Rückkehr des Puppengräbers Ein ganzes Dorf hielt ihn für schuldig – nun kehrt der geistig behinderte Ben nach einem Klinikaufenthalt zurück. Und als er die Polizei zum Grab der vier ermordeten Mädchen führt, breitet sich wieder Misstrauen aus unter den Dorfbewohnern. War Ben doch der Mörder und Heinz Lukka nur ein Zuschauer, der seinen Keller zur Verfügung stellte? Dann zieht Lukkas Pflegetochter Miriam in das leerstehende Haus, wo die Spuren der Verbrechen noch frisch sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Petra Hammesfahr
Lukkas Erbe
Roman
DIE WICHTIGSTEN PERSONEN
Heinz Lukka, geb. 1928, Rechtsanwalt, ledig, vermögend, tötete mehrere Frauen und Mädchen und starb im August 1995.
Miriam Wagner, geb. 1969, Lukkas Haupterbin, ihre Mutter war verlobt mit Heinz Lukka, starb 1981 bei einem Verkehrsunfall.
Benjamin Schlösser, geb. 1973, genannt Ben, tötete Heinz Lukka, verbrachte danach einige Monate in der geschlossenen Psychiatrie. Seine Eltern, Trude, geb. 1936, und Jakob Schlösser, geb. 1932, früher Landwirt.
Geschwister: Anita Schlösser, geb. 1963, Juristin, lebt in Köln. Bärbel von Burg, geb. 1967, verheiratet mit Uwe, lebt im Dorf auf dem Hof ihrer Schwiegereltern. Tanja Schlösser, geb. 1982, lebt bei der Familie Lässler, wurde von Heinz Lukka mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.
Paul, geb. 1931, und Antonia Lässler, geb. 1951, ihre jüngste Tochter Brittawurde im August 95 ermordet.
Weitere Kinder: Andreas Lässler, geb. 1969, verheiratet mit Sabine. Achim Lässler, geb. 1971, Erbe des väterlichen Hofs. Annette Lässler, geb. 1975.
Maria Jensen, geb. 1952, die Schwester von Paul Lässler, war verheiratet mit einem Apotheker. Ihre Tochter Marlenewurde im August 95 ermordet.
Bruno Kleu, geb. 1951, Landwirt, hat die zum Schlösser-Hof gehörenden Ländereien gepachtet und seit Jahren ein Verhältnis mit Maria Jensen, Marlene Jensen war seine Tochter. Verheiratet ist Bruno mit Renate. Die beiden Söhne aus dieser Ehe sindDieter, geb. 1977, und Heiko, geb. 1980.
Patrizia Rehbach, geb. 1978, heiratet im Mai 97 Dieter Kleu, Schwägerin von
Nicole Rehbach, geb. 1969, Eltern unbekannt, wuchs in Heimen auf, verheiratet mit Hartmut Rehbach, geb. 1969.Befreundet ist das Paar mit Bärbel und Uwe von Burg, Andreas und Sabine Lässler sowie
Walter Hambloch, geb. 1969, ledig, Polizeibeamter.
Brigitte Halinger, geb. 1952, ermittelnde Hauptkommissarin und Chronistin.
Prolog
Es war der letzte Dienstag im August 95, als Bens gewohntes Leben ein abruptes Ende fand. Er hatte seinen Freund getötet, aber das wusste er nicht. Zwischen Leben und Tod konnte er nicht unterscheiden. Er wusste nicht einmal, welcher von den vielen sein richtiger Name war. Seine Mutter sagte zu ihm guter Ben oder mein Bester. Seine jüngste Schwester rief ihn Bär oder Waldmensch. Seine beiden älteren Schwestern hatten ihn Idiot genannt, ehe sie große Koffer packten und fortgingen. Auch viele Leute aus dem Dorf sagten Idiot zu ihm. Und wenn sie sagten: «Hau ab, du Idiot», hieß das, er musste gehen.
Er war zweiundzwanzig Jahre alt. Das wusste er auch nicht. Für ihn hatten Wochen, Monate und Jahre keine Bedeutung. Er kannte kein Gestern und kein Morgen, nur jetzt und vorbei. Und nach dem Tag, als er seinen Freund getötet hatte, war für ihn alles vorbei.
Er lag in einem weißen Zimmer, in einem weißen Bett, bei weißen Leuten. Sein Kopf tat weh, seine Schulter, der Arm und die Hände taten weh. Und immer, wenn einer von den weißen Leuten an sein Bett trat, wurde er mit Nadeln gestochen, das tat auch weh. Er hatte Angst und wartete darauf, dass seine Mutter kam und ihn nach Hause holte.
So hatte er es als Kind erlebt. Und er vergaß nie etwas, keine Furcht, keinen Schlag, keinen Schmerz, keine Freundlichkeit, kein Gesicht, keine Erfahrung. Und immer erwartete er, dass es so geschah, wie er es kannte. Aber diesmal war alles ganz anders.
Seine Mutter kam nicht. Es kam nur eine Frau mit Fotos von hübschen Mädchen. Sie wollte von ihm wissen, ob er diese Mädchen gesehen habe und ihr sagen könne, was mit ihnen geschehen sei. Natürlich konnte er das, aber die Frau verstand ihn nicht.
Die Frau mit Fragen und Fotos war ich, Kriminalhauptkommissarin Brigitte Halinger. Im September 95 war ich dreiundvierzig Jahre alt, seit zwanzig Jahren verheiratet und Mutter eines siebzehnjährigen Sohnes. Mir waren die Ermittlungen in einem Fall übertragen worden, den die Medien später Blutsommer nannten.
Im August 95 waren in einem Dorf nahe der Kleinstadt Lohberg die siebzehnjährige Marlene Jensen, die dreizehnjährige Britta Lässler und eine zweiundzwanzigjährige Amerikanerin verschwunden. Der letzte bekannte Aufenthaltsort war jeweils ein Feldweg nahe dem einsam gelegenen Bungalow des Rechtsanwaltes Heinz Lukka gewesen.
Die besondere Tragik: Marlene Jensen und Britta Lässler waren Cousinen. Zwei Mädchen aus einer Familie, da lag es auf der Hand, nach einem Motiv im Umfeld dieser Familie zu suchen. Das Motiv fand ich: verschmähte Liebe, die in Hass umschlug. Es war sechsundzwanzig Jahre her, eine unglaublich lange Zeit. Im Oktober 1969 hatte Marlene Jensens Mutter, damals in dem Alter, in dem ihre Tochter sterben musste, Heinz Lukka zurückgewiesen und ausgelacht.
Die Leiche von Britta Lässler fand ich, Marlene Jensen und die Amerikanerin nicht. Dass es noch ein Opfer mehr war, erfuhr ich erst Monate später.
Am letzten Dienstag im August 95 wurde in Lukkas Bungalow dann noch die dreizehnjährige Tanja Schlösser lebensgefährlich verletzt. Tanja war bei der Familie Lässler aufgewachsen, weil ihre Mutter Trude Schlösser stets beide Hände, beide Augen, ihre gesamte Kraft und Aufmerksamkeit für den einzigen Sohn brauchte, für Ben, den jungen Mann, den ich mehrfach im Lohberger Krankenhaus besuchte.
Einige nannten ihn Puppengräber, weil er als Kind Puppen zerrissen und verbuddelt hatte. Er galt als schwachsinnig, und trotzdem hatte er dem Mörder gerade noch rechtzeitig das Genick gebrochen, um das Leben seiner jüngsten Schwester Tanja zu retten.
Für mich war er nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie im März 96 die letzte Hoffnung, um das Schicksal der vermissten Frauen zu klären. Heinz Lukka konnte ich nicht mehr fragen.
Ich habe schon ausführlich über den August 95 und über Bens Entwicklung berichtet. Das alles möchte ich nicht wieder aufwärmen. Aber einiges wird zwangsläufig noch einmal zur Sprache kommen, weil es nicht vorbei war, als die Akten geschlossen wurden. Viele Fragen waren offen geblieben. Fragen, die nur Ben hätte beantworten können. Aber er konnte es nicht mit Worten.
In meinem ersten Bericht habe ich für ihn gesprochen. Dabei konnte ich ihn nur von außen betrachten, mit den Augen seiner Mutter Trude Schlösser.
Als ich zwei Jahre später im Oktober 97 erneut ins Dorf gerufen wurde, mitten hinein in die Wiederholung des Blutsommers, hat es Wochen gedauert, ehe ich durchschaut habe, was vorgegangen war in den neunzehn Monaten seit seiner Heimkehr. Viel zu spät fand ich heraus, wie Ben gelebt, was er erlitten hatte, wer an ihm interessiert gewesen war, aus welchen Gründen, und warum dann wieder vier junge Frauen und ein Mann sterben mussten wie im August 95 – mit dem großen Unterschied, dass der Mann, der getötet wurde, kein Mörder war wie Lukka.
Es gab Stunden, da fühlte ich mich so schuldig, wie Bens Mutter sich nach dem schrecklichen Sommer schuldig gefühlt haben musste. Ich hatte verschwiegen, was ich im Frühjahr 96 zu begreifen glaubte. Ich hatte Ben zurückgebracht, ohne genau zu wissen, was im Sommer 95 tatsächlich geschehen war.
Und nun muss ich noch einmal sagen: «Ich habe mit allen gesprochen, die noch reden konnten.»
ERSTER TEIL
Schweigen
Ben
Im September 95 war er für mich nur ein Zeuge gewesen, der einen Mörder beobachtet hatte und nicht reden konnte. Sein Sprachschatz war äußerst dürftig. Er verstand viele Worte, doch die meisten wusste er nicht zu deuten. Sie verwirrten ihn, schwirrten um seine Ohren wie lästige Fliegen, die man nur ignorieren konnte, weil es nie gelang, sie zu fangen. Und viele waren falsch. Das hatte er im Laufe der Zeit erkannt.
Falsche Worte mochte er nicht. Er sprach nur solche aus, von denen er ganz sicher wusste, dass sie richtig waren. «Finger weg» waren alle schlechten Dinge. Damit waren Gegenstände wie ein Messer ebenso gemeint wie das Verhalten einer Person. «Fein macht» waren alle guten Dinge, ein Streicheln, ein Kuss, ein gelungenes Werk. «Weh», das war Schmerz.
«Fein» waren Frauen und Mädchen, die freundlich mit ihm umgingen. Seine Mutter natürlich, seine jüngste Schwester Tanja, Britta, Annette und Antonia Lässler und ein paar wenige mehr, viele waren es nie gewesen. Für all die anderen hatte er keinen Ausdruck, er sortierte sie nur in zwei Gruppen.
Zu dunkelhaarigen Frauen fasste er schnell Vertrauen, fühlte Verbundenheit und das Bedürfnis, sie zu schützen. Seine Mutter, seine jüngste Schwester und Antonia Lässler waren dunkelhaarig wie er. Die Blonden wie Antonias Töchter und ihre Nichte Marlene Jensen waren die schönen Mädchen, widersprüchliche Geschöpfe, manchmal waren sie sehr freundlich zu ihm, manchmal überhaupt nicht.
«Freund» war immer nur Heinz Lukka. Der alte Rechtsanwalt hatte nie ein lautes Wort an ihn verloren und stets eine Süßigkeit für ihn gehabt. Ben hatte niemals einen anderen Mann als Freund bezeichnet, es hatten sich nur einige eingebildet, er täte es.
Und «Rabenaas» war kein Schimpfwort, wie ich annahm, als ich ihn im Lohberger Krankenhaus zum Schicksal der vermissten Frauen befragte und dachte, ich ginge ihm damit auf die Nerven. Rabenaas war ein regloser, blutiger Körper. Er hatte mir sofort gesagt, was mit Marlene Jensen und der jungen Amerikanerin geschehen war, er hatte mir auch den Mörder genannt. Das hieß, er konnte Auskunft geben, man musste nur wissen, wie zu interpretieren war, was er von sich gab.
Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde er im November 95 für kurze Zeit in einer offenen Behindertenwohngruppe untergebracht. Es war nicht der richtige Platz für einen jungen Mann mit seinem Freiheitsdrang. Nachdem er zweimal ausgerissen war, wurde er in die Landesklinik eingewiesen, geschlossene Psychiatrie, die Abteilung für die schweren Fälle, weil er sich nicht festhalten lassen wollte und sich zweimal mit den Pflegern anlegte.
Er war stark, hatte bis dahin niemals einen erwachsenen Mann angegriffen, nicht einmal zurückgeschlagen, wenn er sinnlos verprügelt wurde. Er begriff doch nicht, warum er an so einem furchtbaren Ort sein musste. Niemand hatte es ihm erklärt.
Zu Hause war niemand mehr, der sich um ihn hätte kümmern können. Seine Mutter hatte einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sein Vater glaubte, ihm nie mehr in die Augen schauen zu können, weil er ihn für den Täter gehalten und mit einem Schürhaken niedergeschlagen hatte, als er ihn in Lukkas Bungalow zwischen der Leiche des alten Rechtsanwalts und der schwerstverletzten jüngsten Tochter antraf.
Seine älteste Schwester Anita lebte in Köln, war als Juristin bei einer Versicherung beschäftigt und beruflich stark eingespannt. Seine zweitälteste Schwester Bärbel war im Dorf verheiratet und zum ersten Mal schwanger. Sie lebte im Haus der Schwiegereltern, dort wäre Platz genug gewesen. Aber Bärbel wollte ihren Bruder keinesfalls in der Nähe haben. Sie hatte eine üble Erfahrung mit ihm gemacht, beziehungsweise er mit ihr – seitdem tat Bärbel, als existiere ihr Bruder nicht.
Als Trude Schlösser sich im Januar 96 so weit wie möglich von ihrem Infarkt erholt hatte und mir ihren Sohn noch einmal als wichtigen Zeugen ans Herz legte, weil sie ihn unbedingt wieder bei sich haben wollte, hatte ich den Fall längst zu den Akten gelegt. Ahnungslos, dass für seine Entlassung nur ein Gutachten notwendig und ein Amtsrichter zuständig gewesen wäre, rief Trude mich an.
Sie war überzeugt, er wüsste, wo die Leichen der anderen Opfer waren. Um das zu untermauern, legte sie ein unfassbares Geständnis ab. Ben hatte in den Sommerwochen mehrere Beweise für Verbrechen nach Hause gebracht, die Handtasche von Svenja Krahl, einer siebzehnjährigen Schülerin, den blutigen Rucksack der Amerikanerin und zwei Finger von Marlene Jensen. Aus Angst, man könne ihn verdächtigen, hatte Trude alles in ihrem Küchenherd verbrannt.
Niemand glaubte das auf Anhieb. Der zuständige Staatsanwalt vermutete, Trude wolle nur über die Justizbehörden Druck auf den Amtsrichter ausüben lassen, der für Bens Entlassung aus der Psychiatrie zuständig war. Entlassen wollte man ihn nämlich nicht mehr. Es hieß inzwischen, er sei gewalttätig, neige zu unmotivierten und unkontrollierbaren Wutausbrüchen.
Es dauerte noch bis März, ehe man in der Landesklinik erkannte, warum er sich phasenweise friedfertig zeigte und dann unvermittelt zu toben begann. Die Ärzte taten sich schwer, ihn einzuschätzen. Er war nicht geistesgestört und nicht geisteskrank. Einer der Mediziner meinte, autistische Züge zu entdecken. Aber Ben war auch kein klassischer Autist. Es gab keinen Stempel, den man ihm auf die Stirn drücken konnte. Es war nicht einmal völlig korrekt, ihn als schwachsinnig zu bezeichnen.
Sein Intellekt glich dem eines Kleinkindes. Aber er hatte ein paar besondere Fähigkeiten, es hatte sich nur nie jemand darum gekümmert, sie zu fördern, weil seine Mutter sich stets geweigert hatte, ihn in eine entsprechende Einrichtung zu geben. Trude Schlösser war immer der Meinung gewesen, er habe nicht mehr von seinem Leben als die Freiheit in Feld, Wald und Wiesen.
Und in der Gefangenschaft hatte er davon nur noch die Bilder. Kein Mensch hatte auch nur die geringste Vorstellung von seinem Gedächtnis. Er kannte es nicht anders, als dass er in seinem scheinbar leeren Hirn ein Feuerwerk an Erinnerungen entfachen konnte. Wo andere sich Raum für Abstraktionen geschaffen hatten, die Informationen verwahrten, die notwendig waren, einen Beruf auszuüben, mit der Umgebung zu kommunizieren und viele Dinge mehr zu tun, da verwahrte er alle bemerkenswerten Eindrücke seines Lebens, auch die Sommerwochen, all die Antworten, von denen ich dachte, niemand könne sie mehr geben. Es war nicht chronologisch geordnet, aber das störte ihn nicht, solange er jederzeit darin eintauchen konnte.
Er erinnerte sich nicht bloß, er fühlte, roch, schmeckte, wie es gewesen war. Dann war es für ihn jetzt und nicht vorbei. Er spürte den Wind im Gesicht und den Boden unter den Füßen. Er konnte zum Bendchen, einem Waldstück, laufen, verborgen im Gebüsch liegen, beobachten, was die jungen Männer mit den Mädchen machten, und feststellen, dass es den Mädchen gefiel. Er konnte noch einmal durch das offene Wagenfenster von Annette Lässlers Freund greifen, Annettes nackte Brüste streicheln, wie er es im Juni 95 getan hatte. Er konnte hören, wie Annettes Freund sich aufregte und Annette sagte: «Ist nicht so schlimm, Ben, er tobt nur, weil er sauer ist.»
Er hatte ihr auch nicht wehgetan, da war er ganz sicher. Er hatte gut aufgepasst, wie die anderen jungen Männer es machten. Wehtun wollte er keinem Menschen, gewiss nicht einem hübschen jungen Mädchen.
Er konnte im Bruch nach verborgenen Schätzen graben, tote Mäuse sammeln und sie verstecken in einem alten Gewölbekeller unter den Trümmerbergen, dessen Zugang lange Zeit nur er alleine gekannt hatte. Er konnte sich bei seinem Freund Lukka einen Riegel Schokolade und ein freundliches Wort holen, auf dem Lässler-Hof spielen mit seiner kleinen Schwester Tanja und Britta, sich von Antonia Lässler in die Arme nehmen und auf die Stirn küssen lassen.
Er konnte jederzeit den Zirkus sehen und das erste schöne Mädchen in seinem Leben, eine junge Artistin am Trapez und auf Ponyrücken, mit der für ihn ein Wunder verknüpft war – und sein Untergang.
Zwei Ereignisse hatten sein Denken und Handeln geprägt. Das erste geschah im August 80.Damals war er sieben Jahre alt, als im Dorf ein Zirkus gastierte. Seine Mutter besuchte mit ihm eine Vorstellung, und die junge, blonde Artistin begegnete ihm sehr freundlich, nahm ihn mit in die Manege, ritt mit ihm zusammen auf einem Pony und küsste ihn auf die Wange. Bis dahin hatte er nicht sehr viel Zärtlichkeit erfahren, von seiner Mutter hin und wieder ein Streicheln oder einen Kuss auf die Wange. Allzu viel war das nicht, Trude Schlösser war ein eher spröder Typ. Und hübsche, junge Mädchen wie seine älteren Schwestern Anita und Bärbel machten einen Bogen um ihn.
Spät in der Nacht riss er aus, um die Ponys noch einmal zu sehen. Sie waren auf einer Wiese untergebracht, auf der später sein Freund Lukka den prächtigen Bungalow bauen ließ. Das schöne Zirkusmädchen war schon da, als er kam. Und wieder war sie freundlich, ließ ihn noch einmal reiten, küsste ihn noch einmal auf die Wange und begleitete ihn auf dem Heimweg, damit er nicht verloren ging.
Dann kam sein Freund Lukka, stach die Artistin mit einem Messer, machte mit ihr, was Ben Jahre später so oft bei anderen Paaren am Bendchen beobachtete. Und danach warf sein Freund sie in ein tiefes Loch, den Sandpütz. Ein Schacht von zwölf bis fünfzehn Metern Tiefe, am Ende glockenförmig erweitert.
Und Ben dachte, es könne nicht richtig sein, ein schönes Mädchen in dieses Loch zu werfen. Er sagte es seiner Mutter und anderen Leuten mit den Worten, die sein Freund benutzt hatte. «Rabenaas kalt.» Er zeigte es ihnen auch mit Puppen. Und immer wurde er dafür verprügelt.
Zwei Jahre später beobachtete er seine Schwester Bärbel und ihren Freund in einer ihm ähnlich erscheinenden Situation. Er wollte Bärbel beistehen, schlug ihrem Freund einen Stein auf den Kopf und wurde von Bärbel mit einem Knüppel zusammengeschlagen. Danach stürzte er in den Sandpütz, der zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bis auf einen Rest von drei Metern aufgefüllt war. Eine bange Nacht hatte er in der Tiefe verbracht, war erst am nächsten Tag von der Freiwilligen Feuerwehr Lohberg geborgen worden.
Und seitdem hatten die Männer mit Leitern und einem Korb für ihn eine ganz besondere Bedeutung. Welche, das wusste niemand, ich konnte es nicht einmal ahnen. Er hatte den großen Unterschied zwischen Mädchen und Puppen erkannt. Puppen waren kaputt, wenn man sie zerriss oder mit einem Messer aufschnitt. Die Mädchen kamen irgendwann zurück.
Er hatte das schöne Zirkusmädchen wieder gesehen – lange Zeit später – in Gestalt von Marlene Jensen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit der seit 1980 verschollenen Artistin hatte. So wie ihn mussten die Männer mit Leitern und einem Korb auch sie aus dem tiefen Loch geholt haben.
Ihn erstaunte es nicht, dass Menschen, die schon einmal blutend am Boden gelegen hatten und darin verschwunden waren, plötzlich wieder herumliefen. Mit unzähligen Ratten und Mäusen hatte er schon eine ähnlich wundersame Auferstehung erlebt.
Sie lagen auf Feldwegen, einem Acker, im Bendchen oder im Bruch und bewegten sich nicht mehr, wenn er sie fand. Manchmal fielen sie sogar auseinander, wenn er sie aufhob. Aber wenn er sorgfältig jedes Knöchlein aufsammelte und alles an den dunklen Ort trug, den vergessenen Gewölbekeller unter den Trümmerbergen, liefen bald wieder Mäuse und Ratten herum.
Für Menschen brauchte es natürlich andere Voraussetzungen, tiefe Löcher, aus denen die Männer mit Leitern und einem Korb ihnen wieder heraushelfen konnten. So sah er die Sache.
Vielleicht war – wie viele glaubten – die geschlossene Psychiatrie der einzig richtige Platz für einen jungen Mann, der nicht die geringste Vorstellung von der Endgültigkeit des Todes hatte. Aber welche Vorstellungen er hatte, wusste noch niemand.
Und bei den weißen Leuten an dem schlimmen Ort hatte er bald gar keine mehr. All die Bilder in seinem Kopf wurden grau und zäh. Er brauchte sie bunt und lebendig, um sich zu orientieren, all das Schöne und weniger Schöne jederzeit wieder zu erleben, um all das Verworrene und Mysteriöse vielleicht doch noch irgendwann zu entschlüsseln und zu begreifen, warum es manchmal so und manchmal anders war.
Dass sie ihm eine Jacke anzogen, in der er seine Arme nicht bewegen konnte, dass sie ihn am Bett festbanden und mit Nadeln stachen, obwohl er keine Schmerzen hatte, hätte er noch hinnehmen können. Aber dass sie ihm seine Bilder stahlen, war zu viel. Wenn er die Dumpfheit fühlte im Kopf, musste er toben, sich mit aller Kraft zur Wehr setzen gegen die Diebe.
Kein Arzt kam auf den Gedanken, dass die Medikamente ihn um sein Gedächtnis, den Motor seines Lebens, den letzten Halt in der Gefangenschaft brachten. Dabei war allgemein bekannt, in welcher Weise verschiedene Stoffe das Gehirn beeinträchtigten. Als die Medikamente abgesetzt wurden, zeigte sich wieder der Ben, von dem seine Mutter all die Jahre vehement behauptet hatte: «Er ist gutmütig und völlig harmlos.»
Seiner Entlassung in die Freiheit stand nichts mehr im Weg.
Ich sage es ungern, aber es war so. Für mich war Ben an diesem trüben Mittwoch im März 96 nicht viel mehr als ein Hund, der mich zu den Leichen führen sollte. Trude hatte mit ihrer Aussage, Ben wisse, wo die Leichen der vermissten Mädchen lägen, den Stein ins Rollen gebracht. Nun wollte ich den Fall nur noch abschließen und mir nicht auch noch Gedanken über Bens Zukunft machen.
Es war der 20.März 96, Frühlingsanfang. Morgens um neun Uhr holte ich Trude ab. Sie war sehr gefasst, bis sie ihm gegenübertrat.
Die Tür stand offen. Er saß mit gesenktem Kopf auf dem Bett und schaute teilnahmslos hoch, als wir hereinkamen. Für mich hatte er keinen Blick, obwohl er mich vermutlich auf Anhieb erkannte. Aber ich war nur die Frau mit Fragen und Fotos.
Sekundenlang schaute er seine Mutter mit gerunzelter Stirn an, als müsse er sie erst noch irgendwo einsortieren. Trude war immer eine stattliche Frau gewesen, die schwere Krankheit und das Begreifen ihrer Schuld hatten sie ausgezehrt. Ein blasses, verhärmtes Gesicht, die Kleidung schlotterte um den mageren Körper. Unvermittelt riss er sie an sich, umklammerte sie mit beiden Armen. Wohl zwanzigmal stammelte er: «Fein.»
Seine Wiedersehensfreude verschaffte Trude die Zeit, ihre Fassung zurückzugewinnen. Als er sie endlich losließ, strich sie ihm über die Wange und sagte: «Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Hause. Da musst du aber ganz lieb sein.»
Er war lieb, obwohl er hinten einsteigen musste, wozu man ihn früher nur unter erheblichem Zwang gebracht hatte. Aber Trude setzte sich zu ihm. Und ich glaube, er hätte sich auch hinter dem Wagen herschleifen lassen, wenn das der Preis gewesen wäre, wieder nach Hause zu kommen.
Es war kurz nach Mittag, als wir zurück auf den Hof kamen. «Ich koche uns erst mal was», sagte Trude, als wir das Haus betraten. «Das habe ich schon vorbereitet. Und er hat sicher Hunger.»
Während sie am Herd stand, saß ich mit ihm am Tisch in der gemütlichen Wohnküche und versuchte, ihn auf eine Befragung einzustimmen. Ich war gut vorbereitet, konnte seinen beschränkten Wortschatz interpretieren und hatte von den Psychiatrieärzten ein paar nützliche Tipps erhalten, wie man mit ihm umgehen musste. Aber ich scheiterte kläglich. Egal, was ich sagte oder fragte, Ben überhörte es geflissentlich und ließ die Augen nicht von seiner Mutter.
Nachdem wir gegessen hatten, holte Trude ein Vanilleeis aus der Gefriertruhe, um seine Bereitschaft zu fördern, und brachte auf einem Weg seinen Klappspaten aus dem Keller mit. Ich zeigte ihm noch einmal die Fotos der beiden jungen Frauen. Und Trude fragte schlicht: «Weißt du, wo die Mädchen sind?»
Er nickte.
«Zeigst du es uns?», fragte Trude. «Ich freu mich sehr, wenn du es uns zeigst. Frau Halinger freut sich auch sehr. Du magst doch Frau Halinger. Sie war so nett zu dir, hat uns im Auto nach Hause gefahren.»
Er schaute mich an und nickte noch einmal. Ob sich das auf die Fahrt oder auf seine Gefühle für mich bezog, war nicht ersichtlich. Dann ging er gemächlich vor uns her zu dem breiten Feldweg hinunter, der hinter den Gärten der an der Bachstraße gelegenen Häuser vorbeiführte. Er war untrainiert, längst nicht mehr so schnell, wie Trude es von ihm gewohnt war. Abgesehen davon genoss er es auch, der erste Weg in Freiheit, da legte man keine große Eile an den Tag.
Wir konnten mühelos mit ihm Schritt halten. Trude suchte mit den Augen die offenen Gärten ab. Viele waren es nicht. Die meisten hatten sich mit hohen Hecken oder Mauern abgeschirmt. Trudes Mienenspiel sagte mehr als jedes Wort: Hoffentlich sieht uns keiner. Ich hatte vorgeschlagen, im Auto zu fahren. Aber das hätte nicht viel Sinn gehabt. Wie hätte Ben mir begreiflich machen sollen, welche Richtung ich einschlagen und wo ich anhalten sollte?
Wir hatten Glück, kamen ungesehen bis zur Apfelwiese, so genannt wegen der Obstbäume, zwischen denen wir in einer flachen Mulde drei notdürftig verscharrte Müllsäcke mit den Überresten Britta Lässlers gefunden hatten. Es war ein großes Grundstück, von zwei Meter hohem Stacheldraht umgeben. Die Männer von der Spurensicherung hatten seitlich ein Teilstück vom Zaun entfernt. Es war nicht ersetzt worden, offenbar fühlte sich dafür niemand zuständig. Die Lücke irritierte Ben. Er betrachtete erstaunt die Holzpfähle zu beiden Seiten, strich prüfend mit einem Finger darüber.
Es dauerte fast eine Minute, ehe er endlich weiterging, etwa sechs bis sieben Meter in die Wiese hinein. Er zeigte auf die Stelle zwischen den Apfelbäumen, an der Brittas Leiche gelegen hatte. Die flache Mulde war geschlossen worden und wieder bewachsen. Sie unterschied sich nicht mehr von der Umgebung. Aber es war exakt der Fundort.
«Fein?»
Eine Frage, das war nicht zu überhören. Trude wusste auch sofort, wem sie galt. «Britta ist nicht mehr hier», sagte sie. «Frau Halinger hat sie schon gefunden. Jetzt zeig uns, wo Lukka die anderen Mädchen hingelegt hat.»
Er nahm mir die Fotos aus der Hand und zeigte mit ausgestrecktem Arm zu einer tiefen Senke hinüber – der seit Jahren geschlossene Sandpütz. Ich dachte, er betrachte seinen Auftrag als erledigt. Enttäuscht war ich. Auf der Wiese konnte nichts sein, wir hatten sie mehrfach mit einem Leichenspürhund abgesucht, nicht nur die Apfelwiese, die ganze Umgebung.
«Das war wohl ein Irrtum», sagte ich.
Trudes Augen glitten zwischen ihm und mir hin und her. Es muss ein schwerer Kampf für sie gewesen sein. Sie hätte sich eine Menge ersparen können, hätte sie mir in dem Moment zugestimmt. Ben war frei, ohne Leichen gab es keine Beweise gegen sie und damit kein Strafverfahren. Ihr Geständnis allein, Gegenstände aus dem Besitz der Opfer verbrannt zu haben, war ohne Wert, sie konnte es jederzeit widerrufen. Ihre älteste Tochter Anita hatte ihr eine gute Strafverteidigerin beschafft, die dringend geraten hatte, Trude solle behaupten, diese Vernichtungsaktionen nur erfunden zu haben, um ihren Sohn aus der Psychiatrie zu holen.
Aber Trude fragte ihn: «Hast du die Mädchen weggenommen?» Und er nickte.
Großer Gott, dachte ich. Trude begann zu weinen. «Du dummer Kerl», stammelte sie. «Warum hast du das getan?»
Er bewegte unbehaglich die Schultern und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. Ihre Tränen machten ihn nervös. Er verstand nicht, warum ein erwachsener Mensch weinte. Kleine Kinder weinten, wenn sie sich erschreckten, fürchteten, verprügelt wurden und starke Schmerzen hatten. Als Kind hatte er das auch getan, aber er hatte früh begriffen, dass sich nichts änderte, wenn man weinte. Nach ein paar Sekunden sagte er: «Fein macht.»
Ich wollte die Sache Trude zuliebe abkürzen und fragte: «Hat dir jemand gesagt, du sollst die Mädchen an einen anderen Platz legen?»
Es war nahe liegend, zu denken, er hätte in Lukkas Auftrag gehandelt. Trude hatte sich den Kopf zerbrochen, warum der alte Rechtsanwalt stets so freundlich mit Ben umgegangen war, ob er sich nur für einen bestimmten Zweck vor ihn gestellt hatte, wenn wieder mal jemand aus dem Dorf meinte, es sei eine Schande, Ben frei herumlaufen zu lassen. Der Zweck schien jetzt klar auf der Hand zu liegen. Es musste doch jemand die Dreckarbeit machen und im Notfall den Kopf hinhalten. Hätte man Ben mit einer Leiche erwischt… Nur bei Britta Lässler hatte das dann nicht mehr funktioniert, weil Ben zum Zeitpunkt ihres Todes in seinem Zimmer eingesperrt gewesen war.
Trudes jämmerliches Weinen machte mich ebenso nervös wie ihn. Sie wusste genau, wie die Konsequenz aussah. Dass ich ihn zurückbringen musste in die Landesklinik. Und dafür hatte sie das alles auf sich genommen. «Bitte, Frau Halinger», schluchzte sie, «lassen Sie den armen Tropf nicht dafür büßen, dass ich ihn nicht verstanden hab. Er hat’s mir doch immer wieder gesagt.»
Jetzt könnte ich behaupten, ich hätte mir die Entscheidung sehr schwer gemacht. Das wäre eine Lüge. Ich musste nicht lange überlegen, hatte seit Januar unzählige Stunden mit Trude verbracht, mir angehört, was sie für ihren Sohn auf sich genommen hatte, durch welche Hölle sie gegangen war in den verfluchten Sommerwochen.
Immer wieder hatte sie mich angerufen, auch als längst schon alles von Bedeutung zu Protokoll genommen war. Immer wieder hatte mein Mann gewarnt: «Lass dich nicht so tief hineinziehen, Brigitte. Du verlierst deine Distanz.» Ich hatte sie verloren.
«Schon gut, Frau Schlösser», sagte ich. «Hören Sie auf zu weinen.» Dann wandte ich mich an ihn und forderte: «Zeig mir, wo du die Mädchen hingelegt hast, dann kannst du nach Hause gehen.»
Er schüttelte den Kopf. Inzwischen war ich ihm lästig geworden und bedrohlich für seine Mutter. Er sorgte sich um sie, griff nach ihrem Arm und wollte mit ihr auf den Weg.
«Moment», sagte ich. «Wir sind noch nicht fertig. Ich muss wissen, wo die Mädchen sind.»
Er schüttelte erneut den Kopf.
«Du musst es mir zeigen», sagte ich. «Was Heinz Lukka mit Britta Lässler und mit deiner Schwester gemacht hat, war sehr böse. Ich muss wissen, ob mit den anderen dasselbe passiert ist.»
Er nickte, um mir zu bedeuten, dass mit den anderen dasselbe passiert war. Aber er machte keine Anstalten, mir etwas zu zeigen. «Finger weg?», fragte er.
Trude beruhigte sich ein wenig und erklärte: «Er will wissen, ob er es falsch gemacht hat.»
Natürlich hatte er es falsch gemacht, so falsch, dass er für den Rest seines Lebens in einer Anstalt hätte verschwinden müssen. Aber Trude irrte sich. Er wollte nur verhindern, dass ich die Mädchen wegnahm. Das machte er uns auch klar. Er nahm Trude den Klappspaten aus der Hand, machte einen Stich, bückte sich, nahm einen kleinen Stein aus der Kuhle und hielt ihn mir vor. Dann legte er ihn zurück und häufte ein bisschen Erde darüber. «Finger weg», wiederholte er dabei. Missverstehen konnte man das nicht. Ich durfte sie mir mal anschauen.
«Das geht nicht», sagte ich. «Ich muss sie mitnehmen. Sie haben alle eine Mutter, und ihre Mütter sind sehr traurig, weil sie nicht wissen, wo die Mädchen sind. Du bist doch auch gerne bei deiner Mutter.»
Er nickte. Ich wandte mich an Trude. «Erklären Sie ihm, wie wichtig es ist. Dass ich für die Mädchen tun muss, was noch getan werden kann.»
Doch ehe Trude ihm etwas erklären konnte, setzte er sich in Bewegung. Er hatte mich verstanden, auch wenn er noch nicht recht glaubte, dass ich die geschundenen Körper schnell wieder zurück in den ursprünglichen Zustand versetzen konnte. Das konnten nur die Männer mit Leitern und einem Korb. Aber dass die Mütter traurig sein mussten, wollte er nicht.
Das Grab befand sich auf dem Nachbargrundstück, einer von Brombeersträuchern zugewucherten Wildnis, durchsetzt von Nesseln und Disteln. Wir waren im Hochsommer hier gewesen, als alles in vollem Grün stand und die Beeren an den Sträuchern zu faulen begannen. Ein betäubender Geruch über allem und kein Durchkommen. So hatten wir es gesehen und uns auf den Leichenspürhund verlassen, den es nicht in die Dornen zog.
Nachdem Ben mir bestätigt hatte, dass sie alle bei einem alten Birnbaum lagen, bedankte ich mich für seine Hilfe und wollte ihn nach Hause schicken. Nur wollte er jetzt nicht mehr gehen. Er wollte sich überzeugen, dass ich mein Versprechen hielt und sie zu ihren Müttern brachte. Aus Erfahrung wusste er, dass wir alles wegwarfen, was wir nicht mehr schön fanden. Sein Vater hatte die Mäuse immer weggeworfen, wenn er sie mit ins Haus brachte. Und schön sahen die Mädchen nicht mehr aus, das war ihm auch bewusst.
«Du musst gehen», sagte ich. «Wenn ein Mensch erfährt, dass du sie hier begraben hast, werden sie dich wieder einsperren. Ich werde es nicht sagen. Aber ich muss ein paar Männer rufen, die mir helfen.»
Und so kannte er es, die Männer mit Leitern und einem Korb. Er lächelte mich an – zum ersten Mal, griff nach meiner Hand und drückte sie ganz sachte. «Fein», sagte er, «fein macht.» Es sollte wohl heißen, du bist in Ordnung, versuch dein Glück.
Zusammen mit ihm und Trude verließ ich die Wildnis, informierte den Staatsanwalt und forderte die Spurensicherung an. Während ich telefonierte, zupfte er mehrfach an meinem Ärmel, zeigte mit ausgestrecktem Arm nach Süden zu Lukkas Bungalow oder dem Lässler-Hof. Es war dieselbe Richtung.
«Fein», sagte er wieder und: «Freund. Fein macht.»
Dass er mich darauf aufmerksam machte, im Haus seines Freundes lägen möglicherweise noch zwei Körper, die repariert werden müssten, begriff Trude ebenso wenig wie ich. Es war sein letzter Eindruck von Lukkas Bungalow, der alte Rechtsanwalt und Tanja reglos am Boden.
«Da kannst du nicht mehr hingehen», sagte Trude und zog ihn zur Seite, damit ich in Ruhe telefonieren konnte. «Auf dem Lässler-Hof sind alle böse mit uns. Und im Bungalow ist niemand mehr.»
Er folgte seiner Mutter mit gesenktem Kopf den Weg zurück, den wir gekommen waren. Ich schloss mich an und holte mein Auto, mit ins Haus ging ich nicht mehr.
Eine knappe Stunde später traf die Spurensicherung ein, kurz darauf auch ein Gerichtsmediziner.
In achtzig Zentimeter Tiefe stießen wir auf einen blauen Plastiksack, der wie eine Decke im Boden ausgebreitet war, darunter lag die Amerikanerin – auf zwei weiteren Säcken. Die Verwesung war weit fortgeschritten, viel Menschliches nicht mehr zu erkennen, eine Identifizierung auf Anhieb nur an den Haaren möglich. Marlene Jensen, hellblond und langhaarig, war ebenfalls zwischen Müllsäcke gebettet. Unter ihr lag eine dritte Leiche. Svenja Krahl, die siebzehnjährige Schülerin aus Lohberg, von der wir angenommen hatten, sie sei in die Drogenszene abgetaucht. Es war ein Schock für mich, diesen Irrtum zu erkennen.
Die Grube musste mehrfach ausgehoben, vertieft und wieder aufgefüllt worden sein. Der Gerichtsmediziner wunderte sich über die ausgebreiteten Müllsäcke und die Ordnung. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte er. «Alles hübsch beisammen. Das sieht fast aus, als hätte der Täter ihnen zuletzt noch so etwas wie Ehrfurcht erweisen wollen. Aber dass er sie alle in ein Loch steckt, überlegen Sie mal, welch eine mühselige Plackerei das war. Er musste sie von unten doch immer wieder hochholen, um tiefer zu graben. Was hat er sich dabei gedacht?»
Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was Ben gedacht hatte. Ich wusste nicht, dass Svenja Krahl, nachdem sie beim Bendchen aus dem Wagen geworfen worden war, noch eine Begegnung am Waldrand gehabt hatte und vergewaltigt worden war.
Es gab keine Zweifel an Lukkas alleiniger Täterschaft, soweit es die Morde betraf. Da vermuteten wir sogar, dass es mehr Opfer waren als die uns bekannten, das möchte ich ausdrücklich betonen. Die Obduktionsbefunde bestätigten, dass alle in ähnlicher Weise zu Tode gebracht worden waren. Die Einzelheiten möchte ich mir ersparen. Für den Staatsanwalt und mich war der Fall damit abgeschlossen. Heinz Lukka war tot, wir konnten ihn nicht mehr befragen, niemand konnte ihn zur Verantwortung ziehen. Und er konnte keinen Schaden mehr anrichten. So sah ich es, und das war mein größter Irrtum in dem Fall.
17.Juli 1997
Seit einer halben Stunde beobachtete der Mann das Paar im Bendchen. So wurde das Waldstück genannt, das die offenen Felder nach Osten begrenzte. Es lag nicht weit entfernt vom Schlösser-Hof, einem der vier großen Bauernhöfe, die sich wie Wachposten in alle Himmelsrichtungen um das Dorf verteilten.
Auf der Karte von Lohberg und Umgebung sah es idyllisch aus, der kleine rote Fleck mit den vier Punkten und all dem Grün drum herum. Viel freies Land, Felder, Wiesen und der Wald, der seit eh und je ein beliebter Treffpunkt für Liebespaare war. Hier hatte der Mann schon so manche Nacht verbracht, verborgen hinter einem Baumstamm gestanden oder im Unterholz gelegen.
Das Paar in dieser Nacht war mit dem Auto gekommen, das taten sie fast alle. Viele blieben im Wagen, vergnügten sich auf der Rückbank. Dann war es schwierig für ihn, er musste nahe heran, und es bestand die Gefahr, dass sie ihn sahen. Die beiden waren ausgestiegen, einige Meter in den Wald hineingegangen und dabei so dicht an ihn herangekommen, dass er nur eine Hand hätte ausstrecken müssen, um die Frau zu berühren.
Es war eine laue Nacht. Sie hatten eine Decke aus dem Kofferraum genommen und sich darauf gelegt. Jetzt lagen sie da, küssten sich, zogen sich gegenseitig aus. Das lustvolle Stöhnen der Frau klang ihm so laut in den Ohren – wie ein Befehl. Den Knüppel neben seinem linken Bein fühlte er schon seit einer Weile. Es war ein abgestorbener Ast von einem der umstehenden Bäume. Zweimal hatte er bereits die Hand darum geschlossen und wieder losgelassen.
Ihm zogen Bilder durch den Kopf von einer Nacht im Juli vor zwei Jahren, als er das zum ersten Mal getan hatte, obwohl er genau wusste, dass es üble Konsequenzen für ihn haben konnte.
Im Juli 95 waren es zwei Männer gewesen und ein hübsches, blondes Mädchen. Sie waren in Streit geraten, das Mädchen wollte nicht beide Männer an sich heranlassen. Die Männer fuhren ab und ließen das Mädchen zurück. Halb nackt stand sie am Waldrand, schimpfte und fluchte hinter dem davonfahrenden Wagen her, suchte in der Dunkelheit ihre Sachen zusammen, fand die Handtasche nicht.
Er trat ihr freundlich entgegen, half bei der Suche, weil sie so jammerte, in der Tasche seien wichtige Sachen. Bis er sich nicht mehr beherrschen konnte und das tat, was vor ihm einer der beiden Männer getan hatte. Erst danach kam die Angst.
Das Mädchen weinte und drohte: «Ich zeig dich an, du Dreckskerl. Ich sorg dafür, dass du eingesperrt wirst.»
Er wollte nicht eingesperrt werden, legte beide Hände um ihren Hals und drückte zu, bis sie still war und sich nicht mehr bewegte. Danach hatte er noch mehr Angst. Aber er hatte Glück gehabt in der Julinacht vor zwei Jahren. Irgendwann hatte das Mädchen sich wieder bewegt. Als sie vom Boden aufstand und benommen durch die Nacht taumelte, war er noch in der Nähe, hatte sich nicht aufraffen können, den reglosen Körper liegen zu lassen und einfach zu gehen, hatte überlegt, ein Loch im Waldboden auszuheben und sie darin verschwinden zu lassen.
Er konnte sich auch nicht überwinden, noch einmal die Hände auszustrecken oder mit einem Knüppel zuzuschlagen, war irgendwie erleichtert, als sie aufstand und davonlief. Er folgte ihr – in einiger Entfernung, unschlüssig, wie er sich verhalten sollte.
Sie lief nicht den Weg, den die Männer im Auto genommen hatten. Sie lief am Bruch entlang, einem alten Bombenkrater, den die Zeit in eine Senke verwandelt hatte. Im Zentrum ragten die Trümmerberge eines ehemaligen Gehöfts auf. Es war ein unheimlicher Ort, die Bruchkante ragte hoch auf neben dem Weg. In der Dunkelheit war nichts zu sehen von dem Unkraut und den moosüberwachsenen Steinhügeln. Dort hätte er sie auch gut verstecken können. Doch als ihm das einfiel, war das Mädchen schon zu nahe am Lässler-Hof.
Und sie lief weiter, wollte zur Landstraße, hoffte wohl, noch einen Wagen anhalten zu können, der sie nach Lohberg mitnahm. Dort musste sie hin. Aber dort kam sie nie an. Achthundert Meter vom Lässler-Hof entfernt stand noch ein einsames Haus an einer Wegkreuzung, der Bungalow des Rechtsanwalts Heinz Lukka.
Von zwei Seiten war das große Grundstück von mannshohem Mais umgeben, zu den Wegen hin lag es offen. Bei Tag ragte nur das Walmdach über den Mais hinaus. Bei Nacht sah man schon von weitem den Lichtschein aus dem Wohnraum wie eine Glocke über dem Feld liegen.
Diesmal war da nur die Dunkelheit, durchbrochen von einem schwach bläulichen Schimmer, den man erst sah, wenn man den Mais hinter sich gelassen hatte und an der offenen Rasenfläche hinter der Terrasse vorbeilief. Das Mädchen hatte inzwischen bemerkt, dass er noch in der Nähe war. Sie dachte wohl an Hilfe und klopfte beim Tod an. Und er tat nichts, um sie aufzuhalten.
Das Mädchen war die siebzehnjährige Schülerin Svenja Krahl aus Lohberg. Das erste Opfer des Blutsommers 95.Nicht einmal ihre Eltern vermissten sie wirklich. Svenja Krahl hatte ein Drogenproblem gehabt und an jenem Abend sogar ihre eigene Mutter noch um fünfzig Mark bestohlen, um in der Lohberger Diskothek ein paar Pillen dafür zu kaufen. Als ihr Verschwinden bekannt wurde, gingen alle davon aus, sie sei in der Drogenszene abgetaucht. Bis ihre Leiche gefunden wurde – zusammen mit den anderen Opfern.
Der Mann hatte in der Julinacht vor zwei Jahren wirklich sehr viel Glück gehabt. Heinz Lukka hatte getan, wozu er nicht in der Lage gewesen war.
Rückkehr
Zum Besten standen die Dinge nicht für Ben, als Trude ihn im März 96 zurück ins Dorf brachte. Jakob Schlösser hatte sich geweigert, seinen Sohn nach Hause zu holen, und es war nicht allein das schlechte Gewissen, weil er ihn für den Täter gehalten und niedergeschlagen hatte. Inzwischen war auch eine Menge Furcht dabei, Ben könne das nächste Opfer werden.
Seiner Mutter drohte ein Strafverfahren wegen Begünstigung einer Straftat nach Paragraph 211 des Strafgesetzbuches, weil sie Beweisstücke verbrannt und damit verhindert hatte, dass rechtzeitig kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen werden konnten. Der Staatsanwalt wollte an ihr ein Exempel statuieren.
Ich wusste, was Trude Schlösser bevorstand. Aber ich wollte mich nicht auch fragen müssen, wer sich um Ben kümmern sollte, wenn sie zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, wer verhindern sollte, dass er erneut herumstreunte, wie er es immer getan hatte. Es wäre ihm nach all den schrecklichen Ereignissen nicht mehr gut bekommen.
Im Dorf schieden sich die Geister. Für ein paar wenige war Ben ein Held, der einen sadistischen Mörder zur Strecke gebracht hatte. Der Großteil der Bevölkerung vertrat aber nach wie vor die Ansicht, er sei unberechenbar und deshalb in der Anstalt bestens aufgehoben, habe vielleicht doch irgendwie seine Finger im Spiel gehabt, weil er doch ständig bei Lukka herumgelungert hatte.
Auf dem Lässler-Hof, wo er früher jederzeit willkommen gewesen war, durfte er sich nun nicht mehr blicken lassen. Die Familie verkraftete den Verlust der jüngsten Tochter nicht.
Paul Lässler hatte sich Brittas Obduktionsbericht aushändigen lassen und kümmerte sich um nichts mehr, seit er gelesen hatte, wie sie gestorben war. Die Schweine im Stall mochten vor Hunger quieken, Paul saß reglos auf einem Stuhl am Küchenfenster, als wäre er taub geworden. Von diesem Platz hatte er die Hofeinfahrt im Blick. Er schaute hinaus, als warte er darauf, seine «Kleinen», wie er Britta und Tanja Schlösser genannt hatte, auf ihren Rädern in den Hof fahren zu sehen.
Brittas Mutter, die starke, tüchtige, unerschütterliche Antonia, war am Ende ihrer Kraft. Einen winzigen Halt fand sie nur noch bei der älteren Tochter Annette. Aber unzählige schlaflose Nächte machten sich bemerkbar. Die ungelebte Trauer forderte ihren Tribut.
Sie bemühte sich verzweifelt, ihre Familie zusammenzuhalten und zurückzuführen in einen normalen Alltag. Das war unmöglich. Zu Paul drang sie nicht mehr durch. Sechsundzwanzig Jahre Ehe, nie ein ernsthafter Streit, nie ein böses Wort. Jetzt sprach Paul gar nicht mehr, und wenn er sie anschaute, war so viel Leere in seinem Blick, dass Antonia sich abwenden musste.
Der älteste Sohn Andreas kam zweimal in der Woche vorbei mit seiner Frau Sabine. Aber selten blieben sie länger als eine Viertelstunde. Meist sagte Andreas schon nach zehn Minuten: «Sei mir nicht böse, Mama. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch etwas Wichtiges zu erledigen habe.»
Vergessen konnte man einmal eine wichtige Erledigung, nicht zweimal in der Woche. Antonia vermutete, dass ihr Ältester nur bemüht war, für sich und seine junge Frau ein bisschen Zukunft zu retten. Um ihn sorgte sie sich nicht, aber um ihren zweiten Sohn Achim.
Achim hatte nie viel Glück gehabt mit Frauen. Seine letzte Freundin hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass ein Leben auf einem Bauernhof für sie nicht infrage kam. Trotzdem hatte er gehofft, sie eines Tages umstimmen zu können. Aber dann hatte sie Brittas Tod zum Anlass genommen, sich endgültig von ihm zu trennen.
Seitdem erledigte Achim nur noch die nötigsten Arbeiten im Schweinestall, mehr nicht. Fast jeden Abend verließ er das Haus und war die ganze Nacht unterwegs auf der Suche nach einem Menschen, dem er für den Tod seiner Schwester und sein damit verbundenes Elend die Seele aus dem Leib prügeln konnte. Antonia verging fast vor Sorge, dass er sich zu etwas hinreißen ließ, was nicht wieder gutzumachen wäre.
Im vergangenen Jahr hatte sie noch große Hoffnungen auf Tanja gesetzt, die bei ihnen aufgewachsen war. «Vielleicht hilft es Paul, wenn er wenigstens eine zurückbekommt. Vielleicht besinnt er sich und fängt wieder an zu arbeiten. Und wenn sein Vater mit gutem Beispiel vorangeht, kommt vielleicht auch Achim wieder zur Vernunft.»
Im Dezember 95 hatte Antonia das Mädchen dann kurzerhand aus der Klinik geholt, ohne die Ärzte oder sonst wen um Erlaubnis zu fragen, eine regelrechte Entführung, viel zu früh. Tanja hatte schwerste Verletzungen davongetragen, ihr mussten die Milz, der rechte Lungenflügel und große Teile des Dünndarms entfernt werden. Sie hätte noch lange ärztliche Betreuung gebraucht.
Gebracht hatte Antonias Verzweiflungstat nicht viel. Tanja ging es sehr schlecht. Und Paul saß nun die meiste Zeit neben der Couch im Wohnzimmer oder neben dem Ehebett, in dem jetzt auch Tanja schlief. Zweimal in der Woche fuhr Paul sie zur Nachbetreuung ins Lohberger Krankenhaus. Und wenn die Ärzte auch nur andeuteten, Tanja könne stationär besser versorgt werden, ging Paul Lässler ihnen beinahe an die Kehlen.
Der einzige Mensch, mit dem Antonia über ihre Nöte sprechen konnte, war Bruno Kleu, der die zum Schlösser-Hof gehörenden Ländereien gepachtet hatte, nachdem Bens Vater die Landwirtschaft aufgeben musste.
Bruno Kleu gehörte einer der großen Höfe. Er war Jahrgang 51, hatte zwei eheliche und zwei uneheliche Söhne. Verheiratet war er mit der sanften, stillen und duldsamen Renate, mit der er sich irgendwann arrangiert hatte. Das heißt, Renate Kleu hatte sich damit abgefunden, dass ihr Mann sie nicht lieben konnte. Geliebt hatte Bruno – wie Heinz Lukka – immer nur eine: Paul Lässlers schöne Schwester Maria.
Zum Heiraten war er ihr und ihrem Bruder nicht gut genug gewesen. Aber in all den Jahren hatte Maria ihn gebraucht für eine oder zwei Stunden in der Woche. Ob sie ihn liebte, hätte Bruno nicht beschwören mögen. Manchmal verletzte ihn ihre Art. Und sie hatte ihn nie mehr verletzt als an dem Abend, als sie ihm erklärte, dass er nicht nur vier Söhne, sondern auch eine Tochter gehabt hatte. Als Bruno Kleu das erfuhr, war seine Tochter Marlene Jensen seit zwei Wochen verschwunden, getötet worden von Lukka. Und nun sollte der Mann zurück ins Dorf kommen, der getan hatte, was Bruno Kleu liebend gerne mit eigenen Händen erledigt hätte.
Er tat, was er konnte, um Bens Sicherheit zu gewährleisten, pendelte zwischen den Familien Lässler und Schlösser hin und her. Für den Lässler-Hof erledigte er stillschweigend die Arbeit, um die Paul sich nicht kümmerte, damit nicht alles vor die Hunde ging. Er hörte sich Antonias Sorgen an, sagte mindestens einmal jeden Abend: «Ben kann doch nichts dafür.»
Trude Schlösser bestärkte er in ihrem Bestreben, den Sohn aus der Landesklinik zu holen. «Finde ich richtig, dass du ihn nicht büßen lässt für das, was ihr verbockt habt.»
Er versuchte auch, Jakob Schlösser bei einigen Gläsern Bier in Ruhpolds Schenke die Bedenken auszureden. In der für ihn typischen, burschikosen Art sagte er: «Nun mach dir nicht ins Hemd, Jakob. An Ben wird sich keiner vergreifen, ich bringe ihm schon bei, wie man sich wehrt. Und was Trude angeht, kein Richter wird eine Frau für einige Jahre in den Knast schicken, die dem Tod mit knapper Not von der Schippe gesprungen ist. Sie kriegt bestimmt Bewährung. Man muss ihr ja auch den Schock zugute halten.»
Es hatte sich nicht vermeiden lassen, dass Bruno Kleu von dem drohenden Strafverfahren erfuhr. Er war zweimal unerwartet in Trudes Küche aufgetaucht, während sie mit ihrer Anwältin zusammensaß. Dass Trude die Finger seiner Tochter verbrannt hatte, wusste Bruno jedoch nicht. Er nahm an, es ginge nur um Britta Lässlers Fahrrad, das Trude in der Scheune versteckt, und um Brittas Kopf, den sie in ihrem Garten vergraben hatte.
Damit Jakob nicht zu viel Zeit zum Grübeln fand und am Ende noch verhinderte, dass sein Sohn nach Hause kommen durfte, ließ Bruno ihn auf den Feldern arbeiten, wenn es sich eben einrichten ließ, auf dem Land, das Jakob an ihn verpachtet hatte. Zwar beschäftigte Bruno auch zwei Landarbeiter, aber mit der zusätzlichen Arbeit für den Lässler-Hof konnte er jede Hand gebrauchen.
Und Trude meinte, es täte ihrem Mann gut, lenke ihn ab von der Schuld, die sie sich aufgeladen hatten. Sie hoffte, dass es ihm auch half, das schlechte Gewissen gegenüber Ben zu bewältigen und wieder ein Vertrauensverhältnis zu seinem Sohn aufzubauen.
17.Juli 1997
Die Frau auf der Decke im Bendchen war blond wie der Typ, den Lukka bevorzugt hatte. Sie hieß Rita Meier, der Mann neben ihr hieß Frank, so jedenfalls stellte er sich ihr in der Lohberger Diskothek vor, wo Rita ihn an diesem Abend kennen gelernt hatte. Eine Gelegenheitsliebschaft, mehr als ihren Vornamen hatte Rita ihm auch nicht genannt.
Sie war zweiunddreißig Jahre alt und verheiratet. Ihr Mann war beruflich viel unterwegs. Er verdiente gut, bot ihr ein angenehmes Leben und erwartete im Gegenzug, dass sie ihm treu war. Er hätte sie umgehend auf die Straße gesetzt, hätte er gewusst, dass sie sich hin und wieder eine Abwechslung gönnte. Deshalb nahm Rita niemals einen Liebhaber mit nach Hause, aus Angst vor den Nachbarn.
Rita hörte noch ein Geräusch, doch für eine Reaktion war es bereits zu spät. Der Knüppel sauste nieder und traf Frank am Hinterkopf. Das Holz war morsch und zersplitterte, sodass der Schlag Frank nicht völlig betäubte. Rita schrie auf, als der Mann aus dem Unterholz hervorkam und noch einmal mit der Faust zuschlug. Frank brach über ihr zusammen, drückte sie mit seinem Gewicht auf die Decke, nahm ihr jede Möglichkeit zur Flucht.
Als der Mann den Körper ihres Liebhabers zur Seite zog, versuchte Rita zu fliehen. Sie war nicht schnell genug, die Panik verhinderte, dass sie gezielt handelte. Sie schrie nur: «Fass mich nicht an. Fass mich bloß nicht an!» Bis er ihr mit einer Hand den Mund verschloss und die Nase. Als ihr der Atem ausging, gab sie den Kampf gegen ihn auf. Rita hatte einmal gehört, es sei besser, es über sich ergehen zu lassen, als den Täter mit Gegenwehr zum Äußersten zu treiben.
Es ging schnell, schon nach zwei Minuten ließ er wieder von ihr ab und war im Unterholz verschwunden, ehe sie noch richtig begriff, dass es vorbei war. Dann kümmerte sie sich zuerst um Frank, der langsam wieder zu sich kam.
Am Hinterkopf war nur eine Schramme, aber der Faustschlag hatte ihn in den Nacken getroffen und den Wirbel geprellt. Minutenlang fürchteten sie beide, er sei gelähmt. Endlich gelang es ihm, Hände und Füße zu bewegen. Er brauchte noch ein paar Minuten, ehe er aufstehen und Rita zum Auto folgen konnte. Und sie war dankbar, einfach nur dankbar, so glimpflich davongekommen zu sein.
Frank wollte unbedingt zur Polizei, um den Überfall anzuzeigen, das konnte Rita ihm ausreden. Sie hatten doch beide in der Dunkelheit niemanden erkannt, wen sollten sie da anzeigen? Sie hatte zwar das Gesicht des Mannes für zwei Minuten dicht vor sich gehabt, aber in der Panik, er könne sie ersticken mit seiner Hand auf Mund und Nase, und in der Dunkelheit. Etwas von Bedeutung hatte sie nicht gesehen. Größe, Gewicht, Haarfarbe, Kleidung, es waren verschwommene Eindrücke geblieben.
Eine schwarze Lederjacke, da war sie sicher, weil sie ihre Hände hineingekrallt hatte. Schwarze Lederjacken gab es viele, das halbe Dorf lief darin herum, nicht unbedingt in einer warmen Nacht wie dieser, trotzdem. Und wenn ihr Mann erfuhr, dass sie sich in der Lohberger Diskothek von jungen Männern ansprechen ließ…
Rita wollte kein Risiko eingehen. Dass das nächste Paar vielleicht weniger Glück haben, dass es irgendwann Tote geben könnte, daran dachte sie nicht. Die erste Möglichkeit, die Wiederholung des Blutsommers durch rechtzeitige Ermittlungen zu verhindern, wurde vertan. Der Mann hatte wieder einmal Glück gehabt.
Miriam
Im Sommer 95 war es eine verzweifelte Mutter gewesen, die verhindert hatte, dass die Kriminalpolizei rechtzeitig aktiv werden konnte. Zwei Jahre später waren es junge Frauen wie Rita Meier, die um ihre Ehe und die persönliche Bequemlichkeit fürchtete, und Lukkas Erbin, Miriam Wagner. Sie wollte auf eigene Faust herausfinden, ob Lukka allein für die Verbrechen verantwortlich war, und hielt es für überflüssig, ihre Erkenntnisse mit der Polizei zu teilen. Beide mussten sie teuer zahlen für ihr Schweigen.
Ich wusste nichts von Miriam Wagner, es hatte in Lukkas Unterlagen keinen Hinweis auf sie gegeben. Und sie wusste nicht, wer Lukka wirklich gewesen war, als sie im Oktober 95 mit dem Blutsommer konfrontiert wurde.
Den halben August und den September 95 hatte sie in Spanien verbracht. Offiziell war es ein Urlaub gewesen, in Wahrheit eine Flucht. Sie floh immer, wenn sie ihr Leben nicht mehr ertrug, es als sinnlos und überflüssig empfand. Es war ein Beinahe-Leben, zerrissen an einem regnerischen Tag im März 81 – an einem Alleebaum auf der Landstraße von Lohberg ins Dorf.
An dem Tag starb ihre Mutter bei einem Autounfall – fünf Wochen nach der Verlobung mit Heinz Lukka, wenige Wochen vor der Hochzeit. Damals war Miriam Wagner zwölf gewesen, jetzt war sie sechsundzwanzig. Eine auf den ersten Blick kleine, unscheinbare, kindlich wirkende Frau mit einem steifen Bein, einer tiefen Narbe im Gesicht und so vielen Narben in der Seele, dass man sie nicht zählen konnte.
Von Britta Lässlers Tod, dem Mordversuch an Tanja Schlösser und den vermissten jungen Frauen hatte Miriam weder gehört noch gelesen. Eine Mordserie in einem Dorf, nahe einer Kleinstadt, deren Namen kaum jemand kannte, war in Spanien nicht von Bedeutung.
Als sie Anfang Oktober 95 zurückkam, lag das Kuvert in ihrem Zimmer. Absender war die Anwaltskanzlei Heinz Lukka in Lohberg, seine Kanzlei. Die Einladung zur Testamentseröffnung. Es traf sie wie ein Schlag in den Rücken. Der Mann, der beinahe ihr Vater geworden wäre, war tot.
Seine sanfte Stimme verfolgte sie während der Fahrt von Köln nach Lohberg über die Autobahn, wurde mit jedem Kilometer eindringlicher. Kleine Maus hatte er sie immer genannt, auch als sie längst erwachsen war. Zuletzt getroffen hatte sie ihn an dem Abend im Juli 95, an dem Svenja Krahl verschwand. An einem Tisch in einem Kölner Restaurant hatte er ihr gegenübergesessen, ein schmächtiger, kultivierter Mann von siebenundsechzig Jahren.
Er steckte ihr das Geld für den langen Urlaub zu und sprach davon, sich nun bald aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Er hatte schon vor Jahren zwei junge Anwälte eingestellt, um sich zu entlasten, Zeit zu finden für Reisen, etwas zu sehen von der Welt, ehe er für immer die Augen schloss. So hatte er es ausgedrückt, nun waren sie geschlossen.
Es herrschte eine merkwürdige Stimmung in der Kanzlei, so bedrückend und grau wie der Himmel draußen. Einer der jungen Anwälte, die er zu seiner Entlastung eingestellt hatte, war nicht mehr da. Der andere begrüßte sie mit unbewegter Miene und erklärte, noch während er ihr aus der Jacke half, dass sie nicht Alleinerbin sei. Das kümmerte sie nicht, sein Vermögen hatte sie nie interessiert, nur er, der einzige Mensch, dem sie wirklich etwas bedeutet hatte. Und dass er tot sein sollte…
Seine langjährige Sekretärin, an die Miriam Wagner sich noch flüchtig erinnerte, gab nur zögernd Auskunft über seine letzte Ruhestätte. Ein anonymes Urnengrab auf dem Lohberger Friedhof.
«Warum wurde er nicht im Dorf bestattet?», fragte sie.
Es gab ein Familiengrab, in dem seine Eltern lagen, das wusste sie genau. Er hatte häufig davon gesprochen, dass er darin beigesetzt werden wollte. Im ersten Moment dachte sie, er hätte ein Grab in Lohberg gewählt, damit sie ihn besuchen konnte. Ins Dorf fuhr sie nicht. Sie hätte an dem Alleebaum auf der Landstraße vorbeifahren müssen, der ihre Mutter das Leben, sie selbst das Gesicht und die Zukunft gekostet hatte. Aber anonym, das passte nicht zu diesem Gedanken.
«Das hielten wir nicht für sinnvoll», antwortete die Sekretärin, brachte noch Kaffee für alle und verließ den Raum so eilig, als fürchte sie sich vor weiteren Fragen.
Es saß bereits ein Paar im Büro, Jakob und Frau Doktor Anita Schlösser. Die Namen waren Miriam geläufig. Jeden Monat hatte Heinz Lukka ihr einen langen Brief geschrieben. Und statt ausführlich über sich hatte er über das Dorf berichtet, das beinahe ihre Heimat geworden wäre, über die Sorgen und Nöte der Einwohner, ihre Beziehungen zueinander, freundschaftliche Bande und familiäre Stricke, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. Sie kannte jeden, der in den Blutsommer verwickelt oder davon betroffen gewesen war, nur dem Namen nach, dafür mit sämtlichen Beziehungen und Verflechtungen im Dorfgefüge.
Besonders oft hatte Heinz Lukka die Familien Lässler und Schlösser erwähnt, sich über die langjährige Freundschaft ausgelassen mit einem Hauch von Schwermut zwischen den Zeilen, weil sie aus ihm unerfindlichen Gründen auf ihn herabschauten. In einem Brief hatte er versucht, ihr den ältesten Lässler-Sohn Andreas schmackhaft zu machen. Er war sehr enttäuscht gewesen, dass sie nichts unternahm, Andreas Lässler kennen zu lernen, und dieser Sabine Wilmrod heiratete, die einzige Tochter des Mannes, dem der Baumarkt in Lohberg gehörte. Auch Achim Lässler, der so viel Pech mit seinen Freundinnen hatte, und Lukkas Erzfeind Bruno Kleu wurden oft erwähnt. Von «meinem Freund Ben» war in jedem Brief die Rede.
Als agiles, bemerkenswertes Kerlchen hatte Heinz Lukka ihn oft bezeichnet und sich darüber amüsiert, dass weder sein Vater noch sonst jemand ihn zu sinnvoller Arbeit anhalten konnte.
Kerlchen, darunter stellte Miriam sich ein schmächtiges Wesen vor, geduckte Haltung, den typisch debilen Ausdruck im Gesicht, ein bedauernswertes Geschöpf. Nun fiel diesem Geschöpf ein stattliches Wertpapierdepot zu – mit einer kleinen Einschränkung, die sie nur am Rande registrierte–, zur Verfügung bis zum Tod. Danach sollte eine gemeinnützige Einrichtung zur Förderung Behinderter in den Genuss der Wertpapiere kommen.
Das Geschäftshaus in Lohberg ging an sie und garantierte ihr eine sorgenfreie Zukunft in finanzieller Hinsicht. Doch in dieser Hinsicht hatte sie sich bisher keinen Gedanken zu viel gemacht. Sie lebte noch bei ihrem Vater, natürlich auch von ihm. Darüber hinaus hatte Heinz Lukka sie in all den Jahren großzügig unterstützt, ihr jeden Wunsch erfüllt, auch einen kostspieligen Wagen. Trotzdem beschwerte Miriams Vater sich oft, dass sie keine Anstalten machte, einen Beruf auszuüben. «Andere in deinem Alter…» Das hörte sie mindestens dreimal in der Woche. Ihn würde es freuen, dass sie nun über stattliche Mieteinkünfte verfügen konnte.
Im Erdgeschoss des Hauses lagen die Anwaltskanzlei und die Praxis eines Orthopäden. Im ersten Stock praktizierten ein Internist und ein Zahnarzt, im zweiten Stock ein Kinderarzt und ein Gynäkologe, im Dachgeschoss ein Augenarzt und ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Nur Ärzte.
«So kann ich mir einbilden, dass ich dazugehöre», hatte Heinz Lukka einmal gesagt. Er hätte gerne Medizin studiert, aber sein Vater hatte ihm keine Wahl gelassen. Darüber hatte er einmal gesprochen, als sie gerade neunzehn wurde und kurz vor dem Abitur stand. «Überleg dir gut, wie du dich entscheidest, kleine Maus. Du musst es dein Leben lang tun. Wenn es dich nicht ausfüllt…»
Sie hatte nicht lange überlegen müssen, hatte wie er keine Wahl gehabt. Seit dem Tod ihrer Mutter wollte sie Psychologie studieren. Ihr Studium hatte sie abgeschlossen, verfügte über ein Diplom, das sie befähigte, als Therapeutin tätig zu werden. Aber in ihrem Leben war kein Platz für die Nöte und Probleme anderer. Sie wollte mit ihrem Wissen um auslösende Momente, Zusammenhänge und Reaktionen nur den eigenen Schmerz bewältigen, den Verlust ihrer Mutter und ihre Hoffnung auf einen Vater, der Zeit für sie hatte.
Ihr Vater hatte diese Zeit nie gehabt. Er war ein biederes Gemüt, hatte sich mit Zähigkeit hochgearbeitet vom Möbelschreiner zum Antiquitätenhändler. Ein Vermögen hatte er gescheffelt, zwei Läden eingerichtet. Er beschäftigte vier Verkäufer und stand selbst in der Werkstatt, von morgens bis abends, weil er mit seiner betuchten Kundschaft nicht umgehen konnte.
Auch als ihre Eltern noch verheiratet gewesen waren, hatte sie ihn oft tagelang nicht zu Gesicht bekommen. Ihre Mutter vermutete, dass er sich von Holzwürmern ernährte, weil er nicht mal zum Essen in der Wohnung erschien. Allein mit ihr am Tisch verging ihrer Mutter dann meist der Appetit, und statt zu essen, trank sie. Ein paar Mal musste sie zur Kur, versprach anschließend jedes Mal, dass jetzt alles anders würde. Aber es änderte sich erst etwas, als Heinz Lukka in ihr Leben trat.
Wann genau und wo ihre Mutter ihn kennen gelernt hatte, wusste Miriam Wagner nicht, vermutlich in irgendeiner Bar in Köln. Aber sie erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem ihre Mutter sie zum ersten Mal mitnahm nach Lohberg. Die Scheidung lief, ihre Mutter wollte für die Übergangszeit eine Wohnung in der Kleinstadt mieten. Heinz Lukka war ihr bei der Suche behilflich, er vertrat sie auch bei der Scheidung, die auf seine Initiative hin eingereicht worden war.
An dem Tag sagte ihre Mutter bestimmt hundertmal: «Du wirst ihn mögen, Herzchen.» Sie schwärmte von seiner Bildung, den exzellenten Manieren, ein Kavalier alter Schule, der genau wusste, womit man eine Frau glücklich machte. Besuche in der Oper, der Philharmonie oder einem Museum, Kunst und Kultur, Aufmerksamkeit und ein geduldiges Ohr für sämtliche Nöte. Heinz Lukka bot alles, was der Holzwurm nicht bieten konnte.
Die Wohnung, die er für sie ausgesucht hatte, lag nur zwei Straßen von seiner Kanzlei entfernt. Ein Auto brauchten sie nicht, um ihn zu besuchen, nachdem sie die leeren Räume besichtigt hatten. Am Abend fuhren sie in seinem Wagen ins Dorf.





























