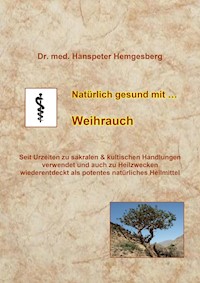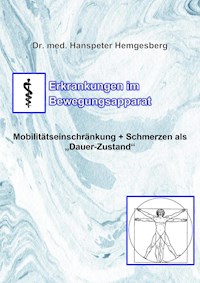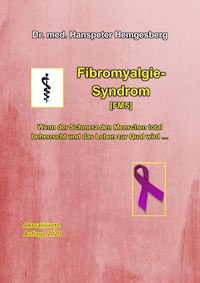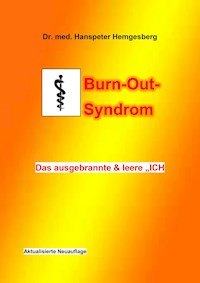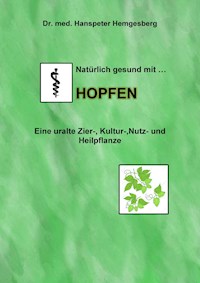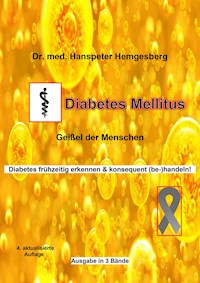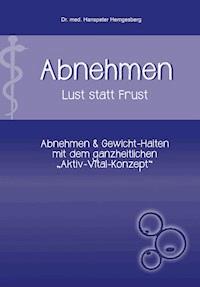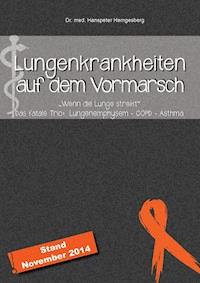
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Bedeutete die Erkrankung an "Lungentuberkulose" bis zur Entwicklung der "Tuberkulostatika" eine schwere Zäsur nicht nur in der Gesundheit des Kranken, sondern in seiner Lebenserwartung dar, stellt die Erkrankung (mit steigenden Erkrankungszahlen) an "Lungenkrebs" nach wie vor ein Lebensrisiko - trotz aller medizinischen Fortschritte in Diagnostik und Therapie - dar, so macht ein "fatales Trio an chronischen Lungenkrankheiten" - Asthma bronchiale, Lungenemphysem & COPD – ganz besonders zu schaffen: primär den Betroffenen, da die Krankheiten (noch) nicht heilbar sind und dann auch den Behandlern. Die Zahl der von diesen chronisch-obstruktiven Lungenkrankheiten betroffenen Menschen geht weltweit in den hohen Millionenbereich. Und die Erkrankungszahlen nehmen ständig zu; u.a. ein "stolzer" Preis für unser modernes Leben mit all seinen Umweltbelastungen und dazu das Quantum an eigen-verschuldeten = hausgemachten Schadenselementen. Ganz gleich, um welche Krankheit aus diesem Trio es sich handelt - zwischen diesen bestehen zudem 'fließende Übergänge' -, meine langjährige Erfahrung findet sich immer wieder bestätigt: Die Behandlung ist umso erfolgreicher und umso geringer für den Kranken belastend, wenn diese sich darstellt als individuelles, variables und multi-modales Behandlungskonzept als synergistische Symbiose von Schulmedizin (sie hat absolutes Primat!) und seriösen Optionen der biolog.-naturheilkundlichen Medizin i.S.d. "Ganzheitsmedizin".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Hanspeter Hemgesberg
Lungenkrankheiten auf dem Vormarsch
"Wenn die Lunge streikt“ - Das fatale Trio: Lungenemphysem - COPD - Asthma
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Lungenkrankheiten
Luft, Leben, Lunge
Asthma bronchiale Teil I
Asthma bronchiale Teil II
Lungen-Emphysem
COPD
Glossar
Impressum neobooks
Vorwort
Lungenkrankheiten
auf dem Vormarsch
„Wenn die Lunge streikt“
Das fatale Trio:
Lungenemphysem - COPD - Asthma
Ein ganzheitsmedizinischer Ratgeber
Dieses Buch
Lungenkrankheiten auf dem Vormarsch * „Wenn die Lunge streikt“ - Das fatale Trio: Lungenemphysem - COPD - Asthma
will Sie - als „Lungenkranker“, allgemein an der eigenen Gesundheit Interessierten und besonders aber auch alle biologisch-naturheilkundlich (besonders ganzheitlich) orientierte Therapeuten - informieren und beraten. Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine Verbindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Lungenkrankheiten
Lungenkrankheit (Gedicht
In jedem Atemzug
wispert
meine Seele
deinen Namen.
Chantal Lahnstein
Deutscher Lungentag
Der
Deutsche Lungentag
ist eine jährlich fortlaufende Aktion. Diese Aktion wird getragen vom Verein
Deutscher Lungentag
e.V. [Anschrift s. Glossar] ...
Der Deutsche Lungentag findet jährlich statt am
20. September
2014 zum 17.mal.
Heuer ist das Leitmotto:
„
Gesunde Lunge – Grundlage des Lebens“
Hinweis
W
ichtige Fachbegriffe bzw. Fremdwörter - schulmedizinische wie biologisch-naturheilkundliche - in diesem Buch sind gekennzeichnet mit einem [?].
Im Glossar werden diese Termini unter
„Lexikon: Was bedeutet …?“
in alphabetischer Reihenfolge erklärt/erläutert.
Ihr
Dr. Hanspeter Hemgesberg
Luft, Leben, Lunge
Atmen heißt Leben!
Wir alle machen es bis zu 30.000 Mal am Tag. In Ruhe etwa 16 Mal pro Minute. Bei körperlicher Anstrengung oder Aufregung auch öfter - wir atmen ein, wir atmen aus. Wir folgen diesem Rhythmus von Geburt an bis zum Tod, ganz unbewusst, automatisch und selbstverständlich. Ohne diesen regelmäßigen Vorgang könnten wir nicht leben.
Unser Körper verlangt nach Sauerstoff, um das Kraftpaket Mensch optimal mit Energie zu versorgen
, versorgen zu können. Täten wir dies nicht, würde unser Körper uns das schnell übel nehmen.
[Quelle: MEDICOM Pharma GmbH]
S
o ist „das“ als
„Normalzustand“
des Menschen.
Und, dass „das“ so ist - und im optimalen und wünschenswerten Falle auch bleiben kann & bleibt (und möglichst bis zum „letzten Atemzug“), dafür sorgt unsere LUNGE.
B
evor wir uns mit Schädigungen/Erkrankungen an diesem in des Wortes wahren Sinne beschäftigen, möchte ich zuerst - quasi im Schnelldurchgang -
„Wichtiges & Wissenswertes“
über unser Atmungsorgan zu Papier bringen.
Lunge (Anatomie & Funktion)
Die
Lunge
(Pulmo)
ist ein der
Atmung
dienendes, paarig angelegtes
Organ
. Sie nimmt
Sauerstoff
aus der
Atemluft
auf und transportiert
Kohlendioxid
als Endprodukt des Körperstoffwechsels ab.
D
er Mensch besitzt zwei Lungen(hälften), die zu beiden Seiten der
Brusthöhle
liegen und vom
Mediastinum
getrennt werden. Die linke Lunge (Pulmo sinister) ist in zwei, die rechte Lunge (Pulmo dexter) in drei
Lungenlappen
(Lobi pulmonis) unterteilt. Die Lungenlappen lassen sich weiter in 19
Lungen-Segmente
(Segmenta broncho-pulmonalia) gliedern, die jeweils von einem
Segmentbronchus
und einer
Segmentarterie
versorgt werden. Die Segmente sind funktionelle Untereinheiten der Lunge. Es gibt jeweils 10 Segmente pro Lungenfügel, wobei das Segmentum apicale und das Segmentum posterius auf der linken Seite zum Segmentum apicoposterius verschmelzen. Deshalb besitzt der linke Lungenflügel eigentlich nur 9 Segmente.
Die Lunge beginnt im Prinzip am Lungenhilus (Hilum pulmonis),
lateral
der Luftröhre (
Trachea
). Diese verzweigt sich in der
Bifurkation
in die beiden
Hauptbronchien
(Bronchi principales), die gemeinsam mit den
Lungenarterien
und den
Lungenvenen
in den Hilus eintreten. Der Hauptbronchus bildet den Stamm des
Bronchialbaums
, der sich innerhalb der Lunge verzweigt und letztlich über die
Bronchiolen
in die
Alveolen
übergeht.
In der Trachea und den Bronchien werden die luft-führenden Hohlräume von
Knorpelspangen
offen gehalten. In den Bronchiolen sieht man nur noch inselartige Knorpelvorkommen.
Die Alveolen enthalten keinen Knorpel. Damit die Alveolen nicht bei der Ausatmung zusammenfallen sind sie mit
Surfactant
[?] benetzt.
Außen ist die Lunge vom
viszeralen
Blatt des Lungenfells (
Pleura
) überzogen. Am Lungenhilus geht das viszerale Blatt in das parietale
Blatt der Pleura
(„Rippenfell“)
über. Die Pleuraduplikatur
kaudal
des Hilus bezeichnet man als
Ligamentum pulmonale
.
A
ls
Lungenfunktion
wird die
physiologische
oder
pathologische
Funktion der
Lunge
als Organ für den Gasaustausch bei der äußeren
Atmung
bezeichnet.
Im
medizinischen
Alltag hat sich der Begriff Lungenfunktion (Abk. LuFu) auch als Sammel- und Oberbegriff für die verschiedenen Untersuchungsverfahren der Lungenvolumen-Messgrößen und anderer Kennzahlen der Lungenfunktion eingebürgert, z.B. der
Spirometrie
(
„kleine Lungenfunktion“
) und der
Bodyplethysmographie
(
„große Lungenfunktion“
) [vgl. Diagnostik].
Die
physiologische Funktion der Lunge
besteht im sogenannten Gasaustausch, der Aufnahme von
Sauerstoff
in den Körper und Abgabe von
Kohlendioxid
aus dem Körper. Damit spielt die Lunge auch in der Regulation des
Säure-Basen-Haushaltes
eine wichtige Rolle.
So der „Normalzustand“.
B
ei Erkrankungen im Bereich des Atmungsorgans sieht das schon ganz anders aus.
Einmal abgesehen von (zumeist) nur kurzzeitig andauernden Beschwerden bei akuten Entzündungen (z.B. Bronchtis, Bronchial-Katarrh), die zu keiner Behinderung/Störung des Gasaustausches führen, bringen gravierend(er)e „Lungenerkrankungen“ stets eine mehr oder minder und vielmals progrediente (fortschreitende) Gasaustausch-Störung - eine „Ventilationsstörung“ oder eine „Belüftungsstörung“ mit sich.
Bei den
Ventilationsstörungen
gilt es zu unterscheiden zwischen:
1. Obstuktive Ventilationsstörung
Hier ist der
Atemwegswiderstand erhöht
. Verursacht werden kann dies durch Sekret oder Fremdkörper in den Atemwegen - Bronchien (z.B. bei chronischer Bronchitis), durch einengenden Druck von außen (z.B. Tumor oder Ödeme), durch Emphyseme (Lungenüberblähung) oder Verengung der Bronchien (z.B. durch Asthma bronchiale oder spastische Bronchitis).
Die Obstruktive Lungenfunktionsstörung zeigt sich im
Tiffeneau-Test
durch forcierte Exspiration, wobei das Forcierte Exspiratorische Sekunden- Volumen (FEV1) erniedrigt ist, die Forcierte Vitalkapazität (FVC) aber gleich bleibt. Ebenso können ein erhöhtes Residualvolumen sowie eine verminderte Vitalkapazität bei länger andauernder Obstruktion diagnostiziert werden.
Krankheitsbilder, die eine Obstruktive Ventilationsstörung verursachen, sind Asthma, chronische Bronchitis bzw. COPD, Fremdkörperaspiration.
2. Restriktive Ventilationsstörung
Hier ist die Vitalkapazität und die totale Lungenkapazität vermindert. Verursacht ist dies durch eine eingeschränkte Compliance des Atemapparats (die Dehnungsfähigkeit ist eingeschränkt). Das Auftreten einer restriktiven Lungenfunktionsstörung kann z.B. an Verwachsungen der Pleura, Lungenfibrose, Verlust von Lungengewebe oder Thorax-Beweglichkeit (zum Beispiel Skoliose, Trichterbrust) liegen.
3. Respiratorische Insuffizienz
Nach der GOLD-Klassifikation [vgl. Klassifikation bei Besprechung COPD, später im Buch] liegt sie vor, wenn der Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut unter 60 mmHg oder Kohlendioxidpartialdruck im arteriellen Blut über 50 mmHg liegt.
Außerdem ist zu unterscheiden zwischen
Perfusions-
und
Diffusions-Störungen
:
1. Perfusionsstörungen
Unter
Perfusion
ist die Durchblutung der Lungenkapillaren zu verstehen, angepasst an die Ventilation.
Perfusionsstörungen:
Bei Gefäßverschlüssen ist die Perfusion im Verhältnis zur Ventilation eingeschränkt. Sie beruhen auf einem Missverhältnis von Durchblutung und Belüftung von Lungenabschnitten. Beispiele sind Lungenembolie, Lungenfibrose (Verdickung der Alveolar-Membran) und Lungenemphysem (Lungenüberblähung). Bei eingeschränkter oder fehlender Perfusion wird der Totraum vergrößert (der Raum, der nicht am Gasaustausch beteiligt ist).
2. Diffusionsstörungen
Die
Diffusion
ist ein passiver Transportvorgang, Teilchen wandern vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration.
Gasaustausch in der Lunge: O
2
gelangt aus der Luft in den Alveolen durch die Membran in die Kapillaren, CO
2
aus dem Lungenkapillarblut in die Alveole.
Diffusionsstörungen:
D.s. Gasaustauschstörungen, die zu einer Lungenfunktionsstörung führen. Das können sein: verlängerter Weg des Austausches von O
2
/CO
2
bei Lungenfibrose durch Verdickung der Alveolar-Membran. Verlust von Alveolen: Austauschfläche ist verkleinert bei Pneumonie und Lungenemphysem. Verkürzte Kontaktzeit: bei Lungenresektion.
N
unmehr zu Erkrankungen der Lunge und zwar ausschließlich zu chronischen Lungenkrankheiten
(Chronische) Lungenkrankheiten
Chronische Lungenkrankheiten im „Kurzportrait“
E
s würde den Rahmen dieses Buches sprengen, würden sämtliche chronischen Lungenkrankheiten ausführlich besprochen werden. Die ausführliche Beschreibung soll dem „fatalen Trio der Lungenkrankheiten“ - Asthma bronchiale, Lungenemphysem, COPD - vorbehalten bleiben.
Wobei aber auch festgehalten werden muss, dass die weiteren chronischen Krankheiten der Lunge ebenfalls gravierend in das Leben allgemein und speziell die Gesundheit des Kranken eingreifen.
D
aher will & werde ich - allerdings in Kurzform als „Kurzportrait“ - die nachfolgenden chron. Lungenkrankheiten (in alphabetischer Reihenfolge, nicht nach „Bedeutung“) beschreiben, u.a. auch, weil die „drei großen Lungenkrankheiten“ abgegrenzt werden müssen gegenüber diesen Krankheiten:
Bronchiektasie
Chronische Bronchitis
Lungen-Atelektasie
Lungen-Fibrose
Lungen-Sarkoidose (M. Boeck * „Lungen-Boeck“)
Lungen-Tuberkulose (M.Koch)
- Bronchiektasie
Darunter ist eine dauerhaft irreversible Ausweitung der Bronchial-Äste zu verstehen; zumeist vorkommend in den basalen Lungenabschnitten. Bronchiektasien können zur Verlegung der Bronchien führen. Zu unterscheiden ist zwischen angeborener & erworbener Bronchiektasie.
Führende Symptome sind:
Dyspnoe
(Atemnot) in Verbindung mit sekret-reichem
Husten
, bes. stark sind die Symptome früh morgens. V.a.
„Bluthusten“
(Haemoptyse: Hsuten mit blutigem Auswurf). Es besteht Anfälligkeit gegenüber Pneumonien. Ohne adäquate Therapie entwickeln die Kranken eine
Zyanose
(blau-rötliche Verfärbung an Lippen & Schleim-Häuten) und es finden sich infolge der Sauerstoff-Minderversorsung die sog.
„Trommelschlegel-Finger“
- Chronische Bronchitis
Eine
chronische Bronchitis
ist eine chronische Entzündung der Atemwege, welche sich vornehmlich im Bereich der Bronchien abspielt. Laut WHO-Definition müssen zur Diagnose einer chronischen Bronchitis folgende Kriterien erfüllt sein: a) produktiver Husten über einen Zeitraum von 3 Monaten und b) Vorkommen dieser Symptomatik in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Als Hauptursache der chronischen Bronchitis gelten Inhalations-Schadstoffe, vornehmlich Rauchen, aber auch berufliche Feinstaubexposition. Weitere begünstigende Faktoren sind unter anderem: 1. Gehäufte broncho-pulmonale Infekte, z.B. in Folge kardialer Vorerkrankungen oder 2. Antikörpermangelsyndrom, ferner 3. erblich bedingte Störungen der muko-ziliären Clearance, z.B. bei zystischer Fibrose oder primärer Zilien-Dyskinesie und 4. Atemwegseinengung und -kompression (z.B. Bronchusstenose). Leitsymptom der chronischen Bronchitis ist einen langen Zeitraum andauernder, produktiver Husten mit weißlichem Auswurf. Bei chronisch-obstruktiver Bronchitis kann zusätzlich eine Belastungsdyspnoe auftreten. Bei schwer exazerbierten Verlaufs-Formen ist auch eine Ruhedyspnoe möglich. Komplikationen sind:
Exazerbation
(= Die Sekretanschoppung begünstigt bakterielle Infektionen, die zu einer akuten Verschlechterung des Krankheitsbildes führen können),
Lungen-Emphysem
(Deszendiert die Infektion in den Bereich der Alveolen, können Elastasen neutrophiler Granulozyten die Alveolarsepten einschmelzen. Förderlich wirkt sich dabei ein Mangel an Proteaseinhibitoren {Alpha-1-Antitrypsin-Mangel} aus),
Cor pulmonale
Eine Form der chron. Bronchitis ist die chronbisch abstruktive Bronchitis, die COPD (s.d.).
- Lungen-Atelektas(i)e
Unter einer
Atelektase
versteht man ein Belüftungsdefizit der Lunge oder von Teilabschnitten der Lunge. Es kann sich um eine fehlende oder um eine unvollständige Belüftung handeln. Man unterscheidet zwischen einer primären (= angeborenen) Atelektase und einer sekundären (= erworbenen) Atelektase. Ursachen für eine sekundäre Atelektase können unter anderem sein: a) durch den Druck von pleuritischen Exsudaten, Geschwülsten der Brusthöhle, der Wirbelsäule u. dgl. auf die Lunge, wodurch die letztere allmählich blutleer, blassgrau, lederartig zähe und für ihre physiol. Funktionen unfähig wird (Kompressions-Atelektase), b) eine Bronchus-Verlegung führt zu einer verminderten Belüftung (Obstruktions-Atelektase), c) im Rahmen von fibrosierenden bzw. vernarbenden Lungen-Gewebserkrankungen kommt es zu einer Mangelbelüftung (Kontraktions-Atelektase) und d) hervorgerufen wird diese Form infolge einer funktionellen Störung der Alveolen-Funktion (Lungenbläschen), so z.B. führt ein Schockereignis zu einer Minderversorgung des Lungengewebes und daraus resultiert ein Surfactant [?], Folge: das Lungengewebe schrumpft (Mikro-Atelektase).
Eine Atelektase führt zur Ausbildung eines funktionellen Shunts. Nicht-oxygeniertes Blut wird aus den Lungenarterien in die Lungenvenen geleitet. Dadurch verschlechtert sich das Verhältnis von Ventilation zu Perfusion. Für den Organismus kann dadurch bei größeren Atelektasen eine schwerwiegende Hypoxie resultieren.
- Lungen-Fibrose
Die
Lungenfibrose
ist eine chronische, diffuse Erkrankung des Lungen-Gewebes mit dem Leitbefund einer fortschreitenden Fibrosierung (= krankhafte Vermehrung des Bindegewebes in Geweben und Organen, dessen Hauptbestandteil Kollagenfasern sind. Dabei wird das Gewebe des betroffenen Organes verhärtet. Es entstehen narbige Veränderungen, die im fortgeschrittenen Stadium zur Einschränkung der jeweiligen Organfunktion führen) des Lungen-Gewebes. Sie entsteht durch chronische Entzündungsvorgänge des Interstitiums, die zu einem bindegewebigen Umbau des interstitiellen Gewebes führen, bei dem die alveolären Membranen mitbetroffen sind.
Bekannte Ursachen
: Infektionen, Inhalative Schadstoffe, anorganische Stäube (u.a. Asbest, Quarz), Gase, Dämpfe, Haarsprays, Arzneimittel, Herbizide, Ionisierende Strahlen, Lungenschädigung durch eine kardio-vasculäre Grunderkrankung, Stauungslunge bei Linksherz-Insuffizienz dazu Systemerkrankungen wie Sarkoidose (M. Boeck, s.u.), Kollagenosen und Autoimmunkrankheiten wie Vasculitiden und Rheumatoide Arthritis.
Unbekannte Ursachen
: Idiopathische interstitielle Pneumonie (IIP), Idiopathische pulmonale Fibrose, usual interstitial pneumonia, akute interstitielle Pneumonie, diffuser alveolärer Schaden.
Die Lungenfibrose ist durch folgende
Symptomatik
gekennzeichnet:
1. Im Anfangsstadium: Belastungsdyspnoe (Atemnot unter Belastung), Tachypnoe (vermehrte Atemzüge), evtl. Fieber (Vorsicht: hier erfolgt leicht die Fehldiagnose Pneumonie), trockener Reizhusten
2. Im fortgeschrittenem Stadium: Zyanose, Trommelschlegelfinger Uhrglasnägel, Cor pulmonale, Terminale respiratorische Insuffizienz.
Das Endstadium einer Lungenfibrose wird durch die sog.
Wabenlunge
markiert.
- Lungen-Sarkoidose (M. Boeck * „Lungen-Boeck“)
Die
Sarkoidose
ist eine granulomatöse Entzündung. Sie kann prinzipiell jedes Organ befallen, fällt klinisch jedoch am ehesten durch den Befall der Lungen auf; dann genannt M. Boeck oder „Lungen-Boeck“. Das Röntgenbild zeigt typische Veränderungen, die auch zur Stadieneinteilung der Sarkoidose genutzt werden.
Stadium 0:
unauffälliger Thorax bei extrapulmonalem Befall
Stadium 1:
bi-hiläre Lymphadenopathie (= Unspezifische Erkrankung der Lymphknoten) ohne sichtbare Lungen-Beteiligung, Hilusvergrößerung in der Regel beidseits
Stadium 2:
bi-hiläre Lymphadenopathie
mit
Lungenbeteiligung, die Lunge zeigt eine retikulo-noduläre Zeichnung
Stadium 3:
Lungenbefall ohne sichtbare Lymphadenopathie
Stadium 4:
Lungenfibrose mit Funktions-Verlust der Lunge. Komplikationen: Lungenzirrhose, Lungenemphysem, Cor pulmonale.
- Lungen-Tuberkulose (M.Koch)
(früher bezeichnet als Schwindsucht od. Lungenschwindsucht)
Meist chronisch verlaufende exsudative oder produkltive Lungen-Entzündung infolge Infektion mit dem humanen Mycobacterium tuberculosis, seltener (10%) mit dem bovinen-Typ (Rindertyp). Die Lungen-Tb ist die häufigste und folgenschwertste Form der Tb. Beginnt v.a. mit einer Pleuritis exsudativa (sog. nasse Rippenfell-Entzündung). Auf diese folgt als 2. Phase eine „käsige Pneumonie“ (mit Bildung von Kavernen oder Verkalkungen); in der produktiven Phase kommt es zur Bildung von Granulationsgewebe (mit Gewebeschrumpfung in Form von Tuberkel). Klinisch erfolgt eine Einteilung nach Infektionsstadium:
1. Latente tuberkulöse Infektion:
Erstinfektion mit erfolgreicher Eindämmung der Erreger, jedoch Persistenz im Organismus.
2.
Primärtuberkulose:
Organmanifestation nach Erstinfektion.
3.
Postprimärtuberkulose:
Reaktivierte Tuberkulose, zeitliche Latenz kann mehrere Jahrzehnte betragen.
Symptome
: Bei Erstinfektion kommt es nach einer Inkubations-Zeit von 6-8 Wochen zu unspezifischen Symptomen im Sinne einer B-Symptomatik wie: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Inappetenz. Bei Ausbildung eines tuberkulösen Primärkomplexes oder einem primär pulmonalen Verlauf können hinzutreten: Husten, Hämoptyse (Bluthusten), lokale Lymphknotenschwellungen und Dyspnoe.
Das vermehrte Auftreten von bakteriellen Resistenzen hat die Behandlung der Tuberkulose in den letzten Jahren deutlich erschwert. Auslöser ist der falsche oder unkontrollierte Einsatz der verfügbaren Tuberkulostatika. Auf dieser Basis hat man Sonderformen der Tuberkulose definiert. Dazu zählen: Multiresistente Tuberkulose (MDR-Tb) und Extrem Arzneimittel-resistente Tuberkulose (XDR-Tb).
Lungen-Tb ist eine meldepflichtige Krankheit und zwar sowohl Erkrankung an Tb wie auch Tod durch Tb; auch jede behandlungsbedürftige Tb, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis (noch) nicht vorliegt; ebenso sind Personen zu melden, die an einer Tb erkrankt sind und die eine Therapie ablehnen oder vorzeitig abbrechen.
Damit ist der 1. Teil des Buches beendet.
Nachgehend nunmehr zu den
„drei fatalen Lungenerkrankungen“
. Den Anfang macht …
Asthma bronchiale Teil I
Wenn die Brust wie zugeschnürt ist und der Atem „pfeift“
Welt-Asthma-Tag 06. Mai Mythen & Fakten
Mythos:
Asthma kommt und geht.
Fakt:
Asthma ist eine chronische Entzündung in den Bronchien, die immer da ist, auch wenn gerade keine Beschwerden vorhanden sind.
Mythos:
Asthma ist eine psychische Erkrankung.
Fakt:
Asthma ist eine Erkrankung der Lunge und nicht der Psyche. Emotionaler Stress kann allerdings Asthmasymptome z.B. durch Ausschüttung von Entzündungsstoffen verschlimmern.
Mythos:
Asthmamedikamente sollten nur bei Beschwerden eingesetzt werden, sonst gewöhnt sich der Körper daran und sie verlieren sie ihre Wirksamkeit.
Fakt:
Nur die regelmäßige Anwendung von Medikamenten kann die ursächliche Entzündung in den Bronchien bekämpfen und Asthmaanfälle verhindern. Entzündungshemmende Asthmamedikamente verlieren ihre Wirkung nicht.
Mythos:
Asthma bei Kindern verwächst sich.
Fakt:
Die angeborene Überempfindlichkeit der Bronchien bleibt bestehen, auch wenn bei vielen Kindern die Asthmas-Symptome mit dem Alter weniger werden.
Mythos:
Asthma verschwindet, wenn man ans Meer oder in die Berge zieht.
Fakt:
Ein Umzug ans Meer kann bei einer Milbenallergie ein Asthma sogar verschlechtern, wenn dort keine Milbensanierung durchgeführt wird. Wenn die individuellen Auslöser vermieden werden und eine regelmäßige Behandlung durchgeführt wird, kann ein Asthmakranker überall leben.
Kurz & knapp zu Beginn
Asthma Bronchiale ist eine chronische Entzündung der Atemwege.Die
CHRONISCHE BRONCHTIS
, das
LUNGEN-EMPHYSEM
(Bläh-Lunge * s. später separates Kapitel), das
COPD
ASTHMA BRONCHIALE
zählen zu den großen/ bedeutenden Erkrankungen der tiefen/ unteren Atemwege; wobei es zwischen diesen Erkrankungen
fließende ‚Übergänge‘
gibt. So z.B. COPD mit Lungenemphysem, Asthma mit chron. Bronchitis, chron. Bronchitis mit COPD u.a.
Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindes- und jüngeren Jugendlichen-Alter. In Deutschland sind etwa 10-12% der Kinder und 5-8% der Erwachsenen betroffen.In den letzten Jahrzehnten hat sich Asthma zu einer regelrechten
„Volkskrankheit“
entwickelt und zwar weltweit. Dabei ist auffallend, dass weder hoch-industrialisierte + schadstoff-belastete noch besonders arme, noch besonders rauch-freudige Gegenden einen Einfluss haben auf die Prävalenz (Häufigkeit der Erkrankung je 100.000 Einwohner). Fakt ist, dass man Asthma als
„Lungenkrankheit der britischen Insel“
bezeichnen kann, denn die Weltrangliste der Asthma-Kranken führen Schottland mit 18,4 und England mit 15,3% an, gefolgt von Australien mit 14,7 und den USA mit 10,9%. In Deutschland liegt die Erkrankungszahl bei 6,9%, in Österreich bei 5,8% und in der Schweiz finden sich nur 2,3% Asthmaktiker. Summa summarum sind
derzeit ca. 300 Mio Menschen weltweit betroffen
(Angaben der WHO) und die
Erkrankungszahlen steigen Jahr für Jahr
. Frauen, Kinder & Senioren gelten als überproportional betroffen. Zurzeit wird als (Mit-)Ursache für das Ansteigen der Erkrankungs-Zahlen der steigende Wohlstand mit der ungesünderen Lebensweise diskutiert.
B
is vor wenigen Jahren wurde in der Medizin davon ausgegangen, dass bei
Kindern & jüngeren Jugendlichen
das Asthma (weit) überwiegend „allergisch“ bedingt sei. Das ist inzwischen wissenschaftlich eindeutig widerlegt (Uni-Kinderklinik Gießen). Danach leiden - wie es auch bei Erwachsenen & älteren Jugendlichen so der Fall ist - weit überwiegend der Kinder/Jugendlichen an einem nicht-allergischen Asthma (71,3%) und lediglich 14,7% an einem ausschließlichen allergischem Asthma, bei 5,5% liegt Asthma vor aufgrund chronisch-rezidivierender Atemwegsinfekte und bei 8,4% tritt Asthma auf infolge der Exposition gegenüber Reizen (u.a. Dämpfe, Gase, Rauch usw.).
D
ie Dauer eines Asthma-Anfalls kann variieren zwischen wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden und auch über 1-2 Tage. Auslöser können Allergien, Infektionen der oberen Atemwege, Überanstrengung, psychische Belastung, Kälte, Medikamente oder verunreinigte Luft sein.
Z
ur
Diagnostik
:
Was die
Diagnostik
angeht, so hat hier die
wissenschaftliche Schul-Medizin
eindeutiges und absolutes Primat
. Empfohlen wird weitgehendes Vorgehen entsprechend den aktuellen
„Leitlinien zur Diagnostik von Patienten mit Asthma“
(herausgegeben von der Dt. Atemwegs-Liga und der Dt. Gesellschaft für Pneumologie & Beatmungsmedizin e.V. * Anschrift s. Glossar). Und dazu - insbesondere für all jene ‚Felder‘, die von der Schulmedizin nicht oder nur in geringem Ausmaß beachtet werden (z.B. Herde, Freie Radikale, Säure-Basen-Haushalt usw.) - komplementär kompetente und aussagefähige Untersuchungs-Option der
seriösen biolog.-naturheilkundlichen Medizin
.Fazit:Die Diagnostik beim Asthma bronchiale sollte in jedem Falle eine „ganzheitliche“ sein!
D
ann folgt die
Therapie
.G
rundbedingung - conditio sine qua non! - war, ist und wird bleiben:Unerlässlich ist die konsequente und ständige wie bestmögliche Mitarbeit & Einhaltung der Therapie („Compliance“) und auch die Bereitschaft zu „Eigenleistungen“ des Asthmatikers (Sport/Bewegung/ Atemübungen, Genussmittel, psychische Stabilisierung & Selbst-Management, Biorhythmus …).W
as die
Behandlung des Asthma’s - als Krankheit! -
angeht, so hat auch in diesem Punkt die
Schulmedizin absolutes Primat
!Wichtigste Maßnahme aus Sicht der wissenschaftlichen (Schul-)Medizin bei einer Asthma-Erkrankung ist es, den/die möglichen Auslöser (Staub, Haustiere bei Allergie, Zigarettenrauch u.a.) soweit als nur möglich zu (ver-)meiden.Daneben unterscheidet man
Anfallsbehandlung
und
Intervall-Therapie
bei häufigen Attacken.Man wendet dafür in der wissenschaftlichen (Schul-)Medizin u.a. Bronchial-Sprays an und verabreicht Beta-Sympathomimetika, Glucocorticoide, Methyl-Xanthine, Leukotrien-Antagonisten, Mastzell-Stabilisatoren. In schweren Fällen kann eine intravenöse Behandlung notwendig werden. Und auch eine (Dauer-)Behandlung mit Corticoiden. Daneben und dazu vielmals außerdem physikalische Therapiemaßnahmen und auch Inhalations-Therapien, u.a. mit Sauerstoff.Etliche der in der Asthma-Behandlung verwendeten Arzneimittel haben aber das Manko, dass sie einerseits Nebenwirkungen mit sich bringen und dass sie nicht selten ausgeprägte Wechselwirkungen mit sonstigen und erforderlichen Medikamenten haben und außerdem bestehen bezüglich der - und vielmals ebenfalls erforderlichen Einnahme sonstiger Medikamente - Kontraindikationen.
D
ie
biolog.-naturheilkundliche Medizin
ist, was die Krankheit Asthma angeht, sicherlich eine bewährte & effektive Behandlungsoption, allerdings mehrheitlich
additiv & komplementär zur Schulmedizin
(in leichten Fällen ggfls. auch als alleinige Maßnahme möglich).Aber hier gilt unbedingt zu wissen und zu bedenken:S
oll die Therapie bei Asthma insbes. langfristig & nachhaltig wirkungsvoll sein, dann darf das Augenmerk nicht einzig auf die Beherrschung der Asthma-induzierten Beschwerden gerichtet sein & bleiben, dann muss in jedem Falle die Krankheit
‚Asthma bronchiale‘
als
Gesamt-Organismus-Schädigung
auf allen 3 Ebenen
- mit Dysregulation bzw. Schieflage i.S.v. von Herden, Störfeldern, energetischen Blockaden über Säure-Basen-Haushalt, Freie (Sauerstoff-) Radikale, Inneres Milieu, gesamtes Hormon-Verbund-System (insbes. die „hormonelle Stress-Achse“) usw. - gesehen und entsprechend gegenregulativ behandelt werden. Das wiederum ist die
Domäne der biolog.-naturheilkundlichen Medizin!
Postulat:Mit einem individuellen
(quasi: „personalisierten“)
multi-modalen ganzheitlichen Behandlungskonzept „Asthma bronchiale“ in der Intervall- und Langzeit-Therapie
(letztere nur bei Patienten mit häufigen Asthma-Anfällen)
- mit einer synergistischen Symbiose von wissenschaftlicher Medizin mit kompetenter und seriöser biologisch-naturheilkundlicher Medizin - kann einmal die Lebensqualität der Kranken deutlich gesteigert werden, ferner kommt es zu einem Rückgang der Anfall-Häufigkeit und -dauer sowie -schwere; und nicht zuletzt können vielmals die synthetisch-chemischen Wirkstoffe reduziert werden und dadurch auch deren Nebenwirkungen.
Definition + Charakteristika
N
ach
der
Definition
des ICR (International Consensus Report) handelt es sich beim
Asthma bronchiale
(kurz genannt „Asthma“ * vom griech. „Atemnot“) um eine
chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege mit anfallsweise auftretender Atemnot auf dem Boden einer variablen bzw. reversiblen Atemwegs-Obstruktion und zwar infolge eines dauerhaft bestehenden hyperreagiblen Bronchial-Systems.
Charakteristisch
für Asthma sind vorübergehende oder dauerhafte Symptome wie
Luftnot, Engegefühl
in der Brust, pfeifende Atmung, erhöhte Produktion
von
zähem Bronchialsekret
(Schleim) und
Husten
. Gleichzeitig besteht eine wechselnd starke
Einschränkung des bronchialen Luftstroms
(Airflow) und eine wechselnd ausgeprägte
Hyperreagibilität
(Überreaktion)
der Atem-Wege
auf endogene und exogene Stimuli (Reize/Noxen).
Bei der Entstehung und der Manifestation des Asthmas spielen ein meist
eosinophiler Entzündungsprozess
und seine Einflüsse auf die Atemwegs-Struktur eine
Schlüsselrolle.
Daher setzt auch eine effektive Asthmatherapie bei einer Begrenzung der auslösenden Faktoren (Trigger) einerseits und einer Eingrenzung des Entzündungsprozesses andererseits an.
Epidemiologie
Im Kindes- & jüngeren Jugendlichen-Alter ist Asthma die häufigste chronische, entzündliche Lungen-Erkrankung.Etwa
10-12% aller Kinder
& jüngere Jugendliche
in Deutschland sind davon betroffen, wobei
Jungen doppelt so häufig erkranken wie Mädchen
. Dieser Geschlechter-Unterschied ist bei älteren Kindern deutlich geringer, im
Erwachsenenalter überwiegt dann der Anteil erkrankter Frauen
. Bei 30% der kindlich Erkrankten tauchen bereits Symptome bis zum ersten Lebensjahr auf, 70% der Betroffenen entwickeln die Krankheit bis zum fünften Lebensjahr.
Je später das erstmalige Auftauchen von Asthma bronchiale ist, desto wahrscheinlicher bedingt eine allergische Komponente das Krankheitsgeschehen
.
I
m
Erwachsenenalter
findet sich das Asthma noch bei etwa
5-10% der Bevölkerung
; d.s. bei rund 82 Mio Einwohnern beträchtliche 4,1- 8,2 Mio!.Kinder/Jugendliche wie Erwachsene - diese vor allem in der zweiten Lebenshälfte - leiden weit häufiger unter dem sog
. „nicht-allergischen“
oder dem
„gemischten/mixed“ Asthma
.
D
ie permanente und weltweite Zunahme der Asthma-Erkrankungsfälle korreliert mit der steigenden, nicht ausreichend geklärten Anzahl allergischer Erkrankungen.
Allergien stellen einen wesentlichen Risikofaktor für das Auftreten der Erkrankung dar
.Mortalität: Die Mortalität von 5- bis 44-jährigen Asthmatikern liegt in Deutschland höher als im restlichen Europa. Die Zahl der asthmabedingten Todesfälle in Deutschland beträgt etwa 5.000 pro Jahr.
Formen & Ätiologie
E
ine strenge
Klassifikation des Asthmas
nach ätiologischen Kriterien ist nicht immer sinnvoll, da sich die verschiedenen Formen oft überschneiden.
Eine mögliche Einteilung orientiert sich an der allergischen oder nicht-allergischen Genese:1)
Extrinsic- oder Allergisches Asthma
Sofortreaktion vom Typ I
durch Allergene in Umwelt und/oder Arbeits- und/oder Privatwelt.Zumeist
„Allergische Reaktion vom Sofort-Typ“
!Häufig betroffen von dieser Asthmaform sind
Atopiker
[?]
mit genetischer Disposition
.Diese Asthma-Form ist die häufigste Form in Kindheit & Jugend!
Was passiert?
Ausgelöst durch Allergie-auslösende Stoffe in der Umwelt, sog.
‚Allergene’
bei entsprechender „Veranlagung“. Es werden Immun-Globuline (= körpereigene Antikörper/AK) vom Typ E (IgE) gebildet, die in Wechselwirkung mit den Allergenen die Ausschüttung von allergie-auslösenden Botenstoffen
- Histamine, Leukotriene, Bradykinine
[?]
-
aus Mastzellen
[?]
bewirken.
Diese Stoffe lösen dann die Atemwegs-Verengung (Broncho-Obstruktion) aus.
Außer im Gehirn sind Mastzellen überall im Körper. Sie sind Schaltstelle der allergischen Reaktion.
Ungefähr 90% aller Allergien sind Allergien von Soforttyp.Die Symptome treten direkt nach dem Kontakt mit dem Allergen auf.
Beim ersten Kontakt wird der Organismus sensibilisiert.
Bei einem Kontakt mit einem Allergen produzieren die B-Zellen IgE-Antikörper, die sich auf den Mastzellen festheften. Diese Antikörper können, jeweils zu zweit, ein Allergen-Molekül einfangen und neutralisieren. Das nennt sich auch
Antigen-Antikörper-Reaktion
(AG-AK-R)
[?]
.
Bei einem ersten Kontakt mit dem Allergen werden nur wenige der auf der Mastzelle angehefteten IgE-Antikörper zur Neutralisation belegt. Dieser Reaktionsschritt nennt sich
Sensibilisierung
.
Beim nächsten Kontakt erfolgt dann eine heftige allergische Reaktion.
D.h.: Ab dem Zweit-Kontakt mit demselben Antigen tritt dann die allergische Reaktion in unterschiedlicher Intensität zutage. Die massenweise auf den Mastzellen festgehefteten IgE-Antikörper, das können zwischen 10.000 und 50.000 auf einer einzigen Mastzelle sein, fangen das Allergen ein. Das hat dann eine übermäßige Freisetzung von Histaminen zur Folge. Durch die heftige Reaktion platzt die Mastzelle förmlich auf.
Die Symptome werden durch Histamine
[?]
ausgelöst.Histamine und andere Entzündungsmediatoren - u.a. Leukotriene - führen dazu, dass die Blutgefäße sich stark weiten. Flüssigkeit tritt innerhalb von Sekunden bis Minuten aus und es kommt zur Bildung der typischen Ödeme und Blasen. Der Blutdruck sinkt. Die Betroffenen leiden unter Juckreiz und Atemnot.Die Reaktion kann örtlich begrenzt oder systemisch sein.Häufig sind diese Reaktionen örtlich begrenzt. Ein Beispiel dafür ist der Heuschnupfen (Rhinitis allergica) oder die Nesselsucht (Urticaria). Bei einer Ausweitung der allergischen Reaktion auf den Organismus, wie das bei einem anaphylaktischen Schock der Fall ist, kann ein lebensbedrohender Zustand eintreten.Neben dieser Sofortreaktion vom Typ I nach Kontakt mit dem Allergen kann es nach 6 bis 12 Stunden zu einer Spätreaktion kommen; diese wird über Immunglobuline vom Typ G (IgG) ausgelöst. Oft treten beide Reaktionen auf:
„dual reaction“
.2)
Intrinsic- oder Nicht-Allergisches Asthma
Sofortreaktion vom Typ II
- auch genannt
endogenes Asthma
- durch:
Infektion
Toxische oder chemisch-irritative Stoffe
Unspezifische Reize (kalte Luft, Tabak-Qualm, Abgase)
Stress/Distress
Psychologische/Psychische Faktoren
das sog.
„Psychogene Asthma“
Gastro-ösophagealer Reflux
Anstrengung
(bes. Kinder und Jugendliche)
das sog.
„Anstrengungs-Asthma“
Pseudoallergische Reaktion (Analgetika)
das sog.
„Analgetika-Asthma“
(am bekanntesten das ASS-Asthma)
Körpereigene Zellen und das umliegende Gewebe werden durch Plasma-Proteine des Immunsystems
(IS)
angegriffen.
Bei der zweiten Form der allergischen Reaktion werden die Zellen selbst geschädigt. Deshalb heißt sie auch
zytotoxische Reaktion
Dabei nehmen die IgG und IgM-Antikörper eine Schlüssel-Position ein
.
Sie verbinden sich mit dem Fremdstoff, der auf der Körperzelle aufliegt. Außerdem wird das
Komplement-System
[?]
aktiviert
.
Das
Komplementsystem ist ein Teil der unspezifischen Immunabwehr
. Es besteht aus verschiedenen Plasmaproteinen, die körperfremdes Eiweiß angreifen, Zellwände auflösen und Fresszellen herbeilocken kann. Bei der allergischen Reaktion führt gerade die Aktivierung des Komplementsystems zu einer allergischen Erkrankung, weil körpereigene Zellen und das umliegende Gewebe angegriffen werden.
Typische Erkrankungen vom Typ 2 sind u.a.:
Hämolytische Anämie
Agranulozytose
Blutgruppenunverträglichkeit (Blutgruppe A trägt Antikörper gegen
Blutgruppe B in sich und umgekehrt)
3)
Mischformen aus Extrinsic- & Intrinsic-AsthmaIm Falle von gemischtförmigem Asthma leiden die Betroffenen unter einer Kombination aus nicht-allergischem und allergischem Asthma. Diese Form tritt bei vielen Asthmatikern auf. Die Bronchien reagieren dabei nicht nur überempfindlich auf allergische Stoffe, sondern auch auf andere Reize wie Rauch, körperliche Anstrengung oder kalte Luft.In vielen Fällen wird der Grundstein für gemischtförmiges Asthma bereits in der
Kindheit
gelegt. Als mögliche Auslöser kommen entzündliche Veränderungen der Atemwege infrage, die dazu führen, dass die Bronchien überempfindlich werden.Andererseits kann zum Beispiel
Tabakkonsum
bewirken, dass es zu einer Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber allergieauslösenden Substanzen kommt.Neben den oben genannten beiden Verlaufsformen - Extrinsic Asthma bronchiale oder „allergisches Asthma“ als Sofortreaktion Typ I bzw. Intrinsic Asthma bronchiale oder „endogenes bzw. nicht-allergisches Asthma“ als Sofortreaktion Typ II - gibt es noch zwei weitere Formen:
Immunkomplex-BildungSpät-Reaktion vom Typ III
Allergene und Antikörper bilden Immunkomplexe, die sich zusammenballen.Die allergische Reaktion vom Typ III ist geprägt durch die Bildung von
Immun-Komplexen
(Allergen + Antikörper). Unter bestimmten Bedingungen, bilden sich
mehrgliedrige Komplexe aus Allergenen und Antikörpern
. Was zu dieser „Zusammenballung" führt, ist bisher nicht geklärt. Bekannt ist aber, dass daran im Wesentlichen der
IgG-Antikörper
beteiligt ist. Die Immunkomplexe zirkulieren im Blut und lösen das
Komplement-System
der unspezifischen Immun-Abwehr aus. Das führt zwar zu einer Auflösung der Immunkomplexe, schädigt aber auch das umliegende Gewebe.
Die allergische Reaktion kann Stunden oder Tage später auftreten.
Nicht immer ist das Immunsystem in der Lage, die Immunkomplexe vollständig zu neutralisieren. Typisch für diese Form der allergischen Reaktion ist eine Ablagerung der „überzähligen" Immun-Komplexe in bestimmten Geweben. Dort führen sie dann zu allergischen Entzündungsreaktionen. Die Symptome einer Allergie treten aber nicht sofort in Erscheinung. Es braucht schon ein paar Stunden oder auch Tage, bis sich allergische Reaktionen zeigen.
Ablagerungen führen zu Entzündungen bestimmter Organe.
Typische Erkrankungen, die zum Typ III gehören sind u.a.:
Vasculitis (Gefäßentzündung)
Serumkrankheit
Alveolitis (Entzündung der Lungenbläschen), Farmerlunge
Nephritis (Entzündung der Nieren)
Arthritis (Entzündungen der Gelenke)
Bei der allergischen Reaktion vom Typ IV spielen die Immunglobuline keine Rolle. Hier sind ausschließlich die T-Lymphozyten beteiligt an der Immunantwort.
T-Lymphozyten
oder
T-Zellen
[= sie spielen eine wichtige Rolle im menschl. IS * Das „T“ steht für Thymus(drüse), wo die Aus-Differenzierung der Zellen stattfindet]
sind spezialisierte weiße Blutkörperchen
(Leukozyten)
und gehören zur spezifischen zellulären Abwehr
.
Aus diesem Grund wird die allergische Reaktion vom Typ IV auch
zelluläre Immunreaktion
genannt.
Zytokine
[?]
führen bei dieser allergischen Reaktion zu Gewebsschäden.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: