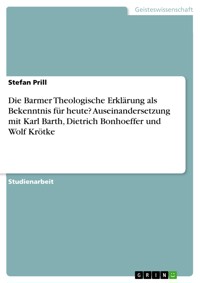13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Theologie - Historische Theologie, Kirchengeschichte, Note: 1,3, Universität Münster (Fachbereich 1 - Evangelische Theologie), Veranstaltung: Proseminar Kirchengeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Haltung Martin Luthers im sogenannten ‚Bauernkrieg‘ von 1524-1525. Anhand der Quelle „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben. 1525.“ (WA 18; [279]291,334) soll diese analysiert und in ein Verhältnis zu Luthers Obrigkeitslehre gesetzt werden. Zu Beginn dieser Arbeit werden in Kapitel 2 zunächst die Entstehungsumstände der Quelle und dessen historischer Kontext näher beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Kapitel auch auf die Fragen gelegt, inwiefern Luther von den Bauernaufruhren erfahren hatte und was ihn zu einer schriftlichen Stellungnahme bewog. In Kapitel 3 steht die Quellenarbeit im Vordergrund. Hier wird die ‚Ermahnung zum Frieden‘ inhaltlich skizziert, analysiert und gegliedert. Anschließend wird in Kapitel 4 Luthers Haltung im ‚Bauernkrieg‘ anhand seiner Schrift ‚Ermahnung zum Frieden‘ genauer analysiert und in ein Verhältnis zu seiner Obrigkeitslehre gesetzt. Es soll gezeigt werden wie vielschichtig sein theologischer Standpunkt ist und aus welchen Faktoren dieser – also letztendlich seine konkrete Haltung im ‚Bauernkrieg‘ – resultiert. Dafür wurden besonders die Aufsätze von Gottfried Maron „Niemand soll sein eigener Richter sein“ und von Martin Greschat „Luthers Haltung im Bauernkrieg“ herangezogen. Deutlich wird aber, dass Luther dabei immer stringent im Sinne seiner Obrigkeitslehre vorgegangen ist. Bevor in Kapitel 4.3. konkret auf Luthers Kritik auf die „12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ eingegangen wird, findet in Kapitel 4.2. Luthers apokalyptisches Grundgefühl, als ein Faktor für seine Haltung in den Jahren 1524/25, besondere Beachtung. Am Ende der Arbeit in Kapitel 5 wird auf noch offene Fragen hingewiesen. Zudem werden die Ergebnisse der Arbeit abschließend zusammengefasst und bewertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einordnung der Quelle
2.1. Entstehungssituation
2.2. Historischer Kontext - Der Bauernkrieg
3. Inhaltliche Skizze der Quelle
3.1. Inhalt
3.2. Gliederung
4. Thematische Behandlung
4.1. Luthers Haltung im Bauernkrieg im Verhältnis zu seiner Obrigkeitslehre
4.2. Luthers apokalyptisches Grundgefühl‘
4.3. Luthers Kritik auf die ,12 Artikel·
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
6.1. Quellen
6.2. Sekundärliteratur
1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Haltung Martin Luthers im sogenannten ,Bauernkrieg' von 1524-1525. Anhand der Quelle „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben. 1525." (WA 18; [279]291,334) soll diese analysiert und in ein Verhältnis zu Luthers Obrigkeitslehre gesetzt werden. Zu Beginn dieser Arbeit werden in Kapitel 2 zunächst die Entstehungsumstände der Quelle und dessen historischer Kontext näher beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Kapitel auch auf die Fragen gelegt, inwiefern Luther von den Bauernaufruhren erfahren hatte und was ihn zu einer schriftlichen Stellungnahme bewog. In Kapitel 3 steht die Quellenarbeit im Vordergrund. Hier wird die ,Ermahnung zum Frieden' inhaltlich skizziert, analysiert und gegliedert. Anschließend wird in Kapitel 4 Luthers Haltung im ,Bauernkrieg' anhand seiner Schrift ,Ermahnung zum Frieden' genauer analysiert und in ein Verhältnis zu seiner Obrigkeitslehre gesetzt. Es soll gezeigt werden wie vielschichtig sein theologischer Standpunkt ist und aus welchen Faktoren dieser - also letztendlich seine konkrete Haltung im ,Bauernkrieg' - resultiert. Dafür wurden besonders die Aufsätze von Gottfried Maron „Niemand soll sein eigener Richter sein" und von Martin Greschat „Luthers Haltung im Bauernkrieg" herangezogen. Deutlich wird aber, dass Luther dabei immer stringent im Sinne seiner Obrigkeitslehre vorgegangen ist. Bevor in Kapitel 4.3. konkret auf Luthers Kritik auf die „12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben" eingegangen wird, findet in Kapitel 4.2. Luthers apokalyptisches Grundgefühl, als ein Faktor für seine Haltung in den Jahren 1524/25, besondere Beachtung. Am Ende der Arbeit in Kapitel 5 wird auf noch offene Fragen hingewiesen. Zudem werden die Ergebnisse der Arbeit abschließend zusammengefasst und bewertet.
2. Einordnung der Quelle
2.1. Entstehungssituation
Nachdem die soziale und politische Situation besonders für die Landbevölkerung immer unerträglicher wurde[1] und die Zahl der Aufruhren und Proteste sich anhäuften, schlugen sich die Forderungen der Landbevölkerung in zahlreichen Artikeln auch literarisch nieder. Als dann von Sebastian Lotzer, einem Memminger Laienprediger, Mitte März des Jahres 1525 die „Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben" veröffentlicht wurden, als eine erste allgemeine Programmschrift der Bauernschaft zwischen dem 24.2. und dem 01.03. verfasst, bekam auch Luther Mitte April Kenntnis von der Bauernbewegung, insbesondere von den ,Zwölf Artikeln' und der ,Memminger Bundesordnung'.[2] Am 16. April brach Luther gemeinsam mit Melanchthon von Wittenberg nach Eisleben auf, um dort auf Geheiß des Grafen Albrecht von Mansfeld eine neue Lateinschule einzuweihen. Dort verfasste er, vermutlich am 19. oder 20. April, seine erste Bauernkriegsschrift „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben", die nach wenigen Tagen, Anfang Mai 1525, gedruckt und als Flugschrift veröffentlicht wurde.[3] Die Schrift stellt eine Antwort auf die „Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben" dar. Zudem hatten ihn die Bauern in einer früheren Schrift - so schreibt Luther selber - zu einer Stellungnahme gebeten.[4] Luther ermahnt die Adressaten seiner Schrift, sowohl die Bauern als auch die Fürsten, den Frieden zu wahren und eine kompromissvolle Lösung zu finden. Er hat die Hoffnung, dass sich der Aufruhr noch friedlich lösen lasse - kennt er noch nicht die realen Ausmaße des Bauernaufstandes, die ihm dann auf dem weiteren Verlauf seiner Reise durch den thüringischen Raum bewusst werden und ihn zur Verfassung seiner zweiten, jedoch strengeren Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern"[5] veranlassen. Luther schrieb seine erste Bauernkriegsschrift allerdings nicht nur um die Fürsten und Bauern zum Frieden zu ermahnen, sondern vielmehr zur Klärung der von den Bauern beanspruchten Legitimation für den Aufruhr und den Widerstand gegen die Obrigkeit.[6] Vom Charakter her ist daher diese Schrift eine Belehrungs- und Programmschrift, da Luther in ihr neben der Ermahnung zum Frieden auch sein Gehorsamsverständnis zur Obrigkeit deutlich macht.
2.2. Historischer Kontext - Der Bauernkrieg