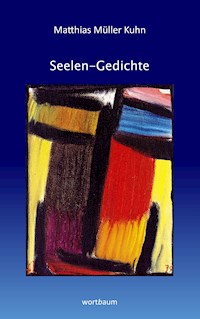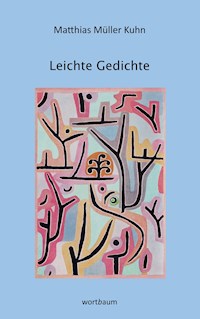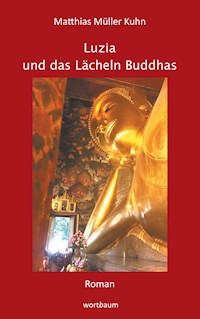
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Migration und Liebe: Ein Roman über Schicksal und Leidenschaft dreier Menschen, die ihre Heimat verlieren und von Liebe zueinander ergriffen werden. In ihrer Jugend gelangt Luzia nach einer dramatischen Flucht während des Bosnienkriegs alleine in den Westen. Sie wird Schriftstellerin, die mit ihrem Debütroman grosse Erfolge feiert, dann aber in eine Sprachkrise gerät und nicht mehr schreiben kann. Nach einem Unfall in den Bergen trifft sie zufällig Max wieder, ihre erste grosse Liebe, der Arzt in einem Bergdorf ist. In seinem Haus kann Luzia während sechs Wochen wohnen, in denen sie in einem Schaffensrausch ihr zweites Buch schreibt. Sie versucht das Geheimnis von Max zu ergründen: Warum wurde aus dem erfolgreichen Forscher der Krebsmedizin ein einfacher Hausarzt, der bald nach Thailand auswandern wird? Steht dahinter eine thailändische Frau? Luzia entdeckt in den Gesprächen mit Max, auf Fotos und in einem Buch Nittaya, die unter abenteuerlichen Umständen ihre Familie aus armen Verhältnissen in Nordosthailand verliess und nach Europa emigrierte, wo sie Max kennenlernte. Ist Nittaya der Grund, warum er sich immer mehr Luzias wiedererwachenden Gefühlen verschliesst? Liebe wird spürbar als Kraft, welche die Menschen an die Grenze von Leben und Tod, von Sein und Nichtsein führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Müller Kuhn, geboren 1963, ist Schriftsteller und Dichter. Er lebt und arbeitet im Raum Zürich. Seit 40 Jahren schreibt er Gedichte und Prosa und seit ungefähr zehn Jahren widmet er sich umfassenden Erzählformen wie dem Roman. Folgende Romane sind bereits entstanden: Der Wortträumer (2010), Im Fluss (2013). Pilger (2017). Gedichtsammlungen: Frohes Wortgewebe (Pro Lyrica Verlag, 2014), Biblia Lyrica (2016), Zugeflogen mit frohen Flügeln (Haiku, 2004)
Inhalt
Teil
Teil
Teil
Teil
Teil
1. Teil
Der Weg verliert sich in der Wiese. Mir scheint, dass hier die Welt aufhört. Hinten, weit oben, im Kessel dieses vergessenen Tales, kommt kaum jemand hin. Hier steht die Zeit still, weht der Wind der Ewigkeit, klingen die Töne der Urzeit. Niemandsland, um das noch nie gekämpft wurde, das keinen Namen trägt, unberührt vom Menschen ist es da.
Ausgerechnet hier zieht es mich hin. Auf der Seite ragen die Felswände empor. Vor mir steht der Berg, welcher das Tal abschliesst, der Berg, der mich nicht loslässt, der mich zu sich ruft, der mir im Weg steht, mir den Weg abschneidet. Wie oft habe mit ihm gerungen. Ich habe ihn gepackt an den Hüften, wollte ihn durch die Luft wirbeln, ihn auf den Rücken legen, besiegen, dass er mir den Weg freigibt und ich weitergehen kann in meinem Leben.
Der Berg türmt sich auf vor mir, stark und mächtig. Ich sinke auf die Knie. Es hilft nicht, wenn ich ihn anschreie, er hört nicht, er hat keinen Verstand, er hat keine Empathie, er setzt sich mir mit seinem Jahrtausende alten Gewicht entgegen. Ich schlage die Hände vors Gesicht, presse die Handballen gegen meine Wangen, drücke die Fingernägel gegen meine Stirn, bis sie durch meine Haut hindurchbrennen.
Ich richte mich auf, hole Luft und setze an zu dem Schrei, lege allen meinen Schmerz hinein, presse alles Elend aus mir heraus. Ich schreie in den Talkessel hinein, dass die Felsen zu zittern anfangen, zu vibrieren, als müssten sie zerbrechen, ich schreie, als würde ich in den Wehen liegen, ich schreie das Leben aus mir heraus, als würde ich ein neues gebären. Plötzlich bricht der Schrei ab und fällt in die Tiefe, fällt in die fallenden Tränen hinein, die jetzt durch meine Augen dringen, über meine Wangen rinnen. Ich werfe mich auf den Boden, breite meine Arme und Beine aus, als würde ich die ganze Erde umarmen und hielte mich an ihr fest:
„Luzia!“ stammle ich meinen Namen, dann flüstere ich ihn flehend: „Luzia,“ dann sage ich ihn beschwichtigend, als würde ich mich selbst beschwören:
„Luzia!“
Heute Morgen noch sass ich in der unrenovierten Küche meiner einfachen, aber liebevoll eingerichteten Altstadtwohnung und versuchte, nachdem ich meinen mit blauen Blumen verzierten Porzellanteller weggeräumt hatte zu schreiben, was ich schon lange nicht mehr getan hatte. Was meinen Beruf anbelangt, lebe ich schon lange in der Wüste.
Immer noch nenne ich mich Schriftstellerin und auch mein Umfeld, nicht nur mein nächstes, sondern im Grunde der ganze deutsche Kulturraum, hält mich für eine solche, denn mein erstes Buch, das wie ein Komet am Himmel erschienen sei, wie einige Kritiker lobten, erlangte Berühmtheit und natürlich fiel die Strahlkraft meines eher aus Zufall oder wegen günstiger Umstände entstandenen Werks auch auf mich. Über Nacht wurde ich zur international gefeierten Autorin, zur Nachwuchshoffnung einer Literaturszene, die aus mehrheitlich älteren, arrivierten, in ihrem sicheren Nachkriegsstil schreibenden Herren bestand. Da sass ich an meinem Küchentisch und versuchte zu schreiben, hatte die Hefte aufgeschlagen, über welche meine Schrift kollerte, wo gestrichen wurde, umgeworfen und wiederaufgebaut. Wenn eine Quelle versiegt, darf man sie noch Quelle nennen oder ist sie nur noch ein lächerliches, vertrocknetes, nichtssagendes Stück Land?
Wie oft hatte mich der Verlag angerufen, wie oft, und in letzter Zeit immer häufiger, bei den Interviews, die allerdings immer seltener werden, wurde die immer gleiche Frage gestellt, welche ich mittlerweile hasse und der ich geflissentlich aus dem Weg gehe: „Wann erscheint ihr neues Buch?“ „Wann dürfen wir mit ihrem neuen Roman rechnen?“
Da sass ich am Küchentisch und schrieb einen Satz, nachdem ich den Kugelschreiber in meiner Hand über eine Stunde nervös hin und hergedreht hatte. Plötzlich begannen die Wörter des einen Satzes, den ich mir eben abgerungen hatte, mich auszulachen: Einige Wörter schlugen auf ihre Schenkel und krümmten sich vor Lachen, die anderen kicherten, wie es Schulmädchen tun aus Verlegenheit, wenn sie über die Jungen in der Klasse sprechen, einige Wörter hatten ein verächtliches Lachen, wie es Männer an einem Stammtisch haben, wenn sie einander schmutzige Witze erzählen.
Alle Wörter lachten mich aus. Wut stieg in mir hoch! Dies erstaunte mich sehr, denn bis jetzt versuchte ich immer, die Wut klein zu halten. Ja, der Selbstzweifel, die Trauer, die Melancholie durften in meiner Seele ungehindert herumspazieren und hatten überall freien Zugang. So machten sie Absprachen, hielten Konferenzen, feierten ihre zweifelhaften Feste. Aber die Wut fürchtete ich wie einen Löwen, ich fühlte mich nur sicher, wenn er im Käfig eingesperrt war. Wehe, man liess ihn frei! Jetzt aber war die Wut los und ich liess sie zu. Anscheinend war ich jetzt dazu bereit, die Wut mir selber und meiner Umgebung zuzumuten.
Die Wut war es auch, die mich aus dem Haus getrieben hatte und mich die Reise machen liess in die Berge. Sie trieb mich zu jenem verlassenen Seitental hoch, in welchem ich schon oft war, um mich von der Welt zu verstecken. Jetzt aber war ich hierher gekommen, um meine Wut dem Berg entgegenzuschleudern, der für mich zum Sinnbild meiner Schreibblockade geworden war. Der Berg liegt auf mir, er hat die Quelle verschüttet, er raubt mir meine Sprache. So werfe ich ihm meine Wut mitten ins Gesicht.
Ich liege auf der Wiese mit ausgebreiteten Armen und Beinen. Mein Atem geht schwer. In meinen Handflächen spüre ich die harten, vom langen Sommer ausgetrockneten Halme. Meine Wange liegt auf dem Boden, es hat schon lange nicht mehr geregnet, dafür sind die Farben des Herbstes umso intensiver. In einem hellen Gelb brennen die Lärchen, Föhren leuchten. Ich öffne die Augen und sehe nahe bei mir den Felsen in die Höhe ragen.
Der Berg steht stumm und ungerührt da. Über ihm sehe ich ein Stück tiefblauen Himmel, an welchem leicht, wie eine winkende Kinderhand, eine Wolke vorüberzieht. Ich schliesse die Augen. Meine Arme wachsen an, werden grösser, bis sie die Rundung der Erde spüren und einen Ball umfassen, die Fingerspitzen der beiden Hände berühren sich. Ich umarme den Ball, es ist die Erde und presse sie an mein Herz. Ich spüre ihre Gefühle, ihre Ängste, ihr pulsierendes Leben. Meine Beine schweben lose im Raum. So sehe ich mich durch den Raum fliegen, die Erde umarmend, an Sonnen und Monden vorbei. Alles um mich ist in eine grosse Stille versunken, ich höre nur meinen eigenen Atem. So beginne ich mit der Erde, die ich mit meinen Armen umfasse und immer fester an mich presse, ein Gespräch:
„Warum bin ich auf dir eine Fremde geworden? Wenn ich dich jetzt in den Armen halte, ist alles rund, alles ist im Ganzen aufgehoben. Ich spüre an dir keine Ecken und Kanten. Du schmiegst dich an meine Brust. Alles hängt zusammen, nichts ist nur für sich da, es gibt keine Gegensätze, das eine fliesst ins andere über, die Nacht geht auf im Tag, das Dunkle fliesst ins Helle.
Erde, du bist rund! Warum hast du mich vertrieben, weg von meiner Mutter, weg von meinen Wurzeln. Warum kam dieser entsetzliche Krieg? Er trennte alles voneinander, den Kopf vom Herzen, die Hand vom Arm, die Füsse von den Beinen! Warum musste ich blind auf dir herumirren? Der Stamm wurde von den Ästen getrennt, die Blätter von den Zweigen. Warum musste ich mühsam das Getrennte wieder zusammenbringen: Die Wörter mussten eine Zunge finden, die Sprache musste einen Boden finden! Erde, du bist doch rund! Ich lasse dich nicht mehr los, in dir wird alles Auseinandergefallene wieder zusammengebracht. Aber wisse, tief in mir drin gibt es diesen Bruch! Wie kann er verheilen? Auch wenn sich an der Oberfläche alles wieder zusammengefügt hat, geht ein Riss durch meine Seele!“
Ich richte mich auf und setze mich im Schneidersitz auf die Wiese. Nun ist der Berg direkt vor mir. Ich nehme mir Zeit, ihn gleichsam mit den Augen abzutasten. Von unten steigt eine breite Felswand jäh in die Höhe mit Spalten und Ritzen. Dann winden sich breite Grasbänder empor, bis zu den Schultern und am Ende kühn, überraschend, ein Kopf wie ein Krieger mit einem Helm, auf dem ein Grat zu einem feinen Spitz verläuft.
Zuunterst gibt es eine Geröllhalde, einen Kegel, der wie eine Rampe zur Felswand führt. An der Stelle, wo die losen, etwa kopfgrossen aufeinanderliegenden Steinbrocken an den Felsen stossen, bleibt mein Blick ruhen. Es ist eine geschwungene Linie etwa hundert Meter über mir, wo sich der Berg klar und unabdingbar aus den Steintrümmern erhebt. Genau dort bewegt sich etwas, es unterscheidet sich kaum von den grau rötlich schimmernden Steinen. Ich schärfe den Blick, da glaube ich es zu erkennen: Es ist ein Steinbock, zwei dunkle Punkte sind seine Hörner, vorsichtig bewegt er sich, über die Steinbrocken balancierend, der Felswand entlang.
Jetzt entdecke ich noch andere sich bewegende Flecken, es ist eine Herde von etwa zehn Steinböcken, die ihren Weg über die Geröllhalde unterhalb der Felswand suchen. Ich stehe auf und gehe langsam zur Geröllhalde hin. Auf keinen Fall möchte ich die Tiere erschrecken, ich nähere mich vorsichtig. Meine Augen auf die Tiere gerichtet, die nur kurz innehalten, um dann gelassen ihren Weg weiterzugehen.
Plötzlich beginnt ein leises bedrohliches Grollen, als würde der Berg Laute von sich geben. Was geschieht jetzt? Der Boden fängt leicht an zu zittern, in der Luft liegt eine kaum wahrnehmbare, hoch singende Schwingung! Jetzt sehe ich es: Die ganze Geröllhalde gerät ins Rutschen. Die Steine bewegen sich. Zuerst springen die oben liegenden Steinbrocken auf und kollern herunter, sie lösen andere und reissen viele mit. Immer mehr Steine rollen, rutschen, überschlagen sich, fallen. Plötzlich wächst das Grollen an zu einem ohrenbetäubenden Lärm.
Als der erste Stein wie ein Geschoss an mir vorbeifliegt, drehe ich mich um und renne weg. Ich spüre die Geröllhalde in meinem Rücken, die im Begriff ist, mich lebendig unter sich zu begraben. Vor mir taucht ein frei auf der Wiese stehender Felsen auf, den ich vorhin nicht beachtet hatte. Den wütenden, wildgewordenen Steinen kann ich nicht mehr entkommen, instinktiv werfe ich mich hinter den Felsen, kaure auf den Boden, presse meinen Kopf an die kühle Oberfläche des Felsens. Um mich herum tobt es, brüllt es, zittert es.
Bilder rasen an meinen Augen vorbei, ich erinnere mich: In meinem blauen Lieblingskleid gehe ich durch die Strassen von Bijeljina. Ich habe mir etwas von dem Parfum meiner Mutter an die Handgelenke und an den Hals getupft. Mein langes, blondes, gewelltes Haar, für das ich von den anderen Mädchen meiner Klasse beneidet werde, habe ich mit einem roten Band zusammen gebunden. Bald werde ich ihn treffen, den Jungen aus der Parallelklasse, der mir eine Rose schenkte nach dem Konzert in der Schule, bei dem ich mein geliebtes Chopin Konzert auf dem Klavier spielte. Ich hatte noch kaum mit ihm gesprochen, aber unsere Blicke waren sich begegnet und jedes Mal spürte ich dieses wohlige Kribbeln in meinem Bauch. Wir haben im Park abgemacht neben der grossen Eiche auf der Bank, welche bekannt dafür ist, dass sich dort Verliebte treffen.
Ich gehe durch den Gemüsemarkt, es ist eine Abkürzung von meinem Haus auf der einen Stadtseite zum Park auf der anderen Seite. Ich kann es kaum erwarten. Meine Arme werden leicht, als würden sich in ihnen Flügel entfalten, welche mich bald aufheben in die Luft. Ich schwebe beinahe an den roten, zu grossen Haufen aufgeschichteten Paprika vorbei, an den purpurnen Tomaten und den gelben Äpfeln, die so hoch auf den Tischen aufgetürmt sind, dass die Verkäuferinnen dahinter kaum mehr zu sehen sind. Vom Markt weg zieht es mich an den beiden Gotteshäusern vorbei, an der Moschee, in deren Kuppel ich den runden Kopf meines Vaters zu erkennen glaube. Er hat eine Glatze und ein breites rundes Gesicht, ist ein Muslim und besucht fleissig das Gebet. Als Kind holte ich ihn oft zusammen mit meiner Mutter von der Moschee ab. Ich umarmte seine Beine, rannte auf ihn zu, schaute an ihm hoch und hatte das Gefühl, dass die Kuppel der Moschee genau gleich wie sein runder Kopf aussieht. Einmal hat er mir erzählt, dass sein Kopf wie die Moschee geworden ist, weil er zu lange und zu gerne darin betet und singt.
Gleich neben der Moschee ist die christliche Kirche mit den weissen Türmen und den goldenen Dächern. In ihrem Innern brennen Kerzen, leuchten Heiligenbilder und liegt ein betörender Duft. Von dem einen Turm winkt mir meine Mutter zu, sie neigt sich mir leicht zu und schliesst den Reissverschluss am Rücken meines Kleides und fährt mir übers Haar mit ihrer leichten, schmalen Hand:
„Mein Kind, pass auf dich auf!“
„Ja,“ rufe ich ihr zu, „ich pass auf mich auf!“
Ich gehe weiter, schwebe und spüre mein Herz immer schneller schlagen, als ich meine Hand an den Hals lege, um die Goldkette zurechtzurücken: Wie schön das Leben ist! Da höre ich den Klang der Musik von Chopin, die ich eben auf dem Klavier noch gespielt habe, bevor ich aus dem Haus ging. In meinem dunkelblauen Kleid, mit dem Parfum meiner Mutter am Hals, spielte ich die Nocturne auf dem Klavier, welches mein Vater mit seinem Ersparten für mich gekauft und mit Kollegen mühsam die Treppe zu unserer Wohnung hochgestemmt hatte.
Chopin! Der lang anhaltende Akkord lag da wie die Ebene, die ich von unserem Wohnzimmer aus überblicken kann. Dann stieg aus der Ebene durch den Triller ein Vogel auf, in die Höhe, und alles, was in der Ebene war, die Stadt, der Wasserturm, der Markt, die Flüsse, die Schuhfabrik, in der meine Mutter arbeitete, alles erhob sich mit dem Vogel in die Höhe, als wäre das wirkliche Zuhause des Menschen im Himmel, in den Wolken, oben, in der Luft. Der Triller warf auch mich in die Höhe.
Danach kam diese kurze Stille zwischen den zwei Tönen, in welcher ich die ganze Tiefe der Musik hörte. Der Himmel öffnete sich, es durchfuhr mich bis in die Fingerspitzen. Nachher erst kam der hohe Ton, der dann wie ein Wasserfall, wie ein Bach über viele Stufen hinunterfiel, wieder zurück in die Ebene. Oh Chopin, ich nahm ihn mit. Ich hörte seine Töne, als ich durch die Strassen von Bjieljina ging, um meinen geliebten Jungen, mit dem ich kaum jemals gesprochen hatte, zu treffen.
Dann komme ich zum Platz. An der Ecke liegt das Kaffee Istanbul, welches ein Treffpunkt der bosnischen Männer ist. Als ich vorbeigehe, werfen mir einige der Männer im überfüllten Lokal mit Bierflaschen in der Hand dichtgedrängt stehend durch die geöffnete Tür strenge Blicke zu. Sie stehen draussen in kleinen Gruppen beieinander und verbreiten mit ihren ernsten Gesichtern eine Spannung, welche meine Leichtigkeit beschwert. Ich beschleunige meine Schritte, nur weg von hier, denke ich.
In den letzten Tagen herrschte eine bedrückende Stimmung in der Stadt, als läge ein Schatten auf ihr. Vater sass am Küchentisch, legte seinen runden Kopf in seine grossen Hände, seufzte und eine dunkle Wolke zog über seine Stirn:
„Böses wird kommen! Serbien wird sich aufblähen, der Adler mit dem spitzen Schnabel stürzt sich auf uns. Er wird es nicht zulassen, dass Bosnien ein eigener Staat wird. Das Referendum hat ihn gereizt, jetzt kommt er und zerfleischt uns!“
Mutter wollte Vater beschwichtigen, indem sie mit ihren hellen Händen über seinen Kopf strich, ihn auf die Wange küsste und in sein Ohr flüsterte:
„Es kommt schon gut!“
Als ich mit schnellen Schritten über den Platz gehe, sehe ich den Reiter. Er sitzt auf einem weissen Pferd, stolz und gefährlich. Ich möchte die Flucht ergreifen, kann aber nicht mehr weg kommen, da immer mehr Männer aus Seitengassen, wie auf ein geheimes Kommando hin, zusammenströmen. Eine gespenstische Ruhe liegt über dem Platz. Etwa ein Steinwurf entfernt, an der Strasse, die vom Platz weggeht, liegt das serbische Lokal, über dessen Eingang das Wappen mit dem Doppeladler prangt. Auch dort finden sich immer mehr Männer ein und füllen die Strasse. Die zwei Parteien, die bosnische beim Kaffee Istanbul am Platz und die serbische weiter oben, stehen sich gegenüber. Alle starren zu dem einen Reiter.
Es ist ein Tschetnik, er hat die für die serbischen Geheimkrieger und gefährlichen Wölfe, wie sie mein Vater nennt, typische Fellmütze auf, an deren Vorderseite der Adler auf einer silbernen Medaille prangt. Der Reiter beginnt nun, mit übelsten Worten die bosnischen Männer zu beschimpfen, die vorsichtig immer enger zusammenstehen und eine Mauer bilden.
Ich dränge mich in einen Hauseingang, warum nur bin ich in dieses Geschehen geraten? Schon gestern erschrak ich zu Tode, als plötzlich zwei Düsenjets vom offenen Feld her im Tiefflug direkt über unser Haus hinweg donnerten und von dem Knall eine Fensterscheibe in Brüche ging. Jetzt rufen die bosnischen Männer zurück und erwidern die Schimpftiraden, der Reiter aber lässt sich nicht abschrecken und kommt immer näher.
In diese Stille hinein, die nur von den hässlichen Rufen der Männer zerschnitten ist, fällt ein Schuss! Der Reiter wird getroffen. Er sinkt leicht nach vorne, dann kippt er kopfüber vom Pferd und bleibt reglos liegen.
In diesem Moment zerplatzt die Welt, in der ich lebte, wie eine Seifenblase, auf der sich bunt, regenbogenfarbig meine ganze Kindheit spiegelte, meine Welt, in der ich hüpfte, lachte, spielte, liebte. Sie fällt ins Dunkle, Blinde, Leere und zerbricht.
Zuerst wird es still. Diese entsetzliche, abgründige Stille entsteht, die kurz vor dem Sturm eintritt, wenn alles Luft holt, alles sich sammelt, um dann loszuschlagen. Schüsse fallen, ich weiss zuerst nicht woher. Doch ich merke schnell, dass die serbische Seite nur auf diesen Moment gewartet hat. Sie scheinen darauf vorbereitet zu sein, sie scheinen es geplant zu haben! Plötzlich haben alle Männer vor dem serbischen Kaffee Gewehre in der Hand und stürmen auf den Platz, die bosnischen Männer sind überrascht, sie ziehen sich schnell in die Häuser zurück.
Ich drücke mich in die Ecke des Hauseingangs, möchte mich unsichtbar machen. Meine Stirn drücke ich gegen die kühle Mauer, presse die Augen zu, nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Es wird geschossen, immer näher bei mir, immer heftiger, lauter. Gibt es Verletzte, Tote? Die Stadt bricht auseinander, die roten Paprika auf dem Markt zerplatzen, die gelben Äpfel rutschen von den Tischen. Der Wasserturm fällt auseinander, eine Flut von rotem Wasser überspült die Strassen. Die Eiche, unter welcher der Junge auf mich wartet, wankt und kracht zu Boden. Die Saiten meines Klaviers zerreissen, die Tasten brechen ein, die Töne ertrinken.
Jemand packt mich am Arm. Ja, ich lebe noch! Ein Mann reisst mich aus dem Hauseingang, zerrt mich auf die Strasse und schreit mir in die Ohren:
„Renne, renne über den Platz, bücke dich!“
Die Hand zieht mich und stösst mich. Ich torkle zuerst, fange mich auf. Dann renne ich los, gebückt. Jetzt schlägt irgendwo ein Geschoss ein, es folgt eine gewaltige Explosion. Der Adler ist los! Er stürzt sich mit seinen brennenden Flügeln auf die Stadt, zerreisst mit seinem stählernen Schnabel den Frieden, in dem wir gelebt haben. Er packt mit seinen Krallen Menschen, hebt sie auf, lässt sie fallen, wirft sie in den Abgrund. Ich renne über die Strasse, an Verletzten vorbei, da lag auch ein Toter! Ich renne auf die andere Seite, den Hausmauern entlang, gebückt, über mir schlagen die wütenden Elendswellen zusammen.
Selbst die Häuser wollen fliehen und sich losreissen von ihrem Platz. Der Himmel wird schwer und schwarz, er lässt sich auf die Strasse fallen, wieder Schüsse über meinen Kopf hinweg, klirrende Scheiben. Ich renne blind, nur den Mauern nach. Da höre ich eine Stimme, sie kommt von oben, sie ruft meinen Namen:
„Luzia! Komm zu uns, komm schnell!“
Ist es die Stimme eines Engels? Ist nun mein Leben zu Ende, ruft der Himmel mich zu sich? Ich bleibe abrupt stehen, richte mich auf, schaue nach oben, wo der Himmel immer noch, als wäre nichts geschehen, sich heiter, in tiefem, unbekümmertem Blau über den Dächern wölbt: „Luzia!“
In der obersten Etage des gegenüberliegenden Hauses sehe ich eine Person aus einem Fenster winken, sie ruft noch lauter: „Luzia!“ Jetzt erkenne ich sie, es ist die Mutter meiner besten Freundin Dana.
„Komm schnell, wir machen dir die Tür auf!“
Es sind nur ein paar Schritte, ich überquere die Strasse, presse mich gegen die Tür des Hauseingangs, welche plötzlich aufgeht. Ich taumle förmlich in den dunklen Raum des Treppenaufgangs. Die Tür schliesst hinter mir, ich bin in Sicherheit. Dana umarmt mich, dann steigen wir schweigend die Treppe hoch und treten in die Wohnung, wo die ganze Familie verängstigt an den Fenstern steht und auf die Stadt hinunterschaut.
Der Vater von Dana kommt auf mich zu. Ich sehe, dass er Tränen in den Augen hat, die er unauffällig von seinen Wangen wischt, dann schaut er mich lange an:
„Dein Vater ist Muslim, deine Mutter Serbin, der Krieg geht mitten durch eure Familie. Dein Vater, er ist mein Freund, hat uns immer Mut gemacht, für unser Land zu kämpfen. Wenn die Serben die Stadt erobern, werden sie ihn holen.“
Er lässt seinen Kopf sinken und lässt seinen Tränen freien Lauf. Es ist ein ergreifendes Bild, diesen breiten, schweren Mann so ungehemmt weinen zu sehen.
Danas Mutter schiebt ihren Mann sanft zur Seite, sie ist gefasster und strahlt eine ruhige Sicherheit aus:
„Lass Luzia, sie muss sich zuerst von ihrem Schrecken erholen. Lasst uns jetzt alle an den Küchentisch sitzen und beten, nur beten hilft jetzt noch!“
Ohne ein Wort zu sagen gehen alle in die Küche, Dana und ihre Eltern mit den zwei Brüdern, einer ist viel kleiner, einer sieht schon aus wie ein erwachsener Mann. Sie setzen sich auf die Holzhocker, ich bin mitten unter ihnen, was mir etwas Halt und Geborgenheit gibt. Unsere Schultern berühren sich. Wir sind wie der Kern der Frucht, denke ich.
„Allah beschütze uns“, fleht die Mutter und der Vater, fast singend mit seiner sonoren Bassstimme:
„Der Prophet halte seine Hände über uns!“
Mir kommt die Ikone in den Sinn, welche mir Mutter letztes Jahr geschenkt hat: Die Mutter Gottes, gehüllt in ihr purpurrotes Gewand, hält liebevoll in ihrer grossen Hand das Kind, welches einen Arm um ihren Hals geschlungen hat. „Trag sie immer mit dir, sie wird dir überall die Liebe schenken, welche du zum Leben brauchst“, meinte Mutter, als sie mir die Ikone feierlich an meinem Geburtstag übergab. Ich taste meine Stofftasche ab, die immer noch an einem Lederband an meinen Schultern hängt und nun in den Falten des Rockes verschwindet. Ich spüre das Holz durch den Stoff hindurch, ziehe die Ikone hervor und lege sie mitten auf den Küchentisch.
Alle schauen stumm auf Maria und es scheint, dass sie mit ihrem sanften Blick einen stillen Trost verbreitet. Ich möchte ein Gebet sagen, doch ich bringe kein Wort hervor. Wie sehr ich mich auch anstrenge, meine Sprache ist verschüttet, nur einige unverständliche Laute kommen aus meiner Kehle, so schweige ich.
Drei lange Tage harren wir in der Wohnung aus. Der Krieg tobt wie ein wildgewordenes Tier durch die Stadt. Einmal entdecke ich, wie unten auf der Strasse ein verwundeter Mann liegt. Jemand eilt ihm zu Hilfe, wird aber von heftigen Gewehrsalven zurückgedrängt, ich rufe den anderen zu:
„Ich muss ihm helfen, ich gehe hinunter!“
„Oh nein“, entgegnet mir Danas Mutter, „du bleibst hier, bis alles vorüber ist.“
Der Vater von Dana und der ältere Bruder sind am nächsten Morgen nicht mehr da. Ich habe die Nacht ohne ein Auge zuzutun zusammen mit Dana in ihrem Bett verbracht. Wir hielten uns aneinander wie zwei Ertrinkende, einmal hörte ich heftige Worte, ein Streit zwischen Danas Eltern: Nein, geh nicht! Lass unseren Sohn hier, er ist noch so jung, nein, geh nicht! Kurze Zeit später fiel die Wohnungstür laut in ihr Schloss.
„Mein Mann ist gegangen, er kämpft mit seinen Brüdern für ein freies Land. Ich wollte ihn davon abhalten. Der Krieg ist immer etwas Böses, du sollst ihm keine Nahrung geben, aber er hörte nicht auf mich, er hat sogar unseren Sohn mitgenommen, Allah behüte sie!“
Als im Haus nebenan eine Granate einschlägt, fliehen wir ins Badezimmer, das nach hinten in den Hof geht und deshalb etwas geschützter ist. Eng zusammengedrängt, über Stunden, kauern wir auf dem Boden und harren aus, bis wir am Abend ins Wohnzimmer zurückgehen. Auf dem Salontisch liegt grauer, feiner Staub, eine Fensterscheibe ist zerborsten. Da sehen wir über dem Sofa in der Wand Einschüsse, die Wohnung wurde unter Beschuss genommen. Wir wären gestorben, wären wir hier geblieben!
Die Nacht vermischt sich mit dem Tag. Angstwolken rollen über die Dächer. Ich kann Mutter nicht benachrichtigen, dass mir nichts geschehen ist. Ich sehe sie, wie sie das Gesicht in ihr Kissen drückt und weint. Wie lange noch? Rauchsäulen steigen auf. Jetzt fahren Armeefahrzeuge durch die Strassen, einer schwingt eine blau-rot-weisse Fahne mit dem weissen Doppeladler. Soldaten mit ihren Fellmützen und dunklen Bärten winken mit ihren Gewehren. Danas Mutter nimmt das Kofferradio, stellt es auf den Küchentisch, sucht einen Sender. Dann sagt eine Stimme feierlich:
„Bijelijna ist befreit.“
„Wozu befreit?“ frage ich und Danas Mutter schlägt die Hände vors Gesicht und weint:
„Die Serben haben unsere Stadt besetzt, jetzt gibt es keine Träume mehr.“
Ich erinnere mich, wie ich mit dem gleichen blauen Kleid nach Hause eile.
„Pass auf dich auf!“ ruft Danas Mutter mir nach.
Doch das Kleid ist nicht mehr blau, es ist grau geworden, und die drei Tage zählen wie Jahre, und die Häuser sind nicht mehr dieselben, ja, sie geben sich alle erdenkliche Mühe, um als die gleichen in meinen Augen zu gelten. Man hat sie aber ausgewechselt, es sind nur noch Kulissen, vor denen ein böses Theater gespielt wird. Serbische Soldaten kommen mir entgegen, sie kreisen mich ein, einer ruft:
„Die bosnischen Mädchen gehören jetzt uns!“
Ein anderer lacht: „Heute feiern wir, morgen wirst du mit uns Spass haben, Kleines!“
Sie ziehen weiter, johlend, lachend. Ihnen gehört jetzt die Stadt, sie werden sie auspressen wie eine Zitrone, umpflügen wie einen Acker, ausreissen wie eine stachlige Pflanze. Jetzt, zum ersten Mal, begegne ich dem Gefühl des Fremdseins. Alles ist nicht mehr es selbst, das Schulhaus, an dem ich vorbeieile, die Gärten, und auch mein Gesicht, das ich in einer Autoscheibe sich spiegeln sehe, gehört nicht mehr gänzlich zu mir. Es hat sich leicht verschoben, meine Augen sind eine Spur nur verrückt von der Stelle, wo sie vorher waren, und dieses ein wenig Verrücktsein macht mich zu einer Fremden.
Ich biege um eine Ecke und nun steht das Haus meiner Kindheit vor mir am Rand der Stadt, dahinter beginnt die grosse Ebene, vor der Schuhfabrik. Die Tür steht offen, ich eile die Treppe hinauf und da, im Gang, müde, eingebrochen, aber mit einem unbändigen Glanz in den Augen, steht meine Mutter, als wäre sie immer da gestanden, während der letzten drei Tage, hätte auf mich gewartet, immer genau in dieser Haltung, leicht vorgebeugt, nicht zögernd, sich mir entgegenzuwerfen. Sie umarmt mich, drückt mich an sich, vergräbt ihren Kopf in meinen Haaren, greift mit ihren Händen in mein blaues Kleid, weint, um sich schnell aufzufangen, sich zu lösen aus dieser fast verschmelzenden Umarmung, sie schaut mir in die Augen:
„Mein Täubchen“, so hat sie mich immer genannt als Kind, als ich in der Wiese vor dem Haus Blumen pflückte und diese ihr entgegenhielt, wenn sie am Mittag aus der Fabrik kam: „Mein Täubchen.“
Ein stechender Schmerz durchfährt meinen Fuss, als ich versuche, mich aufzurichten. Der Felsbrocken, gegen den ich mich presste, bot mir Schutz, während tausend Steine um mich rutschten, zusammenschlugen, lärmten, nach unten donnerten. Da gab es den Moment, in welchem ich dachte, ich würde sterben. Erinnerungen kamen, Bilder flogen an mir vorbei. Das Gewesene kam mir so nah, als würde ich es noch einmal erleben. Jetzt beruhigt sich die Geröllhalde, nur noch einzelne Steine kollern nach unten, neben mir liegen Steine, die mich hätten töten können.
Eine Staubwolke liegt über allem, die meine Lunge reizt. Ich lebe!
Ist der Berg aufgestanden? Wollte er mich abschütteln, mir seine Macht zeigen, wie klein ich bin, wie verletzlich? Jetzt lese ich mein nacktes Leben auf, nehme es dankbar wieder auf. Ich habe überlebt und will aufstehen, um meinen Weg weiterzugehen. Da fährt dieser Schmerz in meinen Fuss, ist er verstaucht oder gebrochen? Konnte mich der Berg trotzdem treffen?
Ich sinke zurück, taste meinen Knöchel ab, schaffe es, meinen Fuss aus dem Schuh zu ziehen, er schwillt an. Stille ist in den Talkessel zurückgekehrt, die Staubwolke verzieht sich langsam. Ich bin allein, ich und der Berg. Hast du mich besiegt? Nein! Ich richte mich am Stein mich haltend auf, versuche einen Schritt zu gehen. Niemals werde ich den Weg zurückgehen können ins Tal hinunter. Es ist später Nachmittag.
Ein roter Punkt taucht auf, da, wo das Tal in die Hochebene mündet, nachdem es sich vom tiefer liegenden Dorf durch eine Schlucht in die Höhe gewunden hat. Es ist ein roter Jeep, stelle ich mit Erleichterung fest, er fährt langsam durch die Wiese, senkt sich dabei leicht ab oder neigt sich zur Seite, wenn er über eine unebene Stelle fährt. Hier gibt es keine Wege mehr, es ist Niemandsland, deshalb befürchtete ich schon, es würde mich niemand entdecken hier hinten im Talkessel, niemand hätte den Bergrutsch bemerkt und ich müsste lange ausharren.
Der Jeep kommt näher, fährt im Schritttempo geradewegs auf mich zu. Vielleicht war der Förster in der Nähe und hatte beobachtet, wie die Steinmassen nach unten rutschten oder man hat das Getöse bis ins Dorf hinunter gehört oder die Staubwolke gesehen. Der Jeep stoppt direkt vor mir. Ich lehne mich gegen den Felsbrocken, kann zwar stehen, da ich alles Gewicht auf ein Bein verlagere. Ich bin wohl kaum imstande, ohne Hilfe zu gehen, mein verletzter Fuss schmerzt derart, dass ich es nicht wage, ihn zu belasten oder gar zu bewegen.
Ein älterer Mann steigt aus dem Jeep. Er trägt einen Filzhut, den er tief in die Stirn gezogen hat. Seine Wangen sind zerfurcht wie der Stamm einer der Witterung ausgesetzten Arve. Im Mund hat er eine erloschene Brissago Zigarre, die wie ein knorriger Ast seltsam aus seinem Gesicht ragt. Die Augen, die im Schatten der Hutkrempe liegen, haben einen stechenden Blick. Er nimmt die Zigarre aus dem Mund und ruft:
„Was ist geschehen?“ Er scheint sich nicht für mich zu interessieren, sondern schleudert seine Frage, die wie eine Anklage klingt, in den Talkessel hinein, dass das Echo bestimmt und eindeutig zurückkommt: „Was ist geschehen?“ Dann schiebt er die Zigarre wieder in seinen Mundwinken, beisst mit den Zähnen auf das Mundstück, dabei schaut er mich aus dem Augenwinkel an. Unverständlich zuerst, mit eigenartig zermahlenen Wörter, beginnt er zu schimpfen, während er sich wieder von mir wegdreht und sich dem offenen Tal zuwendet, als wären dort viele Leute versammelt:
„Dieser Hang, sage ich euch, ist noch nie gerutscht. Ich lebe jetzt schon siebzig Jahre hier, noch nie hat sich der Berg bewegt. Ich sage euch, jetzt rächt sich der Berg an euch, ihr Wohlstandsmenschen, ihr Besserwisser aus dem Mittelland, ihr bequemen, verwöhnten Lebensgeniesser! Klimawandel, ja, ihr habt mit euren Fabriken und Flugzeugen die Welt erhitzt, wo gehen die Gletscher hin? Einmal wird das ganze Gebirge auf euch fallen, denn die Berge, das sage ich euch, sind Lebewesen, ihr habt sie erzürnt, jetzt sind sie wütend, sie werden sich rächen!“
Nun wendet sich der alte Mann mir zu, er hat einen feindseligen Blick, als würde ich die Menschengruppe verkörpern, welche er für das Abrutschen der Geröllhalde verantwortlich macht und welche offensichtlich durch seine harten Worte zur Raison gebracht werden sollte. Ich zucke nur mit den Schultern. Erst jetzt scheint er mich richtig wahrzunehmen. Er kommt auf mich zu, seine Augen bekommen etwas Weiches:
„Sind sie verletzt?“
„Ich habe mir den Fuss verstaucht, als ich vor den rutschenden Steinen geflohen bin.“
„Da hatten sie einen Schutzengel!“ Nun gleitet sein Blick zu meinem Fuss und wieder zu meinen Augen, aus seinem Gesicht ist das Harte gewichen, es wird fast durchlässig:
„Es trifft immer die falschen! Kommen sie, ich bringe sie ins Tal!“
Er reicht mir seinen Arm, an dem ich mich festhalte und zum Jeep humple, der einige Meter von uns entfernt steht. Er öffnet die Autotür, hält meinen Arm fest und zieht mich hoch, um mir zu helfen, den für mich sehr hohen Sitz zu erreichen. Endlich sitze ich im Jeep, da sehe ich über sein Gesicht ein verschmitztes Lächeln huschen, als er zuerst meinen Rucksack und meinen einen Schuh holt und dann vor der Kühlerhaube durchgeht, um auf der Fahrerseite einzusteigen. Dann fährt er los. Mein Fuss schmerzt entsetzlich, als der Jeep über die Bodenwellen fährt und dabei hin und her geschüttelt wird.
„Sie könnten tot sein!“ meint er nach längerem Schweigen. „Was machen sie eigentlich so allein da hinten in diesem gottverlassenen Tal? Hier grasen nur die Kühe und der Senn von der Alp kommt hie und da vorbei. Sie hatten Glück, ich habe oben auf der Alp den Käse geholt für meine Frau, da habe ich den Felssturz bemerkt.“
„Ich habe Ruhe gesucht in der Natur!“
„Gehören sie auch zu den gestressten Städtern, die hierher kommen, weil sie glauben, die Berge würden ihnen den Frieden geben, der ihnen abhandengekommen ist?“
„Gibt es im Dorf einen Arzt?“ frage ich, da ich nun wirklich keine Lust habe, mich in die immer zudringlicheren Fragen einspinnen zu lassen.
„Ja, es gibt einen Arzt, aber ich rate ihnen dringend ab, ihn aufzusuchen. Er ist ein Frauenheld, viele Frauen in unserem Dorf sind ihm geradezu verfallen, er ist ein Verführer!“
Ich lache hell auf, was den alten Mann zu verunsichern scheint.
„Glauben sie, ich bin bei diesem Arzt in Gefahr?“
„Man weiss nie! Meiner Frau jedenfalls hat er den Kopf verdreht! Seit sie sich von ihm behandeln lässt, spricht sie ständig vom Doktor Max!“
„Mein Fuss schmerzt, vielleicht ist er gebrochen!“
„Doktor Max wird bald das Dorf verlassen. Er hat in der Dorfzeitung einen Artikel geschrieben und erklärt, dass er während des Winters nach Thailand geht und dort den Ärmsten helfen will. Uns lässt er im Stich! Im Winter, wenn die Strassen schlecht sind, werden wir keinen Arzt mehr im Dorf haben. Letztes Jahr musste zwei Mal der Helikopter kommen, um einen Kranken ins Spital zu bringen, das kostet! Aber soll ich ihnen sagen, was der wahre Grund ist, warum Doktor Max im Winter in Thailand ist? Vielleicht hat er sich in eine Thailänderin verliebt und geniesst mit ihr das Leben an der Sonne, ob er dort wirklich den Ärmsten hilft, mag ich nicht recht glauben. Meine Frau bewundert ihn gerade deswegen, er habe eben ein gutes Herz, der Doktor Max, und er helfe, wo er nur kann!“
„Passen sie auf!“ schreie ich auf, als der Jeep mit viel zu hohem Tempo in einer Kurve ausschert und dem Abgrund gefährlich nahe kommt auf der steilabfallenden Kiesstrasse. Der alte Mann, der am Anfang schweigsam und sorgfältig den Jeep über die Hochebene steuerte, ist jetzt so richtig in Fahrt gekommen auf der abschüssigen Strecke der bewaldeten Schlucht. Er achtet während unseres Gesprächs immer weniger auf die Strasse und scheint es sichtlich zu geniessen, dass ich immer unruhiger werde und beginne, mich zu fürchten:
„Bringen sie mich bitte zu diesem Doktor Max und zwar lebend, ich bin heute schon einmal dem Tod von der Schippe gesprungen.“
„Ich bringe sie zu meiner Frau Sissi, sie hat die richtigen Kräuter für ihren Fuss. Sie ist Kaiserin von Österreich und in gewissem Sinne auch eine Hexe!“ Der alte Mann nimmt die Brissago aus dem Mund und schmunzelt, dass seine Zähne kurz aufblitzen. Er schaut mich so lange von der Seite an, dass der Jeep dem Abgrund wieder gefährlich nahekommt.
„Bitte, bringen sie mich zu diesem Doktor!“
„Ich bin Kurt,“ sagt er und reicht mir die Hand, nachdem er die Zigarre wieder in den Mundwinkel geschoben hat.
Endlich taucht zwischen den Tannen, die sich mit ihren Wurzeln wie mit gichtigen Fingern an den Felsbrocken am Abhang festkrallen, das erste Haus auf. Hier öffnet sich das Tal wieder. Das Dorf wird sichtbar, das dafür bekannt ist, dass es an die Eisenbahnstrecke angebunden ist, welche in vielen Kehrtunnels über den Pass in ein anderes Tal führt. Schau, die Kirche wechselt wie von Geisterhand die Seite. Wenn man ihm Zug sitzt und aufs Dorf hinunterschaut, erscheint es einmal am linken Fenster, dann wieder am rechten. Kann sich die Existenz eines Dorfes aufheben? Plötzlich verschwindet es und taucht auf der anderen Seite wieder auf!
Sissi lacht, lacht nur, als ich ihr erzähle, dass sie von ihrem Mann Hexe genannt wird.
„Mit Kräutern kenne ich mich aus, manchmal verhexe ich einen Mann, wenn er zu mir kommt in mein Wiener Kaffee und zu aufdringlich wird oder zu wüst redet. Ich jage ihm einen Hexenschuss in den Rücken, dass er zahm wird wie ein Lamm. Mit einem Kräuterschnaps, den ich selber braue, verschwinden seine Schmerzen wieder und schon nennt er mich eine Hexe, dabei bin ich doch die Kaiserin von Österreich!“
Sie tastet meinen Fuss ab, den ich mühsam aus dem Socken gezogen habe und streicht ihn mit einer wohlriechenden Salbe ein, bewegt ihn leicht, dass ich aufschreie vor Schmerz.
„Sie sollten den Fuss röntgen lassen, da hilft meine Magie nicht mehr. Ich bringe sie zu Doktor Max. Kurt ist ein Sturkopf und ein eifersüchtiger Gockel, nur weil ich einmal vom Doktor geschwärmt habe, glaubt mein Mann, ich sei ihm verfallen. Ja, Max hat wunderbare Hände. Ich hatte eine Entzündung in der Schulter, nicht nur die von ihm verschriebenen Medikamente haben mir geholfen, sondern seine Berührung, die Kraft des Himmels liegt in seinen Händen. Luzia, sie müssen ihn kennenlernen.“
Sissi nimmt mich am Arm, zieht mich aus dem Nebenzimmer, in dem sie mich behandelt hat, in ihr Kaffee, wo fünf ältere Männer und Kurt vor einem grossen Bier sitzen. Sissi hat mir während der Behandlung meines Fusses erzählt, dass sie das Wiener Kaffee, in welchem sie als junge Frau gearbeitet hatte, in die Berge mitnahm und hier für die Dorfbevölkerung schon seit vielen Jahren führte. Ihr Kaiserschmarren sei bekannt, es kämen auch viele Touristen, welche in den Bergen einmal eine kulinarische Abwechslung wünschten.
Die fünf Männer schauen zu mir hin, verzehren mich beinahe mit ihren Blicken und werfen mit ihren Sprüchen wie mit Bowlingkugeln nach mir, um ihre Treffsicherheit zu beweisen.
„Die junge Frau hat unseren Berg so sehr zum Beben gebracht, dass die Geröllhalde rutschte!“
„Kommen sie dem Berg nicht mehr zu nahe, sonst wirft er noch seine Felswand auf unser Dorf und begräbt uns alle lebendig.“
Nun meldet sich Kurt, verdreht seine Augen:
„Doktor Max wird mit seinen wunderbaren Händen,“ er hält nach diesem Ausdruck kurz inne, schaut seine Frau spöttisch an, um anzudeuten, dass es sich um ein Zitat von ihr handelt und wiederholt pathetisch: „er wird mit seinen wunderbaren Händen den zarten Fuss von Luzia heilen.“ Sissi wirft ihm einen vernichtenden Blick zurück, kneift ihre Augen zusammen und sagt mit schneidender Stimme: „Du gibst mir jetzt den Schlüssel des Jeeps, ich bringe die junge Frau höchstpersönlich zum Doktor, sie hat eine ernsthafte Verletzung und jeder Spott darüber zeugt von sehr geringem Einfühlungsvermögen.“
„Hoppla!“ meldet sich ein älterer Bauer zu Wort, der schon zwei leere Bierflaschen vor sich stehen hat: „Die Kaiserin hat eine gewählte Sprache, die wir hier oben leider nicht verstehen!“
Nun wird Kurt ungehalten gegenüber den Männern, die ihre Köpfe zusammenstecken, um ihr saftiges Grinsen zu verbergen.
„Auf meine Frau lasse ich nichts kommen. Ich habe sie vor vierzig Jahren aus Wien hierher in dieses Dorf gebracht, damals war sie noch viel schöner als die weltberühmte Sissi“, sagt Kurt schwärmerisch. Sissi geht zu ihm hin, hält ihre Hand hin: „Den Autoschlüssel bitte!“
Wir fahren mit dem roten Jeep durchs Dorf. Sissi umklammert etwas angestrengt das Steuerrad und hält gleichzeitig Ausschau nach Personen, die ihr bekannt sind, ihren Kopf nach links und rechts wendend. Wenn sie jemanden sieht, winkt sie und hält, wenn sie erkannt worden ist, die Hand in die Höhe, als würde sie die Menschen segnen. Ich schaue sie von der Seite an. Sie ist eine energische Person, ihre schwarzen, vermutlich gefärbten Haare, hat sie hinten zusammengebunden. Sie passt nicht in dieses Bergdorf, denn tatsächlich gleicht sie dem Bildnis der Kaiserin Elisabeth, welches mir präsent ist: Die dunklen, lebendigen Augen und die vollen schwarzen Haare, in welche eine zierliche Krone geflochten ist. Nur die Krone fehlt, aber ihre Haltung und ihr Gesichtsausdruck kommt derjenigen der Kaiserin nahe, sie hat sich jung gehalten.
Wir fahren über den Dorfplatz am Brunnen vorbei. Selbstbewusst stehen die breiten Häuser mit ihren dicken Mauern nebeneinander und bilden eine Gasse. Ihre Fenster sind tief ins breite Mauerwerk eingelassen, sie blinzeln wie kleine, tiefliegende Augen hinter buschigen Brauen.
„Hier ist das Haus des Doktors!“ Sissi stoppt den Jeep mitten auf der Strasse, steigt aus, hilft mir aus dem Wagen. „Ich begleite dich ins Wartezimmer, dann muss ich schnell gehen, Kurt will nicht, dass ich zu lange wegbleibe.“
Sissi stützt mich, als ich aus dem roten Jeep steige. Jetzt stehe ich vor dem Haus mit den roten Fensterläden, es ist ein im italienischen Stil erbautes Haus südlich, leicht und charmant, nicht wie die anderen, schweren, wie Berge trotzenden Häuser.
Genau jetzt hält die Zeit an. Diesen Moment kenne ich schon! Habe ich davon geträumt, als ich ein Kind war? Habe ich ihn erahnt, schon erlitten? Steht er in den Sternen, ist davon ein Abbild in meinem Herzen? Ein Déjàvu? Schon gesehen? Ja, ich habe mich selbst schon genau so gesehen. Der Moment verdoppelt sich, weil der reale sich mit einem vorherigen, schon gewesenen Moment paart. Mein Fuss ohne Schuh mit dem gelben Socken, die Jeans an der einen Seite hochgekrempelt, die Türklinke vor mir, die ich in die Hand nehmen will, die geheimnisvolle Frau neben mir mit der kaiserlichen Haarpracht, sie weiss mehr von mir als ich ahne, das Haus mit den roten Läden, die oben an zwei Fenstern geschlossen sind, die schmale Strasse, die neben dem Haus vorbei über eine Brücke führt, das Rauschen eines Baches, den ich nicht sehe. Berge ragen darüber rötlich in die Abendsonne, das alles, déjà vu? So falle ich seltsam aus der Zeit. Dieses Ereignis ragt aus der Zeitlichkeit heraus, es ist nicht diese Stunde an diesem Abend, sondern die Zeit wird entlarvt als etwas, dass es nicht wirklich gibt. Zeit als die grösste Täuschung der menschlichen Wahrnehmung?
„Was ist mir dir?“ fragt Sissi. Genau diesen Satz habe ich voraus gewusst, dass er so kommen würde, wie er betont ist, wie er sich vermischt mit dem Geräusch eines vorbeifahrenden Motorrades. Dieser Satz steht nicht in einer zeitlichen Abfolge, sondern ist ein Teil einer Schicksalskette. Ich gehe weiter wie im Traum, greife nach der Türklinke, antworte Sissi:
„Alles in Ordnung!“ Ich trete ins Haus, dessen Tür nicht verschlossen ist, ein Schild hängt über einer Tür im Gang: Wartezimmer, bitte eintreten. Auch dieses Schild kommt mir bekannt vor. Sissi führt mich in das leere Zimmer, wo nur einige Stühle stehen. Glücksposthefte liegen auf einem niederen Tisch, eine Wasserflasche mit der Aufschrift: Bitte bedienen sie sich.
Sissi stellt meinen Rucksack, den sie aus dem Auto geholt hat, neben einen Stuhl. Sie wünscht mir alles Gute und verlässt den Raum. Ich sehe durchs Fenster, wie sie in den roten Jeep steigt. Ein Auto, das warten muss, weil der Jeep mitten in der Strasse steht, hupt. Der Motor des Jeeps heult auf und Sissi winkt mir nochmals durch das Seitenfenster zu, obwohl sie mich sicher nicht sehen kann hinter dem sich spiegelnden Fensterglas.
Im Wartezimmer warte ich, worauf? Dass die Tür aufgeht und dieser Doktor Max mich zur Konsultation ruft? Warte ich darauf, dass sich mein Leben verändert? Dass in mich ein Same fällt und etwas Neues, Wundersames zu wachsen anfängt? Dass ein alter, abgenützter Sinn sich neu belebt, dass der ausgetrocknete Garten von neuem ein Blütenmeer hervorbringt? Dass der schwere Schmerz versinkt oder das Gewitter vorbeizieht?