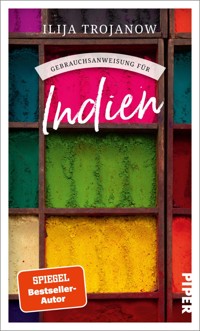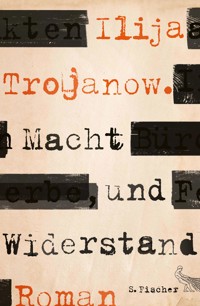
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ilija Trojanow hat sein Lebensbuch geschrieben: Ein schwindelerregender Blick in den Abgrund zwischen Macht und Widerstand. Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert. Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Geschichten, die Trojanow seit den Neunzigerjahren in Gesprächen mit Zeitzeugen gesammelt hat, verdichtet er zu einer spannenden Schicksalserzählung von menschlicher Würde und Niedertracht. ›Macht und Widerstand‹ ist bewegende Erinnerungsarbeit, ein Roman, wie man ihn in seiner Entschiedenheit und poetischen Kraft lange nicht gelesen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ilija Trojanow
Macht und Widerstand
Roman
Über dieses Buch
Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert.
Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Geschichten, die Trojanow seit den Neunzigerjahren in Gesprächen mit Zeitzeugen gesammelt hat, verdichtet er zu einer spannenden Schicksalserzählung von menschlicher Würde und Niedertracht. ›Macht und Widerstand‹ ist bewegende Erinnerungsarbeit, ein Roman, wie man ihn in seiner Entschiedenheit und poetischen Kraft lange nicht gelesen hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Simone Andjelković
Lektorat: Angelika Klammer
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403604-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Vorbemerkung
Motto
1999 erzählt
Konstantin
Metodi
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
Konstantin
1944 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
Metodi
1949 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
Konstantin
1950 erzählt
Metodi
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
Konstantin
1952 erzählt
Rezept Behandlung eines Rechtsabweichlers
Metodi
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
Metodi
Konstantin
1953 erzählt
Metodi
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
Metodi
1999 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
1954 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
1955 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
1956, 1968, 1980 erzählt
Metodi
Konstantin
Metodi
1957 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
1990 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
Konstantin
1958 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Metodi
1959 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
Metodi
Konstantin
1970 erzählt
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
1971 erzählt
Metodi
Konstantin
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Konstantin
Metodi
1989 erzählt
Konstantin
Metodi
2007 erzählt
Metodi
Konstantin
Metodi
1990 erzählt
Metodi
Konstantin
2000 erzählt
Konstantin
Konstantin
Wahrer Geist ist Widerstand [...]
Es hat sich gelohnt.
Danksagung
Für Abdulrahman Pascha
Dieser Roman basiert auf den mündlichen und schriftlichen Zeugnissen einer Vielzahl ehemaliger politischer Häftlinge sowie einiger Offiziere a.D. der Staatssicherheit der Volksrepublik Bulgarien. Bei den abgedruckten Unterlagen (»aus dem archiv der staatssicherheit«) handelt es sich um Originaldokumente aus den zeitweise-teilweise zugänglichen Dossiers eines dieser Widerstandskämpfer. Diese Akten wurden überwiegend von Alexander Sitzmann übersetzt.
Beim ersten Mal kommt Geschichte tragisch daher, beim zweiten Mal absurd, beim dritten Mal tragisch und absurd zugleich.
Miltscho Minkow, Hobbyphilosoph und Amateurhenker aus Panagjurischte
1999 erzählt
Ging früher einer fremd, galt er als sittlich verkommen. Böser Mann, böser kleiner Mann. War’s einer aus der Partei, so hieß es, er habe einen Fehler begangen. Unbedacht, kann ja mal passieren. Verführte ein Bonze die Tochter eines Arbeiters, klopften ihm die Genossen auf die Schulter. Du Schlingel du. Und sammelte einer der Oberen Liebschaften wie Orden, wurden seine Verführungskünste bewundert. Das war früher. Heute ist die Moral an den Dollar gekoppelt.
Ein grandioses Zeitalter läuft aus in vollen Touren, und die Wassermelonen, aufgeschnitten am Straßenrand, glänzen wonnevoll. Dem Einfallsreichtum der Verkäufer höchstes Lob: zwei Tropfen Urin in die Melone gespritzt und schon reift sie prall rot, diese Traummelone. Was für eine elegante Lösung, zeitgemäß effizient statt der umständlichen und langwierigen Pfropferei von einst. Mühsam mussten die Altvorderen Schweine mit Tausendfüßlern kreuzen, zur Ankurbelung der Schweinshaxenproduktion. Mitschurin, du Held jeder Tafelrunde, wie ist dir bloß ein rostresistenter Traktor gelungen? Simpel, aber raffiniert, mit der Kartoffel gekreuzt …
Posaunen und Fanfaren sind passé, Hupe und gestreckter Mittelfinger en vogue, die Reifen zu beiden Seiten des Mittelstreifens, im Rückspiegel Überflüssiges, im Straßengraben ein ölverschmiertes Kopftuch, Brocken selbstgebackenen Brots, eine faulige Zwetschge und ein Passat, Baujahr 1977, erworben im Industriegebiet einer westdeutschen Kleinstadt von einem Studenten der Nationalökonomie, der sich im Ausland von mitgeführten Konserven ernährte, ein grüner Variant, der bis vor einer Stunde gute Dienste geleistet hat, ein Relikt aus Mangelzeiten, die Taschen stehen neben dem geöffneten Kofferraum, im Warten geht es weiter. Schade wirklich, dass dieses Jahrhundert sich dem Ende zuneigt. Bleibt denn noch Zeit für eine Reprise, für eine letzte Gelegenheit, den Rotz aus der Nase zu blasen?
Keine Wehmut bitte, die Voraussagen fürs nächste Säkulum sind blendend, es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, alle Batterien und Akkus sind vollgeladen. Im Kreis Sewliewo schleicht eine alte Frau mit einem Kassettenrekorder aus dem Haus. Wie jede Nacht seit zehn Jahren. Zitternd hält sie das Gerät vor die Brust, sie drückt auf die Aufnahmetaste, sie achtet darauf, keinen Laut von sich zu geben, keinen Seufzer, kein Stöhnen, um die Stimmen nicht zu stören. Ihr Bruder wurde abgeholt, in den grauen Morgenstunden, er ist nicht zurückgekehrt. Er spricht zu ihr, dessen ist sich die Frau sicher. Er war gesellig, ihr verschwundener älterer Bruder, er hat Gefährten um sich geschart, die ebenfalls ungehört blieben, würde seine Schwester nicht jede Nacht mit dem Kassettenrekorder in der Hand im Hof stehen, so reglos es ihr nur möglich ist, um die Stimmen nicht zu verschrecken, die so lange stumm geblieben sind. Einmal im Monat hält ihr Sohn vor dem knarzenden Haus, steigt die Stufen hinauf, in der Linken eine Plastiktüte voller Leerkassetten. Er bleibt nicht lange, er hat keine Zeit, von dem Strudel zu kosten, den sie für ihn gebacken hat. Sie wickelt ein großes Stück in ein Küchenhandtuch ein, für die Heimfahrt, er schlingt es hinunter beim Tankstopp. Wenn die Frau tagsüber die nächtlichen Aufnahmen abspielt, in der Küche, dem einzig beheizten Raum im Winter, die Füße in dicken selbstgestrickten Socken, hört sie keine Stimmen. Früher bewahrte sie die Kassetten in einem Schrank auf, der sich absperren lässt. Der Schrank ist längst voll. Sie schließt die müden Augen und wartet auf die nächste Nacht.
Manche der Flitzenden verkrampfen hinter dem Lenkrad, andere steuern ihr Gefährt mit Daumen und Raucherhusten. Nur wer durch getönte Fensterscheiben auf Hindernisse blickt, wird diese aus dem Weg räumen. Es gibt eingefrorene Gesichter, es gibt Gesichter, die wirken wie zu heiß gewaschen, das Gesicht des Gefängnisdirektors etwa, der sich dienstbeflissen der Aufgabe widmet, Journalisten zu empfangen. Unter dem rechten Auge ein Bluterguss, das linke Auge zuckt. Einer der Journalisten fragt:
»Sie haben schon in der alten Zeit hier gedient?«
»Nein.«
»Seit wann arbeiten Sie hier?«
»Erst seit 1980.«
»Das war doch die alte Zeit?«
»Nein, die war davor.«
»Davor?«
»Ja, in den 50ern.«
Sind sie nicht entzückend, diese Menschentiere? Jedem von ihnen einen Schnaps, großzügig eingießen und gut die Karten mischen, gezinkt wird früh genug.
»Nun mal ehrlich, unter uns, was habt ihr mit den Leichen … damals?«
»Wurden irgendwo verscharrt, nicht auf unserem Gelände, wo denkt ihr hin, hinter dem Gefängnis irgendwo, gibt keine Unterlagen bei uns, ich war ja noch nicht da, mehr wissen wir auch nicht, irgendwann werden beim Umgraben Schädel auftauchen.«
Die Journalisten fahren weiter, nach Prawez, zu einer internationalen Konferenz über Humor und Herrschaft, kostensparend, zwei Hasen mit einem Schuss erlegen. Sie sind ausgelassen, der matschige Winter ist vergangen, sie haben noch eine gute Portion Leben vor sich, die Sanduhr oben und unten gleichermaßen voll. Weil sie früher nicht auffällig geworden sind, können sie heute mitmischen, vorsichtig versteht sich, weiterhin auf leisen Sohlen. Da kommt die spritzige Erinnerung an die Eröffnung des Halbleiterwerks gerade recht, just in jenem Dorf namens Prawez, das sie alle zu einem Städtchen aufphrasiert haben, zu Beginn ihrer schlampig formulierten Karriere. Generalsekretär Žiwkow – letzthin staatsmännisch zu Grabe getragen, die Journalisten waren anwesend, sie haben ein ausgewogenes Resümee gezogen – gab seinem Heimatdorf die Ehre:
»Es ist mir eine außerordentliche Freude, dieses wichtige, dieses äußerst wichtige Werk am heutigen Tag an diesem Ort zu eröffnen. Und ich verspreche euch, Genossinnen und Genossen, heute sind’s nur Halbleiter, doch morgen schon werden wir ganze Leiter produzieren.«
Die Journalisten lachen über die Erinnerung an einen wagemutigen Scherz, das Fenster offen, wer sie überholt, ohne mitzulachen, der kennt den Witz zur Genüge oder hat ihn nicht verstanden.
»Nein, nein. Der geht besser. Žiwkow hält eine Jubiläumsrede: ›Heute ist ein Fünftel der Welt sozialistisch, doch ich schwöre euch, bei Marx, Engels und Khan Krum, bald wird’s ein Zehntel der Welt sein.‹«
Der Lastwagen vor ihnen keucht.
»Ausgleich, mein Lieber. Gerechtes Unentschieden. Da fällt einem die Wahl richtig schwer.«
Qual der Qual.
In einer Wohnung im vierzehnten Stock in einer Trabantenstadt in einem Satellitenstaat. Der Preis: früher zehn Jahre Wartezeit, heute zehntausend Dollar. Ausblick auf unzählige Plattenbauten. Nach Norden hin die Ausläufer des Plana Gebirges, im Süden der kapitale Berg, an seinen Hängen eine Villa, digital befestigt, Sicherheit am Bau. Hier werden die Chrysanthemen mit Bauernschläue bewässert. Eine enge Wohnung, eine geräumige Villa. Zwei alte Männer, die alle Quittungen des Lebens aufbewahrt haben. Im Kopf abgespeichert, abgelegt in den Akten. Die Sterne am Himmel ein Zerrbild, im Spiegel ein entglittenes Gesicht.
Das Jahrhundert schmilzt dahin, unter der Zunge klebt ein Streifen bitteren Bonbons, lieb Vaterland, eine Leiter ohne Sprossen, du Paradies auf Erden, unter Bockshornklee harren Leichen der Lüftung, deine Pracht kennt keine Grenzen, ein Haufen mit Urin aufgespritzter Melonen und am Wegrand Menschen im Schweiße ihrer Verzweiflung. Wir aber flitzen weiter. Ja nicht anhalten.
Konstantin
Verrat, wie lautet dein Name? Deine Adresse, deine Kragenweite? Beziehst du Rente? Wirst du dich jemals zur Ruhe setzen? Schreibst du an deinen Memoiren? Wie viele Kielkröpfe hast du in die Welt geworfen? Hast du ihnen beigebracht, alles und jeden zu verraten?
Es gibt Tage, an denen reicht der Wasserdruck nicht bis in den vierzehnten Stock hinauf. Es tröpfelt aus dem Hahn. Die Plastikeimer sind vorsorglich gefüllt, der Kühlschrank ist voller Wasserflaschen. Aufs Duschen kann ich vorübergehend verzichten. Die Verhältnisse haben selten meiner Verfassung entsprochen. Vom Küchenfenster aus sehe ich den Zeitungskiosk, daneben die Bushaltestelle, gegenüber die kleine Brücke über den Kanal zum Markt. Sobald morgens das Gitter des Kiosks hochgeht, ziehe ich Hose, Jacke über den Pyjama, hinunter, hinaus, wähle meine Lektüre, jeden Morgen leicht variiert. Zwei Zeitungen pro Tag kann ich mir leisten. Beim Kauf einer dritten muss ich mich beim Abendessen einschränken. Das fällt mir nicht schwer, Entbehrung ist eine Frage der Übung. Eine Schale Joghurt, eine Scheibe Brot, das genügt mir. Meist wähle ich 24 STUNDEN + STANDARD, gelegentlich ARBEIT + POLITIK, seltener WORT + DEMOKRATIE. Oder KAPITAL. An Auswahl kein Mangel, mehr Zeitungen als Informationen.
»Sie brauchen die Zeitung nicht wegen eines einzigen Artikels zu kaufen, Bai Konstantin, das ist doch Verschwendung.«
Der Kioskbesitzer blickt auf die aufgeschlagene Zeitung in meinen Händen, deutet auf die Sitzbank der Bushaltestelle. Seine Einladung ist eine kleine Geste des Großmuts, sie berührt mich unangenehm. Von früh bis spät hockt er in seinem wohlgeordneten Kiosk, dicht von Nachrichten umgeben, die ihm nichts bedeuten außer als Überlebensmittel. Die Ränder unter seinen Augen haben sich in letzter Zeit eingedunkelt. Ich lehne dankend ab. Das käme mir wie Ausnutzung vor, auch er muss jeden Lew umdrehen.
Bei einer Tasse Kräutertee, sieben Minuten gezogen (das letzte Geschenk meines Bruders war ein Küchenwecker), blättere ich die Zeitungen durch, jeden Morgen mit Widerwillen. Politik hat mich von jeher angewidert. Auch wenn ich mich ein Leben lang damit beschäftigen musste. Wer in einer Zelle Das Kapital sieben Mal durchgearbeitet hat, mit klecksendem Kugelschreiber, träumt von Zeiten, in denen es solcher Werke nicht mehr bedarf. Als Häftling hatte ich keine andere Wahl, als die »Klassiker« zu studieren, so wie der Teufel das Evangelium. Das Dämonische daran? Die Demaskierung ihrer Heiligen!
Die Zeitungslektüre dauert nicht lange. Ich weiß, wonach ich suche; alles andere blende ich aus. Zwischen den Zeilen lesen wird dies gemeinhin genannt, von jenen, die zwischen den Zeilen schreiben. Die Messung des Schattens, den Polemik und Propaganda werfen, ermöglicht Rückschlüsse auf den Stand der Sonne. Wer dieses Verfahren beherrscht, kann sich als Häftling präziser informieren als die Freien, denen die Schlagzeilen zugefächelt werden, ein angenehmes Lüftchen. Zum Frühstück (ein Stück Schafskäse, einige dicke Scheiben Weißbrot, im Sommer etwas Wassermelone, einige Zwetschgen oder Aprikosen, sonntags ein gekochtes Ei) höre ich im Radio die Acht-Uhr-Nachrichten, danach die Presseschau, gefolgt vom Tagesthema. Bei bedeutenderen Parlamentsdebatten schalte ich den Fernseher an. Eigentlich ist nichts in diesem Land von Bedeutung, außer man glaubt (so wie ich, aus Gewohnheit, aus Sturheit), dass sich in jedem Ausschnitt, mag er noch so nebensächlich sein, etwas Wesentliches spiegelt.
Derart geordnet vergeht die Zeit. Ich weiß nicht, womit die anderen ihre Tage ausfüllen. Wenn wir zusammenkommen, einmal die Woche, Mittwochvormittag, fällt es mir zu, die jüngsten Entwicklungen zu analysieren. Nicht jeder findet sich im Spiegelkabinett des Politischen zurecht. Die anderen streiten meist aus Unkenntnis, widersprechen mir mit unbedachten Argumenten. Sie wollen beweisen, dass sie einen eigenen Kopf haben, ohne ihn zu benutzen. Eine weit verbreitete Malaise. Wir teilen uns eine mitgebrachte Flasche selbstgebrannten Rakija. Einige von uns (nicht viele) bestellen beim Wirt einen kleinen Kaffee. Er serviert ihn mit zwei in dünnem Papier eingewickelten Zuckerwürfeln. Früher stand ein Zuckerstreuer auf dem Tisch. Am Ende unserer wortreichen Vormittage war der Zuckerstreuer leer. Der Wirt würde uns nicht dulden, hätten wir nicht einst seinen Vater warmgerieben, mit vereinten Kräften, auf einem lecken Boot mitten im eisigen Wasser. Jene, die zu viel Zucker in ihren Kaffee rührten, haben das Leben seines Vaters in wärmenden Händen gehalten, haben verhindert, dass er Erfrierungen erlitt (einem anderen wurden beide Beine amputiert). In der Erinnerung der Verwandten waren wir alle, die wir allwöchentlich an diesem schmucklosen Tisch Leitungswasser trinken, einen kleinen Selbstgebrannten, einen Kaffee, die wir unsere Jugend im Gefängnis, im Lager verlebt haben, jahrzehntelang ein Schamfleck. Sooft das Tischtuch der Familiengeschichte zur Reinigung gebracht wurde, so ein Makel ließ sich nicht entfernen. Wenn das dem Wirt nicht Grund genug war, den Vater zu verfluchen, diesen verdammten Querschädel, der ihm ein bequemeres, erfolgreicheres Leben verbaut hat. Wenn man wollte, dass die Nächsten stolz auf einen waren, musste man sich um Unauffälligkeit bemühen.
Egal, wie sehr wir ausschweifen, wir kehren stets zurück zu dem Thema, das uns zusammenbringt, einmal die Woche, wir reden uns in Rage, laut, lauter, bis der Wirt uns um Mäßigung bittet, Gäste von den Nachbartischen hätten sich beschwert.
»Wegen der Lautstärke oder wegen des Inhalts?«, frage ich.
»Ihr müsst die krumme Welt nicht in meiner Kneipe geradebiegen!«
Er klingt eher flehentlich als streitsüchtig.
Ich betrachte die Stiefellecker an den anderen Tischen, die ihre Blicke schnell abwenden. Leicht zu erahnen, was sie über uns denken … Lasst das Vergangene doch mal gut sein (ergo: findet euch mit der Niederlage ab), es ist so viel Gras über die Sache gewachsen (will meinen über die Gräber), was stochert ihr in alten Wunden herum (anstatt euch um neue Wunden zu kümmern). Sogar an unserem Tisch, an dem grob geschätzt zwei Jahrhunderte Kerker beengten Platz gefunden haben, wird unsere Vergangenheit gelegentlich kleingeredet.
»Wir hatten Pech«, klagt einer, »unsere Generation, was für ein grausames Pech. Wir wurden in schlimme Zeiten hineingeboren, wir hatten keine Chance.«
»Was war denn so schlimm an unserer Epoche«, fahre ich dazwischen, »wir haben für etwas gekämpft, an das wir geglaubt haben. Wir waren bereit, uns zu opfern, für etwas von höherem Wert als unser eigenes Leben. Das war ein Geschenk des Schicksals. Ich möchte zu keiner anderen Zeit gelebt haben.«
»Bist du dir da völlig sicher?«, fragt Toma, einer von wenigen, die ich zu meinen Freunden zählen würde.
»Noch lieber wäre mir ein Leben in ferner Zukunft.«
»Wenn …?«, setzt Toma nach, als hätten wir den Wortwechsel einstudiert.
»Wenn es keine Polizei, keine Gefängnisse, keine Ministerien, keinen schlechten Rakija mehr gibt!«
»Ach, Kosjo, du wirst dich niemals ändern.«
»Willst du mir schmeicheln?«
Die anderen schütteln augenfällig den Kopf, typisch Konstantin, immer konträr, aus Prinzip, zum Possen. Muss alles immer in Frage stellen. Ich weiß, ich bin anstrengend. Ich lasse die anderen reden, ich halte meinen Mund. Wenn die ersten Mittagsgäste eintrudeln, werden wir hinauskomplimentiert. Draußen vor der Tür stehen wir herum, es dauert, bis wir uns zerstreuen. Ein Quacksalber, der kaum ein Jahr im Lager verbracht hat, will mir zum Abschied Sedativa andrehen.
»Lass es etwas ruhiger angehen, mein Lieber.«
Er klopft mir auf die Brust.
»Du hast dich genug geopfert, du hast mehr getan als jeder andere.«
»Wie recht du hast«, antworte ich ihm. »All jene, die größere Opfer erbracht haben, liegen im Grab.«
Der Fahrstuhl fällt häufig aus. Das Gebäude verfügt zwar über einen zweiten, aber in dem brennt das Deckenlicht nicht, seit geraumer Zeit. Die Nachbarskinder haben Angst vor der Enge, der Dunkelheit. Seitdem sie wissen, dass ich in einem Raum, nicht größer als dieser Fahrstuhl, Tage, Wochen, Monate verbracht habe
(Wie lang warst eingelocht, Onkel?
Wie alt bist du?
Fünf.
So lange wie du gelebt hast, wenn du doppelt so alt sein wirst wie jetzt.
Versteh ich nicht!),
klingeln sie bei mir: »Onkel, bringst du uns nach unten?« Sie finden Gefallen an meinem verzierten Gehstock, an meinem weißen Bart. Draußen spielen sie inmitten von Unkraut, Bauschutt, bis sie meine vertraute Gestalt erblicken, vom Einkauf zurück, von einem anstrengenden Spaziergang, zu dem ich mich jedes Mal überwinden muss. Mit dem spitzem Ende des Gehstocks drücke ich auf den Knopf zwischen den beiden Fahrstühlen. Einst leuchtete er rot auf. Ich sehe nach der Post, der Schlüssel klemmt, der Kasten ist leer.
So vergeht die Zeit. In aufgenötigter Wachsamkeit. Nächtens starre ich auf die Silhouette des Witoscha. Schlage weitere Nägel ein für längst aufgehängte Erinnerungen, steige sehnsüchtig in das Taxi eines Rauchers, meine Sucht nach vielen Jahren der Enthaltsamkeit wie eine weggeworfene Kippe. Kippe um Kippe aufsammeln, die Tabakreste auf die Handfläche bröseln, in die längste der aufgeklaubten Kippen stopfen, sie anzünden, aussteigen, den nie beleuchteten Gipfel der Schlaflosigkeit erklimmen. Witoscha, für Alpinisten zu leicht, für Gehstockträumer zu mühsam.
Die Nachbarin am Ende des Korridors, eine Krankenschwester in jenem Alter, in dem selbst dezenter Lippenstift zu dick aufträgt, sorgt sich um mich wegen meines solitären Lebens. Wenn ich sie frage, wozu ich eine Gefährtin brauchte, betet Dora eine Liste von Konventionen herunter, die mit der Maxime schließt, der Mensch sollte sein Essen mit einem Nächsten teilen. Ich erwidere, dass ich mein Essen mit dem streunenden Hund teilte, der sich vierzehn Stockwerke hinaufplagen muss, weil die meisten Hausbewohner ihn aus dem Fahrstuhl treten. Er hält sich am Leben trotz eines verkrüppelten Vorderfußes, er schläft vor der Haustür der Krankenschwester, gefüttert wird er vor meiner Tür, das verbindet uns drei. Gelegentlich beobachte ich ihn durch das Guckloch, ein zähes Tier.
Du musst verstehen, flüsterten die Mitläufer früher auf mich ein, wir sind nicht so stark wie du. Es klang wie ein Vorwurf, als wäre Haltung ein Makel, als wäre ich im Unrecht, weil ich keine Kompromisse eingehen, weil ich nicht nachgeben könne. Wenn wir in Streit gerieten, selten genug, denn selbst Streit mit mir konnte Verdacht erregen, warfen sie mir einen Mangel an Nachsicht vor.
Alleinsein ist die Chance, einen interessanten Menschen kennenzulernen. Diesen Satz, leichtfertig dahingesagt, hatte ich Montaigne zugeschrieben. Dora korrigierte mich einige Tage später. Es ist leichter, immer allein zu sein, als nie allein zu sein. Das stamme von Michel de Montaigne. Vielleicht gefalle mir eher La Bruyères Ausspruch: Dies große Unglück, nicht allein sein zu können. Auf meinen Widerspruch hin entgegnet sie, gewiss wünsche ich mir Umgang mit Menschen, allerdings nur mit solchen, die nicht existierten. Meine Sentenz sei hingegen niemandem außer mir geläufig, daher könne ich sie getrost als meine eigene Weisheit ausgeben.
Dora ist der Schlaf vergangen, wie auch mir, sie flaniert nächtens durchs Internet, richtet sich zwischen zwei Bridgepartien (Hospital Bridge, eine beliebte Webseite, vor allem bei jenen, die Nachtschicht schieben müssen) das ideale Krankenhaus ein, ein vorbildliches, eines, das den Namen Städtisches Krankenhaus verdient. Sie informiert sich umfassend, bevor sie die Infusionsständer ordert, die ihr im Alltag fehlen, neue Bettgitterführungen, Schlafkissen, Rückenstützen, Bewegungsschienen, sie wählt alles bis ins letzte Detail aus für das »Spital der gesunden Absichten«, wie sie es benannt hat, mit etwas Schützenhilfe ihres Nachbars am anderen Ende des Korridors. Stundenlang verwaltet sie Warenkörbe, ohne je eine Bestellung abzuschicken. Es sei zum Haareraufen, alles derart leicht verfügbar, erklärt sie mir während einer unserer gemeinsamen Besorgungen, uns beiden Pflichttermin, seitdem sie in meiner Jutetasche einige angefaulte Tomaten erspäht hat. Sie misstraut den Marktverkäufern, hält wenig von meinen Fähigkeiten, mich nicht übers Ohr hauen zu lassen.
»Beim Wesentlichen hat mich noch nie einer hinters Licht geführt.«
Sie lächelt über mich wie über einen Knirps, der sich beim Protzen überhebt.
»Ja, ja, Herr Scheitanow, große Sprüche, faule Tomaten.«
Sie besitzt das Talent der trefflichen Lakonie.
»Dreimal klicken«, berichtet sie mit prüfendem Blick auf das Gemüse, »drei läppische Klicks, damit wär’s getan, dann hätten wir einen Dialysestuhl, elektrisch verstellbar, mobil und stabil, für gerade einmal tausend Dollar, das ist doch ein Klacks. Sie sollten sich schämen, solche Tomaten anzubieten.«
»Haben nicht alle so vornehme Ansprüche wie Sie, werte Frau.«
»Ja«, antworte ich ihr, »es ist ein Klacks. Ein unerreichbarer Klacks.«
Wir könnten uns im Korridor verabschieden; wie soll ich aber einem traurigen Menschen den Rücken zudrehen? Seitdem ich weiß, welche Kekse sie bevorzugt, halte ich im Wandschrank stets einige Packungen vorrätig, neben einer seit Jahren unangetasteten Whiskeyflasche, dem Mitbringsel eines Emigranten, der auf Besuch heimgekehrt war.
Noch bin ich halbwegs bei Kräften, trotz aller Gebrechen. Alter ist ein Feind, unerbittlich wie die Staatssicherheit. Seit Jahren kämpfe ich an zwei Fronten. Der Internist staunt über mein gestundetes Ableben. Ich sei der leibhaftige Beweis, verkündet er mit dem Stolz eines Häretikers, dass der Geist stärker sei als die Materie. Er solle die Latte nicht so hoch hängen, widerspreche ich, die Erklärung sei profaner, ich hätte noch eine Rechnung offen mit dem Verrat. Solange die nicht beglichen ist, werde ich pünktlich das Dutzend Pillen einnehmen, das mich am Leben erhält, während ich auf eine weitere Gelegenheit warte.
Als alter Mann stehe ich früh am Morgen aufrecht vor der schweren Tür.
Metodi
Aman, pisnalo mi e, der Frühling krault ihnen die Eier, sie reißen sich meinen Sonntag unter ihre manikürten Nägel. Diese Parasiten, nisten sich ein, zapfen mich an, verdammte Blutsauger. Wie ich Sonntage hasse. Am Mittwoch erkundigen sie sich höflich bei der Sekretärin, ob du einige Minuten Zeit für sie hast, wie sich’s gehört, am Sonntag terrorisieren sie dich mit ihrem Geschwätz. Obendrauf das Gejammer meiner Frau, wie sieht’s denn hier aus, abgenagte Knochen unter den Stühlen, Albena hat jedes Mal die Nase gestrichen voll, obwohl’s ihre Neffen sind, ihre verwöhnten Kinderchen. Ich darf mich nicht beklagen, wer nicht für eigene Nachfolger sorgt, dem bleibt nur die angeheiratete Brut. Es ist ’n Fluch, wenn man lauter Neffen und keine Söhne hat. Einmal schlug ich Hausverbot vor, da hatte sie gleich ’nen hysterischen Anfall, dann bin ich weg, schrie Albena, was für ’ne lächerliche Drohung. Seitdem habe ich die Sonntage abgeschrieben, ein Tag in der Woche muss halt geopfert werden. Lass doch mal andere jammern, sag ich zu ihr, bist du die Einzige auf der Welt, die was zu jammern hat? Aber nein, sie jammert weiter, Fettflecken auf ihrem geliebten Benz-Sofa, jammert mir die Ohren voll, Spritzer auf dem Velours, wie’s mich juckt, ihr eine runterzuhauen. Wir haben alle so unsere Macken, manche sind verdammt schwer zu ertragen. Was müssen die Neffen auch sonntags ihre Huren anschleppen, früher haben sie die zu Hause gelassen, jetzt schmatzen sie an unserem Tisch, reißen das Maul auf, wie’s ihnen passt. Letzten Sonntag hielt mir eine ’nen Vortrag, zum Lammbraten, über Weltpolitik, also, China brauchen wir nicht fürchten! Wieso das denn, Schneckchen? Die Männer dort, die sind klein, und kleine Männer kriegen nichts gebacken. Woher weißt du das? Aus der Geschichte, Bai Metodi, als große, starke Krieger aus dem Norden zu uns kamen, wurden wir ein mächtiges Reich, die halbe Welt hat vor uns gezittert, als sich die Wichte aus dem Morgenland bei uns einschlichen, da ging’s bergab. Wie die dahergeredet hat, selbstgefällig wie ein akademik, fehlte nur, dass sie mir ihre Theorie mit den Erbsen auf ihrem Teller erklärt, Erbsen mag sie nicht. Ich widersprech nicht, was hab ich mir im Leben nicht schon alles anhören müssen, vor Ewigkeiten hat akademik Potok das versammelte Offizierskorps stundenlang belehrt, politische Ereignisse hängen davon ab, ob die Führer eines Landes der Zukunft oder der Vergangenheit zugewandt sind, und unsere Führer sind der Zukunft zugewandt, keiner mehr als der Genosse Generalsekretär, der plant die Zukunft hinter der Zukunft, während unsereiner mit spuckefeuchtem Finger das Kalenderblatt umdreht. Was für ’ne Rede, wir bekamen Kopfschmerzen und der akademik ’ne Villa in Pomorie. Potok, das war ’n Zwerg mit abgehalftertem Lachen, zwei Köpfe kleiner als diese dozierende Schaufensterpuppe an unserer Tafel, der plumpsen die Auberginen gleich aus dem Ausschnitt, wahrscheinlich hab ich die Dinger bezahlt, wer weiß, was die Neffen mit dem Geld anstellen, das ich ihnen zustecke, ist ja genug, um sich das Fett vom Arsch absaugen zu lassen, auf dem sie breit flacken.
»So, so, hochinteressant«, sag ich, die Freundlichkeit in Person, bin ja Gastgeber, sitze auf dem Präsidentenplatz, »das also sind die schmerzlichen Lehren aus unserer Geschichte. Wo hast denn die aufgegabelt? In ’ner Boutique am Boulevard Witoscha?«
»Ruhig, Metscho, ruhig!« Albena greift nach meiner Hand.
Alle am Esstisch starren mich an, ich lass es gut sein, meist halt ich mich zurück, bis es mich zerreißt, ist ja nicht auszuhalten, wie die anderen sich aufmandeln.
Mit den Nichten war mehr anzufangen, aber die haben sich abgesetzt, die Heimat ist denen nicht gut genug. Was haben wir uns abgeschuftet, diesen rückständigen Acker in ein modernes Land zu verwandeln, haben zwölf Stunden am Tag geschuftet, bis der Kopf uns auf die Brust fiel. Und was hatten wir für Erfolge. Wer würdigt das heut noch? Nachher schwenken alle immer die Fahne der Besserwisserei. Wer ’44 mit ’89 vergleicht, der wird erkennen, was wir rausgeholt haben, das soll uns mal einer nachmachen. Der Sohn eines Schweinehirten hat bei uns Gabelstapler produziert, Güteklasse A, die gingen weg wie warme banitza, weltweit. Wir waren nicht in allen Bereichen spitze, so schnell geht’s nicht, aber immerhin, was wir erreicht haben, das kann sich sehen lassen. Den undankbaren Gören reicht’s nicht. Die eine macht die Beine für die Washingtoner breit, schreibt Berichte für ’nen Denktank dort, gilt als Expertin für den Balkan, das hat sie denen schlau gesteckt, nur jemand aus dem Wirrwarr kann den Wirrwarr erklären, ganz schön gerissen, da war ich feste stolz auf sie, auch wenn sie nicht von meinem Blut ist, na, ich war ihr Vorbild, insgeheim hat sie mich bewundert, wird sie nie zugeben, natürlich nicht, direkt um Rat wird sie mich nie fragen. Die andere hockt in London und jettet von ’ner Party in Moskau zu ’ner Party in Nizza, aber der Weg zu uns, der ist ihr zu weit. Außer bei der eigenen Hochzeit. Hässlich wie ’ne Wahrsagerin, hat aber ’nen strammen Kerl abbekommen, Wirtschaftsattaché an unserer Botschaft dort, aus gutem Haus, ihre Mutter versteht sich aufs Verkuppeln, auch wenn sie sonst nichts versteht. Alle haben drauf bestanden, ich soll was sagen, hab dem Brautpaar gemeinsames Tauziehen gewünscht, in ein und dieselbe Richtung wohlgemerkt, da hatte ich die Lacher auf meiner Seite, das war ’ne Rede, die hat Eindruck gemacht. Ich hab nichts gegen die Londoner Nichte, außer wenn sie mir weismachen will, mit den drei Telefonen und vier Bildschirmen vor ihrer spitzen Nase hat sie mehr Einfluss als ich irgendwann mal im Leben. Lächerlich. Bei Bloomberg werden alle wichtigen Informationen zusammengeführt, behauptet sie. Einfältig. Sie schiebt einige Millionen hin und her und bildet sich ein, Macht zu haben. Dämlich hoch drei. Nur wenn man Angst vor dir hat, Mädchen, hast du Macht. Alles andere ist Konfetti. Und Angst wird in den Archiven gezüchtet. Die kontrollieren wir, selbst wenn andere große Töne spucken. Nein, das wird sie nie begreifen, nach der nächsten Krise hockt sie mit ihrem Pappkarton auf der Straße und erinnert sich daran, sie hat bei uns was zu erben. Dann werd ich ihr unter die spitze Nase reiben, das Erbe verdankst du einzig und allein folgender Tatsache: Uns gehört die Vergangenheit. Das ist die einzige Bank, die zählt, die haben wir vor Zeiten gegründet, lang vor deinen Luftbanken: Gegenwart ist Zins, Zukunft ist Zinseszins. Vielleicht kapiert sie’s ja dann.
Die Sprechanlage surrt, surrt ein zweites Mal, ach, Sonntag, verdammter Sonntag, um alles muss ich mich kümmern.
»Was ist?«
»Komm ans Tor«, sagt der füllige Sergy.
»Wieso ans Tor?«
»Hier will jemand mit dir reden.«
»Um die Uhrzeit?«
»Jetzt komm doch.«
»Wer denn?«
»Eine Frau, eine Unbekannte.«
»Schick sie weg.«
»Sie lässt sich nicht wegschicken.«
»Was?«
»Sie sagt, sie muss unbedingt mit dir reden.«
Da haben wir’s, es muss nur so ’ne Dahergelaufene ans Tor klopfen und auf stur schalten, schon werd ich belästigt. Scheuch sie doch weg, du Nichtsnutz du. Wieso hab ich auf die Frau gehört, am Sonntag will sie ihre Ruhe haben, keine Fremden auf dem Grundstück, die Männer sollen von Montag bis Samstag Wache schieben, aber an einem Tag in der Woche, da wollen wir unter uns sein. Unter uns? Wann sind wir am Sonntag unter uns?
»Ich komme.«
Muss mir erst das Hemd zuknöpfen. Die Haare zurechtkämmen. Was für ein Segen, so ’ne Fülle. Glatzköpfe sind wirklich arm dran, die laufen rum wie mit löchrigen Socken.
»Was willst du?«
»Kurz mit Ihnen reden.«
»Ich hab jetzt keine Zeit.«
»Es ist wichtig.«
»Nicht für mich.«
»Doch, es ist wichtig, auch für Sie.«
Jetzt versteh ich, wieso Sergy sie nicht abwimmeln konnte. Sie hat so was Verbissenes an sich, sie schnappt nach deinem Hosenbein und zerrt daran, während sie kläfft, so sture Stangen kenn ich, ’ne richtige Plackerei, die zurechtzubiegen. Auf dem Bildschirm wirkt sie etwas ausgemergelt, aber fesch genug, könnt mir gefallen. Der Bildschirm täuscht, trotz hoher Auflösung und dem neusten Schnickschnack, es ist wie durchs Guckloch blicken, du hast Einblick, aber keinen Überblick, leicht übersiehst du das Wesentliche. Dem Blick durchs Guckloch hab ich immer misstraut, von Anfang an, besser die Zellentür aufschließen lassen und alles in Augenschein nehmen.
»Hör mal zu, Mädchen. Ich weiß nicht, was dich zu mir treibt, ich hab ’n Büro und ’ne Sekretärin, bei der meldest du dich, verstanden? Du weißt ja wohl wo, oder?«
»Das habe ich versucht. Zuerst am Telefon, dann habe ich sogar persönlich vorgesprochen. Ich wurde jedes Mal abgewiesen.«
»Wird schon seine Gründe haben.«
»Es wurde mir gesagt, ich solle nicht weiter stören. Die Frau war nicht höflich.«
»Das kann passieren. Wenn jeder …«
»Ich bin nicht jeder.«
»Mach vor meinem Haus jetzt keine Szene. Wenn du in fünf Sekunden nicht verschwunden bist, drück ich den roten Knopf, und drei Minuten später hast du ein Rudel Kerle am Hals, die entfernen dich, und zwar nicht sanft, das kannst mir glauben.«
»Werden Sie nicht!«
»Willst du mir drohen?«
»Ja, ich drohe Ihnen.«
»Was glaubst du …«
»Ich drohe Ihnen, Metodski!«
Metodski? Mich bringt man ja nicht leicht zum Kentern, aber dieser Name aus dem Mund dieser Unbekannten, dieser Spitzname unter Offizieren, vergessen fast, sonst nie benutzt, hab ihn gehasst, den haben mir die Kameraden angeleimt. Metodi, das hat Würde, das klingt nach Haltung und drei Sternen, Metodski klingt nach ’nem Hubschrauber, der öfter abstürzt. Woher hat sie diesen Namen? Wenn einer der Kameraden über mich spricht, heute, all die Jahre danach, wie nennt er mich? Sagt er: Metodski war ein feiner Kerl oder sagt er: Auf Major Metodi Popow war stets Verlass? Sie muss im Auftrag hier sein. Wer hat sie geschickt? Wie die Tochter eines Offiziers wirkt sie nicht, die Kleidung abgetragen, ihr Verhalten, unsicher einerseits, andererseits verbissen, irgendwas stimmt da nicht. Ein Scherz vielleicht, kann nur ein Scherz sein, irgend ’n Kamerad sitzt im Auto um die Ecke und wartet auf mein verdutztes Gesicht. Ich hasse Überraschungen. Wer kann’s bloß sein? Von den üblichen Witzbolden liegt einer in der Militärmedizinischen, ambulant stationär, so oft wie der drin ist, ein anderer gießt sein Gemüse in Wraza, andere knabbern an den Radieschen von unten. Die, mit denen ich zu tun habe, die machen so was nicht. Deftige Scherze sind nicht ihr Stil.
Das Tor brummt, wenn’s aufgeht. Elektronisch und langsam. Hat gedauert, bis der Trottel von Wachmann begriffen hat, das Tor darf er nicht zuschieben. Steht den ganzen Tag rum und hat’s trotzdem eilig. Sergy wirft mir ’nen erstaunten Blick zu. Sonst lass ich nie jemanden rein, Lieferanten laden vor der Garage aus.
»Das ist mein Neffe, Sergej, und wer ich bin, weißt du ja offensichtlich. Bleibt bloß die Frage, wer du bist?«
»Nezabrawka Michailowa.«
»Wir kennen uns nicht, oder?«
»Nicht direkt.«
»Na, dann komm mal rein, du hast mir ’ne Nachricht zu überbringen, oder? Unter vier Augen, nehm ich an.«
Hinter uns schließt sich das Tor, und Sergy verzieht sich, ich vermute, er hat’s eilig, zu dem Gekicke zurückzukehren, auf das er seine erhöhten Absätze verwettet, Premier League meist. Wenn der Manchester hört, denkt er nur an United oder City, ist nicht weit her mit der Bildung der Jungen heut. Ich lass mir seine Spieleinsätze wöchentlich auflisten, der Mann vom Wettbüro, dem hab ich mal auf die Beine geholfen. Mit Schulden ist nicht zu spaßen, aus dem Würgegriff kommt er nicht so leicht raus, erst recht nicht, wenn ich ihm nicht unter die Arme greif, das ist ein Betonkopf, zu dem dringt man selbst mit ’nem Presslufthammer nicht durch.
»Jetzt komm mal rein.«
»Wo darf ich mich hinsetzen?«
»Wo du magst, Mädchen, bei uns ist alles ganz bescheiden, ein wenig wie auf ’ner Berghütte, man will ja die Stadt hinter sich lassen am Weekend, den ganzen belastenden Kram, den man nicht braucht, na, du weißt ja bestimmt, was ich mein.«
»Nein, weiß ich nicht.«
»Sei froh, hast dir ’ne Menge Kopfschmerzen erspart.«
»Die Kopfschmerzen … andere … aus der …«
»Was sagst du? Ich hör für mein Alter recht ordentlich, aber wenn du so nuschelst, wird’s schwierig.«
»Still ist es hier. Ich habe nicht gewusst, dass es hier oben so still sein kann.«
»Bestens zum Nachdenken. Klappt hier so gut wie nirgendwo sonst.«
»Worüber müssen Sie denn nachdenken?«
»Du weißt schon, das Übliche. Aufgaben, Pflichten. Was so alles zu erledigen ist.«
»Haben Sie nicht schon genug erledigt?«
»Was willst du damit sagen?«
»Versuchen Sie nicht, mir etwas vorzumachen. Ich habe mich informiert, ich weiß, wer Sie sind, was Sie getan haben.«
»Was wird denn so gemunkelt? Bin pflichtbewusst, das hast du hoffentlich gehört, schon immer, werde dienen, solang ich gebraucht werde.«
»Wie vorbildlich.«
»Versteht sich von selbst. Kann nicht anders. Genug über mich, muss mir was aufsparen für meine Memoiren. Was führt dich zu mir?«
»Etwas, was Sie getan haben. Es ist lange her, Sie waren bestimmt nicht so bedeutend, wie Sie es heute sind. Ich weiß nicht genau, was Sie waren, es ist schwer für mich …«
»Komm, leg die Karten auf den Tisch. Ein Trümpfchen wird schon dabei sein.«
»Nein. Es war ein Fehler, dass ich hierhergekommen bin. Lassen wir es.«
»Wieso denn, jetzt, wo du ohnehin schon da bist.«
»Es ist sinnlos.«
»Was immer es ist, spuck’s aus, Mädchen. Erleichtert das Gewissen ungemein.«
»Das wissen Sie wohl aus eigener Erfahrung?«
»Sagen wir so, ich hab’s oft genug erlebt.«
»Ich habe meinen ganzen Mut zusammennehmen müssen, überhaupt herzukommen. Wochenlang mit mir gerungen. Ich wusste, es geht nur weiter, wenn ich zu Ihnen komme, wenn ich alles mit Ihnen kläre. Und jetzt kann ich nicht.«
»Entspann dich mal, ich fress dich nicht. Darfst nicht alles glauben, was du über die Leute hörst. Wir unterhalten uns einfach, einverstanden? Vielleicht nennst du mir den Namen deines Vaters?«
»Um den geht es ja.«
»Ist er gestorben?«
»Er war nie Teil meines Lebens.«
»Was soll das heißen?«
»Ich hatte nur eine Mutter. Sie hieß Anna-Maria Michailowa.«
»Lass mich mal grübeln, gieß dir doch ’n Glas Wasser ein, die Karaffe ist hinter dir. Anna-Maria Michailowa? Anna-Maria, ein schöner Vorname.«
»Sie war sehr schlank, sie hatte lange schwarze Haare.«
»Es gab eine Maria Michailowa, die hat alle in der Abteilung verrückt gemacht. Nein, die kann’s nicht sein, die hatte keine Kinder, war zu sprunghaft, wenn du verstehst, was ich meine. Eine Anna-Maria, nein, ist mir nicht bekannt.«
»Sind Sie sicher?«
»Mein Namensgedächtnis ist ’ne Bank, Mädchen. Landauf landab berüchtigt. Wer mir mal auffällt, der wird abgespeichert, wer mir vors Korn läuft, der wird nicht vergessen. Da gibt’s kein Vertun, erst recht nicht bei Kameraden und ihren Frauen, das ist ’ne Frage des Respekts.«
»Ich glaube nicht, dass Sie meine Mutter geschätzt haben.«
»Nichts da. Respekt ist Grundeinstellung, selbst wenn man sich nicht immer grün ist. Hieß sie früher anders?«
»Nein, sie hieß immer so.«
»Nie geheiratet?«
»Keiner wollte sie haben.«
»Das kann ich nicht glauben, bist doch ’n hübsches Ding, die Mama war bestimmt keine Schreckschraube.«
»Sie stieß jeden Mann weg, der sich ihr zu nähern versuchte.«
»Schwieriger Charakter, was? Pech, was soll man tun, vor dem Schicksal werden wir nie alle gleich sein. Glück und Unglück kann man nicht mit Gutscheinen verteilen.«
»Halten Sie den Mund!«
Wie? Was erlaubt die sich! Das hat noch keiner gewagt, keiner von niedrigerem Rang, kein Zivilist. Wer ist sie? Was hat sie in der Hinterhand? Wer schützt sie? Wer schickt sie? Vorsicht, Metodi, von jetzt an höchste Vorsicht.
»Sie ist gestorben. Letzte Woche.«
»Ach so. Mein Beileid, deswegen bist du so durcheinander. Das entschuldigt einiges. Nimm ’nen Schluck Wasser. Als mein Vater starb, war ich grad im Einsatz, kam zu spät zurück. Ehrlicher Arbeiter, mein Vater. Nichts geschenkt bekommen vom Leben. Dumme Sache, wenn sie so sterben, egal, was sie dir waren, du kommst dir mit einem Schlag so allein vor.«
»Ich habe sie gepflegt, bis zum Ende.«
»Das spricht für dich, Mädchen, da waren die Deinigen bestimmt stolz auf dich.«
»Ich habe sonst niemanden. Nachdem sie zurückkam, haben sich alle von ihr abgewandt. Alle haben sie gemieden, als wäre sie ansteckend.«
»Ansteckend? Was redest du da? Was hat das mit mir zu tun, das musst du mir jetzt mal verraten.«
»Bevor sie starb, lag sie schon tagelang im Krankenhaus, ich sah sie nicht häufig, ich musste den ganzen Tag hin- und herrennen, Geld für den Arzt zusammenkratzen, im Korridor hörte ich eine Frau wie am Spieß schreien und das Gebrüll eines Mannes: ›Gebt ihr eine Spritze, so gebt ihr doch eine Spritze.‹ Es war nicht die Stimme meiner Mutter, es war die Frau, die neben ihr lag, und deren Mann …«
»Krankenhäuser! Unangenehme Sache. Ein Aufenthalt ist echt nicht zu empfehlen.«
»Die Frau schrie weiter, und ich setzte mich neben meine Mutter, hielt ihre Hand, sie riss sich los, auf einmal, wandte sich von mir ab, und dann sagte sie, sie habe sich vor diesem Augenblick gefürchtet, er lasse sich nicht mehr aufschieben. Ich habe sie unterbrochen, mit einer Lüge, der Arzt ist zuversichtlich, mamo, ich hole dich bald nach Hause. Sie drehte sich zu mir, ihre Augen griffen nach mir. Es ist nicht der Tod, vor dem ich Angst habe. Ich musste meinen Kopf hinabbeugen, um sie zu verstehen, die Frau im Bett nebenan schrie weiter, ihr Mann hämmerte auf das Bettgestell ein und verfluchte die Ärzte und Krankenschwestern, und meine Mutter, meine Mutter sagte mir, mein Vater sei noch am Leben, ein mächtiger, ein bekannter Mann sei er, ein Mann namens Metodi …«
»Was, was, was. Warte mal, wieso Vater? Du hattest doch ’nen Vater?«
»Einen Soldaten, angeblich bei einer Artillerieübung umgekommen. Falsche Zielangaben, riesige Schlamperei. All das frei erfunden. Dein wirklicher Vater, sagte Mutter, bevor sie starb, wird öfter in den Zeitungen genannt, gelegentlich gibt er ein Interview. Du wirst ihn leicht finden. Du kannst ihn zur Rede stellen. Das hätte ich tun sollen. Mir fehlte der Mut.«
Ai siktir, und ich Idiot hab sie ins Haus gelassen. Das ist kein Scherz, das ist eine böse Sache. Erpressung? Rache? Wer will mir an den Karren fahren?
»Wer schickt dich?«
»Niemand schickt mich.«
»So ganz von allein kommst du auf die Idee, ich bin der Mann, von dem deine Mutter, die angeblich letzte Woche gestorben ist, dir angeblich erzählt hat? Grad ich, unter all denen, die in diesem Land Metodi heißen. Was willst mir da unterschieben? Was für ’nen Dreck, das glaubt dir keiner.«
»Sie müssen mir nichts glauben. Rechnen Sie nach. Was schätzen Sie, wie alt ich bin?«
»Das interessiert mich nicht.«
»Siebenunddreißig, Geburtstag im Oktober.«
»Soll was beweisen?«
»Überlegen Sie, Metodi Popow, überlegen Sie, wo waren Sie vor achtunddreißig Jahren? Wo waren Sie im Winter damals? Für meine Mutter war es ein bestialischer Winter, das weiß ich inzwischen, das hat sie mir ein Leben lang verheimlicht. Sie hat sich geschämt. Und Sie, Metodski, wo haben Sie sich gewärmt in jenem Winter? Sie sollten wissen, meine Mutter hat mir mehr über Sie verraten als nur Ihren vollständigen Namen.«
(aus dem archiv der staatssicherheit)
Nr.
Vorname
Name
Alter
Arbeit
Wohnort
1.
Kiro
Iwanow Kiro
19
Soldat
Panagjurischte
2.
Kosta
Schischkow
22
arbeitsfrei
Panagjurischte
3.
Luka
Petrow
26
Bauer
Panagjurischte
4.
Petar
Nikolow Fritz
22
Student
Sofia
5.
Wassil
Angelow Igel
??
arbeitsfrei
Sofia
6.
Marko
Hassanow
43
Elektriker
Panagjurischte
7.
Simeon
Deltschew
22
Arbeiter
Panagjurischte
8.
Nikola
Vassilew
31
Bauer
Panagjurischte
9.
Grigor
Bogoew
23
Arbeiter
Panagjurischte
10.
Nikola
Grigorow
24
Arbeiter
Panagjurischte
11.
Georgi
Stojanow
27
Haarschneider
Panagjurischte
12.
Peter
Keremidjiew
23
Ziegelbrenner
13.
Bojan
Keremidjiew
21
Ziegelbrenner
14.
Stefan
Bejukow
27
Arbeiter
15.
Naiden
Walkow Wolf
21
Student
Sofia
16.
Stojan
Dschudschew
28
Buchhalter
Panagjurischte
Metodi
Welcher Teufel hinkt da aus dem Schatten? Schnell nachgerechnet, Winter ’61/62, als Inspektor unterwegs, im ganzen Land, na und, was soll das?, ’ne Falle, ’n Angriff aus dem Hinterhalt? ’ne Verrückte? Die Demokratie bringt ja immer mehr Leute um den Verstand. Handelt sie allein oder steht jemand hinter ihr? Will sie mir unterschieben, ich habe mich an ihrer Mutter vergriffen? Will mich jemand auf diese hinterfotzige Weise aus dem Hohen Parteirat entfernen? Gibt so einige, die halten mich für ’nen Ewiggestrigen. Modernisierer, da lach ich ja, selbstgefällige Prahlböcke. Tradition ist für die Ballast, der über Bord gehört. Die wollen sich den neuen Herren unterwerfen. Verziehen die Visage, wenn ich auf unsere altgewachsenen Beziehungen zu Moskau hinweise, damit sind wir gut gefahren. Wer mich bloßstellen will, hat’s fein ausgeklügelt. Ich hab nachgerechnet, weiß, was sie mir unterschieben wollen, irgend ’ne Missbrauchsgeschichte, ich durchschau den fiesen Plan. Gerüchte streuen, gegen die sich keiner verteidigen kann, Schmutz werfen, da bleibt was hängen, egal, was du tust. Ein Artikel hier, ein Artikel dort. Und dann kommt der scheinheilige Vorschlag, ich soll mich zurückziehen, jetzt, wo die Partei in die Sozialistische Internationale strebt und das Land in die EU, so ’n Verdacht, unbegründet, klar doch, da sind wir uns alle einig, Metodi, so ’n Verdacht wirft ’nen Schatten auf die Partei, auch wenn er an den Haaren herbeigezogen ist. Provozieren die mich nur, hoffen sie auf ’ne Blamage von mir? Altbewährte Strategie. Dauert der Druck lang genug an, wird der Gegner irgendwann ’nen Fehler begehen. Ist das nur ’n erster Schlag? Was folgt als Nächstes? Keine voreiligen Schlüsse, Meto, nichts ausschließen. Was war in dem Winter los? Verdammt, wieso kann ich mich nicht erinnern? Seit Tagen zerbrech ich mir den Kopf und – nichts. Wenn du das Gedächtnis brauchst, verkriecht es sich. Das ist ja ’n Ding. Mit einem Schlag Vater. Kann das überhaupt sein? Ein Geschenk vorab zum Siebzigsten. Es kann nicht sein. Oder? Auf der Hut, Meto, auf der Hut. Alle Möglichkeiten abklopfen. ’61/62, das waren gute Jahre, starke Jahre, meine Triebwerke liefen wie geschmiert, mit Schwung und Kraft, die Karriere steil nach oben, ich musste nur die Hand ausstrecken, schon fiel mir eine Süße in den Arm. Eigentlich zwei, Swetlana und Rodina, mehr Tatzen hast du nicht, was für ’n Glück für uns, neidischer Kameradenspott, die eine war ’ne Wucht, meine Sputnik, die Flüge mit ihr kosmisch, Swetlana und Rodina, zuerst pudert er das Licht, dann kachelt er die Heimat, sagten die Kameraden, prall vor Bewunderung, Swetlana und Rodina, ’ne Rakete und ’n warmes Bad, das war meine beste Saison, von mir aus konnte dieser Doppelpack ewig weitergehen, aber beide erschienen von sich aus am Flughafen, mich abholen, ohne Absprache, wollten mich beide überraschen, zwei Schöne ein Gedanke, und wie’s der Teufel will, beim Warten haben die beiden ihre Locken zusammengesteckt, nett geplaudert – wie lang war deiner weg?, was die Männer uns wohl mitbringen?, bin schon froh, wenn er wieder da ist, undsoweiter, undsoweiter – bis ich auftauchte, ausgelaugt vom Abschiedsbesäufnis in Moskau, verfickte Situation, welche sprichst du als Erste an, welcher gibst du zuerst ’nen Kuss? Hat mich überfordert, zugegeben, mit einem Schlag war meine Spitzensaison vorbei. Später musste ich bei Albena oft an Swetlana denken, um zum Abschuss zu kommen. Ach, Swetlanka, Swetlanka! Zu zickig zum Aushalten, Geschmack nicht grad billig, Westkram für ihre Traummaße, da musste ich ganz schön viele Gefallen einfordern, aber was für ’ne satte Ernte. Bei Rodina ruhte ich mich aus. Die hat alles für mich getan, die war pflegeleicht, immer dankbar. Eine Dritte? Damals? Unmöglich. Auf einer der Dienstreisen? Lief da was in dem Jahr? Wer lässt sich nicht mal gehen. Lockrufe gab’s, jede Menge, ich, der hohe Besuch aus der Hauptstadt und alle gierig danach, Eindruck zu schinden. Aber ich war pappsatt, hab mich auf nichts eingelassen, hab einige weiße Hasen laufen lassen, soweit ich mich erinnern kann, verdammt nochmal, wenn man das Gedächtnis ruft, desertiert es. Wo war ich nicht überall, im ganzen Land unterwegs, in Plewen, in Belene, in Pazardschik, in Warna, in Stara Zagora, kurze Besuche, Direktiven für die Direktoren, nach dem Rechten sehen, schwere Fälle durchsprechen, die Renitenten unter die Lupe nehmen, Arbeit, nichts als Arbeit, rein und raus, gut, ein wenig mit den Kameraden trinken und essen, wichtig für die Stimmung, so schnell wie möglich wieder heim. Man hielt sich ja nicht gerne auf an solchen Orten, ich besonders nicht, war ja nicht so lange her, die Zeit, als ich aufs tote Gleis geschoben war, die Verwalter eines Gefängnisses sitzen auch hinter dicken Mauern, wer weiß das besser als ich, diese Hand um den Hals, die hab ich gespürt, solang ich drin war. Wenn was passiert ist, dann auf einer dieser Dienstreisen. Keine Erinnerung, wie kann das sein? Nein. Das ist unmöglich. Sie lügt! Sie muss lügen. Das macht mich stutzig, sie wirkt so überzeugt, als glaubte sie’s selber. Das hat nichts zu sagen. Verwirrte glauben ihren eigenen Spinnereien. Oder sie ist ’ner Geschichte aufgesessen. Oder sie ist gut geschult. So ’ne junge Amateurin wird mich nicht an der Nase rumführen. Vielleicht hat die Mutter sie reingelegt, weil sie ’ne Rechnung mit mir offen hatte. Späte Rache. Nichts darfst du ausschließen, Meto. Nicht einmal das Unwahrscheinlichste: eine Tochter auf deine alten Tage hin. Was für ’n verrückter Gedanke. Und ehrlich, so unangenehm auch wieder nicht. Vielleicht taugt sie mehr als die aufgetakelten Nichten. Wenn’s nur ’ne Nacht war irgendwo in der Provinz, was soll’s. Aber wenn ’ne Bedrohung von ihr ausgeht, muss ich sie entschärfen. Hab also gleich ’n Treffen mit ihr vereinbart, irgendwo draußen, wo wir in Ruhe reden können, sagte ich, wo uns niemand sieht, dachte ich, in der Studentenstadt etwa. War das ’n Fehler? Alter Mann, funktionieren deine Instinkte noch? Früher ging ich in Stellung, bevor der Feind blinzeln konnte. Bin ich heute zu langsam auf den Beinen? Ich sollte mir ’nen kleinen Cognac eingießen, damit die Gedanken besser flutschen.
Nein, es war kein Fehler. Besser, der Sache auf den Grund gehen. Gleich alles aufklären. Eine Verrückte, so was wischst du weg wie ’ne Mücke. Wird sie lästig, zerdrückst du sie. Wenn diese Frau aber Teil einer Verschwörung gegen mich ist, Spielball in den Pratzen falscher Parteifreunde, die mich weghaben wollen, bringt das nichts. Hat sich ’ne Front gegen mich formiert? Ist der Zeitpunkt gekommen, altes Eisen? Hast du dir eingebildet, du wirst ewig gebraucht? Das musst du aufklären, und wenn’s deine letzte Tat ist. Die Falle, vor der man wegläuft, ist die Falle, in die man reinfällt. Die Falle, die du nicht aus dem Weg räumst, die wird dir eines Tages zum Grab.
»Ja, ich komm schon!«
Die Frau kann nicht einschlafen, wenn ich nicht neben ihr liege. Wir sind alle Gewohnheitstiere. Schlechte Gewohnheiten sollte man nicht einreißen lassen. Leicht gesagt. Was tun, wenn ’ne gute Gewohnheit rostet? Da gibt’s kein Entrinnen.
»Ich bin gleich bei dir, Albena!«
Albena, dieser Name hat mir gefallen, von Anfang an. Wie sie mich aufgezogen hat, das war ich nicht gewohnt. Ich hatte ’nen hohen Rang, sie saß im Vorzimmer der Macht. Manche hatten Schiss vor ihr, andere versuchten, ihr Honig ums Maul zu schmieren. Die einen hielten sie für prinzipienfest, andere für ’ne gefährliche Intrigantin. Die Jüngsten waren wir beide nicht mehr. Der Dienst war mir alles, nebenher ein reger Verbrauch, Staffelrennen haben wir’s genannt. Welche hält sich bei Meto am längsten? Ich sah nach was aus, ich hatte was zu bieten. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, das war das einzige Problem, doch da gab’s Lösungen, ich lockte die Kleine in meine Bleibe, versprach früh nach Hause zu kommen, verspätete mich bis tief in die Nacht, verschwitzt, müde und angespitzt gleich ins Bett und der Hübschen ein Geschenk, am besten gefiel’s mir, wenn sie aufwachte und ich schon in ihr drin war, das gab mir so ’n Gefühl, als ob ich mich in ihren Träumen ausbreite. Ha, ganz besonders machte es mich an, wenn’s Verheiratete waren, da hatten wir natürlich wenig Zeit, junge Dinger, hatten sich beim ersten Tettattäh gleich ’nen Balg anhängen lassen, schon waren die Handschellen der Ehe angelegt, und ich musste nur ein wenig mit den Schlüsseln klimpern, wer hatte damals schon ’ne eigene Wohnung, für sich allein? Die eine gluckste danach zufrieden: Das war mein erstes Mal. Wie, dein erstes Mal, du hast doch ’n Kind? Das erste Mal, ohne dass seine Mutter im Nebenzimmer schnarcht. Ehrlich, ’n gutes Gefühl, wenn du so ’nem jungen Ding das Schwiegerdrachenschnarchen ersparst. Gute Jahre waren das, Erfolg an allen Fronten. Zuerst hab ich’s nicht gemerkt, erst die Kameraden stießen mich drauf, ihr beide, du und Albena, habt ihr was miteinander? Ich war baff. Sie eine Hopfenstange, breiter Mund, die Lippen fleischig, Schalk in den Augen, wenn sie wollte, ansonsten streng, zum Fürchten, die armen Schweine, denen sie eine vor den Latz ballerte. Das hatte sie drauf. Sie konnte den Häuptling abschirmen, keiner kam an ihr vorbei. Das erledigte sie tadellos. Entsprechend selbstbewusst trat sie auf, das hat mich spitz gemacht. Pass auf, das ist nicht eines deiner Flittchen, warnten mich die Kameraden, an der kannst du dir die Finger verbrennen. Der Genosse Žiwkow schätzt sie, sie hat bislang keinen an sich rangelassen. Auf dich hat sie ein großes Auge geworfen. Wie eine Python, wart’s ab, die wird dich verschlingen, mit Uniform und Stiefeln. Na, das stimmte nicht ganz, die Uniform hab ich beim ersten Mal abgelegt, die trug ich sowieso selten, die Stiefel ließ ich allerdings an. Als Zeichen. Das mochte sie. Albena wird mich gleich ausfragen, sie will immer alles wissen, früher musste ich dicke übertreiben, um ihre Neugier abzuwürgen, nationale Sicherheit, mein Täubchen, darf keinen Piepser von mir geben. Die Nummer läuft heut nicht mehr. Sie wird mich so lang nerven, bis ich explodiere. Wieso kann sie mich nicht in Ruhe lassen? Wie’s mich juckt, ihr eine runterzuhauen, wenn sie so nachbohrt, ich hab sie noch nie geschlagen, undenkbar, sie war zwar nur Sekretärin, aber die Sekretärin des Häuptlings. Ich hatte ’n Gespür dafür, was ich mir erlauben konnte und was nicht, hat mir im Leben viel Ärger erspart. Na gut, einmal hat’s auch mich erwischt, wo weltpolitisch gehobelt wird, da fallen unter den Kadern die Späne. Zwänge, so kann man’s nennen, ein heftiger Sturm braust auf, und wer kein Loch findet, in das er sich verkriecht, bis der Sturm vorüber ist, den trifft’s übel, den mäht’s nieder. Wie ich mich da rausgehaun hab, das war ’ne Leistung, die soll mir mal einer nachmachen. Aus Sibirien kehrt keiner zurück, hieß es. Ich war nicht in Sibirien, sondern in einem Kabuff im Zentralgefängnis von Plewen, im Karrierekarzer, so haben wir’s genannt, alle hatten mich abgeschrieben. Das merkst du schnell, keine Briefe mehr, keine Anrufe, nicht mal zum Geburtstag. Die Reaktionen, wenn sie dir auf der Straße über den Weg laufen, da erkennst du gleich, woran du bist. Ob sie dich einladen ins nächste Café oder ob sie’s verfickt eilig haben, schmierig freundlich abzuzischen. Alles schon erlebt, stand ja oft genug auf der anderen Seite, verpisste mich, bevor ich in irgendwas verwickelt wurde. Mit einem, der in Ungnade gefallen ist, kannst du dir keinen Umgang leisten, da ist jede gemeinsame Minute ’n unnötiges Risiko, außer du handelst gemäß Auftrag, erfüllst eine dir zugewiesene Aufgabe, das ist was anderes. Ich werd den Fernseher einschalten, die Nachrichten laut aufdrehen, das wird mir etwas Aufschub verschaffen.
»Arbeit, Albena, wir haben ’ne wichtige Sitzung morgen, ich muss auf dem Laufenden sein, die Nachrichten noch. Da braut sich was zusammen, weißt du.«
Für die Zwänge des Diensts hat sie immer Verständnis gehabt, da war sie ’ne gute Gattin. Wir waren eine Mannschaft, gut eingespielt. Kochen kann sie immer noch nicht, die Kantine war schuld. Alles, was wir essen, ist vorgekocht, Fertiggerichte, sarmi aus Dosen, taramas vom Delikatessenladen. Oder Käse, Trauben, leichtes Spiel. Sonntags zaubert ’ne herbestellte Köchin alles Leckere auf die Tafel. Soll mir egal sein, während der Woche halte ich mich mittags schadlos, kein gutes Restaurant in der Stadt, in dem man mich nicht mit Namen begrüßt.
»Was sagst du? Hör dich nicht, ich ess grad ’nen Apfel, wenn ich kau, hör ich schlecht, das weißt du doch.«
Ich werd ihren Fragen ausweichen, sie wird nicht nachgeben, sie wird mich nicht einschlafen lassen, bevor ich ihr nicht Rede und Antwort gestanden bin. Sie wird mich quälen, grad mich, den Michelangelo des Verhörs, höchstes Kameradenlob, was musste ich mich auch mit ’nem gleichgeschalteten Aggregat zusammentun? Der Spott damals Billigware: Metodski zu Hause im Kreuzfeuer, Metodski 24 Stunden im Einsatz, mal bläst er den Ton, mal wird ihm gepfiffen.
»Nur noch ’n paar Minuten, Albena, ist was Wichtiges.«
Was soll ich ihr erzählen? Die Behauptungen dieser Unbekannten, ob wahr oder gelogen, das kommt nicht in Frage. Ich hab ’nen halben Cognac im Glas und ’ne Viertelstunde Zeit, mir was einfallen zu lassen. Bis die Spätnachrichten vorbei sind. Dann endet das Tagesprogramm an Ausreden.
Konstantin
Ich habe fünfundvierzig Minuten vor verschlossener Tür warten müssen. Das macht mir nichts aus. Mir ist lieber, ich warte, als dass auf mich gewartet wird. Nach der Identifizierung am Eingang holt mich ein Unteroffizier ab. Das Gespräch verläuft nach altbewährtem Muster.
»Name?«
»Konstantin Scheitanow.«
»Alle drei Namen!«
»Konstantin Milew Scheitanow.«
Der Unteroffizier führt mich durch einen Korridor in einen großen Raum, den Lesesaal des Archivs. Ich folge ihm betont langsam, schaue mich um. Der Unteroffizier muss stehen bleiben, um auf mich zu warten. Ich nehme auf einem der Stühle an der Wand Platz, ohne meinen Regenmantel auszuziehen. Ich lege Kugelschreiber, Notizbuch auf dem braunen Pult ab. Der Saal füllt sich, bald ist jeder Platz besetzt, neunzehn Männer sowie eine Frau. Jeder starrt vor sich hin. Keiner unterhält sich. Tropfen fallen zu Boden. Ich vergewissere mich, ob in der Innentasche der Jacke weitere Stifte stecken. Eine Überwachungskamera ist über dem Porträt des Staatspräsidenten an der Wand gegenüber angebracht. Gewährleistet eine gewisse Übersicht, ob sie aber erfassen kann, was ein jeder von uns notiert, wage ich zu bezweifeln. Ein Leutnant erklärt uns die Vorschriften:
Erlaubt: handschriftliche Notizen.
Streng untersagt: Seiten herauszureißen, Seiten mitzunehmen.
Diebstahl von amtlichen Dokumenten wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsentzug bestraft. Wiederum die alte Manier: jede Vorschrift mit einer Drohung ausschmücken.
Erlaubt: Fotokopien einzelner Dokumente, gesondert zu beantragen.
Untersagt: die Veröffentlichung der Namen von Mitarbeitern und Informanten der Staatssicherheit, auch wenn diese Namen in den Akten nicht mit einem schwarzen Balken verdeckt sind.
»Was kostet eine Kopie?«, fragt ein Mann aus der ersten Reihe.
»Zwanzig Stotinki.«
»Das ist ja fünfmal mehr als der reguläre Preis!«
»Dann musst du dir halt gut überlegen, was du kopiert haben willst.«
Zwei weitere Mitarbeiter des Archivs betreten den Lesesaal, Mappen in den Händen. Sie legen sie vor uns auf die Pulte. Meine wiegt nicht schwer.
»Das soll alles sein?«
Der Leutnant weist mich barsch an, im Lesesaal des Archivs still zu sein, so wie es sich in einer Bibliothek gezieme.
»In einer Bibliothek kann ich jedes Buch einsehen.«
Der Leutnant ignoriert mich.
Ich betrachte den Einband, die Heftung der Mappe, bevor ich sie aufschlage. Der Inhalt: Die Gerichtsakten des Prozesses gegen mich und vier weitere Verschwörer. Die Anklageschrift gezeichnet am 30. April 1953. Anklage wegen Bildung einer Vereinigung mit dem Ziel, die gesetzmäßige Ordnung zu stürzen gemäß Paragraph 71 des Strafgesetzbuches der Volksrepublik. Bei erwiesener Schuld war zwingend die Todesstrafe zu verhängen.
Ich beginne zu lesen: die Anklage, ein ausstaffiertes Monstrum. Fünf junge Männer, skrupellos, gewalttätig, zum Äußersten entschlossen, von finsteren Kräften im kapitalistischen Ausland angestiftet und unterstützt – eine kreischende hyperbolische Erzählung, abgenutzt, vergilbt. Sie ermüdet mich. Von ihren Verbrechen, begangen zur Aufklärung unseres angeblichen Verbrechens, keine Spur. Unser Fall, aufbewahrt in den Sarkophagen der Staatskrypta, abgenagt bis auf ein Skelett von Behauptungen. Was wir tatsächlich getan haben (ein Netz aus Widerstandszellen geknüpft, eine spektakuläre Aktion ausgeführt), scheint hinter den Verteufelungen kaum auf.
Ich lese jedes der Dokumente aufmerksam durch, mache mir Notizen, eher aus Pflicht, der Vollständigkeit halber. Die Ausbeute an Erkenntnissen ist mager. Kurz nach zehn Uhr verlasse ich das Archiv, nachdem ich ein halbes Dutzend Fotokopien in Auftrag gegeben habe. Jahrzehntelang habe ich auf diese Gelegenheit gewartet, habe die Machtkämpfe verfolgt, die nationalen, die internationalen, habe leichte Beben ebenso aufmerksam analysiert wie tektonische Verschiebungen, in der Erwartung, eines Tages – wenn alles zusammenbricht – würde das Volk das Ministerium stürmen, die Archive in Besitz nehmen, für freien Zugang, für Gerechtigkeit sorgen. Ich habe mich getäuscht. Die Täter von einst sind weiterhin in Amt und Würden oder als Biznismänner erfolgreich oder bequem pensioniert oder ehrenvoll begraben, sie haben sich keiner der schwärenden Fragen stellen müssen. Kein Einziger von ihnen wurde konfrontiert mit den Taten, die im Schatten seiner Selbstrechtfertigung verborgen liegen. Viele Erwartungen habe ich in den letzten zehn Jahren zurücknehmen, viele Hoffnungen begraben müssen.