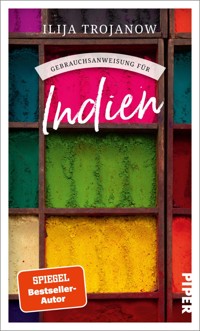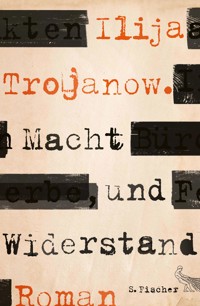19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Ilija Trojanow und Klaus Zeyringer zeigen den Sport aus einer anderen Perspektive: aus der Perspektive von uns Fans! Denn wie der Sport erlebt wird, welche Höhepunkte, Emotionen, Rituale und Gemeinschaften er stiftet, das macht seine große Faszination aus. In Reportagen live vor Ort berichten sie von großen Wettkämpfen u.a. aus der Welt des Fußballs, des Tennis, des Biathlon und Handballs, des Schwingens und Darts, des Cricket und des Radfahrens. Sie erzählen von Bierduschen und Fangesängen, von Feuerwerk und Fanblocks – und von Stadien ohne Zuschauer, ohne Fans. Ergänzend zu den Reportagen denken sie über das Wesen des Fantums nach, über Emotionen, Nationalismus und Männlichkeit, über Fachsimpelei, Geld und VIP-Zonen, über Mythen, Inszenierung und Ersatzreligionen. Ihr Buch ist sowohl Feier wie Analyse der großen Leidenschaft, die wir Menschen dem Sport entgegenbringen: mitreißend erzählt, ungewöhnlich und voller Momente mitfühlender Erkenntnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ilija Trojanow | Klaus Zeyringer
Fans
Von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft
Über dieses Buch
Karneval auf den Rängen, Bierdusche in der Gelben Wand, Geborgenheit in einer Gemeinschaft und Chauvinismus bis hin zur Gewalt: Fans erleben Höhen und Tiefen menschlicher Leidenschaft. Ilija Trojanow und Klaus Zeyringer nehmen uns zu elf großen Wettkämpfen mit: Wimbledon, Tour de France, Hahnenkammrennen, Cricket Indien gegen Pakistan, Ruhrpott-Derby, Biathlon und Handball-WM der Frauen, Darts und Baseball, Schwingen in der Schweiz und Olympia im TV. Ihre scharfsinnig gewitzten Reportagen führen mitten in die Welt der Fans, verbunden mit Essays zu allen wesentlichen Aspekten des Fantums, von Heldenverehrung und Ritualen über Kennerschaft und Aggressivität bis zu Hingabe und Inszenierung.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, ist Romancier, Reporter, politischer Kolumnist und gefeierter Bestseller-Autor. Sein Werk ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Im S. FISCHER Verlag erschien u.a. der Bestseller »Meine Olympiade. Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen« (2016) sowie zuletzt sein gefeierter Roman »Tausend und ein Morgen« (2023).
Klaus Zeyringer, geboren 1953 in Graz, lehrte Germanistik in Frankreich und ist heute als Autor und Literaturkritiker tätig. Im S. FISCHER Verlag ist »Fußball. Eine Kulturgeschichte« (2014) erschienen sowie das zweibändige Werk »Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte. Band 1: Sommer« (2016) und »Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte. Band 2: Winter« (2018).
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60395 Frankfurt am Main
Originalausgabe © 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60395 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Covermotiv: mauritius images/Alamy
ISBN 978-3-10-491345-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Uschi
1. Anspiel
Ilija, 1973–1977, Nairobi
Klaus, 1978, Graz und Córdoba
Klaus, ab 1978, Nantes
Ilija, September 2021, im virtuellen Raum
2. Arena ohne Fans
3. Wo die Pfeile fliegen
4. Inszenierung
5. Die Marter an der Alpe d’Huez
6. Emotion
7. Piste und Party
8. Matchscheibe
9. Nationalismus
10. Gruppenbild mit Stier
11. Männlichkeit
12. WM ohne Welt
Erster Akt
Zweiter Akt
Dritter Akt
Vierter Akt
13. Weiblichkeit
14. Kalte Aussichtslosigkeit
15. Sozialtribüne
16. Blaues Wunder in der gelben Wand
17. Geld
18. Träume auf engstem Raum
19. Fachsimpel
20. Ein Sonntag im park
21. Vergötterung
22. Erdbeeren mit Aufschlag
23. Epilog: Ein Wechselbad der Gefühle
Für Uschi
1.Anspiel
Ilija, 1973–1977, Nairobi
Im Herbst Cricket, im Frühjahr Hockey, im Sommer Rugby.
Am Vormittag Unterricht, am Nachmittag Sport.
Das ganze Jahr über Tennis.
Am Sonntag Wettkampf.
In den Ferien Turniere.
Aber es war kein wirklicher Herbst und kein wirkliches Frühjahr und auch nicht Sommer. Wie die Sportarten waren auch die Jahreszeiten importiert, aus dem englischen Mutterland, im kolonialen Jahr 1929 oder 1931.
Es gab kalte Morgen und warme Vormittage und heiße Nachmittage, es gab eine lange Trockenzeit, es gab eine kurze Regenzeit, es gab Tage, an denen der Platz, ob für Cricket, Hockey oder Rugby, zu matschig war oder überflutet. Dann liefen wir querfeldein durch den Busch, sprangen in den eisigen (so kam es mir damals vor) Swimmingpool, mussten Länge um Länge schwimmen, einen ganzen Kilometer, so lautete die unbeugsame Vorgabe. Danach liefen wir bibbernd zur Dusche. Eklige Meter der unvermeidbaren Selbstüberwindung. An solchen Abenden war der graue Pullover selbst am Äquator dringend notwendig. Grau war die dominante Farbe unserer Schuluniform, Purpur die Schmuckfarbe. Aus der Ferne sahen wir alle gleich aus. Die Uniformen für die Sportarten hingegen unterschieden sich: Tennis in reinstem Weiß, Rugby in einer hellen Farbe, die sich der rötlich braunen Erde anpasste, Hockey in Türkis. Sport war bunt.
Im Korridor nach dem Eingang zum Hauptgebäude hingen vier Listen. Die houses des Internats: Oryx, Bongo, Kudu und Eland. Vier seltene Antilopenarten (es gibt wenige Menschen, die alle vier in freier Wildbahn gesehen haben). Der Oryx ist ohne Zweifel das schönste Tier auf Erden – ich war Mitglied des Oryx-Hauses. Jeder Schüler war einem der Häuser zugeteilt – nach welchem Prinzip, entzieht sich meiner Kenntnis, aber wenn es Prinzip Zufall gewesen sein sollte, so war bemerkenswert, wie schnell wir diesen Zufall umarmten. Ohne dass es einer besonderen Erklärung bedurft hätte, war jedem Neuen klar, dass er alles für sein Haus zu geben hatte, damit dieses besser abschnitte als die anderen Häuser. Innerhalb weniger Wochen nach meiner Ankunft als verängstigter und desorientierter Neuling war ich ein feurig flammender Oryx-Patriot. Für jede gute schulische oder sportliche Leistung erhielten wir (spätestens jetzt sollte ich anmerken, dass Kenton College ein reines Jungeninternat war) einen, zwei oder drei Sterne, die in die Listen eingetragen wurden, für alle sichtbar, damit jeder wusste, welches Haus in Führung lag, aber auch welchen Anteil welcher Schüler zu diesem Erfolg beitrug. Am Ende des Schuljahres wurde abgerechnet, und es gehört zu den großen Erfolgen meines Lebens, dass ich 1976 zusammen mit vierzig oder fünfzig anderen Mitschülern für das Haus Oryx den Sieg errang. Selbst für das häufige Ausleihen von Büchern aus der Schulbibliothek gab es einmal im Monat Sterne. Ich war auf drei Sterne abonniert. Zusammen mit Nganga, einem Jungen aus Sambia, dessen Vornamen ich leider vergessen habe, wie auch die der meisten anderen Schüler.
Gelegentlich verließen wir unser weiträumiges Internatsareal und fuhren zu einem Kräftemessen in eine andere Schule. Sie hieß Pembroke oder Banda oder Hillcrest. Wir spielten mit entschiedener Verbissenheit, unser Stolz nun anders definiert, nicht mehr einem der Häuser verpflichtet, sondern gänzlich unserer Schule. Wir vertraten Kenton College und keiner konnte es mit den Jungs von Kenton aufnehmen. Selbst wenn wir verloren, was selten geschah, waren wir besser. Noch Jahre später habe ich Streitgespräche mit Absolventen anderer Schulen geführt, die dreist behaupteten, Banda School habe Kenton stets den Hintern versohlt.
Am nächsten Tag wurde im Rahmen der morgendlichen Zusammenkunft, dem assembly, nach Kirchenlied und Bibelstelle ein Spielbericht vorgetragen, eine kurze, den Fakten verpflichtete Chronik unseres »Drei-Tore-Siegs« in Banda, unserer knappen Niederlage (a two wicket loss) in Hillcrest.
Manchmal wurde am Wochenende ein Turnier veranstaltet, Schulmannschaften aus aller Welt, so kam es mir vor, lungerten auf unserem Gelände herum, wir stolzierten an den Gästen vorbei, das hier ist unser Heim, unser Spielfeld. Es war kühl im Schatten und lecker am Buffet, wo ausnahmsweise Shortbread angeboten wurde, zusammen mit dem obligaten Tee. Wir missbrauchten unsere Sporttrikots, um möglichst viel Shortbread zu raffen, zu verstecken, beiseitezuschaffen, eine Delikatesse sondergleichen in Zeiten des täglichen Porridge (damit es keine kulinarischen Missverständnisse gibt: Haferflocken mit Wasser zu einer glibberigen Masse verkocht, die wir allmorgendlich aufessen mussten, eine paramilitärische Prüfung, die unter anderem den Erfolg des britischen Empire ermöglichte, weil Generationen von Kolonialisten auf diese Weise früh gestählt wurden).
Sport war so wichtig wie der Unterricht, aber er wurde dramatischer inszeniert, intensiver gefeiert. Auf dem Feld spielte die Herkunft eine noch geringere Rolle als im Klassenzimmer. Wir stammten aus zwei Dutzend Nationen, wir waren Afrikaner, Asiaten, Europäer, die Mehrheit Kenianer, darunter Kikuyu und Kalenjin und Kamba, wir waren Gujaratis und Sikhs, wir stammten aus England (die Kenya Cowboys) oder aus Europa, und einer sogar aus Griechenland. Dass die anderen Schüler aus so vielen verschiedenen Ländern kamen, war keinem von uns bewusst, bis Headmaster Stagg eines Tages einen Jungen mit libanesischen Eltern und mich aus dem Klassenzimmer abholte, für ein gestelltes Gruppenbild, das die kulturelle Vielfalt von Kenton College stolz demonstrieren sollte. Lange bewahrte ich einen Abzug dieses Fotos auf, bevor er einem Umzug zum Opfer gefallen ist, und betrachtete es gelegentlich: Wir sahen keineswegs so unterschiedlich aus, wie die Bildunterschrift behauptete: »Schüler aus 23 Ländern«.
Ich habe versucht, mich zu erinnern, ob es in den vier Jahren, die ich dort verbrachte, einen einzigen Vorfall gab, bei dem die Herkunft eines Schülers von Bedeutung war, in eine Konfrontation, Beleidigung oder Beschimpfung resultierte. Wir rauften und wurden dafür hart bestraft (Schläge auf das Hinterteil mit einem Bambusstock), stets unabhängig von Hautfarbe oder Glauben. Kein einziges Mal.
Aufgrund der Vielzahl und Vielfalt der angebotenen Sportarten hatte jeder Schüler die Chance, seine verborgenen Talente zu entdecken. Nur sehr wenige waren in allen Disziplinen gut, aber es gab kaum jemanden, der nicht in einer Sportart zumindest bescheidene Fähigkeiten an den Nachmittag gelegt hätte.
Ich war im Cricket ein Versager, weil ich das äußere Spielfeld als einladende Fläche zum Tagträumen missverstand, weil der Ball nur jede halbe Stunde in meine Richtung flog. Aber wenn dies geschah, wurde zu meiner Verwunderung von mir erwartet, hellwach auf dem Posten zu sein und mit einem Sprung den Ball zu stoppen oder gar zu fangen. Erst die Schreie der Mitspieler alarmierten mich, stets zu spät – mir blieb nichts anderes übrig, als dem roten Ball hinterherzuschauen, wie er zur Begrenzung des ovalen Spielfeldes rollte (was der gegnerischen Mannschaft satte vier runs einbrachte).
Beim Feldhockey war ich eine Niete, frei von der nötigen Geschicklichkeit, mit dem krummen, widerborstigen Schläger umzugehen. Aber aufgrund meines Mutes erwies ich mich als brauchbarer Torhüter (wie beim Eishockey wird dieser aus allen Winkeln beschossen und wer Angst vor dem Ball hat, ist für diese Position ungeeignet). Als Torwart der Schulmannschaft rettete ich einmal unsere knappe Führung, als ich mich vor zwei auf mich zustürzende Stürmer warf. Für die Dauer einer Dusche war ich ein Held.
Beim Rugby war ich wegen meiner schweren Brille derart benachteiligt, dass mir die Aufgabe zugewiesen wurde, den anderen Spielern Wasser zu reichen. Das verletzte meinen Stolz nicht, denn ich konnte zu jeder Jahreszeit, solange es nicht regnete, Tennis trainieren, zweimal die Woche. Mir machte mein Versagen im Cricket und Rugby nichts aus, weil ich beim Tennis ein Könner war (Sieg beim Nairobi Open U-10). Meine zuverlässige Vorhand und mein giftiger Rückhandslice zwangen die Gegenspieler, einen Winner zu schlagen, ich retournierte, bis ihnen ein Fehler unterlief. Ich war ein Verteidiger, der jedem Ball hinterherjagte, der nie aufgab, so dass mir die ruhmreiche Aufgabe zufiel, beim allmorgendlichen assembly den Spielbericht vorzulesen, die Tennismannschaft von Kenton College habe die kenianische Schulmeisterschaft gewonnen. So sehr identifizierte ich mich mit meiner Rolle als Tennisspieler, ich lernte das Regelbuch auswendig und wurde deswegen bei Turnieren gebeten, als Umpire (siehe das Kapitel über Wimbledon, »Erdbeeren mit Aufschlag«) zu fungieren – ich wusste sogar, was ein Fußfehler ist.
Abgesehen von Hemmings, der später in der englischen Hockey-Jugendnationalmannschaft spielte, gab es keinen, der in allen Sportarten für die Schulauswahl aufgestellt wurde. Mein Freund Sachu war groß und ungelenk, aber wenn er mit einem Cricketschläger in den Händen vor dem wicket (siehe das Kapitel über Cricket, »Träume auf engstem Raum«) stand, traf er so gut wie jeden Ball, weswegen alle aufstöhnten, wenn er beim batten an der Reihe war, denn wir wussten, dass wir an diesem Nachmittag zum Zuschauen verdammt waren. Seine Lethargie ließ ihn geduldig jeden scharfen, gefährlichen Ball abblocken, bis ein zu kurzer oder langsamer Ball auf ihn zuflog, den er wie eine lästige Fliege wegscheuchte. Einmal musste ich den Ball von der Terrasse des Hauptgebäudes holen. Sachu war hochgradig spezialisiert auf diese eine Tätigkeit. Ansonsten hatte er einen deftigen Sinn für Humor.
Die Verjee-Brüder hingegen waren klein und schmächtig, aber sie konnten dem Ball einen Spin geben und dadurch jeden batsman bloßstellen. Es dauert einige Minuten, sich als nächster batsman bereit zu machen, sich die verschiedenen Polster umzuschnallen, den langen Weg zum wicket zu gehen, schwerfällig wie ein Nashorn. Dann musste man sich einrichten, indem man im Sand einen Strich zog, um zu erkennen, wo sich hinter einem das wicket befand. Kaum war man bereit für den ersten Ball, lief einer der beiden Verjees an, der Ball flog wie eine besoffene Wespe, sprang vor einem auf, flatterte um einen herum, der Schläger patschte ins Leere und schon war der eklige Klang auseinanderfliegender Hölzer und der Schrei »clean bowled« zu hören. Mit tief gesenktem Kopf schlich ich vom Feld. Nie habe ich auch nur einen einzigen run gegen einen der beiden Verjees erzielt, meist war ich out for a duck – die »Ente« ein Euphemismus für null, zero, sifuri.
Darnborough, ein Kenya Cowboy durch und durch, dessen Eltern Farmer waren irgendwo in Kisii oder Kericho, konnte schwimmen wie ein Fisch, er beherrschte sogar die Delfin-Technik, mit beneidenswerter Eleganz. Darnborough, später Manager eines Küstenhotels, fiel im Unterricht nie so auf wie im Schwimmbecken. Ezana Bocresian Haile, mein äthiopischer Freund, war ein eleganter Flügelflitzer in jeder Ballsportart und spezialisiert auf den schnellen Lauf entlang der Linie, ob mit Schläger oder eiförmigem Ball spielte keine Rolle. Es war (fast) unmöglich, ihn zu erwischen. Und wenn er die Eckfahne erreicht hatte, hob er seinen Hockeyschläger wie zum drohenden Gruß und drosch den harten Ball vors Tor, wo nicht selten ein Mitspieler das Geschoss ablenkte und zwar ins Tor.
Die kenianischen Schüler mit Namen wie Moi (einer der Söhne des späteren Diktators), Kiplagat oder Kimutai liefen uns beim Cross-Country im Regen auf und davon – das kennt man inzwischen von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Wir Nachzügler holten sie im Schwimmbecken ein, so dass wir etwa gleichzeitig zur Dusche eilten. Und die Leseratte Nganga, der als Einziger sportlich universell unbegabt war, erwies sich als begnadeter Schachspieler (auch dafür gab es Punkte). Ich vermute, dass er, der für die Kudus an den Start ging, aufgrund von Buch und Brett mehr Sterne sammelte als manch ein Sportass seines Hauses.
Aufgrund der unterschiedlichen Begabungen verschob sich die natürliche Autorität eines jeden Schülers von Trimester zu Trimester, von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Vormittag zu Nachmittag. Ich war in den meisten Fächern gut, am Jahresende der Klassenbeste, am Nachmittag aber nur ein geduldeter Mitläufer.
So geschah es nicht selten, dass ich aus dem Klassenzimmer stolzierte, weil ich 92 Prozent für einen Essay erhalten hatte, während einige der Mitschüler gedemütigt zum Mittagessen schlichen. Eine Stunde später waren die Verhältnisse auf den Kopf gestellt.
Es gab keine Hierarchie der Leistungen. Manch einer könnte zwar argumentieren, die Kenntnis der Mathematik sei wichtiger als ein Dropkick, das Beherrschen der Sprache entscheidender als die Wucht des Aufschlags, aber das entsprach nicht der Auffassung jener, die sich dieses System der ausgleichenden Gerechtigkeit einst ausgedacht hatten. Im Rampenlicht der stets lautstarken Anerkennung stand jener, der gerade Ausgezeichnetes geleistet hatte, egal auf welchem Feld. Nirgendwo auf Erden habe ich seitdem ein System erlebt, das so entschieden meritokratisch war. Und durchdrungen von der Überzeugung, dass Sport keine Nebensache ist, aber auch keine Hauptsache, sondern integraler Bestandteil eines wertvollen Lebens der geistigen und körperlichen Mobilität.
Seit diesen Jahren in Kenton College kann ich mir eine Existenz ohne Sport nicht vorstellen, und auch nicht, dass ich einen Mitmenschen danach beurteile, in welche Tradition er oder sie hineingeboren wurde. Seitdem weiß ich, dass Menschen nur individuell unterschiedlich sind.
Auch wenn es keinen wirklichen Herbst und kein wirkliches Frühjahr und auch keinen Sommer gab, spielten wir im Herbst Cricket, im Frühjahr Hockey, im Sommer Rugby. Am Vormittag gab es Unterricht, am Nachmittag Sport. Das ganze Jahr über Tennis.
Und am Sonntag Wettkampf.
Aufschlag.
Ass.
Klaus, 1978, Graz und Córdoba
»Tooor«, ruft der Reporter, »Tooor, Tooor, i werd narrisch.«
Alle springen auf, klatschen, jubeln: »ja«, »ja« oder ein langgezogenes »juuuh«. Klopfen ihren Nachbarn auf die Schulter, als hätten wir (das Fan-Wir, eine besondere sprachliche Form) gemeinsam diesen Schicksalstreffer erzielt. Ich klatsche mir die Hände wund. Das Glaciscafé ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter dem Farbfernseher zittern wir voller Spannung dem Schlusspfiff entgegen.
Mein Studium in Graz habe ich soeben abgeschlossen, demnächst werde ich nach Frankreich übersiedeln und dort ins akademische Berufsleben einsteigen. Als flinker Außenverteidiger habe ich seit Jahren beim TSV Pöllau Erfolge gefeiert. Und wichtiger noch, einen starken Mannschaftsgeist schätzen gelernt. Aber mich nie als Anhänger eines großen Vereins gefühlt. Die Leistungen des Nationalteams haben mich nicht so mitgerissen wie Franz Klammers Abfahrt und Karl Schnabls Skisprung zum Olympiagold in Innsbruck. Ansonsten war ich übernational orientiert, Grillparzers »von Humanität durch Nationalität zur Bestialität« erschien mir als Warnung.
Nun singe ich – zu meiner eigenen nachträglichen Verwunderung – im Glaciscafé mit dem ganzen Lokal: »Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich.« Alle fiebern auf den nahen Sieg hin, keiner hebt sein Glas, keiner trinkt. Niemand will den Blick auch nur eine Sekunde vom Fernseher lösen; die Kellner lassen das Servieren sein. Von Herrn Otto hinter der Theke kommt keiner seiner üblichen ironischen Zwischenrufe. Nach dem Schlusspfiff reißen wir alle die Arme in die Höhe und schreien wild, der tiefe Bass von Herrn Otto donnert durch unsere Euphorie: »Bravo, bravo, bravo!«
Meine Erinnerung an diesen unvergesslichen Abend trügt. Denn die legendären Worte »Tooor. I werd narrisch« waren im Fernsehen nicht zu hören. Sie stammen von Edi Fingers Radiokommentar. Ich habe sie später ins Fernsehen übertragen, weil sie dem historischen Ereignis angemessener waren und meinen Gefühlen eher entsprachen. Wie viele andere Österreicher habe ich immer wieder Ausschnitte der Rundfunkübertragung gehört. Der erste Höhepunkt: »Tooor, Tooor, Tooor, Tooor. Eins zu eins, meine Damen und Herren. Wir wurden erhört, bravo.« Der zweite Höhepunkt: »Tooor, Tooor, Tooor, Tooor. Ich kann nicht mehr. Der Hansi Burli, sei Papa, da Straßenbahner, wird sich freuen. Schöner kann man’s gar net machen. Da fehlen mir die Worte, da müsste ich ein Dichter sein.« Und dann der Höhepunkt der Höhepunkte, das Tor zum 3:2-Sieg für Österreich: »Tooor, Tooor, Tooor, Tooor. I werd narrisch. Krankl schießt ein. […] Meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals.«
Diese drei Stufen der Ekstase vermitteln – auch wenn sie im Radio ausgestrahlt wurden – die Atmosphäre im Glaciscafé: Überraschung, Überschwang, Überwältigung.
Die Erwartungen an die Weltmeisterschaft waren in Österreich gedämpft. Unter Freunden waren wir uns einig, dass man nicht in die argentinische Militärdiktatur reisen durfte, während die Junta unweit der Stadien Menschen foltern und ermorden ließ. Von der eigenen Mannschaft hielten wir wenig. Dann erzielte Herbert Prohaska, wegen seiner Lockenpracht »Schneckerl« genannt, im entscheidenden Qualifikationsspiel in der Türkei das Tor zum 1:0-Sieg. Dieser »Spitz von Izmir« versetzte die heimische Sportwelt in verhaltene Vorfreude. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren spielten wir wieder bei einem WM-Turnier mit. Aber vermeintlich ohne Chancen, nach dem sprichwörtlichen Motto: »Ein Unentschieden ist ein Sieg für Österreich.«
Das erste Match der Endrunde sah ich bei Freunden, unaufgeregt, denn die Spanier galten als klare Favoriten. Als wir 2:1 führten, wurden wir vor lauter Ungläubigkeit nervös. Wir gewannen! Mit dem nachfolgenden 1:0 gegen Schweden hatten wir sogar den Aufstieg unter die letzten acht geschafft. Und auf einmal rechneten wir uns etwas aus.
Auf diese Zuversicht folgte der Absturz: drei Niederlagen. Gegen die Niederlande gab es eine heftige Klatsche und auch das Spiel gegen Italien ging verloren. Österreich war ausgeschieden, hatte indes noch ein Spiel zu bestreiten. In Córdoba, ausgerechnet gegen den Titelverteidiger. Gegen die Nationalelf der BRD, für uns nur »die Deutschen«, gegen die wir seit dem Wiener Kongress nicht mehr gewonnen hatten. Ein hoher Sieg mit vier Toren Differenz würde ihnen für den Finaleinzug vielleicht sogar reichen. Was alle Zeitungen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen wie selbstverständlich erwarteten.
So ging ich am 21. Juni 1978 durch den Stadtpark zum Glacis, ein Buch in der Hand, für den Fall, dass sich das Spiel als fad erweisen sollte. Lange vor Anstoß, um einen Sitzplatz unweit des recht kleinen Bildschirms zu ergattern. Die Niederlage war programmiert, aber schau ma mal.
Das Glaciscafé hatte Gewicht in Graz, es herrschte Herr Otto. Er bestand auf gepflegten Manieren, duldete keinen Überschwang. Otto Wanz, wie er mit vollem Namen hieß, ein Berg von einem Mann, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Jährlich gastierten die weltbesten Catcher in der Stadt – und eines Tages nahm es der Cafetier Herr Wanz mit ihnen auf, vermöbelte sie, startete eine Catch-Karriere als »Big Otto«. Man nannte ihn nur noch »Weltmeister«, aber nach wie vor stand er oft hinter der Theke seines Lokals.
In Córdoba lief es zunächst wie befürchtet. In der 19. Minute traf Rummenigge zum 1:0. Raunen, gemäßigte Enttäuschung. Wir hatten es ja gewusst: »Die Holländer habn uns fünf Bummerl eingschenkt. Unsere habn nix mehr zu gwinnen, die Daitschn werden die Tore scho machn.«
Wir schauten und tranken.
Und waren elektrisiert, als Berti Vogts in der 59. Minute ein Eigentor unterlief. Dieses Unentschieden wäre ein besonderer Sieg für Österreich, den Deutschen hätten wir das Finale vermasselt.
Dann offenbarte sich das Genie des Hans Krankl. Bedrängt nahm er eine Flanke an und wuchtete den Ball ins rechte Kreuzeck. Ein Volleyschuss der Sonderklasse. Und drei Minuten vor dem Abpfiff startete er aus dem Halbfeld ein Dribbling, überwand zwei Verteidiger und schlenzte das Leder an dem herausstürzenden Sepp Maier vorbei ins Tor, zum 3:2 für Österreich.
Dieser Doppelstreich verwandelte mich in einen Fan. Wir, ja wir, hatten Deutschland in die Knie gezwungen. Ausgerechnet als ich im Begriff war, das Land zu verlassen.
Mit dem ganzen Glaciscafé sang ich »Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich.«
Klaus, ab 1978, Nantes
Zwei Jahre nach dem glorreichen Sieg Österreichs in Córdoba stehe ich im Stade Marcel-Saupin und singe »Allez, allez les Canaris«. Um mich herum neue Freunde, die ich auf den Fußballplätzen Westfrankreichs gefunden habe. Wieder einmal begeistert uns das schnelle Angriffsspiel. Ein herrlicher Pass von Henri Michel auf den linken Flügel, Loïc Amisse flitzt dem Verteidiger davon, seine präzise Hereingabe in die Mitte wuchtet Eric Pécout vom Elfer ins Tor. Wir hüpfen, wir jubeln, das ganze Stadion ein Chor.
In stolzer Vorfreude gehe ich zum letzten Heimmatch der Saison, der FC Nantes mit seinem jeu à la nantaise, einem offensiven und direkten Spiel, ist französischer Meister. Unbeschwert werden wir gegen Laval aufspielen.
Das Stadion liegt eng an die Loire gedrängt. Auf der Straße vor der Tribune Nord steigt uns der Geruch würziger maghrebinischer Würste in die Nase, einige Stände verkaufen Merguez. Aus Lautsprechern tönt »Allez, allez les Canaris, vous êtes les rois de la prairie« – das grüngelbe Team als Kanarienvögel und Könige der Prärie. Die Treppe zu den Sitzplätzen ist düster, oben trete ich ins Helle der Tribüne. Das Rund gesprenkelt von Clubtrikots und Schals in Gelb und Grün.
Erstmals im Leben fühle ich mich als Fan eines Vereins, eine Zugehörigkeit auf Dauer. Mein Stehplatz ist mein Stammplatz. In der kalten Saison schenke ich aus meiner Thermoskanne (damals war sie im Stadion erlaubt) in Tee versteckten Schnaps aus. Jacques, Didier und Gilles mögen ihn nicht nur wegen seines süßen Zwetschgengeschmacks sehr.
Im Europacup spielen wir 1983 gegen Rapid Wien, die Mannschaft von Hans Krankl. Auswärts – in Österreich – haben wir verloren, aber zu Hause sind wir eine Macht. Auf der Tribüne hinter dem Tor skandieren die Wiener Fans in Grün-Weiß »Hansi, Hansi, Hansi«, sie feiern ihren Goalgetter. Plötzlich hüpfen zwei davon durch die gelb-grüne Menge auf den Stufen unter ihnen, mit den Fäusten um sich schlagend, springen wieder die Treppengasse hinauf und verschwinden im kleinen Wiener Fanblock. Geschrei, Rangelei, Polizei.
»Dehors les Autrichiens«, sagt Jacques.
»Mais oui, bien sûr«, stimme ich zu.
Das Match gewinnen wir, Rapid mit Hans Krankl ist trotzdem eine Runde weiter. Niedergeschlagen verlasse ich das Stade Marcel-Saupin.
Bald darauf wird am Rand von Nantes das Stade de la Beaujoire eröffnet. Wir lassen die Enge von Marcel-Saupin zurück, die Erfolge nehmen wir mit. Im geräumigen Umfeld der neuen Spielstätte stehen nun zwei Dutzend Merguez-Frites-Buden, den Schnapstee habe ich anfangs auch hier dabei. Vereinsfarben und Geruch ändern sich nicht, ebenso wenig das jeu à la nantaise.
Jahre später komme ich mit den Kindern, eine Stunde vor Anpfiff. Wir positionieren uns ganz oben auf der Tribüne, plaudern und genießen den Anblick, wie sich das Rund füllt. Seit langem lebe ich nicht mehr in Westfrankreich. Jedes Wochenende rufe ich die Webseite der »Canaris« auf, um zu wissen, wie der FC Nantes gespielt hat, obwohl der Verein das jeu à la nantaise nicht mehr praktiziert. An jedem Neujahrstag schreibt mir Jacques, wie schade das ist und wie glorreich die alten Zeiten waren. Ich antworte, dass wir es doch hoffentlich wieder einmal in den Europacup schaffen. Und wenn ich in der Region bin, gehe ich »in die Beaujoire«, Tribune Océane. Als Fan. Als lebenslanger Fan.
Ilija, September 2021, im virtuellen Raum
Der erste Sieg war nicht der Rede wert. Die Saison dauert lang, über 160 Spiele, der Gegner war schwach. Auch zwei Siege nacheinander sind nichts Ungewöhnliches. Selbst für mittelmäßige Mannschaften. Das dritte Spiel ließ mich aufhorchen. Wir hatten einen schweren Brocken vor uns, die New York Mets, die sich zwar unter Wert schlugen – ging man von ihrem Tabellenplatz aus –, aber eine starke Mannschaft hatten und zu Hause eine Macht waren. Wir gewannen 7:0. Noch souveräner, als es das Ergebnis ahnen lässt.
Am nächsten Morgen wachte ich mitten in Mitteleuropa mit einer drängenden Neugier auf. War der Sieg gegen die Mets der Beginn eines Schlussspurts, um eine verkorkste Saison noch zu retten? Oder nur ein Strohfeuer? Verschlafen öffnete ich meinen Laptop und schaute mir auf mlb.com die Zusammenfassung des Spiels an, das bei mir zur Geisterstunde stattgefunden hatte.
So beginnt fast jeder meiner Tage in der Zeit von April bis Oktober, zehn Minuten Erregung, zehn Minuten Hoffnung und am Ende Enttäuschung oder Beglückung. Am 15. September 2021 gewannen meine St. Louis Cardinals ein Spiel, das mehrmals aufs Messers Schneide gestanden hatte, ein Spiel, das sie in den Monaten zuvor knapp verloren hätten. Nicht in diesem September. Mit einem 7:6 im Rücken machte ich mich beschwingt an die Arbeit. Das lange Wochenende von Freitag bis Sonntag bestätigte – nach drei Siegen gegen die San Diego Padres –, dass wir auf dem Weg in die Playoffs waren. Der Kommentator erwähnte eher beiläufig, wir hätten achtmal hintereinander gewonnen. Eine Seltenheit.
Bevor ich 2007 ein Semester als Gastprofessor an der Washington University verbrachte, hatte ich keine Ahnung von Baseball gehabt. Ich wohnte in einem Apartment direkt am Forest Park, wo 1904 die Olympischen Spiele ausgetragen worden waren, eine längst verblasste Erinnerung, denn die Stadt atmete Baseball, seit je und erst recht, nachdem die heimische Mannschaft im Vorjahr die World Series gewonnen hatte. Auf denkbar dramatische Weise. Bis zur allerletzten Chance im Rückstand. Als mit David Freese ein Junge aus St. Louis mit einem Schwung das Spiel in die Verlängerung brachte und zwei innings später mit einem home run den Sieg sicherte – ein sogenanntes walk-off, ein unübersetzbarer, merkwürdiger Ausdruck. Denn niemand spaziert davon, die Fans rasten aus, ebenso die Spieler, die sich auf dem Spielfeld zusammenknäulen und den Helden des Augenblicks zu erdrücken versuchen. Dieses Ergebnis führte zu einem Entscheidungsspiel, das die Cardinals (benannt nach den Vögeln) klar für sich entschieden. Die Euphorie dauerte noch an, als ich in der Stadt ankam, ein halbes Jahr nach dem Triumph. Im Laden der Cardinals waren alle begehrten Artikel, unter anderem die DVD der Meistersaison, ausverkauft.
Also ab ins Stadion. Es war Liebe auf den ersten Blick. Eine Sitzreihe vor uns mehrere Burschen mit Bier in der Hand, die sich über Mädchen unterhielten, hinter uns Freundinnen, die sich über Männer unterhielten, dazwischen ein Zehnjähriger mit Brille, der ein dickes Buch las, sowie ein altes Ehepaar, das beste Erinnerungen an die wunderbare Saison von Bob Gibson im Jahre 1968 heraufbeschwor. Die Stimmung entspannt und friedlich. Ich kam mir vor wie in einem der ausufernden Romane des 19. Jahrhunderts, vieles nebeneinander und das Wesentliche nicht immer klar vom Nebensächlichen zu unterscheiden. Und vor meinen Augen das Wahrzeichen der Stadt, der elegante und imposante Gateway Arch. Seitdem bin ich ein Fan der St. Louis Cardinals.
Der 21. September 2021 war ein außergewöhnlicher Tag. In der Elbphilharmonie erlebte ich eine Probe des Zyklus House of Call von Heiner Goebbels, gespielt von meinem Lieblingsorchester, dem Ensemble Modern. Am Abend führte ich ein Gespräch in der Reihe Der utopische Raum über globale Gesundheitsversorgung. Und doch fieberte ich den ganzen Tag über dem zweiten Spiel gegen unsere Rivalen entgegen, die Milwaukee Brewers, einem schweren Spiel, bei dem unsere Siegesserie reißen könnte. Früh wachte ich am nächsten Morgen auf, noch vor dem Zähneputzen sah ich mir die Zusammenfassung eines nail biters an: 2:1. Für die Cardinals. Der zehnte Sieg in Folge!
Am übernächsten Tag begann das Game mit einem Grand Slam – für die gegnerische Mannschaft. Das ist fast so außergewöhnlich wie ein Hattrick im Fußball. Der Begriff stammt ursprünglich aus der weniger dynamischen Welt des Bridge-Spiels (wenn ein Paar alle Stiche macht). Als etwas später derselbe gegnerische Spieler einen weiteren home run schlug, sah es schlecht für uns aus. Doch nichts konnte uns stoppen. »This team is dangerous«, sagte der Kommentator und ich jubelte in meinem Pyjama (nicht in den Vereinsfarben).
Am 27. September stellten die St. Louis Cardinals einen neuen Serienrekord auf: siebzehn Siege in Folge. Das konnte nicht ewig andauern.
Am nächsten Tag war die Herrlichkeit vorbei. Doch es war trotzdem ein September der täglichen Beglückungen. Zu Beginn lagen wir im Kampf um einen Playoff-Platz klar im Hintertreffen, als der Monat zu Ende ging, hatten wir uns qualifiziert. Der Herbst konnte kommen.
2.Arena ohne Fans
»Ohne Fans kein Sport« verkündet das Spruchband, das sich einsam im Wind bläht. Auf dem Centre Court ist ein Match im Gang. Niemand auf der Tribüne, nach dem Ballwechsel kein Applaus. Wenn jemand zuschaut, dann nur vorm Fernseher.
In einem fernen Stadion fordert ein Transparent »Wir wollen unseren Fußball zurück«. Zwei Teams betreten den Rasen, die Spieler schauen sich um, als könnten sie es nicht glauben: kein Anfeuern, kein Klatschen, keine Gesänge, keine Fahnen, keine Choreographie, nicht einmal ein paar Vereinsschals. Als wäre ein riesiger Dämpfer über das weite Rund gestülpt. Nur ein Häuflein Funktionäre sitzt auf den Rängen. Die Kameraleute machen einen Schwenk über die Tribüne, um das Unfassbare in bewegte Bilder zu fassen. Beim Anstoß keine Begeisterung, beim Fehlpass kein Raunen, beim Tor kein Jubeln.