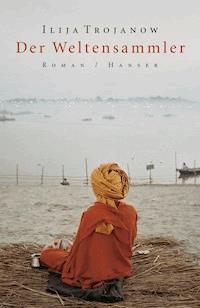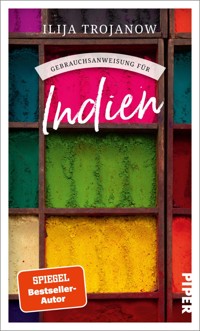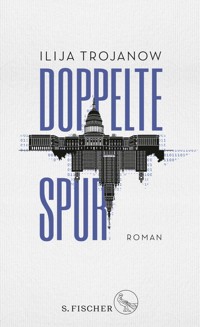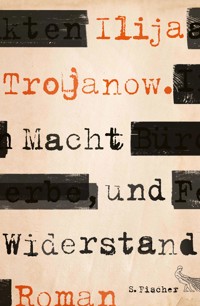9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Ilija Trojanow und der indische Dichter und Kulturkritiker Ranjit Hoskote haben mit ›Kampfabsage: Kulturen bekämpfen sich nicht - sie fließen zusammen‹ eine radikale Streitschrift gegen neue Feindbilder verfasst. Sie wollten damit einst Samuel Huntigtons These vom »Kampf der Kulturen« eine Antwort geben, doch das Thema ist aktueller denn je. Abgrenzung durch die Definition der eigenen kulturellen Identität hat leider wieder Konjunktur. So werden weltweit neue Feindbilder geschaffen und Konflikte geschürt. Die Autoren entlarven die Unsinnigkeit dieser Haltung und rücken den Propheten eines kulturellen Weltkriegs die Köpfe zurecht. Sie zeigen, dass das Zusammenfließen von Kulturen kulturelle Identität und Zivilisation überhaupt erst möglich macht. Ein ermutigender Appell an unsere Vernunft. Trojanow und Hoskote haben das erstmals 2007 erschienene Buch aktualisiert und ergänzt; Pankaj Mishra hat ein Nachwort zu der Neuausgabe verfasst. »Das einzig Ewige ist die Veränderung, sagt ein altes Sprichwort. Wenn die westliche Welt sich abschotten will, so glaubt sie also an das Ende der Geschichte. Sie glaubt, dass ihr System das beste und letzte ist, dass die westliche Kultur abgeschlossen und fertig ist. Sie ist dem Tod geweiht.« Ilija Trojanow
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ilija Trojanow | Ranjit Hoskote
Kampfabsage
Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen
Über dieses Buch
Abgrenzung durch die Definition der eigenen kulturellen Identität hat wieder Konjunktur. So werden weltweit neue Feindbilder geschaffen und Konflikte geschürt. Gemeinsam entlarven der Autor Ilija Trojanow und der indische Dichter und Kulturkritiker Ranjit Hoskote die Unsinnigkeit dieser entstehenden Haltung und rücken den selbsterkorenen Propheten eines kulturellen Weltkriegs die Köpfe zurecht. Trojanow und Hoskote zeigen in ihrer Streitschrift, dass das Zusammenfließen von Kulturen kulturelle Identität und Zivilisation überhaupt erst möglich macht – ein ermutigender Appell an unsere Vernunft und an ein neues Verständnis unserer Gemeinsamkeiten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ranjit Hoskote, geboren 1969 in Mumbai, ist Redakteur bei »The Hindu«, Dichter und Sekretär des indischen PEN-Clubs.
Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem Deutschlandaufenthalt in den Jahren 1977 bis 1981 lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er 1989 den Kyrill & Method Verlag und 1991 den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Bombay, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine weithin bekannten Romane wie z.B. ›Die Welt ist groß und Rettung lauert überall‹, ›Der Weltensammler‹ und ›Eistau‹ sowie seine Reisereportagen wie ›An den inneren Ufern Indiens‹ sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschien bei S. Fischer sein großer Roman ›Macht und Widerstand‹ und sein Sachbuch-Bestseller ›Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
©2016 Ilija Trojanow und Ranjit Hoskoté
Die Erstausgabe ist 2007 im Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House, erschienen.
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490228-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
To the Inhabitants of [...]
Beachte nun folgendes:
Vorwort zur Neuausgabe
1. Kultur: Wesen oder Wandel?
2. Gegen die Zwangsjacke der Identität
3. Gemeinsame Kultur oder kulturelles Gemeingut?
Ohne Zusammenfluß keine Kultur!
Die Entstehung Europas
1 Die Gabel und andere zweifelhafte Segnungen
2 Der Schoß des Ostens
Die Idee von Europa
Alpu Betu Gamu
Tausendundein Gedanke
3 Die Wiege im Mittelmeerraum
Für ein Lied und einen Tanz
DJ Boccaccio und der große 14. Jahrhundert-Remix
Dante zwischen Himmel und Hölle
Übersetzung ist kein Verrat
Die Partei des Glaubens gegen die Partei der Vernunft
Die siamesischen Zwillinge
Ein gesundes Gleichgewicht
Zwietracht und Zusammenfluß
Die Gaben der Weisen
1 Krippenspiele
2 Die Segnungen der Gefangenschaft
3 Die ewige Baustelle
4 Eine Reise auf den Spuren des Glaubens
5 Ein Körper für den Buddha
Das Ghetto des Geistes
1 Der Tod von Zusammenfluß und der Beginn der Vernichtung
2 Brüder im Geiste: Hindutva und Islamismus
3 Die Nonsens-Mantras unserer Zeit
Eine notwendige Aufklärung in verwirrten Zeiten Ein Nachwort von Pankaj Mishra
Bibliographie
To the Inhabitants of the In-between
Für jene, die das Dazwischen bewohnen
Beachte nun folgendes:
Kein sterbliches Ding hat einen Anfang,
und es findet auch kein Ende in Tod und Vernichtung;
was einzig existiert, ist die Vermischung
und das Trennen des Vermischten.
Aber die Sterblichen
nennen diese Prozesse Anfänge.
EMPEDOKLES
Vorwort zur Neuausgabe
1. Kultur: Wesen oder Wandel?
Auf der ganzen Welt, ob bei politischen Demonstrationen auf großen Plätzen, ob im Fernsehen oder im Internet hören wir wüstes Gebrüll, »unsere Kultur« sei in Gefahr, uns bedrohe das Andere: xenos, das Fremde, ganz konkret der Fremde. Stets wird diese Kreatur, gelegentlich als Schmarotzer und Versager dargestellt, manchmal der Übertragung des Terrorvirus verdächtig, mit groben Strichen als Bedrohung der bestehenden Ordnung verteufelt. Die Verunsicherung gegenüber dem Anderen zu schüren, gehört zu einer Identitätspolitik, die sich aus der rhetorischen Übertreibung eines eindimensionalen, angeblich von Anbeginn der Zeiten reinen und unverfälschten eigenen Wesens speist. Diese Politik lässt sich schlichtweg auf »Entweder die oder wir« eindampfen.
Die Logik dieser Dichotomie verlangt nach einem konstruierten »Wir«, aus dem jede noch so kleine Spur des »Anderen« ausgemerzt wurde.
Das reichhaltige Erbe, das aus den Begegnungen mit anderen Kulturwelten in vergangenen Jahrhunderten herrührt, wird entweder kleingeredet oder aus den Annalen getilgt, ein immer wiederkehrender Vorgang in der Menschheitsgeschichte. Die derzeitige Flüchtlingshysterie ist so alt wie der Turmbau zu Babel, bei dem die Sprachvielfalt angeblich zu Zank, Hader und Chaos führte. Manchmal verankert sich eine Orthodoxie mit wörtlichem Koranverständnis (der Aufstieg der wahhabitischen Dynastie der Saud in Saudi-Arabien), manchmal wird die Vielschichtigkeit der Begegnung auf eine liturgische Schilderung von Opferrolle und gewalttätiger Selbsterlösung reduziert (wie die politisierte Religiosität der Hindutva in Indien derzeit). Und gelegentlich behauptet die vorherrschende Meinung verschlagen, zum Schutz von Vielfalt und Multikulti müssten die Grenzen dichtgemacht und fremde Bedrohungen vertrieben werden (Europa Anfang des 21. Jahrhunderts).
In solchen Zeiten werden Erzählungen, die von Pluralität und gemischten Ursprüngen künden, von den Zusammenflüssen, die zur Entstehung eines großen Stroms beitragen, von den unterschiedlichen Vergangenheiten, die unser kostbarstes Erbe bilden, misstrauisch beäugt. Ihnen verwehrt man den Zugang zum Kanon, tilgt sie aus Geschichtsbüchern und nationalstaatlichen Darstellungen. Dabei gehen uns Geschichten verloren, deren Ideen, Gedanken und Vorstellungen uns von anderswo zuwanderten, Bilder, die über Pilgerwege, Fluchtpfade, durch Krieg und Handel zu uns fanden, über Grenzen, die sich beliebig verschoben, statt ihre Zaunpfähle in den Boden zu rammen. Sobald einmal jene Geschichten langsam, aber stetig getilgt werden, in denen das Fremde eine zentrale Rolle spielt, ist die allmähliche Vernichtung des Anderen nicht mehr fern. Diese Vision der Vernichtung geht von einem Kulturbegriff aus, der Kultur als Erstarrung versteht. Als unveränderliches Wesen aus tradierten Gebräuchen und Vorschriften, sämtlicher historischer Begegnungen und Vermischungen beraubt, durch ein dogmatisches System verteidigt, dem wir uns in Namen einer unter allen Umständen zu bewahrenden ewig gültigen Identität beugen.
Dieser eingrenzende Blick schränkt zugleich die kreativen Möglichkeiten der Menschen ein. Wir möchten die Vision einer Kultur dagegenhalten, die wir alle im Hier und Jetzt kontinuierlich erschaffen und verändern. Sie entspringt dem dynamischen Wandel und dem unvorhersehbaren Zusammenspiel von Ideen und Gedanken, Werten und Techniken sowie den unterschiedlichen Veranlagungen und Gedankenwelten, aus der sich unsere Gesellschaft formt. Diese Vorstellung bezeichnen wir hier als Kultur der Zusammenflüsse.
2. Gegen die Zwangsjacke der Identität
Man hat uns vorgeworfen, wir idealisierten bestimmte Phasen der Geschichte, gewisse Gesellschaften oder soziokulturelle Verflechtungen, redeten einer utopischen Weltsicht das Wort. Wir möchten klarstellen, dass wir keineswegs eine bestimmte Tradition, eine bestimmte Religion für moralisch überlegen halten. Jedes Zeitalter bestätigt das Dickens-Zitat: »Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit.« Wir haben uns vielmehr an der Beschreibung der breiten und einflussreichen Strömungen versucht, die durch die Menschheitsgeschichte mäandern.
Als Verfechter der Kultur des Zusammenflusses weigern wir uns, Menschen oder Gemeinschaften auf Repräsentanten eines künstlichen Wesensgehalts zu reduzieren. Eine derartige Beschränkung empfinden wir als Übergriff, als gewaltsam antidemokratisches Hineinpressen menschlicher Fähigkeiten in eine konfektionierte Identitätszwangsjacke. Seit je haben sich schöpferische, sich immer wieder selbst neu erfindende Menschen und Gruppen der Kategorisierung verweigert, sind stets Freigeister in Wort und Tat geblieben. Jegliche Form einer Gemeinschaftsidentität von der Stange ist problematisch – ob sie im ideologischen Gewand daherkommt (wie der politische Dschihadismus) oder aus dem Stoff drakonischer Frömmigkeit geschneidert wird (Opus Dei) oder aus dem Gewebe einer positivistischen Ideologie aus Moral und Leistung (die deutsche Lebenshaltung). Sämtlich und sonders basieren diese Identitäten auf essentialistischer Auswahlverengung und dem Favorisieren schmalspuriger Ideen.
Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es sich selbst bei der »natürlichsten« und »normalsten« Identität um ein »naturalisiertes« und »normalisiertes« Konstrukt handelt. Im turbulenten und unbeständigen Heute, das der Soziologe Zygmunt Bauman als Epoche der »flüchtigen Moderne« bezeichnet, erwählen sich bestimmte Schichten, wirtschaftliche oder kulturelle Unsicherheit fürchtend, einen harten »Neutribalismus« zu ihrer identitätsstiftenden Ideologie.
Leider spricht die Vorstellung einer starren Kultur gewisse niedere Instinkte an, wird zugleich von konservativen Eliten und autoritären Regimes instrumentalisiert. Die Ideologie des Ultranationalismus und ethnischen Chauvinismus ist überall im Aufwind – nicht nur in postkolonialen Gesellschaften, die mit gewaltigen Umbrüchen zurechtkommen mussten –, sondern auch in West- und Mitteleuropa, Russland und den USA. Entsprechend wird vielerorts Kultur als Zusammenfluss stigmatisiert, als Luxus angeprangert, den sich nur Künstler und andere Mitglieder einer vermeintlich weltfremden, privilegierten Boheme leisten können. Offenbar wird das kritische Potential dieser Kulturvorstellung und -praxis als bedrohlich empfunden. Angeblich schwäche die Empfänglichkeit für Anregungen und Impulse aus den verschiedensten Quellen die »kollektive Stärke« der Gesellschaft, des Staats. Natürlich geht die heraufbeschworene kollektive Stärke mit autoritärer Herrschaft von oben und blindem Gehorsam von unten einher. Die Kultur des Zusammenflusses wird, neben anderen menschlichen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität von der repressiven Politik als Erstes unter Beschuss genommen.
3. Gemeinsame Kultur oder kulturelles Gemeingut?
Soziale Entfremdung rührt aus der tiefgreifenden Erfahrung, kein vollwertiger Teil einer Kultur zu sein, unabhängig davon, ob man als Fremder bezeichnet wird – als Außenseiter, der nicht dazugehört –, oder sich freiwillig als solcher positioniert, ablehnt, was als gemeinsames Erbe gefeiert werden könnte. Diese Haltung trifft auf den Neonazi genauso zu wie auf sein Spiegelbild am anderen Ende des Spektrums, den Dschihadisten. Beide sind vom Gefühl durchdrungen, die breite Mitte der Gesellschaft dränge sie an den Rand. Sie verkörpern zwar Extremfälle, doch mittlerweile fremdeln in den meisten Gesellschaften viele Menschen, manche mehr, manche weniger, mit dem sogenannten »gemeinsamen Erbe«, zumal sich die gemeinsame Grundlage meistens als eher schmales Brett herausstellt, man denke nur an das Konzept der Leitkultur. Offenbar ist es nicht einfach, dieses Konzept mit Inhalten zu füllen, was sich schon allein daran erkennen lässt, dass Leitkultur wie ein Mantra wiederholt wird, wie ein religiöser Kampfbegriff ohne semantischen Nährwert. Dem Begriff einer gemeinsamen Kultur möchten wir die Vorstellung des kulturellen Gemeinschaftsraums entgegensetzen: ein Ort der Versammlung, wo unterschiedliche Ideen, Meinungen und Lebensentwürfe vorgestellt und ausprobiert werden, miteinander konkurrieren, wo Dissens, nicht Konformität den Ausdruck der menschlichen Möglichkeiten ohne Wenn und Aber garantiert, wo eine bereichernde Vielfalt gefeiert wird. Dieses Buch soll zur Einkehr in diesen so viel weiteren, farbigeren, vielstimmigeren gemeinsamen Raum anregen.
Anamnese ist der Grundgedanke von »Kampfabsage«, hybride Vergangenheiten sichtbar zu machen, die vielfältigen Zusammenflüsse, an die wir uns nicht immer erinnern oder zu denen wir uns nicht immer bekennen möchten, die aber das Erbe der gesamten Menschheit sind. Anamnese ist der Kampf gegen das Vergessen. Sie ist kein bloßes archäologisches Unterfangen, keine akademische Exhumierung und Archivierung der Vergangenheit. Vielmehr bestimmt sie über unsere Zukunft und wie wir uns auf diese vorbereiten, eine Zukunft, in der sich unterschiedlichste Menschen und Gemeinschaften im selben sozialen und kulturellen Raum begegnen und einen tragfähigen Modus Vivendi erarbeiten müssen. Unter solchen Umständen ist die Alternative zum kulturellen Gemeinschaftsraum eine Politik der Ausgrenzung, die zu einem Teufelskreis aus Hass, Stigmatisierung und Gewalt, möglicherweise zur Vernichtung führt. Daher lehnen wir die angebliche Wahl zwischen Integration oder Assimilation auf der einen und Segregation oder Ghettoisierung auf der anderen ab. Beides sind moralisch verwerfliche, kulturell sterile und politisch explosive Alternativen, aus denen nichts Gutes entstehen kann. Konfluenz hingegen ist ein realisierbares politisches Konzept jenseits der Logik des Entweder-Oder, im Sinne des Abaelard’schen Prinzips des Sic et non, die den Menschen als Einzelwesen sowie als Gemeinschaft eine aus dem Vollen schöpfende Lebensweise ermöglicht.
Übersetzt von Susann Urban
Ohne Zusammenfluß keine Kultur!
Je größer ein Fluß, desto irreführender sein Name. Unser geographisches Grundverständnis schreibt vor, daß die Quelle, die von der Mündung am weitesten entfernt ist, als Ursprung des Flußes zu gelten hat. Der gesamte Flußlauf trägt lediglich einen einzigen Namen. Aber kein Strom kann zu majestätischer Größe wachsen und den Ozean erreichen, ohne von Neben- und Zuflüssen gespeist zu werden: Rinnsale, Bäche, Kanäle vereinigen sich mit dem Quellfluß, führen ihm mehr Wasser, Mineralien, Schlamm und Getier zu, als er ursprünglich hatte. Wenn der große Strom das Meer schließlich erreicht, hat er mit dem ursprünglichen Quellwasser nicht mehr gemeinsam als eine vage Erinnerung. Vermischung und Zusammenfluß haben seinen Charakter definiert, aber sein Name tut noch immer so, als hätte es diese Vermischung nie gegeben, er verschweigt die wahre Herkunft. Um das Wesen des Flußes wirklich zu verstehen, müßte man jedoch vor allem die Stellen untersuchen, an denen Wasser zusammenfließen, müßte herausfinden, was sich ergänzt, verdrängt, erneuert.
Unsere Geschichte ist auch ein großer, fälschlich benannter Fluß. Über die Daten und Ereignisse der Geschichte definieren wir uns selbst und unsere Kultur. Dabei verwechseln wir meist eine Momentaufnahme des Flußes mit seinem gesamten Verlauf. Wenn kulturelle Errungenschaften erst einmal im öffentlichen Bewußtsein soweit verankert sind, daß sie in der Schule gelehrt werden, sind die Wirren ihrer Entstehung längst vergessen. Die Zusammenflüsse jeder Kultur sind verborgen, an ihre Stelle werden vereinheitlichende Gründungsmythen gesetzt. Anstatt die vielen Vergangenheiten zu betrachten, die unsere Gegenwart hervorgebracht haben, sehen wir nur eine einzige Vergangenheit. Die scheinbare Stabilität unserer Kultur sichert unsere Identität. Daher müssen wir die Reinheit unserer Kultur bewahren und vor Verunreinigung durch das andere schützen. Derzeit wird Globalisierung auch als Vielfalt gefeiert, aber die herrschenden Eliten jedes Stammes definieren ihre Kultur weiterhin in Abgrenzung zu anderen. Denn schließlich bedroht die Vermischung der Kulturen die Stabilität von Gesellschaft und Staat, untergräbt die allein selig machende Wahrheit von »einem Volk, einer Nation, einer Kultur«.
Seit dem 19. Jahrhundert spukt die essentialistische Vision einer einheitlichen Kultur oder Nation, die sich um die Hegelianische Vorstellung von »Geist« entwickelte, durch unser Denken und bestimmt den politischen Diskurs. Der Nationalstaat, der sich über inneren Zusammenhalt und äußere Abgrenzung definiert, blendet mit seinem existentiellen Bedürfnis nach Helden und Schurken alle anderen, differenzierteren Darstellungen aus. Im Mausoleum des Nationalstaats sind Künstler, Philosophen und Wissenschaftler als Büsten um den Sarkophag des nationalen Erbes versammelt. Draußen tauschen sich einzelne und Gemeinschaften intensiv aus, als Teile einer lebendigen Kultur, einem innovativen Vermischen der Formen, bei dem alles zusammenfließt. So war Kultur schon immer und ist sie bis heute.
Nehmen wir das Beispiel Griechenland und Türkei, zwei Nachbarländer, die seit Jahrhunderten in Konflikte verstrickt sind und eine Geschichte der ethnischen Säuberungen teilen. Einer der schlimmsten Fälle von Vertreibung fällt in das Jahr 1922. Hunderttausende Griechen, die in der Türkei lebten, mußten ihre Häuser in Smyrna, Istanbul und anderen kosmopolitischen Städten verlassen. Sie strömten in Hafenstädte wie Piräus und Thessaloniki und lebten dort in Ghettos. Die Flüchtlinge brachten ihre orientalische Musik mit, die sie an die neue Heimat und ein neues Publikum anpaßten. Aus dieser Musik wurde der Rembetiko, die »typische« griechische Volksmusik, eine originelle und scheinbar zeitlose Tradition, die in den Tavernen der ägäischen Inseln zelebriert wird und bei den westlichen Touristen so beliebt ist. Aber rembetis bedeutet »Unterdrückter«, und in den Liedern geht es um Schmerz, Rebellion und Verlust, denn viele großartige Sänger und Musiker des Rembetiko, die sich in Haschischbars trafen, den so genannten tekes (im übrigen die Bezeichnung für die Derwischklöster der Sufis), waren Außenseiter und Drogenabhängige, die unter der Diktatur von Ioannis Metaxas in Gefangenschaft oder ins Exil geschickt wurden. Grund für die Verfolgung war nicht zuletzt der satirische Inhalt ihrer Lieder mit ihrer Kritik an den militärischen Abenteuern des Diktators, der sein »asiatisches« Standbein verlor, als er versuchte, seinen Herrschaftsbereich auf Kleinasien auszudehnen, dafür aber bei einer dieser bizarren Wendungen des Schicksals den Rembetiko gewann.
Am anderen Ende Europas, in Portugal, entwickelte sich der Fado aus einer Vermischung von afrikanischen, brasilianischen und iberischen Musikstilen. Die bekannteste Fadosängerin unserer Zeit, Mariza, erklärt, der Fado sei das Produkt eines Dreiecks, und sei mit den Sklaven aus Afrika nach Brasilien gekommen, wo der portugiesische Hof während der Napoleonischen Kriege im Exil lebte, und von dort nach Portugal eingewandert. Ironischerweise war der Fado ein wesentlicher Bestandteil der lusitanischen Kultur, die Diktator Salazar den afrikanischen Kolonien brutal aufzwang.
Wir wollen zeigen, daß der Zusammenfluß eine besonders vitale und dynamische Energie in der Entwicklung der Kultur ist. Zusammenfluß ist für die Kultur das, was Schwerkraft für die Natur ist. Oder anders ausgedrückt: ohne Zusammenfluß keine Kultur. Eine lebendige Kultur verändert sich durch Inspirationen aus nah und fern, sie verändert ihren Lauf. Kultur wandelt immer wieder ihre Gestalt. Nur durch die Interaktion mit dem anderen bleibt Kultur lebendig. Die bedeutendsten Zivilisationen gründeten auf dem Zusammenfluß von verschiedenen Kulturen.
Nehmen wir Alexandria: Als Kreuzungspunkt vieler Handelswege, die Asien, Europa und Afrika verbanden, beherbergte Alexandria griechische Philosophen, jüdische Gelehrte und indische Yogis. In der Hafenstadt kartographierte Ptolemäus die Erde und berechnete Eratosthenes ihren Umfang. Euklid verfaßte dort seine Abhandlungen über die Geometrie und 72 hellenisierte Juden schufen die Septuaginta, die erste griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die Septuaginta war ein denkwürdiger Triumph, nicht nur der biblischen Gelehrsamkeit, sondern auch der griechischen Literatur. In der Septuaginta gibt es wunderbare Beispiele für multiethnische und multireligiöse Kulturen wie etwa Nebukadnezars Babylon oder das persische Reich unter Kyros. Während der babylonischen Gefangenschaft der Juden wurde der Prophet Daniel vom Gottkönig Nebukadnezar zu seinem Hohepriester ernannt, erhabener als alle einheimischen, dem wahren Glauben ergebenen Astrologenpriester (das wäre etwa so, wie wenn ein Mullah zum Kardinal ernannt werden würde). In al-Andalus entwickelten Muslime, Juden und Christen während der 800jährigen islamischen Herrschaft durch den engen Kontakt miteinander ein eigenes Selbstverständnis. Muslimische Herrscher setzten Juden oft in wichtigen Positionen ein. Ein Beispiel dafür ist Samuel ha-Nagid, der im 11. Jahrhundert Großwesir von Granada war, ein Rabbi, Diplomat und Soldat, der seine überwiegend muslimischen Truppen in die Schlachten führte, aber auch weltliche hebräische Dichtung und jüdische Liturgie verfaßte. Der nach dem Emir wichtigste Mann im Staat konnte nach Belieben die religiöse Erziehung der Juden fördern und Schreine in Jerusalem stiften (das ist ungefähr so, als würde der Rabbi der Berliner Synagoge zum Verteidigungsminister von Deutschland ernannt und erhielte vom US-Präsidenten die Erlaubnis, die Ausbildung junger jüdischer Theologen in New York oder Jerusalem zu unterstützen). Auch wenn sich der Westen heute viel auf seine Toleranz einbildet, kann er es mit der religiösen Vielfalt von Babylon oder al-Andalus wahrlich nicht aufnehmen.
Wiederholung ist die Mutter des Dogmas. Seit kurzem wird uns das Dogma einer seit langem bestehenden jüdisch-christlichen Tradition eingetrichtert – obwohl den Juden in Europa 2000 Jahre lang von den Christen immer wieder entsetzliche Gewalt angetan wurde, obwohl das Christentum aus jüdisch-orthodoxer Sicht ein Irrglaube ist, und obwohl die Christen glauben, das Judentum sei eine überholte Religion, weil es der Hohe Rat der Juden versäumt habe, den wahren, von Jesaja prophezeiten Messias zu erkennen. Seriöse Theologen auf beiden Seiten lehnen die weltliche Erfindung der jüdisch-christlichen Tradition als »Widerspruch in sich« ab. Der Begriff »jüdisch-christlich« wurde von amerikanischen Politikexperten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, nach der Erfahrung der nationalsozialistischen Todeslager und der Gründung des Staates Israel. Die Erfinder des Begriffs hatten dabei zwei klare strategische Ziele vor Augen. Erstens: eine vermeintlich umfassende und religionsübergreifende Terminologie zu schaffen, mit der man dem Vorwurf des Antisemitismus beim militärisch-industriellen Establishment der USA begegnen konnte, das die Todeslager trotz glaubhafter Beweise ignoriert hatte. Und zweitens: eine strategische Allianz mit Israel zu rechtfertigen, die den USA die Kontrolle über die Ölvorkommen im Nahen Osten ermöglichte und gleichzeitig einen zuverlässigen Stützpunkt gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten bot. Doch man täuscht sich, wenn man glaubt, die Bezeichnung schließe alle Wurzeln des Christentums ein. Sie öffnet einer bestimmten Vergangenheitsvariante des Christentums die Tür, schließt aber alles andere aus. Wenn man die zahlreichen Einflüsse richtig wiedergeben will, die in den dichten Teppich des Christentums hineingewoben wurden, muß man von einem ägyptisch-persisch-jüdisch-islamisch-christlichen Erbe sprechen.
Um das enorme Maß an Vermischung zu erkennen, muß man zu den Ursprüngen der großen monotheistischen Religionen zurückreisen, etwa zur babylonischen Gefangenschaft der Juden, jenen 60 Jahren im persischen Exil, die eine grundlegende Veränderung der jüdischen Religion nach sich zogen. Fast alle Elemente der Lehre vom Erlöser stammen aus dem Zoroastrismus, einer Religion im alten Persien. Die zoroastrischen Schriften sagen die Ankunft von Saoshyant voraus, dem Erlöser, der dem Vormarsch der Sünde ein Ende bereiten wird. Saoshyant soll die Guten von ihrem Leiden erlösen und in den Himmel führen, die Bösen dagegen mit der Verbannung in die Hölle bestrafen und so eine magische Zukunft losgelöst von der Zeit einläuten. Als Kyros der Große das jüdische Volk aus seiner babylonischen Gefangenschaft entließ, reiste Saoshyant in der Vorstellung der Juden mit nach Westen und wurde zum jüdischen Messias und später zum Erlöser im christlichen Glauben.
Auch der kosmische Kampf zwischen den himmlischen Heerscharen und den Armeen des Teufels ist ein wesentlicher Bestandteil der zoroastrischen Religion: Ahura Mazda, der weise Gott, kämpft bis zum Ende der Zeit gegen Angra Mainyu, das Böse. Himmel und Hölle wurden zuerst und sehr kunstvoll von den alten Persern ersonnen; schon das Wort »Paradies« geht auf das persische »pairidaêza« zurück, den ummauerten Garten der Engel. Der Heiligenschein des auferstandenen Christus und auch der Heiligen basiert auf den Darstellungen persischer Künstler, die damit göttliche und königliche Figuren von bloßen Sterblichen abheben wollten. Wenn ein Christ ein Bild seines Erlösers betrachtet, sieht er ein visuelles Echo, ein Nachbild, geformt von vielen anderen Bildern aus vergangenen Religionen und Kulturen. Er blickt auf das Ergebnis eines langen Prozesses, des Zusammenfließens von verschiedenen Impulsen. Was wir zum Kanon gehörig und als klassisch erachten, basiert auf Hybriditäten, die wir vergessen haben – oder die ins Vergessen gestoßen wurden.
Es lohnt sich auch, an den antiken syrischen Gott Adonis zu erinnern, dem jedes Frühjahr geopfert wurde, um eine gute Ernte zu erbitten. Sein Tempel wurde Baith la-Haim oder »Haus des Korns« genannt. In der christlichen Überlieferung wurde daraus Bethlehem, das Dorf, in dem Jesus geboren wurde. Fleisch und Blut von Adonis wurden unter den Gläubigen verteilt, ein Symbol, das mit der Eucharistie ins Christentum gelangte. Wir werden das Antikenkabinett des Christentums öffnen und viele vergessene Namen darin finden, etwa Mithras, den Sonnengott, der den Stier der Finsternis tötete und der von den Legionären im spätkaiserlichen Rom verehrt wurde. Sein alljährliches Fest wurde an dem Tag begangen, der im Gregorianischen Kalender als der 25. Dezember festgehalten wurde. Wir werden das Schicksal des Buddhacarita-Manuskripts (»Das Leben Buddhas«) verfolgen, das in den ersten Jahrhunderten nach Christus in den Satteltaschen von Kaufleuten nach Edessa kam, dem Übersetzungszentrum in Kleinasien, von wo aus man die vielen mit Buddha in Verbindung gebrachten Wunder im Lauf der Zeit Jesus Christus zuschrieb: der Gang übers Wasser, die Heilung Kranker, die Beruhigung des Sturms. Auch die Geschichten über die früheren Leben Buddhas, die Jatakas, durchquerten den ganzen Kontinent: Wenn wir im Museum oder in einer katholischen Kirche den heiligen Hubertus sehen, der gebannt auf einen Hirsch mit Kruzifix im Geweih blickt, oder den heiligen Martin, der seinen reich verzierten Umhang teilt und einem Bettler schenkt, dann betrachten wir die christliche Interpretation von Themen, die zuerst in der buddhistischen Literatur in Afghanistan, Kaschmir und Nordindien auftauchten. Selbst die vier Evangelien sind das Ergebnis eines Zusammenfließens aus essenischen, gnostischen, manichäischen und anderen frühchristlichen Materialien, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus im Umlauf waren.
Wir möchten nicht behaupten, das Zusammenfließen sei ein friedlicher Prozeß, bei dem das andere mit offenen Armen aufgenommen wird. Uns schwebt ganz bestimmt kein naives pazifistisches Ideal vor. Wenn unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen, kommt es unausweichlich zu Konflikten. Ein kultureller Wandel entsteht sowohl aus friedlichen Begegnungen wie auch durch gewaltsame Umbrüche, etwa Kriege, Invasionen, Versklavung, die Inquisition, Pogrome und Exil. Zeiten des regen kulturellen Austauschs waren nicht unbedingt geprägt von Heiterkeit und gegenseitigem Verständnis der verschiedenen Gruppen, die in einem gemeinsamen Staat zusammenfanden. Nehmen wir als Beispiel die Black Music mit Blues, Jazz, Rock, Reggae und Hip-Hop. Vom Rand der Gesellschaft, von den Plantagen und den Ghettos hat diese Musik die weiße amerikanische Kultur erobert. Entstanden aus Sklaverei und Apartheid entwickelte sich die Musik der Unterdrückten zum wichtigsten kulturellen Beitrag Nordamerikas und ironischerweise auch zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor, einem Handelsgut, das von den multinationalen Unterhaltungskonzernen perfekt verpackt und vermarktet wird.
Ebenso wenig impliziert das Zusammenfließen von Kulturen gegenseitiges Verständnis oder einen fortwährenden, konstanten Austausch. Manche kulturellen Errungenschaften entstanden aus Irrtümern und Mißverständnissen zwischen Einzelnen und Gesellschaften. Wenn man eine Charta der kulturellen Grundrechte erstellen würde, müßte das Recht auf Fehlinterpretation weit oben stehen. Vor allem in der Kunstgeschichte wurde die künstlerische Vorstellungskraft oft von fremden Formen angeregt, die aus dem Zusammenhang gerissen einen neuen Sinn erhielten. Die westeuropäischen Maler und Bildhauer Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die altägyptische Flachreliefs, Drucke aus Fernost oder westafrikanische Statuen für sich entdeckten, waren begeistert von deren Ausdruckskraft, der Stilisierung von Körper und Raum. Dabei kannten die Künstler nicht immer die damit verbundenen Rituale und die ästhetische Bedeutung der Kunstobjekte. Dennoch nahmen sie deren künstlerischen Gehalt auf und revolutionierten damit ihre eigene Kultur. So ließen sich etwa Picasso, Braque und Kirchner von westafrikanischen und ozeanischen Skulpturen inspirieren; Matisse, Klee und Macke fanden in Nordafrika und der Türkei eine neue Sprache der Motive und Farben, und Kandinsky, Mondrian und Malewitsch holten sich Anregungen bei der asiatischen Spiritualität, darunter auch Yoga und Sufismus. Die moderne europäische Kunst wäre undenkbar ohne die Auseinandersetzung ihrer Künstler mit anderen Kulturen.
Eine Generation zuvor hatten sich die radikalen jungen Künstler in Paris Ende der 1880er Jahre in Rebellion gegen die bürgerlichen Salons der damaligen Zeit mit großer Neugier einer Kultur von der anderen Seite der Welt zugewandt – eine Entwicklung, die man als Japonismus bezeichnet. Maler wie Gauguin und Van Gogh bewunderten die Farbholzschnitte von Hokusai und Hiroshige. Sie übernahmen die kompakten, stilisierten Figuren, die asymmetrisch in einem Raum ohne Tiefe verteilt waren, und die matte Farbgebung mit betonten Konturen. Die japanischen Holzschnitte, vor allem die des Ukiyo-e, der »fließenden Welt«, etwa der Vergnügungsviertel von Tokio und Kyoto, waren durch die Öffnung Japans und den wachsenden Handel zwischen Japan und Europa zugänglich geworden. Interessanterweise sind die japanischen Holzschnitte selbst stark von westlichen Techniken wie Perspektive, Verkürzung, manieristischer Übertreibung und dem Einsatz von Schatten zur Volumengestaltung beeinflußt – Techniken, die über Indien und China von Westeuropa nach Japan gelangt waren. Hokusai (1760–1850), einer der bedeutendsten Vertreter des Ukiyo-e, studierte die westlichen Techniken sorgfältig und interessierte sich sehr für Mathematik und Optik. Er hielt sich über die neuesten Entwicklungen in den europäischen Naturwissenschaften auf dem laufenden; so berichtet etwa sein Kollege Ryutei Tanehiko in seinem Tagebuch aus dem Jahr 1810, er habe bei Hokusai Unterricht im Gebrauch eines holländischen mathematischen Instruments genommen. Als die Werke von Hokusai und Hiroshige nach Holland und Frankreich gelangten, beeinflußten sie wiederum die Gemälde von Monet, Manet, Van Gogh, Gauguin und Cezanne.
Der Zusammenfluß von Kulturen ist auf die Mobilität von Menschen, Ideen, Gütern und Dienstleistungen angewiesen, ebenso auf das Vorhandensein von Treffpunkten und Kreuzungen, wo die Begegnung mit dem anderen ein Bestandteil des Alltags ist und man den Unterschied nicht ignorieren kann, weil man von ihm umgeben ist; man lebt und ißt ihn, atmet ihn ein. Der Austausch erfordert fein verwobene Handelsbeziehungen, bei denen jede Seite die andere braucht, um wirtschaftlich zu existieren. Als weitere Voraussetzung sind eine gewisse Freiheit von selbstgefälligem Dogma sowie grundlegende Neugierde und intellektuelle Toleranz zu nennen: Ein Interesse, das über das Streben nach Gewinn und dem eigenen Vorteil hinausgeht, Interesse an dem, was anders ist, was man nicht gemeinsam hat und was anders konditioniert ist. Mit einem Wort: Wir beschreiben ein offenes System; das typische Beispiel dafür wäre eine Hafenstadt, und keine ist berühmter als das antike Alexandria.
Aber Alexandria fiel den Bigotten zum Opfer, die seine bedeutendste Gelehrte Hypatia ermordeten, und den christlichen Fanatikern, die seine berühmte Bibliothek niederbrannten: Diese Männer handelten zwar im Namen der Religion, aber sie vertraten etwas so Unheiliges wie die Angst vor dem Unbekannten und Wut über die Bedrohung, die ihrer Meinung nach vom pluralistischen freien Denken für ihren engstirnigen Glauben ausging. Diese Männer waren auf ihren eigenen Stamm fixiert, und ihre Unsicherheit und Abwehrhaltung wurden nur noch von ihrer Ichbezogenheit und Aggression übertroffen.
In dem abschließenden Kapitel werden wir die Macht der Ausgrenzung analysieren, die im Verlauf der Geschichte den Zusammenfluß der Kulturen immer wieder einschränkte. Es ist allgemein bekannt, daß Christoph Kolumbus 1492 im Dienste der vereinigten Königreiche Kastilien und Aragon in die »Neue Welt« aufbrach. Der Zeitpunkt war kein Zufall: Die sogenannte Reconquista war in vollem Gang, die das 800 Jahre währende Wunder von al-Andalus beendete und den Weg zur Vernichtung seiner vielfältigen Kultur ebnete. Doch die Gaben der kulturellen Vermischung ließen sich nicht so leicht auslöschen. Wie Kolumbus in seinen Aufzeichnungen notierte, erhielt er an eben dem Tag das Kommando über die Seereise nach »Indien«, an dem die Herrscher des neuen Spanien die Vertreibung der Juden aus ihrem Herrschaftsgebiet anordneten. Die katholischen Herrscher tolerierten das andere nicht und verbannten die Juden, die unter den Muslimen gefördert worden waren und zur religiösen und künstlerischen Blüte des Landes beigetragen hatten.
Iberien erholte sich nie wieder von dem Schlag gegen seine Kultur. Das Ende von al-Andalus markierte den Beginn von Paranoia und Verfolgung – auf die Brutalität der Inquisition folgte die Ausdehnung des spanischen Herrschaftsgebiets in Übersee, die barbarische Ermordung der Inka und Azteken, die Ausplünderung des Orients und Lateinamerikas auf der Suche nach Gold, Silber, Gewürzen und Sklaven. Im Lauf der Zeit betrachtete das Christentum jede Errungenschaft, die auch nur entfernt an al-Andalus erinnerte, als tödliche Bedrohung. Die Spanische Inquisition benötigte alle verfügbaren Folterbänke, Daumenschrauben und Scheiterhaufen – denn sie kämpfte nicht nur gegen häretische Tendenzen innerhalb des christlichen Glaubens, sondern auch dafür, den Einfluß der Juden und Muslime auszulöschen. Erst als Spanien seine unterdrückte Vergangenheit wieder für sich beanspruchte, gelangte es erneut zur Blüte. Der größte moderne Schriftsteller Spaniens, Federico García Lorca, betrachtete sich als Erbe von al-Andalus, schrieb Ghaselen und Kassiden, zwei orientalische Gedichtformen, die in längst vergangenen Zeiten populär waren, und griff mit seiner Sprache den Rhythmus des Flamenco auf, der auf den Traditionen der Araber und Zigeuner basiert.
Heute wird Alexandria erneut von den Bigotten und Fanatikern bedroht. Die Kräfte der Ausgrenzung und Abschottung bedrohen das offene System, das die Voraussetzung für den Zusammenfluß der Kulturen ist. Die Fanatiker klammern sich an eine Doktrin, die das menschliche Potential auf wenige Optionen beschränkt, während alle anderen Möglichkeiten als Werk des Teufels geschmäht werden.
Ihre sichtbarste Waffe ist der Terror des Jihad, dazu kommen aber noch die Verweigerung des Dialogs, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Unterdrückung der Frau und die Bereitschaft, alle religiösen und philosophischen Alternativen zu ihrem einzig wahren Glauben auszulöschen. Die Ideologie der Christlichen Rechten und der Neokonservativen ist ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit dem so genannten radikalen Islamismus weltweit und der Hindutva in Indien. Der Kreuzzug von US-Präsident Bush ist gegenüber den verschiedenen Schattierungen der Vielfalt so blind wie Bin Ladens Jihad: Sie sind Zwillinge des Terrors, Spiegelbilder in dem Wunsch, die kulturelle Schaffenskraft einzuschränken, zu gängeln und abzuwürgen. Die Vertreter derartiger Ideologien nehmen für sich in Anspruch, sie würden eine große Tradition verteidigen, die sie jedoch auf eine armselige Version ihres religiösen und kulturellen Erbes zurückgestutzt haben. Sie fordern eine Rückkehr zu den fundamentalen Wahrheiten und ursprünglichen Gesetzen, obwohl diese nur Vorschriften und Verbote sind, die sie mittels einer selektiven, ja zynischen Interpretation ihrer Traditionen erfunden haben.
Die Großmächte vertreten eine ganz ähnliche Haltung zur kulturellen Vielfalt wie die Guerillas der Intoleranz: Das andere wird manipuliert, um Rekruten für die eigene Sache zu finden, klare Feindbilder zu schaffen und Konflikte in die Länge zu ziehen, denn davon profitieren Wirtschaft und Seelenleben der Nation gleichermaßen. Beide Seiten beanspruchen die Welt als Spielplatz für sich und bekämpfen einander, um die Kontrolle darüber zu erlangen.
Wir können aber auch nicht unkritisch den Anspruch der Globalisierung unterstützen, sie sei umfassend und habe die Fusion heterogener kultureller Elemente erreicht. Diese Fusion ist oberflächlich, ein falscher Ersatz. Eine Fusion ist kein Zusammenfluß; sie ist das Produkt des Kapitalismus, der kein Interesse an echter Vielfalt hat. Die wirtschaftliche Logik der Globalisierung verlangt die einfache Reproduktion, schnell zu vervielfältigende Produkte, die auf einem einheitlichen Variationsmuster basieren, leicht zu bedienende Programme in verschiedener Aufmachung, damit die Einheimischen das Neue nicht als fremd empfinden. Das Gleichgewicht zwischen globalen Ambitionen und lokalem Komfort wird durch Hochglanzpolitur erreicht; und wie das Beispiel McDonald’s zeigt, verkauft sich weltweit nichts so gut wie ein stromlinienförmiges Produkt, das in einem stromlinienförmigen Umfeld angeboten wird.